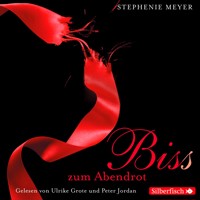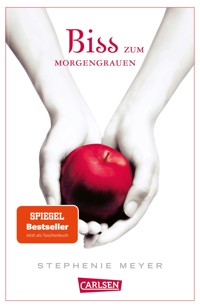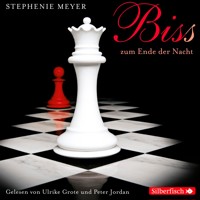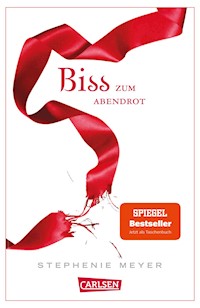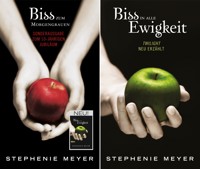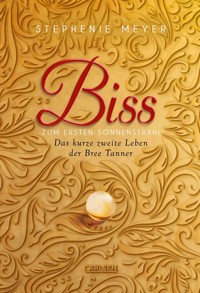11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das packende Ende der Twilight-Saga Ein Jahr voller Glück, aber auch voller Schmerz liegt hinter Bella. Ein Jahr, in dem sie fast zerbrochen wäre, weil ihre Leidenschaft für Edward und ihre innige Freundschaft zu Jacob einfach unvereinbar sind. Aber nun ist ihre Entscheidung gefallen. Unwiderruflich. Auch wenn sie für alle verheerende Folgen haben könnte. Zwischen Tag und Nacht: Bella und Edwards ungewöhnliche Liebesgeschichte Als die 17-jährige Bella Swan aus dem sonnigen Phoenix ins regnerische Forks zieht, erwartet sie wenig von der beschaulichen Kleinstadt. Doch dann trifft sie Edward Cullen, einen Mitschüler mit faszinierend blassen Augen und einer Aura, die Bella sofort in ihren Bann zieht. Edward ist geheimnisvoll, zurückhaltend, unglaublich attraktiv – und ein Vampir! Bella kann nicht anders: Sie fühlt sich trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner dunklen Geheimnisse zu ihm hingezogen. Doch was bedeutet es, als Mensch einen Vampir zu lieben? Mit der "Twilight"-Saga hat Stephenie Meyer eine der populärsten Fantasy-Romance-Serien der letzten Jahrzehnte erschaffen. Insbesondere die Kombination aus romantischer Liebesgeschichte und übernatürlichen Elementen wie Vampiren und Werwölfen begeistert die breite Fangemeinschaft. Zwischen 2008 und 2012 wurden die Biss-Bände mit Kristen Stewart und Robert Pattinson erfolgreich verfilmt. Der vierte Band der weltberühmten Fantasy-Serie für Fans von paranormaler Romance und Vampirgeschichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Wie wird die packende Liebesgeschichte zwischen Edward und Bella enden? - Teil 4 von Spiegel-Bestseller-Autorin Stephenie Meyer
Ein Jahr voller Glück, aber auch voller Schmerz liegt hinter Bella. Ein Jahr, in dem sie fast zerbrochen wäre, weil ihre Leidenschaft für Edward und ihre innige Freundschaft zu Jacob einfach unvereinbar sind. Aber nun ist ihre Entscheidung gefallen. Unwiderruflich. Auch wenn sie für alle verheerende Folgen haben könnte …
Dies ist Band 4 der international erfolgreichen »Biss«-Saga. Alle Bände auf einen Blick:
Biss zum Morgengrauen
Biss zur Mittagsstunde
Biss zum Abendrot
Biss zum Ende der Nacht
Biss zur Mitternachtssonne
Biss zum ersten Sonnenstrahl – Das kurze zweite Leben der Bree Tanner
Endlich gibt es auch Band 5 der weltweit geliebten Fantasy-Romance-Serie: »Biss zur Mitternachtssonne« und wir erfahren die Geschichte aus Edwards Sicht!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Vita
Dieses Buch ist meiner Ninja/Agentin Jodi Reamer gewidmet.Danke, dass du mich vor dem Abgrund bewahrt hast.Außerdem ein Dank an meine Lieblingsband mit demso treffenden Namen Muse, für die Inspiration,die für eine ganze Saga reicht.
Erstes Buch – Bella
Kindheit ist nicht von Geburt bis soundsoviel,und von soundsoviel anSind Kinder groß und räumen Kindisches weg.Kindheit ist das Reich, darin niemand Dir stirbt.Edna St. Vincent Millay
Vorwort
Ich war dem Tod schon allzu oft nah gewesen, doch an so etwas gewöhnt man sich nicht.
Dennoch schien es seltsam unausweichlich, sich ihm noch einmal zu stellen. Als wäre ich tatsächlich zum Unglück verdammt. Immer wieder war ich gerade noch davongekommen, doch es verfolgte mich.
Aber diesmal war es ganz anders als sonst.
Wenn man vor jemandem Angst hat, kann man fliehen; wenn man jemanden hasst, kann man versuchen ihn zu bekämpfen. Alles in mir war auf diese Sorte Mörder eingestellt – auf die Monster, die Feinde.
Wenn man von jemandem getötet wird, den man liebt, hat man keine Wahl. Wie kann man fliehen, wie kämpfen, wenn man damit dem Liebsten wehtun würde? Wenn das eigene Leben das Einzige ist, was man dem Liebsten geben kann, wie kann man es ihm dann verweigern?
Wenn es jemand ist, den man wirklich liebt?
Verlobt
Keiner starrt mich an, versicherte ich mir. Keiner starrt mich an. Keiner starrt mich an.
Aber weil ich nicht einmal mir selbst überzeugend etwas vormachen konnte, musste ich nachsehen.
Während ich darauf wartete, dass die eine der drei Ampeln in Forks auf Grün schaltete, spähte ich nach rechts – Mrs Weber in ihrem Minivan wandte sich mit dem ganzen Oberkörper in meine Richtung. Ihr Blick bohrte sich in meinen, ich zuckte zurück und fragte mich, wieso sie nicht wegschaute oder wenigstens peinlich berührt aussah. Schließlich galt es doch gemeinhin als unhöflich, andere Leute anzustarren. Oder war ich davon neuerdings ausgenommen?
Dann erst fiel mir wieder ein, dass sie durch die dunkel getönten Scheiben meines Wagens vermutlich gar nicht sehen konnte, dass ich darin saß, geschweige denn, dass ich sie beim Starren ertappt hatte. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass sie gar nicht mich anschaute, sondern nur den Wagen.
Meinen Wagen. Seufz.
Ich spähte nach links und stöhnte. Zwei Fußgänger standen wie angewurzelt auf dem Gehweg, sie gafften zu mir herüber und vergaßen ganz, die Straße zu überqueren. Hinter ihnen glotzte Mr Marshall durch das Schaufenster seines kleinen Souvenirladens. Immerhin hatte er nicht die Nase an die Scheibe gedrückt. Noch nicht.
Die Ampel sprang auf Grün, und ich hatte es so eilig wegzukommen, dass ich, ohne nachzudenken, mit voller Wucht aufs Gaspedal trat – wie ich es von meinem alten Chevy gewohnt war.
Während der Motor knurrte wie ein Panther auf dem Sprung, machte der Wagen einen so schnellen Satz nach vorn, dass ich tief in den schwarzen Ledersitz gedrückt wurde und mein Magen sich an die Wirbelsäule presste.
»Ah!«, rief ich erschrocken und tastete nach der Bremse. Diesmal war ich so schlau, das Pedal nur leicht anzutippen. Auch so kam der Wagen mit einem Ruck zum Stehen.
Ich wollte gar nicht wissen, wie die Leute guckten. Falls sie vorher noch irgendeinen Zweifel gehabt hatten, wer am Steuer des Wagens saß, dürfte er jetzt ausgeräumt sein. Mit der Schuhspitze tippte ich das Gaspedal einen halben Millimeter hinunter, und schon schoss der Wagen wieder nach vorn.
Irgendwie erreichte ich mein Ziel, die Tankstelle. Hätte ich nicht zwingend Benzin gebraucht, wäre ich überhaupt nicht in die Stadt gefahren. In den letzten Tagen war mir so einiges ausgegangen, Pop Tarts zum Beispiel und Schnürsenkel; ich wollte mich so wenig wie möglich in der Öffentlichkeit zeigen.
Ich kam mir vor wie bei einem Autorennen, in wenigen Sekunden war die Tankklappe geöffnet, der Deckel abgeschraubt, die Karte unterm Scanner, die Zapfpistole im Tank. Die Zahlen auf der Zapfsäule konnte ich natürlich nicht antreiben. Träge krochen sie dahin, fast als wollten sie mich ärgern.
Es war kein sonniger Tag – sondern das für Forks typische Nieselwetter –, doch es kam mir immer noch so vor, als wäre ein Scheinwerfer auf mich gerichtet, der die Aufmerksamkeit auf den grazilen Ring an meiner linken Hand lenkte. In solchen Momenten, da ich die Blicke anderer Leute im Rücken spürte, war es, als würde der Ring blinken wie ein Neonschild: Schaut her, schaut her.
Meine Befangenheit war idiotisch, das wusste ich wohl. Wen kratzte es, was die Leute – meine Mutter und mein Vater ausgenommen – zu meiner Verlobung sagten? Oder zu meinem neuen Wagen? Zu meiner mysteriösen Aufnahme an einer Eliteuni? Zu der glänzenden schwarzen Kreditkarte, die jetzt gerade in meiner hinteren Hosentasche brannte?
»Ja, sollen sie doch denken, was sie wollen«, murmelte ich leise.
»Hm, Miss?«, rief eine männliche Stimme.
Ich drehte mich um und bereute es sofort.
Zwei Männer standen neben einem schicken Geländewagen mit nagelneuen Kajaks auf dem Dachgepäckträger. Keiner der beiden Männer schaute mich an, sie starrten auf das Auto.
Ich persönlich konnte das gar nicht nachvollziehen. Aber ich war ja auch schon stolz darauf, dass ich die Markenzeichen von Toyota, Ford und Chevy auseinanderhalten konnte. Das hier war ein schönes Auto, glänzend schwarz und schnittig, aber für mich war es trotzdem nur ein Auto.
»Entschuldigen Sie die Frage, aber könnten Sie mir sagen, was für einen Wagen Sie da fahren?«, fragte der Größere der beiden.
»Einen Mercedes, oder?«
»Ja«, sagte der Mann höflich, während sein etwas kleinerer Freund bei meiner Antwort die Augen verdrehte. »Ich weiß. Aber ich hab mich gefragt, ob das … fahren Sie da einen Mercedes Guardian?« Der Mann sprach den Namen voller Ehrfurcht aus. Ich hatte das Gefühl, dass der Typ sich gut mit Edward verstehen würde, meinem … meinem Verlobten (die Wahrheit ließ sich nicht länger verleugnen, bis zur Hochzeit waren es nur noch wenige Tage). »Ich dachte, der wär in Europa noch gar nicht auf dem Markt«, fuhr der Mann fort. »Geschweige denn hier.«
Während er mit dem Blick die Konturen meines Wagens nachzeichnete, der für mich nicht viel anders aussah als jede andere Mercedes-Limousine, aber was wusste ich schon, dachte ich kurz über meine Probleme mit Wörtern wie Verlobter, Hochzeit, Ehemann und so weiter nach.
Ich bekam es einfach nicht zusammen.
Erstens war ich dazu erzogen worden, schon bei dem bloßen Gedanken an weiße Tüllkleider und Blumenbuketts das kalte Grausen zu kriegen. Aber vor allem konnte ich so etwas Gesetztes, Seriöses und Ödes wie Ehemann nicht mit meinem Bild von Edward in Einklang bringen. Das war so, als sollte ein Erzengel einen Buchhalter spielen; in so einer banalen Rolle konnte ich ihn mir einfach nicht vorstellen.
Wie immer, wenn ich anfing an Edward zu denken, war ich sofort in einem wirbelnden Reigen von Traumbildern gefangen. Der Fremde musste sich räuspern, damit ich ihn wieder beachtete; er wartete immer noch darauf, dass ich seine Frage nach dem Modell des Wagens beantwortete.
»Ich weiß nicht«, sagte ich aufrichtig.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich ein Foto davon mache?«
Es dauerte einen Moment, bis ich kapierte. »Echt? Sie wollen den Wagen fotografieren?«
»Na klar – ohne Beweis glaubt mir das doch keiner.«
»Hm. Okay. Na gut.«
Schnell steckte ich die Zapfpistole zurück und versteckte mich auf dem Fahrersitz, während der Autonarr eine riesige professionell wirkende Kamera aus dem Rucksack holte. Er und sein Freund posierten abwechselnd neben der Motorhaube, dann machten sie Aufnahmen am Heck.
»Ich will meinen Transporter wiederhaben!«, jammerte ich.
Wie passend – viel zu passend –, dass mein Transporter, nur wenige Wochen nachdem Edward und ich diesen faulen Kompromiss geschlossen hatten, der unter anderem beinhaltete, dass er meinen Transporter ersetzen durfte, falls der den Geist aufgab, der dann auch tatsächlich seinen letzten Ächzer ausgestoßen hatte. Hinterher schwor Edward, dass das längst absehbar gewesen sei; mein Transporter hatte ein langes, erfülltes Leben gehabt und war dann eines natürlichen Todes gestorben. Laut Edward. Und natürlich konnte ich das ohne Hilfe weder überprüfen noch meinen Transporter von den Toten wiederauferstehen lassen. Mein Lieblingsmechaniker …
Ich verbot mir den Gedanken, weigerte mich, ihn zu Ende zu denken. Stattdessen hörte ich den Männern zu, deren Stimmen gedämpft durch die dicken Wände des Autos drangen.
»… ist in dem Online-Video mit einem Flammenwerfer darauf losgegangen. Da hat sich nicht mal die Farbe gekräuselt.«
»Logisch. Über das Schätzchen hier könnte man einen Panzer fahren lassen. Ist vor allem für Diplomaten im Nahen Osten konstruiert worden, für Waffenhändler und Drogenbarone.«
»Glaubst du, sie ist irgend so was?«, fragte der Kleinere von beiden mit leiser Stimme. Ich duckte mich, meine Wangen wurden heiß.
»Hm«, machte der Größere. »Möglich. Kann mir nicht vorstellen, wozu man hier in dieser Gegend raketensicheres Glas und zweitausend Kilo Panzerung brauchen sollte. Die ist sicher auf dem Weg in ein gefährlicheres Gebiet.«
Panzerung. Zweitausend Kilo Panzerung. Und raketensicheres Glas? Wie schön. Hätte es das gute alte kugelsichere Glas nicht auch getan?
Tja, irgendwie passte das schon – wenn man einen ziemlich schrägen Humor hatte.
Es überraschte mich eigentlich nicht, dass Edward unsere Abmachung ausnutzte, dass er mehr gab, als er bekommen würde. Ich hatte ihm erlaubt, mir einen neuen Wagen zu schenken, wenn es notwendig war, aber natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass es schon so bald notwendig sein würde. Als ich zugeben musste, dass der Transporter vor unserem Haus nur noch ein Stillleben war, allenfalls noch gut für eine Oldtimer-Ausstellung, war mir schon klar, dass Edward mich mit dem neuen Wagen vermutlich in Verlegenheit bringen würde. Dass ich gaffende Blicke und Geflüster würde ertragen müssen. Damit lag ich richtig. Aber selbst in meinen düstersten Vorstellungen wäre ich nicht darauf gekommen, dass er mir zwei Autos besorgen würde.
»Das Vorher-Auto und das Nachher-Auto«, hatte er erklärt, als ich ausgeflippt war.
Das hier war nur das Vorher-Auto. Er hatte mir gesagt, es sei nur ein Leihwagen, und versprochen, ihn nach der Hochzeit zurückzugeben. Ich war aus alldem überhaupt nicht schlau geworden. Bis jetzt.
Haha. Weil ich so ein zerbrechlicher Mensch war, so unfallgefährdet, weil ich mich mit meinem Pech andauernd selbst in Gefahr brachte, brauchte ich also ein raketensicheres Auto, damit mir nichts zustieß. Urkomisch. Bestimmt hatten er und seine Brüder hinter meinem Rücken herzlich darüber gelacht.
Oder vielleicht, ganz vielleicht, flüsterte eine kleine Stimme in meinem Kopf, vielleicht ist es gar kein Witz, du Dummchen. Vielleicht macht er sich wirklich solche Sorgen um dich. Es wäre nicht das erste Mal, dass er in dem Versuch, dich zu beschützen, übers Ziel hinausschießt.
Ich seufzte.
Das Nachher-Auto hatte ich noch nicht gesehen. Es war bei den Cullens im hintersten Winkel der Garage unter einem Laken versteckt. Ich wusste, dass die meisten an meiner Stelle inzwischen daruntergespäht hätten, aber ich wollte es wirklich nicht wissen.
Das Nachher-Auto hatte vermutlich keine Panzerung – denn die würde ich nach den Flitterwochen nicht mehr brauchen. Unverwundbarkeit war nur einer der vielen Vorteile, auf die ich mich freute. Zur Familie Cullen zu gehören, beinhaltete Besseres als teure Autos und beeindruckende Kreditkarten.
»Hey«, rief der große Mann und legte die Hände an die Schläfen, um durch die Scheibe schauen zu können. »Wir sind fertig. Vielen Dank!«
»Gern geschehen«, rief ich zurück, dann verkrampfte ich mich, als ich den Motor anließ und langsam das Gaspedal heruntertrat …
Ganz gleich, wie oft ich die vertraute Strecke nach Hause fuhr, ich konnte die ausgewaschenen Plakate immer noch nicht ausblenden. Sie waren an Telegrafenmasten geheftet und an Straßenschilder geklebt, und jedes einzelne war immer aufs Neue wie ein Schlag ins Gesicht. Ein verdienter Schlag. Sofort war der Gedanke von vorhin wieder da – den ich mir so streng verboten hatte. Auf dieser Straße konnte ich ihm nicht ausweichen. Nicht, wenn das Foto von meinem Lieblingsmechaniker in regelmäßigen Abständen an mir vorbeizuckte.
Mein bester Freund. Mein Jacob.
Die Plakate mit der Aufschrift WER HAT DIESEN JUNGEN GESEHEN? waren nicht die Idee von Jacobs Vater. Mein eigener Vater, Charlie, hatte die Plakate drucken und überall in der Stadt aufhängen lassen. Nicht nur in Forks, sondern auch in Port Angeles, Sequim, Hoquiam, Aberdeen und jeder anderen Stadt auf der Halbinsel Olympic … Und er hatte dafür gesorgt, dass das Plakat auch in jeder Polizeiwache des Staates Washington hing. Seine eigene Polizeiwache hatte der Suche nach Jacob eine ganze Pinnwand gewidmet. Eine Pinnwand, die zu Charlies Ärger und Enttäuschung weitgehend leer war.
Mein Vater war nicht nur enttäuscht, weil kaum Hinweise eingingen. Vor allem war er enttäuscht von Billy, Jacobs Vater – und Charlies bestem Freund.
Enttäuscht, weil Billy sich bei der Suche nach seinem sechzehnjährigen »Ausreißer« nicht mehr ins Zeug legte. Weil Billy sich weigerte, die Plakate in La Push aufzuhängen, dem Reservat an der Küste, wo Jacob zu Hause war. Weil er sich mit Jacobs Verschwinden offenbar abgefunden hatte, als könne er sowieso nichts dagegen tun. Weil er sagte: »Jacob ist jetzt alt genug. Er wird schon wieder nach Hause kommen, wenn er will.«
Und es ärgerte ihn, dass ich mich Billys Meinung anschloss.
Auch ich wollte keine Plakate aufhängen. Denn Billy und ich wussten beide, wo Jacob war, ungefähr jedenfalls, und wir wussten auch, dass niemand diesen Jungen gesehen hatte.
Von den Plakaten bekam ich wie üblich einen dicken, fetten Kloß im Hals, wie immer brannten meine Augen, und ich war froh, dass Edward an diesem Samstag auf der Jagd war. Wenn er sehen würde, wie es mir ging, würde er sich auch schlecht fühlen.
Es hatte allerdings auch seine Nachteile, dass heute Samstag war. Als ich langsam und vorsichtig in unsere Straße einbog, sah ich den Streifenwagen meines Vaters in der Auffahrt vor unserem Haus stehen. Er war heute schon wieder nicht fischen gegangen. Hatte immer noch schlechte Laune wegen der Hochzeit.
Also konnte ich zu Hause nicht telefonieren. Aber ich musste unbedingt noch jemanden anrufen …
Ich parkte am Straßenrand hinter dem Denkmal meines Transporters und nahm das Handy, das Edward mir für den Notfall gegeben hatte, aus dem Handschuhfach. Ich wählte, und während es am anderen Ende klingelte, hielt ich den Finger über der Aus-Taste. Sicherheitshalber.
»Hallo?«, sagte Seth Clearwater, und ich atmete erleichtert auf. Ich hätte mich nie getraut, mit seiner älteren Schwester Leah zu sprechen. Den Ausdruck »Jemandem den Kopf abreißen« konnte man bei Leah durchaus wörtlich verstehen.
»Hallo, Seth, hier ist Bella.«
»Oh, hi, Bella! Wie geht’s?«
Ich hatte immer noch einen dicken Kloß im Hals und brauchte dringend Aufmunterung. »Gut.«
»Willst du den neuesten Stand wissen?«
»Du kannst wohl hellsehen.«
»Nö. Ich heiße ja nicht Alice – du bist nur leicht zu durchschauen«, scherzte er. Er war der Einzige aus dem Quileute-Rudel in La Push, dem es nichts ausmachte, die Cullens zu erwähnen, und der sogar Witze über sie machte, wie jetzt über meine fast allwissende Schwägerin in spe.
»Ich weiß.« Ich zögerte einen Augenblick. »Wie geht es ihm?«
Seth seufzte. »Wie immer. Er will nicht reden, obwohl wir wissen, dass er uns hören kann. Er versucht, nicht menschlich zu denken, weißt du. Überlässt sich ganz seinen Instinkten.«
»Weißt du, wo er jetzt ist?«
»Irgendwo in Nordkanada. Weiß nicht genau, in welcher Provinz. Um Grenzen schert er sich nicht sonderlich.«
»Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass …«
»Er kommt nicht zurück, Bella. Tut mir leid.«
Ich schluckte. »Schon gut, Seth. Eigentlich wusste ich das schon, bevor ich gefragt hab. Aber ich wünsche es mir so sehr.«
»Ja. Das geht uns allen so.«
»Danke, dass du mich erträgst, Seth. Ich weiß, dass die anderen dir das übelnehmen.«
»Sie sind nicht gerade deine größten Fans«, stimmte er fröhlich zu. »Aber ich finde das ziemlich schwach. Jacob hat sich entschieden, du hast dich entschieden. Er findet es auch nicht gut, wie sie dazu stehen. Natürlich ist er auch nicht gerade begeistert, dass du ihm nachspionierst.«
Ich schnappte nach Luft. »Ich dachte, er redet nicht mit euch!«
»Alles kann er nicht vor uns verbergen, obwohl er sich sehr anstrengt.«
Dann wusste Jacob also, dass ich mir Sorgen machte. Ich war mir nicht sicher, wie ich das finden sollte. Na ja, immerhin wusste er dann auch, dass ich nicht einfach wie im Film in den Sonnenuntergang entschwunden war und ihn völlig vergessen hatte. Womöglich hätte er mir das sogar zugetraut.
»Dann sehen wir uns also auf der … Hochzeit«, sagte ich und brachte das Wort kaum heraus.
»Ja, meine Mom und ich kommen auf jeden Fall. War super von dir, uns einzuladen.«
Ich lächelte über die Begeisterung in seiner Stimme. Es war Edwards Idee gewesen, die Clearwaters einzuladen, und jetzt war ich froh, dass er daran gedacht hatte. Es würde schön sein, Seth dabeizuhaben – eine wenn auch noch so dünne Verbindung zu meinem abwesenden Trauzeugen. »Ohne dich würde mir was fehlen.«
»Grüß Edward von mir, ja?«
»Klar.«
Ich schüttelte den Kopf. Die Freundschaft, die zwischen Edward und Seth entstanden war, verblüffte mich immer noch. Jedenfalls war sie ein Beweis dafür, dass es auch anders ging. Dass Werwölfe und Vampire miteinander auskommen konnten, wenn sie es nur wollten.
Diese Erkenntnis passte nicht allen.
»Oh«, sagte Seth und seine Stimme sprang eine Oktave höher. »Leah kommt grad nach Hause.«
»Oh! Tschüss!«
Die Verbindung brach ab. Ich legte das Handy auf den Sitz und bereitete mich innerlich darauf vor, ins Haus zu gehen, wo Charlie auf mich wartete.
Mein armer Vater hatte es in dieser Zeit wahrlich nicht leicht. Jacob der Ausreißer war nur eines der vielen Päckchen, die er zu tragen hatte. Fast ebenso besorgt war er um mich, seine nur knapp volljährige Tochter, die in wenigen Tagen unter die Haube kam.
Langsam ging ich durch den Nieselregen und dachte zurück an den Abend, an dem wir es ihm erzählt hatten …
Als das Geräusch des Streifenwagens uns verriet, dass Charlie zurückkam, wog der Ring an meinem Finger plötzlich hundert Pfund. Am liebsten hätte ich die linke Hand in die Tasche gesteckt oder mich draufgesetzt, aber Edward hielt sie mit seinem kühlen, festen Griff auf meinem Schoß fest.
»Bella, hör auf so herumzuzappeln. Bitte denk daran, dass du hier keinen Mord zu gestehen hast.«
»Du hast gut reden.«
Ich lauschte auf das unheilvolle Stapfen von Charlies Stiefeln auf dem Gehweg. Der Schlüssel rasselte unnötigerweise in der bereits offenen Tür. Das Geräusch erinnerte mich an die Stelle in Horrorfilmen, wo der verfolgten Frau bewusst wird, dass sie vergessen hat die Tür zu verriegeln …
»Ganz ruhig, Bella«, flüsterte Edward, als er hörte, wie schnell mein Herz schlug. Die Tür knallte an die Wand, und ich zuckte zusammen, als hätte ich einen elektrischen Schlag bekommen.
»Hi, Charlie«, rief Edward, er war ganz ungezwungen.
»Nein!«, zischte ich leise.
»Was ist?«, flüsterte Edward.
»Warte, bis er seine Pistole weggehängt hat!«
Edward kicherte und fuhr sich mit der Hand durch das zerzauste bronzefarbene Haar.
Charlie kam um die Ecke, immer noch in Uniform, immer noch bewaffnet, und er versuchte, nicht allzu unfreundlich zu gucken, als er uns zusammen auf dem kleinen Sofa sitzen sah. In letzter Zeit gab er sich große Mühe, Edward ein wenig sympathischer zu finden. Was wir ihm zu sagen hatten, würde diese Anstrengungen natürlich sofort zunichtemachen.
»Hallo, ihr zwei. Was gibt’s?«
»Wir möchten gern mit dir sprechen«, sagte Edward, ganz gelassen. »Wir haben gute Neuigkeiten.«
In Sekundenschnelle wechselte Charlies Gesichtsausdruck von angestrengt freundlich zu höchst misstrauisch.
»Gute Neuigkeiten?«, brummte er und sah mir ins Gesicht.
»Setz dich doch, Dad.«
Er hob eine Augenbraue, starrte mich fünf Sekunden lang an, stapfte dann zum Sessel und setzte sich ganz vorn auf den Rand, den Rücken stocksteif.
»Reg dich nicht auf, Dad«, sagte ich nach einem kurzen, spannungsgeladenen Schweigen. »Es ist alles okay.«
Edward verzog das Gesicht, und ich wusste, dass ihm das Wort »okay« gegen den Strich ging. Er hätte wahrscheinlich eher etwas wie »wundervoll« oder »großartig« oder »himmlisch« gesagt.
»Na klar, Bella. Wenn alles prima ist, wieso schwitzt du dann so?«
»Ich schwitze doch gar nicht«, log ich.
Ich drehte mich so, dass ich seine wütende Miene nicht mehr sah, drängte mich an Edward und wischte mir automatisch mit der rechten Hand über die Stirn, um den Beweis zu entfernen.
»Du bist schwanger!«, platzte Charlie heraus. »Du bist schwanger, hab ich Recht?«
Obwohl die Frage vermutlich an mich gerichtet war, starrte er jetzt Edward an, und ich hätte schwören können, dass seine Hand zur Pistole hinzuckte.
»Nein! Natürlich nicht!« Ich hätte Edward gern in die Rippen gestoßen, aber ich wusste, dass mir das nur einen blauen Fleck eingebracht hätte. Ich hatte Edward prophezeit, dass die Leute genau diesen Schluss ziehen würden. Weshalb sonst sollte ein vernünftiger Mensch mit achtzehn heiraten? (Bei seiner Antwort hatte ich die Augen verdreht. Aus Liebe. Ja, sicher.)
Charlies finstere Miene hellte sich ein kleines bisschen auf. Man konnte es mir immer ziemlich genau ansehen, ob ich die Wahrheit sagte oder nicht, und er glaubte mir. »Ach so. Entschuldigung.«
»Angenommen.«
Lange Zeit sagte niemand etwas. Nach einer Weile begriff ich, dass Edward und Charlie darauf warteten, dass ich etwas sagte. Panisch schaute ich zu Edward. Es war ausgeschlossen, dass ich die Worte herausbringen würde.
Er lächelte mich an, dann straffte er die Schultern und wandte sich zu meinem Vater.
»Charlie, ich bin diese Sache nicht so angegangen, wie es sich gehört. Der Tradition gemäß hätte ich zuerst dich fragen müssen. Und ich möchte dich keineswegs übergehen, doch da Bella bereits ja gesagt hat und ich die Entscheidung ganz ihr überlassen wollte, bitte ich dich nicht um die Hand deiner Tochter, sondern um deinen Segen. Charlie, wir werden heiraten. Ich liebe Bella mehr als alles auf der Welt, mehr als mein Leben, und wie durch ein Wunder liebt sie mich ebenso. Gibst du uns deinen Segen?«
Er sagte es so selbstsicher, so ruhig. Als ich die vollkommene Zuversicht in seiner Stimme hörte, hatte ich einen seltenen Moment der Erkenntnis. Ich sah die Welt mit seinen Augen. Einen Herzschlag lang erschienen mir seine Worte vollkommen logisch.
Und dann sah ich Charlies Gesichtsausdruck, er starrte auf meinen Ring.
Ich hielt den Atem an, während sein Gesicht die Farbe wechselte – von Blass zu Rot, von Rot zu Purpur, von Purpur zu Dunkelblau. Ich wollte schon aufstehen – ich weiß nicht genau, was ich vorhatte, vielleicht den Heimlich-Handgriff anwenden, damit er nicht erstickte –, aber Edward drückte meine Hand und sagte so leise, dass nur ich es hören konnte, »Lass ihm ein wenig Zeit«.
Diesmal blieb es wesentlich länger still. Dann wurde Charlies Gesichtsfarbe nach und nach wieder normal. Er schürzte die Lippen und runzelte die Brauen; sein typischer Denkerblick. Er sah Edward und mich lange an, und ich spürte, wie Edward neben mir noch gelassener wurde.
»So richtig überrascht mich das ja nicht«, grummelte Charlie. »Dachte mir schon, dass mir so was in der Art bald bevorsteht.«
Ich atmete aus.
»Bist du dir sicher?«, sagte Charlie und starrte mich an.
»Ich bin mir hundertprozentig sicher, was Edward angeht«, sagte ich unerschrocken.
»Aber gleich heiraten? Warum die Eile?« Jetzt schaute er mich wieder argwöhnisch an.
Die Eile kam daher, dass für mich mit jedem verdammten Tag die Neunzehn näher rückte, während Edward in der Vollkommenheit eines Siebzehnjährigen verharrte. Nicht dass das für mich ein Grund zum Heiraten gewesen wäre, aber es musste sein, weil ich mit Edward einen verzwickten Kompromiss geschlossen hatte, um endlich ans Ziel zu gelangen – um von einer Sterblichen in eine Unsterbliche verwandelt zu werden.
Aber das konnte ich Charlie nicht erklären.
»Wir werden doch im Herbst zusammen nach Dartmouth gehen, Charlie«, erinnerte Edward ihn. »Und ich würde das gern, nun ja, so machen, wie es sich gehört. So bin ich erzogen worden.« Er zuckte die Achseln.
Da übertrieb er nicht, die Moralvorstellungen waren zu Edwards Zeit wirklich ziemlich streng gewesen.
Charlie verzog ein wenig den Mund. Als suchte er nach einem möglichen Gegenargument. Aber was hätte er sagen sollen? Mir wäre es lieber, ihr würdet erst noch ein bisschen in Sünde leben? Er war mein Vater, ihm waren die Hände gebunden.
»Ich wusste, dass es so kommen würde«, murmelte er vor sich hin und runzelte die Stirn. Dann wurde seine Miene plötzlich ganz ruhig und ausdruckslos.
»Dad?«, fragte ich ängstlich. Ich schaute verstohlen zu Edward, der ebenfalls Charlie ansah, doch auch seine Miene konnte ich nicht deuten.
»Ha!«, machte Charlie unvermittelt. Ich fuhr auf dem Sofa in die Höhe. »Hahaha!«
Fassungslos starrte ich Charlie an, der sich vor Lachen krümmte, sein ganzer Körper schüttelte sich.
Ich schaute zu Edward, der natürlich schon wusste, warum Charlie so lachte, aber Edward hatte die Lippen fest zusammengepresst, als müsste er selbst ein Lachen unterdrücken.
»Okay, na gut«, stieß Charlie hervor. »Heirate.« Ein weiterer Lachkrampf schüttelte ihn. »Aber …«
»Was aber?«, sagte ich.
»Aber du sagst es deiner Mutter! Von mir erfährt Renée kein Wort! Das überlasse ich gern dir!« Er brach in schallendes Gelächter aus.
Mit der Hand am Türgriff hielt ich lächelnd inne. Keine Frage, damals hatten seine Worte mir Angst gemacht. Das war wie ein Todesurteil: es Renée erzählen zu müssen. Früh zu heiraten stand auf ihrer Liste möglicher Schandtaten noch weiter oben, als Hundebabys in kochendes Wasser zu werfen.
Wer hätte ahnen können, wie sie reagieren würde? Ich bestimmt nicht. Und Charlie ganz sicher auch nicht. Alice vielleicht, aber ich hatte nicht daran gedacht, sie zu fragen.
»Tja, Bella«, hatte Renée gesagt, nachdem ich die Worte »Mom, ich werde Edward heiraten« mühsam herausgestammelt hatte. »Ich bin fast ein bisschen beleidigt, dass du so lange damit gewartet hast, es mir zu sagen. Die Flüge werden doch immer teurer, je später man bucht. Oooh«, sagte sie dann besorgt. »Ob Phil bis dahin wohl den Gips abhat? Wenn er nicht im Smoking kommen kann, sind die Fotos ruiniert …«
»Moment mal, Mom.« Ich schnappte nach Luft. »Was soll das heißen, lange gewartet? Ich hab mich gerade erst verl-l…« – das Wort »verlobt« kam mir einfach nicht über die Lippen –, »es ist alles erst seit heute klar, weißt du.«
»Heute? Echt? Das ist wirklich eine Überraschung. Ich hatte gedacht …«
»Was hattest du gedacht? Und wann?«
»Na ja, als ihr uns im April besucht habt, da wirkte es so, als sei alles schon beschlossene Sache, wenn du weißt, was ich meine. Du bist nicht so schwer zu durchschauen, mein Schatz. Aber ich hab nichts gesagt, denn das hätte ja doch nichts genützt. Du bist genau wie dein Vater.« Sie seufzte resigniert. »Wenn du dir einmal etwas in den Kopf gesetzt hast, dann ist mit dir nicht mehr zu reden. Und natürlich bleibst du deinen Entschlüssen treu, genau wie Charlie.«
Und dann sagte sie etwas, das ich meiner Mutter niemals zugetraut hätte.
»Bella, du machst nicht meine Fehler. Du klingst so, als hättest du einen Riesenbammel, und ich nehme an, du hast Bammel vor mir.« Sie kicherte. »Davor, was ich wohl denke. Und ich weiß, dass ich viel darüber gesagt habe, wie dumm es ist zu heiraten – und das werd ich auch nicht zurücknehmen –, aber das alles galt natürlich nur für mich. Du bist ganz anders als ich. Du machst deine eigenen Fehler, und bestimmt wirst du im Leben auch das eine oder andere zu bereuen haben. Aber du hattest nie ein Problem damit, dich auf etwas einzulassen, Schatz. Du hast bessere Chancen, dass die Geschichte gut ausgeht, als die meisten Vierzigjährigen, die ich kenne.« Renée lachte wieder. »Mein kleines altes Kind. Wie gut, dass du offenbar eine verwandte alte Seele gefunden hast.«
»Du bist gar nicht … sauer? Du glaubst nicht, dass ich einen gigantischen Fehler mache?«
»Klar fände ich es gut, wenn du noch ein paar Jahre warten würdest. Ich meine, sehe ich etwa alt genug aus, um irgendjemandes Schwiegermutter zu sein? Bitte sag jetzt nichts. Aber hier geht es ja nicht um mich, sondern um dich. Bist du glücklich?«
»Ich weiß nicht. Jetzt gerade steh ich total neben mir.«
Renée gluckste. »Macht er dich glücklich, Bella?«
»Ja, aber …«
»Glaubst du, dass du jemals einen anderen willst?«
»Nein, aber …«
»Was aber?«
»Aber wirst du nicht gleich sagen, dass alle verknallten Teenager seit Anbeginn der Zeiten so reden?«
»Du bist nie ein Teenager gewesen, Schatz. Du weißt, was das Beste für dich ist.«
In den letzten Wochen hatte Renée sich dann sogar noch mit in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt. Jeden Tag hing sie stundenlang mit Esme am Telefon – die Schwiegermütter kamen also schon mal gut miteinander aus. Renée fand Esme hinreißend, allerdings konnte ich mir auch kaum vorstellen, dass irgendjemand nicht so für meine zukünftige Schwiegermutter empfinden könnte.
Damit war ich aus dem Schneider. Edwards und meine Familie kümmerten sich gemeinsam um die Hochzeit, und ich musste mir nicht groß den Kopf zerbrechen.
Charlie war natürlich stocksauer, aber das Schöne war, dass er nicht auf mich sauer war. Renée war die Verräterin. Er hatte sich darauf verlassen, dass sie sich querstellen würde. Was konnte er jetzt noch machen, da sich seine schlimmste Drohung – dass ich es meiner Mutter erzählen müsste – als völlig harmlos erwiesen hatte? Rein gar nichts, und das wusste er auch. Also lief er mit Leichenbittermiene herum und murmelte vor sich hin, dass auch auf überhaupt niemanden mehr Verlass sei …
»Dad?«, rief ich, als ich die Haustür geöffnet hatte. »Ich bin da.«
»Wart mal, Bella, bleib, wo du bist.«
»Hä?«, sagte ich und blieb automatisch stehen.
»Einen Moment. Aua, Alice, das war ich.«
Alice?
»Tut mir leid, Charlie«, trällerte Alice. »Wie ist das?«
»Ich blute ihn voll.«
»Ach was. Deine Haut ist nicht mal angekratzt – vertrau mir.«
»Was ist denn hier los?«, fragte ich und blieb immer noch zögernd im Eingang stehen.
»Dreißig Sekunden, Bella, bitte«, sagte Alice. »Deine Geduld wird belohnt werden.«
»Umpf«, machte Charlie.
Ich tippte mit dem Fuß auf den Boden und zählte jeden Schlag. Kurz bevor ich bei dreißig war, sagte Alice: »Bella, du kannst kommen!«
Vorsichtig bog ich um die Ecke und trat ins Wohnzimmer.
»Oh«, keuchte ich. »Mann, Dad. Du siehst ja …«
»Affig aus?«, fiel er mir ins Wort.
»Ich hätte jetzt eher todschick gesagt.«
Charlie wurde rot. Alice fasste ihn am Ellbogen und führte ihn in einer langsamen Drehung herum, um seinen blassgrauen Smoking vorzuführen.
»Nun lass mal gut sein, Alice. Ich sehe aus wie ein Trottel.«
»Niemand, der von mir eingekleidet wird, sieht aus wie ein Trottel.«
»Sie hat Recht, Dad. Du siehst spitzenmäßig aus. Gibt’s einen besonderen Anlass?«
Alice verdrehte die Augen. »Das ist die letzte Anprobe. Für euch beide.«
Jetzt erst löste ich den Blick von dem ungewöhnlich eleganten Charlie und sah die gefürchtete weiße Kleiderhülle, die sorgfältig über das Sofa gelegt worden war.
»Aaah.«
»Denk an was Schönes, Bella. Es dauert nicht lange.«
Ich atmete einmal tief durch und schloss die Augen. Ich hielt sie geschlossen und stolperte so die Treppe hoch in mein Zimmer. Ich entkleidete mich bis auf die Unterwäsche und streckte die Arme aus.
»Man könnte meinen, ich wollte dir Bambusspäne unter die Fingernägel treiben«, murmelte Alice, während sie mir hinterherkam.
Ich achtete nicht auf sie. Ich dachte an etwas Schönes. Ich dachte an mein Paradies.
In meinem Paradies war das ganze Hochzeitstheater schon längst vorbei. Lag hinter mir. Verdrängt und vergessen.
Wir waren allein, Edward und ich. Wo wir uns befanden, war unklar – mal sah es aus wie in einem nebligen Wald, dann wieder wie in einer bewölkten Stadt, dann wie in arktischer Nacht –, denn Edward wollte mir noch nicht verraten, wohin es in die Flitterwochen ging; es sollte eine Überraschung werden. Aber über das Wo machte ich mir keine großen Gedanken.
Edward und ich waren zusammen und ich hatte meinen Teil der Abmachung erfüllt. Ich hatte ihn geheiratet. Das war die Hauptsache. Außerdem hatte ich alle seine absurden Geschenke angenommen und mich, so sinnlos es war, für den Herbst an der Uni in Dartmouth eingeschrieben. Jetzt war er dran.
Bevor er mich in einen Vampir verwandelte – sein großes Zugeständnis –, hatte er noch eine andere Bedingung zu erfüllen.
Edward war geradezu besessen von der Sorge, dass ich so viel Menschliches aufgeben musste und dass es Erfahrungen gab, die ich mir nicht entgehen lassen durfte. Die meisten – wie zum Beispiel der Abschlussball – kamen mir ziemlich lächerlich vor. Dabei gab es nur eine einzige Erfahrung, die ich unbedingt machen wollte. Und gerade auf die sollte ich, ginge es nach ihm, am liebsten verzichten.
Aber genau das war der springende Punkt. Ich wusste, wie ich sein würde, wenn alles vorbei war. Ich hatte neugeborene Vampire hautnah erlebt, und ich hatte von meiner zukünftigen Familie alle Geschichten über diese wilde Anfangszeit gehört. Mehrere Jahre lang würde meine hervorstechendste Charaktereigenschaft »Durst« heißen. Es würde eine Weile dauern, bis ich wieder ich selbst sein konnte. Und auch wenn ich mich wieder im Griff hatte, würde ich doch nie wieder ganz genauso empfinden wie jetzt.
Menschlich … und leidenschaftlich verliebt.
Ich wollte diese eine Erfahrung machen, ehe ich meinen warmen, zerbrechlichen, hormongebeutelten Körper gegen etwas Schönes, Starkes … und Unbekanntes eintauschte. Ich wollte richtige Flitterwochen mit Edward. Und obwohl er befürchtete, mich damit in Gefahr zu bringen, hatte er eingewilligt, es zu versuchen.
Ich nahm Alice und das Gefühl von Satin auf meiner Haut nur am Rande wahr. In diesem Moment kümmerte es mich nicht, dass die ganze Stadt über mich sprach. Ich dachte nicht an das Schauspiel, in dem ich schon allzu bald die Hauptrolle spielen musste. Ich dachte nicht daran, dass ich über meine Schleppe stolpern oder im falschen Augenblick kichern könnte, dass ich zu jung war oder dass alle mich anstarren würden, ich dachte nicht einmal an den leeren Platz, auf dem mein bester Freund hätte sitzen sollen.
Ich war mit Edward in meinem Paradies.
Eine Lange Nacht
»Du fehlst mir jetzt schon.«
»Ich muss nicht gehen. Ich kann auch bleiben …«
»Mmm.«
Eine Weile blieb es still bis auf das Hämmern meines Herzens, den unregelmäßigen Rhythmus unseres rauen Atems und das Flüstern unserer Lippen, die sich in vollkommener Harmonie bewegten.
Manchmal war es ganz leicht zu vergessen, dass ich einen Vampir küsste. Nicht weil er gewöhnlich oder menschlich gewirkt hätte – nie vergaß ich auch nur eine Sekunde lang, dass der, den ich in den Armen hielt, mehr Engel war als Mensch –, sondern weil er mir das Gefühl gab, es sei das Selbstverständlichste von der Welt, dass seine Lippen meine berührten, mein Gesicht, meinen Hals. Er behauptete, er sei über die Versuchung, die mein Blut einmal für ihn bedeutet hatte, längst hinweg, und die Vorstellung, mich zu verlieren, habe ihn von jedem Verlangen danach geheilt. Doch ich wusste, dass der Geruch meines Bluts ihn immer noch quälte – ihm in der Kehle brannte, als würde er Flammen einatmen.
Ich schlug die Augen auf und sah, dass er mich ansah. Es war verrückt, dass er mich so anschaute. Als wäre ich der Hauptgewinn, nicht diejenige, die das große Los gezogen hatte.
Einen Moment lang trafen sich unsere Blicke; und ich meinte durch seine goldenen Augen bis auf den Grund seiner Seele schauen zu können. Es kam mir lächerlich vor, dass die Existenz seiner Seele je in Frage gestanden hatte, auch wenn er ein Vampir war. Er hatte die schönste Seele der Welt, sie war noch schöner als sein funkelnder Verstand, sein unvergleichliches Gesicht, sein göttlicher Körper.
Er erwiderte meinen Blick, als könnte auch er meine Seele sehen und als gefiele ihm das, was er sah.
Doch meine Gedanken konnte er nicht lesen, anders als die aller anderen. Ich wusste nicht, woran es lag – irgendein seltsamer Defekt schien mein Gehirn immun zu machen gegen die außergewöhnlichen und schrecklichen Sachen, zu denen manche Vampire fähig waren. (Allerdings war nur mein Geist immun; mein Körper war nicht gefeit gegen die besonderen Fähigkeiten von Vampiren.) Doch ich war sehr dankbar für diese wie auch immer geartete Störung in meinem Gehirn, die meine Gedanken vor Edward verbarg. Allein die Vorstellung, es könnte anders sein, war zu peinlich.
Ich zog sein Gesicht zu mir heran.
»Ich bleibe«, murmelte er kurz darauf.
»Nein, nein. Es ist dein Junggesellenabschied. Da musst du hin.«
Während ich das sagte, fasste ich gleichzeitig mit der rechten Hand fest in sein bronzefarbenes Haar und verstärkte mit der linken den Griff in seinem Nacken. Seine kühlen Hände streichelten mein Gesicht.
»Junggesellenabschiede sind etwas für jene, die ihrer Zeit als Alleinstehende nachtrauern. Ich dagegen könnte es gar nicht eiliger haben, meine hinter mir zu lassen. Es ist also ganz sinnlos.«
»Stimmt.« Mein Atem strömte gegen die winterkalte Haut seiner Kehle.
Das hier kam meinem Paradies schon ziemlich nahe. Charlie schlief nichtsahnend in seinem Zimmer, was fast so gut war wie allein zu sein. Edward und ich lagen zusammen auf meinem Bett, so sehr ineinander verschlungen, wie es die dicke Decke zuließ, in die ich eingemummelt war wie in einen Kokon. Ich fand es grässlich, dass wir die Decke brauchten, aber es zerstörte die Romantik, wenn ich anfing mit den Zähnen zu klappern. Und wenn ich mitten im August die Heizung einschaltete, würde es Charlie auffallen …
Nun ja, auch wenn ich dick eingepackt sein musste, Edwards T-Shirt lag jedenfalls auf dem Boden. Ich konnte es immer noch nicht fassen, wie vollkommen sein Körper war – weiß, kühl und glatt wie Marmor. Ich ließ meine Hand über seine steinharte Brust wandern, fuhr über seinen flachen Bauch und gab mich meinem Staunen hin. Ein leichter Schauer lief über seinen Körper und wieder fand sein Mund meinen. Vorsichtig stieß ich mit der Zungenspitze gegen seine spiegelglatte Lippe, und er seufzte. Kalt und köstlich strömte sein süßer Atem über mein Gesicht.
Ich spürte, wie er sich langsam von mir löste – das war seine automatische Reaktion, sobald er fürchtete, wir würden zu weit gehen, eine Art Reflex, wenn er eigentlich am liebsten weitermachen würde. Den größten Teil seines Lebens hatte Edward auf körperliche Lust verzichtet. Wenn er es jetzt zu ändern versuchte, machte ihm das große Angst, das wusste ich.
»Warte«, sagte ich, fasste seine Schultern und schmiegte mich fest an ihn. Ich befreite ein Bein aus der Decke und schlang es um seine Taille. »Übung macht den Meister.«
Er schmunzelte. »Nun, dann dürften wir jetzt schon beinahe Meister sein, oder? Hast du im letzten Monat überhaupt geschlafen?«
»Aber das ist jetzt doch die Generalprobe«, erinnerte ich ihn, »und wir haben erst ein paar Szenen geübt. Jetzt müssen wir auch den Rest proben.«
Ich hatte damit gerechnet, dass er lachen würde, aber er gab keine Antwort und sein Körper war plötzlich starr vor Anspannung. Das Gold in seinen Augen wirkte auf einmal fest statt flüssig.
Ich dachte über meine Worte nach und begriff, was er darin gehört hatte.
»Bella …«, flüsterte er.
»Fang nicht wieder damit an«, sagte ich. »Versprochen ist versprochen.«
»Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn wir so zusammen sind. Ich … ich kann nicht klar denken. Ich werde mich nicht beherrschen können. Ich werde dir wehtun.«
»Mir passiert schon nichts.«
»Bella …«
»Scht!« Ich drückte meine Lippen auf seine, um seine Panik zu ersticken. Ich kannte das alles. Aber er würde aus der Geschichte nicht herauskommen. Nicht, nachdem ich seiner Bedingung zugestimmt hatte, dass ich ihn vorher heirate.
Er erwiderte meinen Kuss eine Weile, aber ich merkte, dass er nicht mehr ganz bei der Sache war. Immer machte er sich Sorgen, immer. Wie anders würde es sein, wenn er sich um mich keine Sorgen mehr zu machen brauchte. Was würde er dann mit all der Zeit anfangen? Er müsste sich ein neues Hobby suchen.
»Wie geht es deinen Füßen?«, fragte er.
Ich verstand die Anspielung und sagte: »Angenehm warm.«
»Wirklich? Möchtest du es dir nicht noch einmal überlegen? Noch ist es nicht zu spät.«
»Willst du mich loswerden?«
Er lachte leise. »Ich will nur sichergehen. Du sollst nichts tun, was du nicht ganz bestimmt willst.«
»Was dich betrifft, bin ich mir sicher. Den Rest werd ich schon überleben.«
Er zögerte und ich fragte mich, ob ich schon wieder ins Fettnäpfchen getreten war.
»Wirklich?«, fragte er ruhig. »Ich meine nicht die Hochzeit – ich habe keinen Zweifel, dass du sie überleben wirst, trotz deiner Bedenken –, aber danach … was ist mit Renée, mit Charlie?«
Ich seufzte. »Sie werden mir fehlen.« Schlimmer noch war, dass ich ihnen fehlen würde, aber ich wollte kein Öl ins Feuer gießen.
»Angela und Ben und Jessica und Mike.«
»Auch meine Freunde werden mir fehlen.« Ich lächelte in die Dunkelheit. »Vor allem Mike. Oh, Mike! Wie soll ich nur ohne ihn leben?«
Er knurrte.
Ich lachte, aber dann wurde ich ernst. »Edward, wir haben das doch schon so oft besprochen. Ich weiß, dass es schwer wird, aber ich will es so. Ich will dich, und zwar für immer. Ein Leben lang ist mir einfach nicht genug.«
»Mit achtzehn erstarrt«, flüsterte er.
»Der Traum einer jeden Frau«, scherzte ich.
»Keine Veränderung mehr … keine Entwicklung.«
»Was soll das heißen?«
Seine Antwort kam langsam. »Weißt du noch, als wir Charlie erzählt haben, dass wir heiraten werden? Und er dachte, du seist … schwanger?«
»Und er hat dich in Gedanken erschossen«, sagte ich lachend. »Gib’s zu, einen kurzen Augenblick hat er daran gedacht.«
Er sagte nichts.
»Edward, was ist?«
»Ich denke nur … na ja, es wäre schön, wenn er Recht gehabt hätte.«
»O Gott«, sagte ich.
»Oder vielleicht eher, wenn es wenigstens hätte sein können. Wenn wir diese Möglichkeit hätten. Es ist furchtbar für mich, dir das zu rauben.«
Es dauerte einen Moment, bis ich etwas sagen konnte. »Ich weiß schon, was ich tue.«
»Wie kannst du das wissen, Bella? Sieh dir meine Mutter an oder meine Schwester. Es ist kein so leichtes Opfer, wie du denkst.«
»Esme und Rosalie kommen doch gut damit klar. Falls es später mal zum Problem wird, machen wir es einfach so wie Esme – wir adoptieren ein Kind.«
Er seufzte, dann wurde sein Ton heftig. »Es ist nicht richtig! Ich will nicht, dass du für mich Opfer bringst. Ich will dir etwas geben, nicht dir etwas wegnehmen – schon gar nicht deine Zukunft. Wäre ich ein Mensch …«
Ich legte ihm eine Hand auf die Lippen. »Du bist meine Zukunft. Jetzt hör auf damit. Hier wird keine Trübsal geblasen, sonst rufe ich deine Brüder an und sag ihnen, sie sollen dich abholen. Vielleicht brauchst du doch einen Junggesellenabschied.«
»Entschuldige. Ich blase wirklich Trübsal, was? Das sind sicher die Nerven.«
»Hast du etwa kalte Füße?«
»Nicht in diesem Sinn. Schließlich habe ich ein Jahrhundert darauf gewartet, dich zu heiraten, Miss Swan. Ich kann es gar nicht abwarten, bis …« Mitten im Satz brach er ab. »Oh, um Himmels willen!«
»Was ist?«
Er biss die Zähne zusammen. »Du brauchst niemanden anzurufen. Offenbar haben Emmett und Jasper nicht vor, mich heute Abend davonkommen zu lassen.«
Ich zog ihn noch einmal fest an mich, dann gab ich ihn frei. Bei einem Tauziehen mit Emmett hatte ich nicht die geringste Chance. »Viel Spaß.«
Am Fenster quietschte es – jemand kratzte voller Absicht mit Fingernägeln wie Stahl über die Scheibe, nur um ein ohrenbetäubendes Gänsehautgeräusch zu produzieren. Ich schauderte.
»Wenn du Edward nicht rausschickst«, zischte Emmett, der in der Dunkelheit immer noch unsichtbar war, drohend, »dann kommen wir rein und holen ihn!«
»Geh«, sagte ich lachend zu Edward. »Bevor sie das Haus zertrümmern.«
Edward verdrehte die Augen, aber mit einer einzigen fließenden Bewegung kam er auf die Füße und zog sich gleichzeitig das T-Shirt an. Er beugte sich zu mir herab und küsste mich auf die Stirn.
»Schlaf jetzt. Morgen ist dein großer Tag.«
»Danke! Das macht mich bestimmt ruhiger.«
»Wir sehen uns vorm Altar.«
»Ich bin die im weißen Kleid.« Ich lächelte darüber, wie wunderbar gleichgültig das klang.
»Sehr überzeugend.« Er kicherte und ging in die Hocke, die Muskeln gespannt wie eine Sprungfeder. Und dann verschwand er – schneller, als ich gucken konnte, war er zum Fenster hinaus.
Draußen ertönte ein dumpfer Schlag und ich hörte Emmett fluchen.
»Wehe, ihr bringt ihn zu spät zurück«, murmelte ich, wohl wissend, dass sie mich hören konnten.
Da tauchte Jasper vor meinem Fenster auf, sein honigfarbenes Haar glänzte silbern in dem schwachen Mondlicht, das durch die Wolken brach.
»Sei unbesorgt, Bella. Wir bringen ihn rechtzeitig wieder nach Hause.«
Plötzlich war ich ganz ruhig und all meine Sorgen kamen mir belanglos vor. Auf seine Art war Jasper ebenso begabt wie Alice mit ihren geradezu unheimlich genauen Visionen. Jaspers Talent hatte mit Stimmungen zu tun, und wenn er wollte, dass man etwas Bestimmtes fühlte, konnte man sich ihm einfach nicht entziehen.
Ich setzte mich ungeschickt auf, ich war immer noch in die Decke gewickelt. »Jasper? Was machen Vampire beim Junggesellenabschied? Ihr geht doch nicht mit ihm in ein Striplokal, oder?«
»Nichts verraten!«, knurrte Emmett von unten. Ich hörte noch einen dumpfen Schlag, dann Edwards leises Lachen.
»Keine Panik«, sagte Jasper und augenblicklich wurde ich ruhig. »Wir Cullens haben unsere eigene Variante. Nur ein paar Pumas und ein oder zwei Grizzlybären. Also eigentlich eine ganz gewöhnliche Nacht auf der Piste.«
Ich fragte mich, ob ich wohl je so lässig von der »vegetarischen« Vampirkost sprechen würde.
»Danke, Jasper.«
Er zwinkerte mir zu, dann verschwand er aus meinem Blickfeld.
Draußen war es vollkommen still. Charlies gedämpftes Schnarchen dröhnte durch die Wand.
Ich ließ mich wieder ins Kissen sinken, jetzt war ich doch müde. Mit schweren Lidern starrte ich an die Wände meines kleinen Zimmers, die im Mondlicht fahl leuchteten.
Die letzte Nacht in meinem Zimmer. Meine letzte Nacht als Isabella Swan. Morgen Nacht würde ich Bella Cullen sein. Obwohl mir die ganze Hochzeitszeremonie gegen den Strich ging, musste ich zugeben, dass das gut klang.
Ich ließ den Gedanken eine Weile freien Lauf und wartete darauf, dass der Schlaf mich übermannte. Doch nach ein paar Minuten merkte ich, dass ich wieder munterer war, die Aufregung schlich sich wieder in meinen Magen und er zog sich unangenehm zusammen. Ohne Edward kam mir das Bett zu weich und zu warm vor. Jasper war weit weg und hatte die Ruhe wieder mitgenommen.
Morgen würde ein langer Tag werden.
Mir war bewusst, dass die meisten meiner Ängste albern waren – ich musste mich einfach überwinden. Es gehörte nun mal zum Leben, dass man hin und wieder im Mittelpunkt stand. Ich konnte mich nicht immer verstecken. Dennoch hatte ich einige ganz berechtigte Sorgen.
Da war zunächst mal die Schleppe des Brautkleids, die Alice entworfen hatte. Das Aussehen war ihr dabei eindeutig wichtiger gewesen als praktische Erwägungen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich die Treppe der Cullens mit hochhackigen Schuhen und Schleppe bewältigen sollte. Ich hätte üben sollen.
Dann die Gästeliste.
Tanyas Familie, der Denali-Clan, würde vor den Feierlichkeiten eintreffen.
Es könnte ziemlich heikel sein, Tanyas Familie und unsere Gäste aus dem Quileute-Reservat, Jacobs Vater und die Clearwaters, im selben Raum zu haben. Die Denalis waren nicht gerade begeistert von den Werwölfen. Tanyas Schwester Irina kam aus diesem Grund gar nicht erst zur Hochzeit. Sie hegte immer noch Rachegelüste gegen die Werwölfe, weil sie ihren Freund Laurent getötet hatten (als er gerade versuchte mich zu töten). Wegen dieser Geschichte hatten die Denalis Edwards Familie in der Stunde der größten Not im Stich gelassen. Nur das überraschende Bündnis mit den Quileute-Wölfen hatte uns allen das Leben gerettet, als eine Horde neugeborener Vampire angegriffen hatte …
Edward hatte mir versichert, es sei nicht gefährlich, wenn die Denalis in der Nähe der Quileute wären. Tanya und ihre ganze Familie – außer Irina – hatten ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil sie die Cullens damals im Stich gelassen hatten. Ein Waffenstillstand mit den Werwölfen war nur ein geringer Preis, um das wiedergutzumachen, ein Preis, den sie gern bereit waren zu zahlen.
Das war das eigentliche Problem, aber es gab noch ein weiteres kleines Problem: mein zerbrechliches Selbstbewusstsein.
Ich hatte Tanya noch nie gesehen, aber ich war mir sicher, dass die Begegnung mit ihr für mein Ego nicht sehr angenehm sein würde. Vor langer Zeit, wahrscheinlich noch ehe ich auf der Welt war, hatte sie sich mal an Edward herangemacht – nicht dass ich es ihr oder irgendeiner anderen Frau verdenken könnte, dass sie ihn attraktiv fand. Trotzdem, bestimmt war sie mindestens schön, wenn nicht gar umwerfend. Und obwohl Edward eindeutig – wenn auch unbegreiflicherweise – mich lieber hatte, würde ich mich automatisch mit ihr vergleichen.
Ich hatte ein bisschen gemurrt, bis Edward, der meine Schwächen kannte, mir ein schlechtes Gewissen gemacht hatte.
»Wir sind die Einzigen, die für sie so etwas wie Verwandtschaft sind, Bella«, hatte er gesagt. »Sie fühlen sich immer noch als Waisen, selbst nach all der Zeit.«
Also hatte ich mich geschlagen gegeben und gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
Tanya hatte inzwischen auch eine große Familie, fast so groß wie die der Cullens. Sie waren zu fünft: zu Tanya, Kate und Irina waren Carmen und Eleazar gestoßen, so wie Alice und Jasper zu den Cullens gestoßen waren; sie alle verband der Wunsch, ein humaneres Leben zu führen als gewöhnliche Vampire.
Doch obwohl Tanya und ihre Schwestern nun also eine große Familie hatten, waren sie in einer Hinsicht immer noch allein. Immer noch in Trauer. Denn vor sehr langer Zeit hatten auch sie eine Mutter gehabt.
Ich ahnte, was für eine Lücke dieser Verlust gerissen haben musste, selbst nach tausend Jahren noch; ich versuchte mir die Cullens ohne ihren Schöpfer und Mittelpunkt vorzustellen – ihren Vater, Carlisle. Es war unmöglich.
Carlisle hatte mir Tanyas Geschichte erzählt, an einem der vielen Abende, an denen ich bis spät bei den Cullens geblieben war, um so viel wie möglich zu erfahren und mich, so gut es ging, auf die Zukunft vorzubereiten, für die ich mich entschieden hatte. Die Geschichte von Tanyas Mutter war nur eine von vielen, ein warnendes Beispiel für eine der Regeln, die ich beachten musste, wenn ich in die Welt der Unsterblichen eintrat. Eigentlich gab es nur eine einzige Regel – ein Gesetz, das sich in tausend verschiedenen Facetten zeigte: Hüte das Geheimnis.
Das Geheimnis zu hüten, beinhaltete eine ganze Menge: ein so unauffälliges Leben zu führen wie die Cullens, den Wohnort zu wechseln, bevor die Menschen merkten, dass man nicht alterte. Oder ein Nomadenleben zu führen und sich ganz von den Menschen fernzuhalten – außer zu den Mahlzeiten –, wie James und Victoria es getan hatten und wie es Jaspers Freunde, Peter und Charlotte, noch immer taten. Außerdem musste man die neuen Vampire, wenn man welche schuf, im Griff haben, wie Jasper und Maria damals. Während es Victoria mit ihren Neugeborenen nicht gelungen war.
Und es bedeutete auch, gewisse Dinge gar nicht erst zu erschaffen, denn manche Schöpfungen ließen sich nicht beherrschen.
»Ich weiß nicht, wie Tanyas Mutter hieß«, hatte Carlisle gesagt, und der Blick seiner goldenen Augen, die fast dieselbe Farbe hatten wie sein helles Haar, wurde bekümmert bei der Erinnerung an Tanyas Trauer. »Sie vermeiden es, über sie zu sprechen, denken niemals absichtlich an sie. Die Frau, die Tanya, Kate und Irina schuf – und die sie liebte, wie ich glaube –, lebte viele Jahre vor meiner Geburt, in einer Zeit, in der eine Seuche umging, die Seuche der unsterblichen Kinder. Was sie sich damals dabei dachten, verstehe ich noch immer nicht. Aus Kindern schufen sie Vampire.«
Ich musste die Wut herunterschlucken, die in mir aufstieg, als ich mir vorstellte, was er beschrieb.
»Sie waren sehr schön«, erklärte Carlisle schnell, als er meine Reaktion sah. »So liebreizend, so bezaubernd, du kannst es dir nicht vorstellen. Man konnte nicht anders, als sie zu lieben, sobald man sie sah. Doch man konnte ihnen nichts beibringen. Sie waren an dem Punkt ihrer Entwicklung stehengeblieben, an dem sie sich befunden hatten, bevor sie gebissen wurden. Niedliche Zweijährige, die Grübchen hatten und lispelten und die in einem einzigen Trotzanfall ein halbes Dorf zerstören konnten. Wenn sie Durst hatten, tranken sie und nichts konnte sie zurückhalten. Menschen sahen sie, Geschichten machten die Runde, Angst breitete sich aus wie ein Buschfeuer … Auch Tanyas Mutter erschuf ein solches Kind. Ihre Gründe sind mir ebenso schleierhaft wie die der anderen.« Er atmete tief durch. »Und dann griffen natürlich die Volturi ein.«
Wie immer, wenn ich diesen Namen hörte, zuckte ich zusammen, aber natürlich waren jene italienischen Vampire – die sich selbst als königlich betrachteten – von zentraler Bedeutung für diese Geschichte. Es konnte kein Gesetz geben ohne Strafe und keine Strafe, wenn da nicht jemand war, der sie vollstreckte. Die Ältesten Aro, Caius und Marcus hatten die Befehlsgewalt über die Truppen der Volturi; ich war ihnen nur einmal begegnet, und bei dieser kurzen Begegnung hatte ich den Eindruck gewonnen, dass Aro mit seiner mächtigen Gabe, Gedanken zu lesen – eine Berührung und er kannte alle Gedanken, die ein anderer je gedacht hatte –, der wahre Anführer war.
»Die Volturi beobachteten die unsterblichen Kinder eine Weile, zu Hause in Volterra und überall auf der Welt, bis Caius entschied, dass die Kinder nicht in der Lage waren, unser Geheimnis zu bewahren. Und deshalb mussten sie zerstört werden. Wie ich bereits sagte, sie waren voller Liebreiz. Die einzelnen Zirkel kämpften bis zum letzten Mann, um sie zu beschützen. Das Gemetzel zog nicht so weite Kreise wie die Kriege im Süden des Kontinents, war jedoch auf seine Weise fast noch verheerender. Alteingesessene Zirkel, alte Traditionen, Freundschaften … es ging so vieles verloren. Am Ende durften überhaupt keine unsterblichen Kinder mehr erschaffen werden. Es wurde nicht einmal mehr über sie gesprochen, sie wurden ein Tabu.
Als ich bei den Volturi lebte, lernte ich selbst zwei unsterbliche Kinder kennen, ich weiß also aus eigener Erfahrung, wie reizend sie waren. Aro erforschte die Kleinen noch viele Jahre, nachdem die Katastrophe, die sie ausgelöst hatten, vorüber war. Du weißt, wie wissbegierig er ist; er hoffte, man könnte sie zähmen. Doch schließlich war die Entscheidung einstimmig: Es durfte die unsterblichen Kinder nicht mehr geben.«
Ich hatte gar nicht mehr an die Mutter der Denali-Schwestern gedacht, als Carlisle auf sie zurückkam.
»Was genau mit Tanyas Mutter geschah, wissen wir nicht«, sagte er. »Tanya, Kate und Irina waren jedenfalls völlig ahnungslos bis zu jenem Tag, als die Volturi zu ihnen kamen; ihre Mutter und deren unerlaubte Schöpfung hatten sie bereits gefangen genommen. Nur ihre Unwissenheit rettete Tanya und ihren Schwestern das Leben. Aro berührte sie und sah, dass sie unschuldig waren, deshalb wurden sie nicht zusammen mit ihrer Mutter bestraft. Keine von ihnen hatte den Jungen zuvor gesehen oder seine Existenz auch nur geahnt, bis zu dem Tag, als sie mit ansehen mussten, wie er in den Armen ihrer Mutter verbrannte. Ihre Mutter hatte ihn wohl deshalb vor ihnen geheim gehalten, um sie vor dem zu beschützen, was dann geschah. Doch weshalb hatte sie ihn überhaupt erschaffen? Wer war er und was hatte er ihr bedeutet, dass sie diese unüberschreitbare Grenze doch überschritten hatte? Tanya und ihre Schwestern fanden nie eine Antwort auf diese Fragen. Doch es gab keinen Zweifel an der Schuld ihrer Mutter, und ich glaube, sie haben ihr nie ganz vergeben.
Obgleich Aro wusste, dass Tanya, Kate und Irina unschuldig waren, wollte Caius sie verbrennen. Sippenhaft. Sie hatten Glück, dass Aro an jenem Tag gnädig gestimmt war. Tanya und ihre Schwestern kamen davon, doch sie hatten von da an ein gebrochenes Herz und einen sehr gesunden Respekt vor dem Gesetz …«
Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt die Erinnerung in einen Traum überging. Eben noch hatte ich in meiner Erinnerung Carlisle zugehört und ihm ins Gesicht geschaut, einen Augenblick später schaute ich auf ein graues, dürres Feld und hatte den schweren Geruch von brennendem Weihrauch in der Nase. Ich war nicht allein.
Das Gewirr der Gestalten auf dem Feld, alle in aschfarbene Umhänge gehüllt, hätte mich ängstigen müssen – es konnten nur die Volturi sein und ich war, entgegen dem, was sie bei unserer letzten Begegnung befohlen hatten, immer noch ein Mensch. Doch ich wusste, wie manchmal in meinen Träumen, dass ich für sie unsichtbar war.
Überall um mich herum waren qualmende Haufen. Ich roch etwas Süßliches und schaute die Haufen nicht allzu genau an. Ich wollte die Gesichter der Vampire, die sie hingerichtet hatten, gar nicht sehen, denn ich befürchtete, ich könnte in den glühenden Scheiterhaufen jemanden erkennen.
Die Krieger der Volturi standen in einem Kreis um etwas oder jemanden herum, ich hörte ihr aufgeregtes Geflüster. Ich konnte nicht anders, als mich näher an die Umhänge heranzuschleichen, um zu sehen, wen oder was sie da so eingehend betrachteten. Ich kroch vorsichtig zwischen zwei der hohen wispernden Gestalten, und da sah ich auf einem kleinen Hügel über ihnen, was sie so aufregte.
Er war wunderschön, hinreißend, genau wie Carlisle gesagt hatte. Es war ein kleiner Junge, vielleicht zwei Jahre alt. Hellbraune Locken umrahmten das Engelsgesicht mit den Pausbacken und den vollen Lippen. Und er zitterte, er hatte die Augen geschlossen, als hätte er zu große Angst zuzuschauen, wie der Tod mit jeder Sekunde näher kam.
Ich verspürte einen so unwiderstehlichen Drang, dieses reizende, verängstigte Kind zu retten, dass die fürchterliche Bedrohung der Volturi mich auf einmal nicht mehr schrecken konnte. Ich zwängte mich an ihnen vorbei und es kümmerte mich nicht, ob sie mich bemerkten. Ich rannte zu dem Jungen hin.
Taumelnd blieb ich stehen, als ich erkannte, auf was für einem Hügel der Junge saß. Es war kein Hügel aus Erde und Stein, sondern aus menschlichen Körpern, die übereinanderlagen, ausgezehrt und leblos. Ich kannte sie alle – Angela, Ben, Jessica, Mike … Und genau unter dem liebreizenden Jungen lagen die Körper meines Vaters und meiner Mutter.
Der Junge öffnete die leuchtenden, blutroten Augen.
Der große Tag
Ich riss die Augen auf.
Zitternd und keuchend lag ich in meinem warmen Bett, und es dauerte einige Minuten, bis ich mich von dem Traum befreit hatte. Der Himmel vor meinem Fenster wurde erst grau, dann blassrosa, während ich darauf wartete, dass sich mein Herz beruhigte.
Zurück in der Wirklichkeit meines unordentlichen, vertrauten Zimmers, ärgerte ich mich ein bisschen über mich selbst. Musste ich in der Nacht vor meiner Hochzeit ausgerechnet so etwas träumen! Das kam davon, wenn man sich mitten in der Nacht in solche Geschichten hineinsteigerte.
Um den Albtraum möglichst schnell abzuschütteln, zog ich mich an und ging früher als nötig hinunter. Erst räumte ich die ohnehin schon ordentlichen Zimmer auf, und als Charlie aufstand, machte ich ihm Pfannkuchen. Ich selbst war viel zu aufgeregt, um zu frühstücken – ich rutschte auf dem Stuhl hin und her, während er aß.
»Um drei holst du Mr Weber ab«, erinnerte ich ihn.
»Ich hab heute nicht viel anderes zu tun, Bella, als den Geistlichen zu chauffieren. Es ist unwahrscheinlich, dass ich meine einzige Aufgabe vergesse.« Charlie hatte sich für die Hochzeit den ganzen Tag freigenommen, und jetzt wusste er nichts mit sich anzufangen. Hin und wieder blickte er verstohlen zu dem Schrank unter der Treppe, wo er seine Angelgeräte aufbewahrte.
»Das ist nicht deine einzige Aufgabe. Du musst außerdem ordentlich angezogen sein und vorzeigbar aussehen.«
Brummig schaute er in seine Cornflakesschale und murmelte leise etwas von »Pinguinen«.
Jemand klopfte forsch an die Haustür.
»Und du meinst, du hast es schwer.« Ich stand auf und schnitt eine Grimasse. »Alice wird sich den ganzen Tag an mir zu schaffen machen.«
Charlie nickte nachdenklich, er musste zugeben, dass er nicht ganz so schlimm dran war. Ich beugte mich zu ihm hinab und küsste ihn auf den Kopf – er wurde rot und machte hmpf –, dann ging ich zur Tür und ließ meine beste Freundin und zukünftige Schwägerin herein.
Alice’ kurze schwarze Haare waren nicht stachlig wie sonst – sie fielen ihr in seidig glänzenden Locken um das Elfengesicht, auf dem im Gegensatz dazu ein sehr geschäftsmäßiger Ausdruck lag. Sie rief nur flüchtig »Hi, Charlie« über die Schulter und zog mich aus dem Haus.