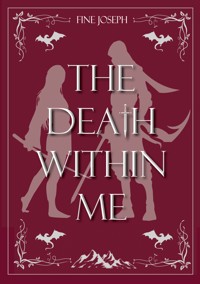
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Todesboten, Götter, Drachen - das alles hält Hazel für alte Kindermärchen. Bis eines Nachts Erys, der grausame Diener des Todes in ihrem Zuhause auftaucht und ihr mühselig verdientes Gold stiehlt. Es dauert nicht lange, bis Lord Harrington, Kommandant der Königsgarde, davon erfährt und sie in einem riskanten Plan als Köder einsetzt, um dem Todesboten eine Falle zu stellen. Zu allem Überfluss verspürt Hazel plötzlich dieses Brodeln in ihr, das sie wenig später als Magie erkennt. Dunkle Magie. Hin und hergerissen zwischen ihren Grundsätzen von Gut und Böse verliert sie sich immer mehr in den Verlockungen des Todesboten. Zu spät erkennt sie, dass nicht alles, was im Tal der Sterblichen erzählt wird, wahr ist und es oft die Menschen sind, die ein tödlicheres Verlangen in sich tragen als so mancher Todesbote...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 900
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist für...
Meine Oma, Bärbel - Du wirst diese Geschichte nicht mehr lesen, aber ich weiß, dass du die Erste wärst, die in die Buchhandlung laufen würde, um sich ein Exemplar zu holen. Du bist nicht mehr da, wenn ich The Death within Me veröffentliche und doch begleitest du mich jeden Tag auf diesem Weg
Stephan - Ich sehe jetzt schon vor mir, wie du lachend abwinkend wirst, wenn du diese Worte liest, aber glaub mir, wenn ich sage, dass du mir auf meinem Weg schon so oft geholfen hast, ohne es zu merken. Meistens sind es die kleinen Dinge, die das Herz berühren und davon gibst du jeden Tag so viel, ohne dass du es selber siehst.
Emelie - Verzeih mir, dass ich dir erst jetzt ein Buch widme. Das hätte ich schon von Anfang an tun sollen, denn du hast mich schon in meinen Geschichten und chaotischen Gedanken unterstützt, als ich nicht einmal ansatzweise ans Veröffentlichen gedacht habe. Für Emmi - Fan, Freundin und ein großartiger Mensch
Meine Eltern, Yvi & Rainer - Für eure Widmung müsste ich eigentlich ein ganzes Buch füllen und wäre selbst dann nicht fertig. Ich bin so stolz darauf, eure Tochter zu sein und kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich euch jeden Tag für alles bin, was ihr tut. Und damit meine ich nicht nur die Unterstützung beim Schreiben.
Fine Joseph wurde am 18.01.2001 in Langenhagen unter dem
Namen Josefine geboren und ist in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Schon als kleines Mädchen lag ihre größte
Leidenschaft im Lesen und Schreiben. Von 2017 bis 2019 absolvierte sie eine Ausbildung zur Gestaltungsstechnischen Assistentin, bevor sie ein eineinhalbjähriges Studium im Schwerpunkt „Kreatives Schreiben“ abschloss.
Nachdem sie zwei Thriller veröffentlichte, widmete sie sich dem Fantasy und Romantasy-Genre.
The Death within Me ist der Auftakt einer epischen Fantasy-Reihe.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Prolog
Diesmal klebte kein Blut an ihm.
Während er den Stoffbeutel mit langen, blassen Fingern in seiner Manteltasche verschwinden ließ, bahnte er sich seinen vertrauten Weg durch das Schloss. Kühles, graues Gemäuer. Kahle Wände. Kein Licht erhellte die Gänge. Es war nicht nötig; dem Tod und seinen Boten war es möglich, im tiefsten Schwarz der Nacht noch etwas zu sehen.
Für einen Moment umschlossen seine Finger noch das klimpernde Säckchen voller Goldmünzen in seinem Mantel. Diesmal klebte kein Blut am Stoff. Sie hatten es ihm freiwillig gegeben.
Lautlos glitt er in seinem langen, schwarzen Mantel durch die Flure, die Kapuze tief in die Stirn gezogen, sodass bis auf seine Finger nicht ein Flecken Haut zu erkennen war. Türen aus dunklem Holz zogen an ihm vorbei, doch nicht einmal hielt er inne, um eine von ihnen zu öffnen. Sie waren nicht für ihn bestimmt. Zielstrebig führten ihn seine Schritte auf die riesigen Flügeltüren zu, die mit dunklem Stein gesäumt waren. Einige uralte Runen und Schriftzeichen waren in den Stein graviert, doch selbst dafür hatte der Fremde im schwarzen Mantel keinen Blick übrig. Er zog die Hand aus der Tasche, legte sie gegen die Pforten und drückte die Türen auf. Das Knarzen hallte durch die stillen Korridore, vermischte sich mit dem Klimpern der Münzen, die bei jedem Schritt des Fremden gegen seine Hüfte schlugen.
Der Raum, den er soeben betreten hatte, war kaum als einfacher Raum zu bezeichnen. Schwarze Säulen aus Granit, die mit schlangenartigen Schnörkeln verziert waren, säumten den Weg durch die Halle. Die rote Farbe, in die die Verschnörkelung getränkt war, erinnerte an das viele Blut, das innerhalb dieser Wände schon vergossen wurde. Der Fremde hatte nie das Bedürfnis verspürt, nach der wahren Substanz der Verzierung zu fragen. Auch heute mied er gekonnt den Blick in Richtung der Säulen, die ihn bis hinauf zum Podest begleiteten, auf dem der steinerne Thron stand. Hoch über dem Thronsaal ragte er empor, gewaltig und mächtig. Dornen aus hartem Stein umfassten die Lehne, als würden sie einen grotesken Heiligenschein bilden. Eine unnatürliche Kälte lag in der Luft, die selbst der Fremde spüren konnte. Seine Augen lagen unter dem Stoff der Kapuze verborgen und doch fixierten sie nur einen einzigen Punkt vor sich.
„Erys.“
Es war eine menschliche Stimme, die in dem Moment durch den Saal wehte. Menschlich und doch so animalisch, so leer, ohne jegliche Emotionen. Jeder Muskel des Fremden spannte sich an, als er die letzten Schritte tat und vor den Stufen des Podests zum Stehen kam. „Ihr seid zurück.“
Der Fremde, Erys, neigte den Kopf und ließ sich vor dem Thron auf ein Knie sinken. Wieder klimperte das Gold in seiner Tasche. Sein Blick war nun auf die spiegelglatten Fliesen gerichtet, während er ganz genau spüren konnte, dass der Schatten auf dem Thron immer größer wurde. Die Kälte kroch durch jede Ritze des Saals. Erys wusste, dass jedes menschliche Wesen, das auch nur einen Schritt in dieses Reich setzen würde, bereits erfroren wäre. Doch welcher Sterbliche würde es je wagen, es zu betreten? Das Reich des Todes. Unbarmherzig und hinterlistig. Herzlos.
So wie seine Diener, seine Untertanen, seine Boten. Seine Todesboten. Sie waren es, die hinaus in die Welt zogen, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, selbst den kleinsten Dörfern statteten sie einen Besuch ab, um den Sterblichen den Preis für ihr Leben abzunehmen.
Sie sollten wissen, wo ihr Platz war. Die meisten taten das auch. Erys dachte an die Goldsäcke, die nicht unbefleckt geblieben waren. Die Goldsäcke, an denen selbst heute noch das längst geronnene Blut haftete.
Manche wussten nicht, wo ihr Platz war. Und der Preis, den sie für diese Unwissenheit zahlten, war hoch.
Der Tod richtete sich auf seinem Thron auf, sein langer, schwarzer Mantel floss in einem einzigen Schatten an ihm herab und waberte wie dunkler Nebel um den Podest. Die Kapuze fiel ihm noch tiefer ins Gesicht als sie es bei Erys tat.
Erys wusste nicht, wie oft er schon in diesen Hallen gestanden hatte.
Wie oft er an diesen blutgetränkten Säulen vorbeigelaufen war.
Irgendwann hatte er aufgehört zu zählen.
Hatte aufgehört zu zählen, wie viele Goldmünzen er schon zum Tod getragen hatte.
Als hätte dieser seine Gedanken vernommen, streckte er wortlos seinen Arm aus. Sein Mantel verdeckte auch diesen und erst als Erys sich erhob und den Beutel hervorholte, schüttelte der Tod den langen Ärmel zurück. Erys‘ Kiefermuskeln zuckten unter seiner Kapuze, als sein Blick auf die knochige, verfaulte Haut fiel, die sich ihm an gräulichen Fingern entgegenstreckte. Darauf bedacht, seine Hand nicht zu berühren, ließ Erys den Sack in seinen wartenden Griff fallen.
„28 Goldmünzen.“
Seine Worte hallten in tiefer, rauer Stimme durch den Saal. Sie klang leicht heiser, als hätte er seit langer Zeit nicht mehr gesprochen. Die knochigen Finger schlossen sich um den Sack, bis sich die schwarzen Fingernägel in den Stoff gruben. Erys trat einen Schritt zurück und verschränkte die Hände hinter dem Rücken, während der Tod das Gold in den Händen abwägte.
„Ich sehe kein Blut“, stellte er schließlich mit einem kühlen Zischen fest.
„Sie haben meinen Besuch bereits erwartet. Ich musste sie dieses Mal nicht zwingen, mir das Gold zu überlassen“, erklärte Erys ruhig.
Der Tod bewegte sich auf seinem Thron und obwohl seine Augen noch immer unter der Kapuze verborgen lagen, spürte Erys die Härte seines Blickes auf sich ruhen.
„Dann wird es keinen nächsten Besuch mehr geben.“
Erys runzelte die Stirn und sah den Tod – das, was von ihm zu sehen war – abwartend an. Klimpernd hielt dieser das Goldsäckchen empor.
„Der Winter wird hart. Wenn das ihr letztes Hab und Gut war, werden sie schon bald in mein Reich übertreten. Ob sie es wollen oder nicht.“
Erys antwortete nicht. Er wusste, dass der Tod Recht hatte. Hatte es in den ausdruckslosen Blicken der Familie gesehen, der er ihr letztes Vermögen abgenommen hatte. Sie hatten gewusst, dass sie den Winter ohne Gold nicht überleben würden. Und Erys hatte es auch gewusst.
Dennoch hatte er sie nicht direkt von ihrem Leiden befreit. Nein. Er hatte sich dazu entschieden, ihnen ihrem qualvollen, hoffnungslosen Ende zu überlassen, schleichend und unbarmherzig.
Die Tat eines Todesboten.
Mit einer fließenden Bewegung ließ der Tod das Gold in seinem Umhang verschwinden, bevor er sich auf dem Thron vorbeugte. Der Nebel, der ihn umgab, tauchte nun auch Erys‘ Stiefel in schummrige Dunkelheit.
„Ihr werdet nicht in die Stadt im Norden zurückkehren“, sagte der Tod eisig.
Erys hob die Augenbrauen.
Die letzten fünf Jahre hatte er die Aufträge, die der Tod ihm übertrug, in einer kalten, grauen Stadt hoch oben in den nördlichen Bergen ausgeführt. Dass er jetzt, nach so langer Zeit, einem anderen Ort zugeteilt werden würde, überraschte ihn.
Der Tod streckte abermals seine faulige Hand aus und vollführte vor sich eine knappe Bewegung, worauf eine bläulich schimmernde Kugel zwischen ihm und Erys in der Luft erschien. Auch sie umgab ein seltsamer Nebel, den der Tod mit einer weiteren Handbewegung beiseite wischte. Erys warf dem Tod einen kurzen Blick zu, bevor er sich der schwebenden Kugel näherte und einen Blick hinein warf. Im ersten Moment fiel es ihm schwer, etwas aus den vielen, verschwommenen Farben zu erkennen. Doch nach und nach wurde das Bild klarer. Er sah frisches, grünes Gras. Bunte Blumen. Weite Felder. Einen plätschernden Bach.
Und an jenem Ufer saß sie.
Ihr langes braunes Haar fiel ihr in einem geflochtenen Zopf über die Schulter, während sie sich tief über das Wasser beugte und leise summend die Wäsche ins Nass tauchte. Das blaue Kleid, das sie trug, war schlicht und einfach und auch sonst konnte Erys keinerlei Schmuck an ihr erkennen. Wenn sie selber die Kleidung wusch und dafür zu einem Fluss im Wald ging, konnte sie nicht auf einem reichen Anwesen zu Hause sein.
„Wer ist sie?“, fragte Erys, ohne den Blick von ihr zu nehmen.
Sie hob den Kopf, als hätte sie selbst seine Frage gehört, doch in Wahrheit sah sie nur einer Libelle hinterher, die über die Wasseroberfläche sauste. Ihre blauen Augen glitzerten in der tiefstehenden Sonne.
„Euer nächster Auftrag“, höhnte der Tod.
Erys konnte das gehässige Grinsen in seiner Stimme hören, ohne es sehen zu müssen. Also hatte er Recht. Das Mädchen stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Er trat einen Schritt zurück, wandte den Blick von der Kugel ab und nickte dem Tod zu.
Gut.
Ein leichtes Opfer.
Kapitel 1
- Hazel Goldwing -
Meine Lunge stand in Flammen.
Eine der Schnüre, die mein Kleid an den Schulterblättern zusammenhielten, hatte sich gelöst und in meinem Haar verknotet, das in einer einzigen, wilden Mähne hinter mir her wehte.
Mein Herz pochte so schnell, so laut, dass ich es in meinen Ohren hörte. Nur nicht stehenbleiben. Wenn ich jetzt stehenblieb, verlor ich.
Wie ein Mantra wiederholte ich die Worte in meinem Kopf. Meine nackten Füße schmerzten und ich war mir sicher, dass ich heute Abend nicht nur eine neue Schramme entdecken würde – sollte ich diesen Tag überhaupt überstehen.
Als würde mein Leben davon abhängen, klammerte ich mich an den Korb in meinen Händen und presste ihn an meine Brust. Immer schneller trugen meine Beine mich den von Ahorn und Eiche gesäumten Weg entlang – vorbei an Fliederbüschen, an Efeuranken und Moos bewachsenen Baumstämmen. Die Schritte hinter mir wurden lauter. Mein Herz pochte so hart gegen meinen Brustkorb, als würde es jeden Moment herausspringen.
Sie kamen näher, hatten mich fast erreicht. Ich wagte einen flüchtigen Blick über die Schulter und – erstaunt weiteten sich meine Augen.
Der Weg hinter mir war leer. Das konnte nicht sein. Hatten sie aufgegeben?
Ich drehte den Kopf.
Und sah den Schatten zu meiner Rechten zu spät.
Keuchend stieß ich die Fersen in den Boden, irgendwie um Gleichgewicht bemüht, doch ich hatte keine Chance. Etwas Hartes knallte gegen meine Seite und riss mich mit sich zu Boden. Der Korb fiel aus meinen Händen und rollte ein paar Meter weiter, bevor er zwischen zwei Steinen eingeklemmt liegenblieb. Ich kniff die Augen zusammen, ballte die Hände zu Fäusten und schlug auf den Boden.
„Schon wieder? Wirklich? Wie stellt ihr das nur an, ihr kleinen Biester?“
Mit einem frustrierten Stöhnen, das mein Schmunzeln nicht ganz verstecken konnte, rollte ich mich auf den Rücken und klopfte mir den Dreck von den Händen.
Billy, der Junge, der mich soeben zu Boden gestoßen hatte, grinste über beide Ohren.
Seine Latzhose – nun, mehr Loch als Stoff – hing ihm nur noch an einem Träger über die Schulter und auch an seinen nackten Füßen klebten Schlamm und Moos.
„Wir haben gewonnen“, rief er freudestrahlend.
„Natürlich haben wir das. Wir gewinnen immer.“
Vor uns baute sich ein zweiter Junge auf. Sein Kopf wirkte auf seinem langen, dünnen Hals etwas fehl am Platz und seine großen Ohren wurden gerade so von strohblondem Haar bedeckt.
„Hast du das gesehen, Alfred?“, rief Billy.
Der Blonde grinste, streckte die Hand aus und half seinem Freund auf die Beine. Dann reichte er mir die Hand, die ich dankbar lächelnd ergriff und mich ebenfalls von ihm aufhelfen ließ.
„Das war stark!“
Dabei klopfte Alfred Billy so kräftig auf die Schulter, dass dieser beinahe wieder zu Boden fiel. Ich kicherte und machte mich daran, die Kordel meines Kleids aus meinem Haar zu befreien.
„Ihr seid viel zu brutal. Wenn Mutter wüsste, dass ich wieder mit euch unterwegs bin...sie würde mich nie wieder aus dem Haus lassen.“
Ein Mädchen, das wesentlich eleganter gekleidet war als die Jungen, bückte sich nach meinem Korb und hob ihn vorsichtig auf. Ihr mit Rüschen besetztes Kleid reichte fast bis auf den Waldboden und ihre weiße Strumpfhose wies nicht einen Schlammspritzer auf. Die Locken des Mädchens wippten, als sie sich aufrichtete und ihre Augen blitzten uns trotzig entgegen.
„Tja, deine Mutter ist jetzt aber nicht hier, oder Stella?“, höhnte Alfred.
Ich schüttelte milde lächelnd den Kopf und nahm den Korb von ihr entgegen.
„Sei nicht so grob, Alfred“, tadelte ich ihn.
„Wir haben gewonnen, Hazel. Jetzt kriegen wir unseren Gewinn!“,
stieß Billy aus.
Ich verdrehte amüsiert die Augen und holte dann zwei Kuchenstücke aus meinem Korb. Die Augen der Jungen weiteten sich und auch Stella stellte sich auf die Zehenspitzen, um einen besseren Blick auf das Gebäck erhaschen zu können.
„Erdbeertörtchen“, seufzte Billy sehnsüchtig.
„Das nächste Mal mache ich es euch nicht so einfach“, sagte ich und reichte die Stücke an die beiden weiter.
„Das werden wir ja noch sehen!“
Schmatzend und winkend liefen die Jungen den Waldweg davon Richtung Dorf. Ich wandte mich Stella zu, die mich aus schüchternen Augen beobachtete. Als sie meinem Blick begegnete, erröteten ihre Wangen. Mein Lächeln wurde sanfter.
„Hier.“
Überraschung blitzte in ihren Augen auf, als ich auch ihr ein Stück reichte.
„Mutter sagt, ich darf nichts von Fremden annehmen“, nuschelte sie.
„Da hat sie Recht. Aber mich kennst du doch schon so lange, oder nicht? Und ich versichere dir, dass ich absolut nicht vorhabe, meinen Kuchen irgendwann mit Gift zu versetzen. Wer würde den denn dann noch kaufen wollen, hm?“
Ihre Mundwinkel zuckten, als sie schließlich doch die Hand ausstreckte und das Törtchen an sich nahm.
„Danke.“
Ich winkte ab und sah ihr nach, wie sie nun den beiden Jungen hinterherlief, auch diesmal darauf bedacht, ihr Kleid nicht über den Boden schleifen zu lassen. Noch während ich den Inhalt meines Korbes überprüfte, ertönten hinter mir erneut Schritte.
„Ich verstehe nicht, wie man sich auf dieses Gesindel einlassen kann.“
Innerlich verdrehte ich die Augen. Es gab nur eine Frau, die ihrer Stimme diesen Grad an Arroganz verleihen konnte.
Bedacht legte ich das Deckchen zurück über den Korb und wandte mich den beiden Frauen zu, die ich am ehesten zu meinen Freunden zählen konnte.
Isolde Staunton, strohblondes Haar, markante Kieferpartie und volle Lippen, die stets mit knalligem Lippenstift bemalt waren – selbst nachts. Sowohl an ihren Händen, als auch am Hals klimperten die unterschiedlichsten Ringe und Ketten und in ihrem ordentlich hochgesteckten Haar funkelten feine Haarspangen. Ihre jüngere Schwester Amanda war das komplette Gegenteil und waren die beiden einem fremd, würde man wohl kaum vermuten, sie wären in irgendeiner Weise miteinander verbunden.
Amandas Haar war pechschwarz und fiel ihr in langen Wellen über die Schultern. Der einzige Schmuck, den sie an sich trug, war ein goldener, breiter Ring, den sie einst von ihrer verstorbenen Großmutter geschenkt bekommen hatte.
Als Isolde und Amanda nun den Weg auf mich zukamen, warf letztere mir schon von weitem ein entschuldigendes Lächeln zu. Sie wusste, wie kompliziert ihre Schwester manchmal sein konnte.
Dies war wohl der Preis, den man zahlte, um in der Gesellschaft einen hohen Platz einzunehmen, selbst, wenn man nicht in eine reiche Familie geboren worden war.
„Dir auch einen guten Morgen, Isolde!“, rief ich ihnen entgegen.
Sie rollte nur mit den Augen, während ihr Blick abwertend an meinem Kleid herabglitt, das an einigen Stellen bereits mehrfach geflickt wurde, zu meinen nackten, dreckigen Füßen bis hin zu meinem strubbeligem Haar, das immer noch zur Hälfte mit meinem Kleid verknotet war.
„Ich sag immer, dass da nichts mehr zu machen ist. Verdorben, durch und durch“, sagte Isolde spitz.
Amanda kam zu mir und machte sich sogleich daran, mir mit der Kordel in meinem Haar zu helfen.
„Heute ist sie besonders gut gelaunt“, raunte sie mir zwinkernd ins Ohr.
„Tatsächlich? Ist mir gar nicht aufgefallen.“
Grinsend sahen wir uns an, bevor sie hinter mich trat und die Verschnürung an meinem Rücken wieder festigte.
„Danke.“
Amanda winkte ab und hakte sich bei mir ein, während wir zu dritt Richtung Markt aufbrachen. Ein feines Lächeln legte sich auf meine Lippen, als ich die Augen schloss und das Gesicht gen Himmel reckte.
Nicht eine Wolke weit und breit. Die Vögel sangen zwitschernd ihre Lieder, jagten sich von einem Zweig zum nächsten und stoben in Schwärmen aus den hohen Baumkronen, um dann in der Ferne immer kleiner zu werden.
Die Luft war erfüllt vom Summen der Bienen und dem Duft des Flieders, der links und rechts am Wegrand wuchs.
Die Luft war erfüllt von Sommer.
Ich konnte nicht beschreiben, wie sehr ich mich in diesen Ort verliebt hatte. Wie sehr ich es genoss, jeden Morgen in dieser friedlichen Idylle aufzuwachen und abends einzuschlafen. Ich wusste, dass sowohl Isolde, als auch Amanda davon träumten, einmal weit weg zu reisen. Sie wollten die Welt sehen, wollten erkunden und hatten große Pläne. Nun, jedenfalls Amanda.
Vor nicht allzu langer Zeit, als sie mich in meinem Zuhause besucht hatte, erzählte sie mir von ihrer heimlichen Leidenschaft, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Manchmal schlich sie sich früh morgens, wenn der Tau auf dem Gras noch nicht getrocknet war, aus dem Haus und stahl sich in den Wald, um zu jagen.
Kaninchen. Krähen. Tauben. Sogar ein Reh hatte sie einst geschossen.
Sie hatte Träume, große Träume.
Sie wollte an Turnieren teilnehmen und sich einen Namen im Bogenschießen machen.
Nein. Nicht nur irgendeinen Namen. Jeder sollte ihren Namen kennen.
Auch jenseits des großen Gebirgskamms, der sich rundum unser Land erstreckte.
Es war ein verbotener Gedanke. Einer, der nur allzu schnell mit dem Tod bestraft werden würde. Unser Land, das Land der Sterblichen, der Menschen, war ein sicherer und friedlicher Ort. Es gab zahlreiche Städte und Dörfer, Flüsse und Seen, prachtvolle Natur und wunderschöne Pflanzen. Es gab keinen Grund, sich zu wünschen, diesen Platz zu verlassen und gegen etwas Geheimnisvolles, womöglich etwas Finsteres, eintauschen zu wollen.
Denn das war es, was einen hinter den großen Bergen erwartete, die wie eine mächtige Mauer das Land der Menschen einschlossen.
Das Reich der toten Seelen. Der Dämonen. Der Hexer.
Das Reich des Todes selbst.
Ich konnte ihren Wunsch dennoch nachvollziehen, auch wenn ich ihn nicht für mich selbst hegte. Wenn ich solch eine gemeine Schwester hätte, die sich andauernd in den Vordergrund drängte, wäre ich wohl auch darauf erpicht, mir etwas zu suchen, in dem ich gut war und sie nicht.
Isolde hingegen wollte heiraten.
Das rieb sie jedem, der es hören wollte – oder eher zu höflich war, sie zu unterbrechen – unter die Nase und das schon seit sie vierzehn war. Es sollte die berauschendste Hochzeit werden, von der die Leute noch Jahre, ach was, Jahrzehnte danach sprechen würden. Sie würde das teuerste, weiße Kleid tragen und ihr Bräutigam wäre der begehrenswerte Gentleman, nach dem sich die Köpfe reihenweise umdrehten.
Nun, wenn es nach ihr ginge.
„Ich verstehe nicht, wieso du dich mit denen abgibst, Hazel.“
Ihre Stimme riss mich aus den Gedanken.
„Die Jungs sind sehr lieb. Und äußerst zuvorkommend“, erwiderte ich.
„Zuvorkommend? Du meinst wohl eher heruntergekommen“, schnaubte Isolde.
„Wenn du dir einmal die Mühe machen würdest, sie näher kennenzulernen, würdest du sehen, wovon ich spreche“, sagte ich leise.
Doch Isolde hörte mir schon gar nicht mehr zu. Sie war in einen angeregten Monolog über die störenden Raben vor ihrem Schlafzimmer vertieft, die sie viel zu früh aus dem Schönheitsschlaf rissen.
Amanda knuffte mir sanft in die Seite und nickte mit dem Kinn auf den Korb in meinen Armen.
„Womit versüßt du uns heute den Tag?“
Ich konnte mein stolzes Lächeln nicht verbergen und schlug die Decke an einer Seite zurück, damit sie einen Blick hinein werfen konnte. Ihre Augen leuchteten.
„Rieche ich da Erdbeeren?“, rief Isolde.
Amanda und ich kicherten und ich reichte sowohl ihr, als auch ihrer Schwester ein Stück des Kuchens. Unsicher sah Amanda mich an, während Isolde bereits herzhaft hinein biss.
„Bist du sicher? Die sind doch für den Markt...“
Wie bereits bei Stella winkte ich ab und nickte ihr beruhigend zu. Es stimmte, die Törtchen würde ich heute auf dem Marktplatz gegen ein paar Goldmünzen eintauschen. Wenn ich Glück hatte, verkauften sie sich so gut, dass ich mir am Ende des Monats vielleicht sogar neuen Garn für die löchrigen Stellen in meinem Kleid leisten konnte. Aber es machte mir nichts aus, ein paar von ihnen an meine Freunde zu verteilen.
„Wie war deine letzte Jagd, Amanda? Erfolgreich?“, fragte ich.
Isoldes abfälliges Schnauben ignorierte sie. Ihre Schwester war die Einzige neben mir, die von Amandas ungewöhnlichem Hobby wusste.
Zu meinem Erstaunen – und auch meiner Anerkennung geschuldet – hatte sie es nicht sofort ihren Eltern erzählt.
„Ich hab das Gefühl, es hat sich unter den Tieren herumgesprochen, dass ich diesen Wald zu meinem Jagdgebiet gemacht habe. Aber ich überlege, ob ich vielleicht dazu übergehe, an Attrappen zu üben.
Strohpuppen. Holzkisten. So was eben.“
„Ich kann dir ein paar leere Mehlsäcke geben. Wenn du sie mit Stroh füllst, sollten sie eine ideale Zielscheibe abgeben“, sagte ich.
Amanda strahlte mich an, während Isolde nur mit den Augen rollte.
„Ermutige sie nicht auch noch zu diesem Schwachsinn. Sie sollte lieber endlich etwas Anständiges machen.“
„So wie du, meinst du? Fremde Männer anschmachten und sich dabei blamieren?“, gab Amanda zurück.
Ich verkniff mir das Grinsen, als ich Isoldes eiskalten Blick sah.
„Ein anständiger Mann an deiner Seite würde dir gut tun, Schwesterherz. Und dir übrigens auch, Hazel.“
Ich verschluckte mich beinahe und hob beide Augenbrauen. Als ich auch noch Amandas Blick auf mir spürte, schüttelte ich entschieden den Kopf.
„Was soll ich denn mit einem Mann? Meine Hütte ist doch für zwei viel zu klein.“
„Das hat andere vor dir auch nicht aufgehalten, glaub mir“, murmelte Amanda.
„Was ist mit diesem Herzog, der seit neustem in die Stadt gezogen ist?
Wie war noch gleich sein Name?“, sagte Isolde.
Ich seufzte. Natürlich wusste ich, wen sie meinte. Und natürlich wusste ich auch, dass sie wusste, wie sein Name war.
Sie wollte es nur von mir hören. Die Bestätigung.
„Sein Name ist Harrington und er ist Lord, kein Herzog“, murmelte ich.
Die beiden Schwestern wechselten einen Blick, den ich wissentlich ignorierte. Für Isolde mochte es vielleicht kein spannenderes Thema als reiche Männer – unerreichbare Männer – zu geben, aber ich konnte mir definitiv schönere Gespräche vorstellen. In der Ferne tauchten bereits die ersten Dachspitzen auf und retteten mich so vor der Diskussion, die Isolde wohl schon auf der Zunge lag.
Es stimmte, es gab einen Lord in der nächsten großen Stadt nordöstlich von Telua. Und natürlich ging das nicht spurlos an den Bewohnern vorbei. Es war wahrscheinlich das Aufregendste, was seit Jahren hier passiert war.
Lord Harrington war kein gewöhnlicher Lord.
Er war einer der drei Lords, die der König des Sterblichen-Reiches selbst ausgewählt und zur persönlichen Leibgarde gekürt hatte.
Vor zwanzig Jahren, als jeder Zugang zum Reich des Todes abgeriegelt worden war, versprach König Jarvis für die Sicherheit jedes Sterblichen zu sorgen. Niemandem, der sich innerhalb des Tales aufhielt, würde etwas zustoßen. Die Menschen standen fortan unter dem Schutz der königlichen Leibgarde, die von drei klugen und kriegsbewanderten Männern geführt wurden – Lord Laximus, Lord Carrenbush und Lord Harrington.
Sie zogen von Stadt zu Stadt, um ihre Pflicht zu erfüllen. Für Sicherheit zu sorgen. Die Menschheit zu beschützen.
Manchmal fragte ich mich, wovor sie uns überhaupt beschützen sollten.
Seitdem alle Tunnel, die durch das Gebirge auf die andere Seite geführt hatten, verschlossen worden waren, hatte sich kein übermenschliches Wesen mehr in unser Reich verirrt. Dafür sorgten König Jarvis und seine Armeen. Und das nun schon seit zwanzig Jahren. Wieso die Tore, die unsere Länder vereint hatten, damals geschlossen wurden, wusste ich nicht.
Es gab Theorien, natürlich, und eine wilder als die andere. Doch wie viel Wahrheit wirklich in ihnen steckte, konnte ich nicht sagen.
Ich selbst war gerade einmal ein Jahr alt gewesen, als sie die Tunnel verschlossen hatten. Und Vater hatte es mir nie erzählt.
Normalerweise hätten Amanda und Isolde mich auch gar nicht auf dieses Thema angesprochen. Ich war nicht gerade dafür bekannt, bei den Männern beliebt zu sein. Nur leider war ich diejenige gewesen, die den Lord bereits zu Gesicht bekommen hatte und seitdem fing Isolde immer wieder damit an.
Wie sah er aus? Trug er wirklich so schicke Anzüge, maßgeschneidert und auf seine Augenfarbe abgestimmt, wie man es sich erzählte?
Seine Zähne sollen makellos sein, schneeweiß und ein wunderbares Lächeln.
Manchmal hatte ich das Gefühl, Isolde dachte, ich würde Lord Harrington bereits mein Leben lang kennen. Dabei hatte ich nur ein Wort mit ihm gewechselt und das auch nur, weil ich seiner Kutsche vor die Pferde gelaufen war und mich entschuldigen wollte.
Er hatte seinen Kopf aus dem Fenster gestreckt und mich in einer Mischung aus Belustigung und Verwirrung angesehen.
Braunes, lockiges Haar, auf dem ein schwarzer Zylinder thronte.
Ebenso braune, freundliche Augen, ein feines Grübchen und ein warmes Lächeln. Mehr hatte ich nicht von ihm gesehen, denn da hatte mich der Kutscher schon unter wütendem Fluchen aus dem Weg gescheucht.
Ich war mir sicher, dass der Lord sich nicht einmal mehr an diesen Zwischenfall erinnerte.
Der Marktplatz von Telua war genauso beschaulich, wie gemütlich.
Die Leute kamen nicht nur zum Handel und Verkaufen ihrer Waren hierher. Stundenlang unterhielten sie sich über Gott und die Welt; die Luft war erfüllt von Gelächter und dem Gackern der freilaufenden Hühnern, von denen keiner so recht wusste, zu wem sie gehörten.
Wenn man wusste, wo man zu suchen hatte, konnte man hier alles erwerben, was das Herz begehrte.
Geräucherten Lachs, süßen Honig, Fleischwurst, frisches Obst und Gemüse, feinsten Schmuck, wunderbare Stoffe, Kleider, Hüte, Handschuhe, Schwerter, Äxte und sogar aufgeregt schnatternde Enten.
Ich wusste, dass unser Markt nichts im Vergleich zu dem in der Stadt war und doch würde ich dieses Leben gegen nichts eintauschen wollen.
Der Duft von frisch gebackenen Brot wehte mir entgegen, als wir den matschigen Waldweg hinter uns ließen und das Kopfsteinpflaster betraten.
„Das riecht aber gut. Du wirst doch keine Konkurrenz bekommen, oder?“, sagte Amanda, als wir an der Auslage mit frischen Baguettes und Brot vorbeikamen.
Ich lachte und schüttelte den Kopf. Ganz bestimmt nicht. Es stimmte, es gab hier unter den Dorfbewohnern fantastische Bäcker, aber an die Kreationen, die ich mir Tag für Tag überlegte, reichten ihre Backkünste nicht heran.
Und das wussten die meisten auch – zu meinem Glück.
Ich wüsste nicht, wie ich mir sonst mein Leben draußen im Wald in meinem kleinen, aber heimischen Cottage leisten würde. Meine Leidenschaft lag nun einmal im Backen. Und in der Natur. Wenn es eines gab, was mich mehr faszinierte als das Mischen von Mehl und süßen Zutaten, dann Blumen.
Jeden Tag ging ich hinaus in meinen bunten, wilden Garten und pflückte einen neuen Strauß, den ich dann mit in mein Zimmer nahm.
„Komm Amanda. Ich will sehen, ob Mr. Dunkling das neue Kleid fertig hat, das er mir versprochen hat.“
Isoldes Stimme ließ keinen Widerspruch zu und als sie sich bei Amanda einhakte und Richtung Schneider zog, warf meine Freundin mir einen entschuldigenden Blick zu. Ich winkte ihnen hinterher und schlenderte hinüber zu meinem Stammplatz, an dem ich üblicherweise meinen Stand aufbaute.
Es war nicht viel, aber an guten Tagen brachte mir mein Gebäck mehr als zwanzig Goldtaler ein. Mein Stand bestand aus einem alten Werktisch, den mir der Tischler aus Telua großzügigerweise überlassen hatte.
Ich musste lächeln, als ich den großen Ahornbaum erblickte, der sich direkt hinter meinem Marktstand gen Himmel erstreckte.
Seine Zweige reichten weit über das Kopfsteinpflaster und boten mir und meinen Küchlein gerade im Sommer kühlenden Schatten.
„Guten Morgen, Hazel.“
„Guten Morgen.“
Die anderen Verkäufer nickten mir höflich zu, manch einer lächelte mir sogar entgegen, doch die meisten waren bereits tüchtig damit beschäftigt, ihre Ware zu bewerben und zu feilschen. Leise vor mich hin summend stellte ich den Korb neben meinen Tisch, zog die Decke zurück und faltete sie auseinander, sodass sie gerade so die Tischplatte abdeckte.
Neben den Erdbeertörtchen hatte ich mich noch an ein neues Rezept für Rosinen-Zimt-Plätzchen und Orangengelee-Taler gewagt.
Als alles auf dem Tisch seinen Platz gefunden hatte, pflückte ich eine Handvoll Gänseblümchen vom Fuße des Ahorn und verteilte sie dekorativ auf dem Stand. Zufrieden rieb ich mir die Krümel von den Händen und trat ein paar Schritte zurück, um mein Werk zu begutachten.
„Autsch.“
Erschrocken fuhr ich herum.
Meine Augen weiteten sich voller Unglaube.
Das konnte nicht sein, oder?
Hitze kroch in meine Wangen, als ich Lord Harrington anstarrte.
Dem Lord Harrington, dem ich soeben auf die Schuhe getreten war.
Dem ich schon wieder in den Weg gelaufen war.
„Verzeiht, Mylord. Das war keine Absicht“, beeilte ich mich zu sagen.
Lord Harrington hob den Kopf, seine braunen Augen trafen auf meine - und ein wissendes Lächeln breitete sich auf seinen Lippen aus.
Kapitel 2
-Hazel Goldwing -
„Ich glaube, wir kennen uns bereits.“
Lord Harringtons Stimme war anders, als ich erwartet hatte. Dort, wo ich die Härte eines Kriegers, die Strenge eines Anführers vermutet hätte, klang nichts als sanfte Wärme nach.
Wie ein milder Sommertag.
Blinzelnd starrte ich ihn an, nicht sicher, ob er gerade wirklich mit mir sprach. Als ich nicht antwortete, stieß er ein leises Lachen aus und trat näher. Ich sah den Dreck auf seiner Schuhspitze, den ich dort hinterlassen hatte und errötete noch mehr.
„Nun, wobei das Wort Kennen hier vielleicht etwas übertrieben ist.
Aber mir ist so, als wären wir uns schon einmal begegnet“, fuhr er fort.
Mein Blick huschte zurück zu seinem Gesicht. Sauber gestutzter Vollbart, freundlicher Blick und auch heute trug er einen Zylinder auf dem Kopf. In seiner Brusttasche seines braunen Anzugs steckte eine goldene Taschenuhr.
Er wirkte gar nicht wie ein berüchtigter Krieger.
Plötzlich war ich mir jedem einzelnen Loch in meinem Kleid bewusster denn je und beschämt versuchte ich den Matsch von meinen nackten Füßen abzustreifen.
„Verzeihung“, murmelte ich erneut.
Lord Harrington schenkte mir ein strahlendes Lächeln.
„Wofür entschuldigt Ihr Euch? Dafür, dass meine Kutsche Euch beinahe überfahren hätte oder für dieses freundliche Antlitz, in das ich gerade schauen darf?“
Überrascht öffnete ich den Mund. Was hatte er gerade gesagt?
„Für beides“, schloss ich schließlich.
Erneut stieß er ein Lachen aus.
„War das eine Frage, Mylady?“
Zögernd schüttelte ich den Kopf.
Er reckte den Hals und warf einen Blick an mir vorbei auf meine Auslage. Nervös knetet ich meine Hände, bevor ich nach einem der Plätzchen griff und es ihm hinhielt.
„Ich hoffe, Ihr mögt Rosinen.“
„Ich liebe Rosinen“, lächelte er.
Genüsslich biss er in das Plätzchen und verdrehte schmatzend die Augen. Sein entzücktes Stöhnen hallte über den Platz und die ersten neugierigen Köpfe drehten sich nach uns um. Ich gluckste hinter vorgehaltener Hand.
„Das sind...mhhh...die besten Plätzchen, die ich je gekostet habe“, stieß er aus, bevor er noch einen Schritt vortrat und sich ein weiteres nahm.
„Die Besten wage ich zu bezweifeln, Mylord. Aber ich habe monatelang an dem Rezept gefeilt. Wisst Ihr, es kommt manchmal nicht auf die Menge an, sondern die Art und Weise, wie man das Mehl mit der Butter vermischt. Und außerdem muss man darauf achten...“
Meine Worte verloren sich, als mir klar wurde, dass ich es schon wieder tat. Ich verlor mich in meinen Erzählungen. Hastig verstummte ich und senkte den Kopf.
„Verzeiht. Das war...langweilig.“
Ich spürte seinen Blick auf mir, bevor er sich wieder meinem Stand zuwandte.
„Wieso erzählt Ihr mir nicht etwas über diese überaus verführerischen Törtchen?“
Verwundert sah ich auf und folgte seinem Blick, der nun auf den Erdbeerstücken lag.
„Wie bitte?“
„Pflanzt Ihr die Erdbeeren selber an?“
Ungläubig musterte ich den Mann vor mir. Doch in seinem Gesicht konnte ich nichts als ernsthaftes Interesse erkennen und so entspannten sich meine Schultern allmählich wieder.
„Ja. Ja, ich habe einen wunderschönen Garten, in dem sie sehr viel Sonne abbekommen. Das ist gut für‘s Wachstum, wisst Ihr?“
„Tatsächlich? Tja, ich sage immer, man lernt nie aus, richtig?“, rief er und klatschte zufrieden in die Hände.
Ich lächelte verhalten.
„Jero! Jero, komm her und probier von diesen Keksen. Die musst du gegessen haben!“, rief Harrington.
Der Mann, der sich gerade noch über die Auslage an Dolchen und Messern des Schmiedes gebeugt hatte, hob nun den Kopf und sah zu uns herüber.
Er trug ein weißes Leinenhemd und eine weite, schwarze Stoffhose, die von einem breiten Gürtel geziert wurde. An diesem steckte nicht nur ein Langschwert, sondern auch mehrere Dolche und schmale Taschen.
Als er näher trat, hielt ich erschrocken die Luft an.
Eine Narbe, unsauber verheilt, zog sich von seinem linken Ohr über seine Wange und sein Kinn bis hin zu seinem Hals. Seine dunklen Augen fixierten erst Lord Harrington, dann mich und meine Auslage. Es schien, als würde er binnen eines Wimpernschlags seine ganze Umgebung auskundschaften. Eine solche Härte lag in seinem Gesicht, dass ich mir sofort sicher war, dieser Mann hatte noch nie in seinem Leben gelacht.
Geschweige denn gelächelt.
Sein Blick wanderte von meinem Stand zu mir. Er musterte meine dreckigen Füße, mein löchriges Kleid, wanderte höher und endete an meinem Gesicht. Nicht eine Regung. Die Wärme, die in Harringtons Augen fröhlich schimmerte, fand in seinen Augen keinen Platz.
„Hier, probiert von den Plätzchen“, rief Harrington und reichte dem Mann einen meiner Kekse.
Ohne den Blick von mir abzuwenden, legte er seine behandschuhte Hand auf Harringtons Arm und drückte ihn und den Keks aus seinem Blickfeld. Harrington stöhnte und rollte mit den Augen, während er mir zuzwinkerte.
„Ihr müsst wissen, Jero ist der Spielverderber schlechthin. Aber mein bester Mann, wenn nicht sogar der beste aus der ganzen Königsgarde.“
An Jero gewandt fügte er hinzu: „Und ein Rosinen-Taler wird ihn nicht gleich umbringen. Seht mich an, ich habe mehrere davon gegessen und erfreue mich ausgesprochen guter Gesundheit.“
„Ich sah weitaus stärkere und klügere Männer als mich an einfachem Gebäck sterben, Mylord. Nicht einfach nur sterben. Qualvoll krepieren, so langsam, dass genug Zeit blieb, um sich all seinen Fehlern im Leben bewusst zu werden“, sagte Jero kalt.
Ich schluckte. Verunsichert sah ich zwischen den beiden Männern hin und her. Harrington jedoch warf den Kopf in den Nacken, stieß ein herzhaftes Lachen aus und schlug Jero kräftig auf den Rücken. Dieser zuckte nicht einmal mit der Wimper. Sein harter Blick durchbohrte mich wie tausend Dolche.
„Jero nimmt seinen Platz in der Garde sehr ernst“, sagte Harrington.
Ich räusperte mich, nicht sicher, ob meine Stimme versagen würde oder nicht.
„Ich wüsste nicht, wieso meine Kekse jemanden umbringen sollten.“
„Kennt Ihr nicht die Geschichte um König Likos, der von seiner eigenen Magd getötet wurde? Ein einziger Krümel ihres Kuchens hätte gereicht, um die ganze Königsgarde auszulöschen“, sagte Jero.
Ich starrte ihn an. Seine Augenbraue zuckte, als wolle er sie hochziehen.
„Gift“, sagte er schließlich.
„Mag sein, dass der ehemalige König vergiftet worden ist, doch ich bin weder die Magd eines Königs, noch hege ich die Absicht, meine Kunden zu vergiften. Schlecht für‘s Geschäft, versteht Ihr?“, erwiderte ich.
Seine Kiefermuskeln zuckten.
Fast schon fühlte ich mich ein klein wenig stolz, dass ich es geschafft hatte, ihm eine Emotion zu entlocken. Es war Harrington, der das angespannte Schweigen schließlich brach. Er schob sich zwischen uns und drückte Jero den Keks in die Hand.
Mittlerweile war das halbe Dorf darauf aufmerksam geworden, dass Lord Harrington am Stand der jungen Bäckerin stand und sich anscheinend köstlich amüsierte. Eine Traube an Menschen versammelte sich nach und nach um meinen Stand und um davon abzulenken, dem Lord verstohlene Blicke zuzuwerfen, standen sie bei mir Schlange.
Jero warf mir einen letzten harten Blick zu, zerbröselte mit einer Hand meinen Keks und kehrte zum Stand des Schmiedes zurück.
Ich kam kaum hinterher, das Gebäck für all die Leute einzupacken und die Münzen in meinem Korb zu verstauen. Es war nicht einmal Nachmittag und schon hatte ich über die Hälfte meiner Ware verkauft. Voller Vorfreude dachte ich an die Stoffauslagen, mit denen ich mein Kleid ausbessern konnte.
In all der Zeit wich der Lord nicht einmal von meiner Seite.
Er blieb, unterhielt sich mit den Bewohnern, erzählte von seinen Reisen, die er schon unternommen hatte und genehmigte sich hier und da eines meiner Rosinen-Plätzchen. Als auch das letzte Törtchen verkauft war, stieß ich einen Seufzer der Erleichterung aus.
Ich hatte an einem Tag so viel Gold zusammenbekommen, wie ich es manchmal nicht einmal in einer Woche schaffte. Ich faltete gerade meine Decke zusammen, um sie zurück in den Korb zu legen, als mir eine Hand voller Goldtaler unter die Nase gehalten wurde.
Irritiert runzelte ich die Stirn.
„Ich glaube, ich schulde Euch noch etwas“, sagte Lord Harrington schmunzelnd.
Hastig winkte ich ab und trat einen Schritt zurück.
„Oh nein, das ist nun wirklich nicht nötig.“
„Doch. Ich denke, das ist es sehr wohl“, erwiderte er.
Und schon schloss er die Distanz zwischen uns, nahm meine Hände in seine und ließ das Gold langsam hineinfallen.
„Das kann ich nicht annehmen, Mylord“, sagte ich kopfschüttelnd.
„Wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.
Mein Name ist Henrik Harrington. Ich bin erst vor kurzem in die Gegend gezogen, wahrlich ein Paradies auf Erden, nicht wahr?“
Lächelnd nickte ich.
„Ja. Das ist es.“
Er erwiderte mein Lächeln und betrachtete mich aus warmen Blick.
„Und wie ist der Name dieser talentierten Bäckerin?“
Ich lachte.
„Hazel. Hazel Goldwing.“
„Hazel“, wiederholte er, als würde er sich den Namen unbedingt einprägen wollen.
„Es wird Zeit aufzubrechen, Mylord.“
Irritiert blinzelte ich. Seit wann war Jero zu uns zurückgekommen?
Eine Hand am Knauf seines Schwertes, den Blick in die Ferne gerichtet, stand er neben Harrington, während sich eine steile Furche auf seiner Stirn abzeichnete.
„So ungeduldig, mein Junge?“, grinste Harrington.
„Ihr vergesst, dass wir nicht hier sind, um Almosen zu verteilen, Mylord.“
Zornig funkelte ich Jero an.
Almosen? Für was hielt er mich, ein armes Bauernmädchen?
Irgendeine böse Stimme in meinem Kopf flüsterte, das ich genau so aussah.
„Hazel! Hazel!“
Der geladene Schleier, der mich, Lord Harrington und Jero umgab, wurde mit einem Hieb zerschnitten. Ich blinzelte und trat hastig einen Schritt zurück, als mir klar wurde, wie nah ich bei den Männern stand.
Isolde lief auf uns zu, mit gerafftem Kleid und glühendem Blick.
Amanda war ihr dicht auf den Fersen. Außer Atem kamen sie vor uns zum Stehen und während Amanda mir einen verwirrten Blick zuwarf, hatte Isolde natürlich nur Augen für den Lord.
Sie zupfte an ihrer Frisur herum, während sie mit ihren Wimpern klimperte und ein zuckersüßes Lächeln aufsetzte, das mich nur eine Augenbraue heben ließ. Amanda verkniff sich das Grinsen.
„Oh, entschuldigt. Ich wusste ja nicht, dass Hazel gerade in solch hoher Gesellschaft verkehrt“, flötete Isolde.
Ich musste mich zurückhalten, nicht die Augen zu verdrehen.
Natürlich hatte sie es gewusst. Wieso sonst wäre sie quer über den Marktplatz gerannt? Um mir beim Packen meiner Sachen zu helfen?
Wohl kaum.
Lord Harrington warf mir einen kurzen Blick zu, bevor er Isoldes Hand galant in seine nahm und einen Handkuss andeutete. Isolde kicherte. Es verging ihr jedoch recht schnell wieder, als er dieselbe Geste bei ihrer Schwester wiederholte.
„Es freut mich, Euch kennenzulernen, meine Damen. Ihr müsst wohl Freunde von Ms. Goldwing sein?“
„Hazel reicht vollkommen“, sagte ich rasch.
Er bedachte mich mit einem langen Blick, bevor Isolde seine Aufmerksamkeit mit einem Räuspern wieder auf sich zog.
„Isolde Staunton. Und Ihr müsst Lord Harrington sein. Wir haben schon viel von Euch gehört.“
Er hob die Augenbrauen.
„Nun, ich hoffe, nur Gutes.“
Isolde lachte.
Ein lautes, übertriebenes Lachen.
Amanda und ich tauschten einen kurzen Blick, bevor sie mir half, die Tischplatte von den letzten Krümeln zu befreien. Sie senkte die Stimme, sodass weder Isolde, noch Lord Harrington oder Jero uns hören konnten.
„Wieso hast du mir nichts davon erzählt?“
Sie klang fast ein bisschen gekränkt.
„Von was erzählt?“
Amanda sah mich ungläubig an und nickte dann unauffällig zu dem Lord hinter uns. Ich schüttelte den Kopf und wischte die Tischplatte ab, obwohl sie bereits sauber war.
„Da gibt es nichts zu erzählen, glaub mir. Ich habe ihn gerade erst kennengelernt. Es war...eher ein Unfall“, sagte ich achselzuckend.
„Ein Unfall also, hm?“, murmelte sie.
In dem Moment schaffte es Harrington, sich von Isolde loszueisen.
„Leider erwarten mich noch ein paar Gentleman zum Tee in der Stadt. Es war mir eine außerordentlich große Freude, Telua zu sehen.
Meine Damen.“
Er zog den Zylinder und neigte nacheinander vor uns den Kopf. Die letzte Verbeugung galt mir und als er den Blick wieder hob, zierten seine Lippen ein verschwörerisches Schmunzeln.
Als würden wir ein Geheimnis teilen, das die anderen nicht kannten.
In einer schwungvollen Drehung setzte er sich den Hut zurück auf den Kopf.
Dann drehte er sich um und bahnte sich einen Weg durch die schnatternden Hühner, die nach ein paar Körnern suchten. Jero würdigte uns keines Blickes mehr, als er seinem Lord über den Platz folgte. Erst, als er außer Hörweite war, wirbelte Isolde zu mir herum.
Mit einer Hand fächerte sie sich Luft zu.
„Also hatte ich Recht! Du kennst den Lord und du hast es mir verschwiegen. Uns verschwiegen!“
Ich hob abwehrend die Hände und setzte mich auf die Tischplatte, sodass meine Beine über den Rand baumelten.
„Isolde. Ich weiß genauso viel wie ihr über diesen Mann. Anscheinend ist er gerade erst in die Stadt gezogen. Wahrscheinlich wollte er sich nur mal die Gegend ansehen. Die Beine vertreten.“
„Die Beine vertreten?“, wiederholte Amanda skeptisch.
„Naja, das, was reiche Leute eben so tun“, lachte ich.
„Er ist ein reicher Mann, nicht wahr?“, sagte Amanda nachdenklich.
„Natürlich. Er ist einer der Lords der Königsgarde. Er muss ein halbes Vermögen besitzen“, sagte ich.
„Glaubt ihr, ihm ist mein neuer Ring aufgefallen?“, säuselte Isolde, die immer noch den Fleck anstarrte, an dem der Lord gerade noch gestanden hatte.
„Er hatte für nichts anderes Augen“, grinste ich und stupste Amanda mit dem Ellbogen an.
Mein Grinsen verflog jedoch schnell wieder, als ich den ernsten Ausdruck in ihren Augen bemerkte.
„Amanda?“
Zögernd sah sie mich an. Ich runzelte die Stirn und beugte mich vor, um meine Hand an ihren Arm zu legen. Ich spürte, dass sie mit sich selber rang. Während Isolde sich mal wieder in ein Selbstgespräch über neuen Schmuck verlor, drückte ich sanft Amandas Arm.
„Was ist los?“
Sie kaute unsicher auf ihrer Lippe herum.
„Du lachst mich aus“, sagte sie mit gesenkter Stimme.
Erstaunt riss ich die Augen auf.
„Das würde ich nie tun. Das weißt du, Amanda“, beharrte ich.
Wir zogen uns manchmal auf, machten unsere Späße, aber wenn es drauf ankam, hielten wir uns den Rücken frei. Das war schon immer so gewesen und das würde sich auch niemals ändern. Davon war ich überzeugt. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass es meiner Freundin da ähnlich ging. Dass sie jetzt plötzlich daran zweifelte, versetzte mir einen leichten Stich.
Doch das würde ich nicht zugeben.
Stattdessen wartete ich geduldig, dass sie weitersprach. Seufzend setzte sie sich neben mich auf den Tisch und legte ihren Kopf auf meine Schulter.
„Als Isolde vorhin beim Schneider war, da habe ich die Leute reden hören.“
Ich horchte auf.
„Über Lord Harrington?“
Amanda schüttelte an meiner Schulter den Kopf.
„Sie sagten, sie haben Gerüchte gehört. Gerüchte über gewisse Dinge, die nicht weit von hier geschehen.“
„Was für Dinge?“, fragte ich.
Amanda schluckte, als würden ihr die nächsten Worte im Hals steckenbleiben. Inzwischen war auch Isolde verstummt und lauschte unserem Gespräch.
„Hast du schon einmal etwas von den Todesboten gehört?“
„Du meinst diese Märchengeschichte, um Kindern Angst einzujagen?“
Amanda hob den Kopf von meiner Schulter und sah mich aus ernsten Augen an.
Ich runzelte die Stirn.
„Du glaubst doch nicht etwa daran, oder?“, sagte ich.
„Es ist bewiesen, dass Abgesandte des Todes selbst vor zwanzig Jahren in der großen Schlacht um die Reiche gekämpft haben sollen.
Todesboten, die mit dunklen Kräften auf die Menschen losgegangen sind. Es gab sie einst.“
„Ja, richtig. Einst. Todesboten gibt es doch schon lange nicht mehr.
Mag sein, dass der Tod noch ein paar Gefolgsleute jenseits des Bergkamms um sich scharrt, aber hier? In Telua?“
„Drüben in Avalol sollen zwei von ihnen gesichtet worden sein. Sie kamen nachts und plünderten das Haus eines Ehepaars. Die Frau konnte fliehen, weil ihr Mann sich zwischen sie und die Todesboten stellte. Sie rettete sich zu ihren Nachbarn, doch als die erfuhren, weshalb sie geflohen war, setzten sie sie gleich wieder vor die Tür.“
„Kein Wunder. Ich würde es nicht anders machen, wenn jemand vor meiner Haustür auftauchen würde, der von diesen Kreaturen heimgesucht wird. Jeder, der mit einem Todesboten in Kontakt war, ist verflucht, sag ich euch. Und das ein Leben lang“, warf Isolde ein.
Sie reckte stolz den Kopf und doch konnte ich den Anflug von Angst in ihren Augen sehen.
„Also ich weiß nicht. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen dieser Todesboten gesehen hat“, sagte ich langsam.
„Weil die meisten von ihnen es für sich behalten. Wer würde ihnen schon glauben? Und wenn sie doch den Mut aufbringen, sich ihren Freunden anzuvertrauen, ist es meisten schon zu spät“, sagte Amanda.
Isolde schluckte und fasste sich an den Hals. Ich sprang von der Tischkante und angelte nach meinem Korb. Das Gold klimperte fröhlich, als ich ihn hochhob.
„Was ist mit der Frau passiert, die von ihren Nachbarn verstoßen wurde?“, fragte ich.
„Sie ist zurück nach Hause. Hat sich durch den Hinterhof in die Küche geschlichen. Und dort...dort lag er.“
„Er?“
„Ihr Mann. Und die Fliesen waren nicht länger weiß...“
Isolde schlang sich die Arme um den Oberkörper. Zweifelnd sah ich Amanda an, während wir den Marktplatz langsam hinter uns ließen und den Heimweg antraten. Die Sonne stand schon tief am Himmel und warf lange Schatten auf den Waldweg.
„Weißt du, nach was das klingt? Nach einer unglücklichen Ehefrau, die mit dieser Horrorgeschichte versucht, den Mord an ihrem Mann zu vertuschen“, meinte ich schulterzuckend.
„Nimm das nicht auf die leichte Schulter, Hazel. Die Todesboten sind real und sie kommen näher. Vielleicht sind sie bereits unter uns und wir wissen es nur nicht“, stieß Amanda aus.
Isolde beäugte eine Gruppe Waschfrauen mit misstrauischem Blick und selbst ich ertappte mich dabei, wie ich sie nachdenklich musterte.
Dann schüttelte ich entschieden den Kopf und schlang einen Arm um Amanda und den anderen um Isolde.
„Wenn es so sein sollte, will ich es auch gar nicht wissen. Ich will jetzt nämlich nur eines“, grinste ich fröhlich.
„Ach ja?“
Mein Grinsen wurde breiter.
„Ich werde mir ein schönes Bad unten im Bach genehmigen, ein Feuer im Kamin machen und zur Feier des Tages einfach mal die Füße hochlegen.“
„Hoffentlich erst, nachdem du sie gewaschen hast“, kreischte Isolde.
Ich lachte und selbst Amanda stimmte mit ein.
Den restlichen Weg bis zur Gabelung, an dem sich unsere Wege trennen würden, redeten wir über alles, was uns gerade in den Sinn kam. Über neue Rezepte, feine Kleider und wir rätselten, ob Lord Harrington eine Gattin mit in die Stadt gebracht hatte oder nicht.
Als ich den beiden zum Abschied hinterher winkte und mit Gold gefülltem Korb den Pfad zu meinem Cottage einschlug, hatte ich die Gerüchte über Todesboten im Land der Sterblichen schon vergessen.
Kapitel 3
- Hazel Goldwing -
Das Cottage war mein schönster Besitz.
Vater hatte es mir vor seinem Tod vermacht.
Das Versprechen, immer gut darauf aufzupassen, war mir nicht schwer gefallen. Ich liebte alles daran. Umringt von Wald und Fluss fand es seinen Platz inmitten einer wilden Wiese aus hohem Gras, durch das ich mich im Hochsommer geradezu kämpfen musste. Nur der schmale Trampelpfad, der von der Pforte meines Gartens bis hin zum Waldweg führte, bewies, dass hier jemand wohnte und jeden Morgen das Haus verließ.
Vater hatte es sich damals zur Aufgabe gemacht, alles in seiner Macht stehende zu tun, um mir ein gutes Leben zu ermöglichen.
Früh morgens hatte er die kleine Einzimmerwohnung, in der wir damals gelebt hatten, verlassen und war runter zum Kutschendepot gegangen. Tag ein, Tag aus hockte er sich in die stickige, nach Öl und Holz riechende Lagerhalle und arbeitete an der Herstellung der neuen Kutschen, die eine direkte Verbindung zwischen Avalol, der Stadt des Süd-Ostens und der Hauptstadt im Westen, Prinzenherr, ermöglichen sollten. Es dauerte Jahre, bis sein Arbeitgeber, ein wohlhabender, arroganter Kerl aus dem Westen mit allem zufrieden gestellt war.
Zu diesem Zeitpunkt war Vater nicht mehr am Leben.
Doch seine harte Arbeit hatte sich ausgezahlt. Jedes Mal, wenn ich vom Markt nach Hause kam und meinen wunderschönen Garten, die weiße Fassade meiner Hütte und die vielen Schmetterlinge sah, die sich über den wilden Blumen sammelten, dachte ich an Vater und schickte ihm meinen stillen Dank. Nachdem Mutter uns kurz nach meiner Geburt verlassen und mich bei Vater zurückgelassen hatte, setzte dieser Mann alles daran, um für mich zu sorgen.
Manchmal beschlich mich der Gedanke, dass er gewusst hatte, dass er es nicht mehr erleben würde, mit mir zusammen in dieses Cottage zu ziehen. Als hätte er geahnt, dass er zwei Wochen vor dem Einzug versterben würde.
Für einen Moment schloss ich die Augen und reckte mein Gesicht der untergehenden Sonne zu.
Er tat es für mich.
Und jeden einzelnen Keks, den ich verkaufte, verkaufte ich für ihn.
Das hohe Gras kitzelte meine nackten Beine, als ich über die Wiese auf mein Gartentor zusteuerte. Wenn ich mich beeilte, war das Wasser unten am Fluss von der Sonne sicher noch ganz warm. Mit einem vorfreudigen Lächeln schob ich die Pforte auf und schlüpfte in meinen Garten.
Neben drei stolzen Erdbeerstauden fand sich hier auch ein Apfelbaum, ein Birnenbaum, dessen Ranken sich an die Hauswand schmiegten, ein Beet mit Kohl, Radieschen und Tomaten, Fliederbüsche, Hortensien und jede Art von Blumen, die man sich nur vorstellen konnte. Hier wuchs eine Rosenstaude empor, dort vermischte sich der Holunder mit dem Löwenzahn und direkt unter dem Küchenfenster bahnten sich die ersten Sonnenblumen ihren Weg an die Oberfläche.
Lächelnd strich ich über den wilden Farn, der neben dem Gartenzaun wuchs. Noch immer hatte ich es nicht übers Herz gebracht, ihn zu schneiden. Isolde hatte ihn einst als Unkraut bezeichnet und dass ihr persönlicher Gärtner sich „diesem Chaos“ nur zu gerne einmal annehmen würde.
Was ich niemals zulassen würde. Ich liebte das Chaos in meinem Garten.
Denn es war mein Chaos.
Mein Zuhause.
Und eher würde mich der Teufel holen, als dass ich eine fremde Hand an mein Zuhause lassen würde.
„Na ihr seid aber gewachsen.“
Beim Anblick des Goldlacks, dessen Blüten in den prächtigsten Gelb – und Lilatönen strahlten, konnte ich nicht anders, als mich zu bücken und ein paar der Blumen zu pflücken. Vorsichtig legte ich sie in den Korb, verscheuchte eine Hummel, die sich neugierig neben mich setzte und lief dann zur Tür.
„Ihr werdet einen wunderschönen Platz bekommen, das verspreche ich euch!“
Pfeifend stieß ich mit der Hüfte die Tür auf und betrat endlich das Cottage.
Im Prinzip bot es nicht viel mehr Platz als die alte Wohnung in der Stadt. Doch hier wurde ich nicht länger von meckernden Männern unter dem Fenster und dem Rollen der Kutschräder auf Stein geweckt.
Nein. Hier hörte ich zuerst den Wind, der durch die Bäume rauschte.
Hier konnte ich den Vögeln lauschen, die mich morgens mit ihrem ganz eigenen Lied begrüßten. Noch immer pfeifend schwang ich die Tür hinter mir zu, vollführte eine glückliche Drehung und stellte den Korb neben dem Spülbecken ab.
In meinem Cottage gab es genau einen Raum (abgesehen von der kleinen Toiletten-Kammer) und durch das große Fenster über der Küchenzeile fiel die Sonne direkt auf mein Bett und tauchte das ganze Zimmer in goldenes, warmes Licht. Jeden Morgen wachte ich in diesen herrlich weichen Kissen zu einem Sonnenaufgang auf, der mir immer wieder den Atem verschlug.
Es war ein Anblick, ein Gefühl, das ich für kein Gold dieser Welt eintauschen wollen würde.
An den Wänden hatten sich über die Jahre die verschiedensten Sachen angesammelt, von denen ich mich einfach nicht trennen konnte. Getrocknete Blumensträuße, Windspiele, Traumfänger, ein paar Kohlezeichnungen aus meiner Zeit, als ich versuchte, Blumen und Tiere auf Pergament einzufangen und eine Violine, auf der ich bis jetzt ein einziges Mal gespielt hatte.
Sie gehörte Vater.
Von der Decke hingen im Raum verteilt bunte Gläser, die ich vor zwei Jahren zu meinem achtzehnten Geburtstag von den Staunton-Schwestern geschenkt bekommen hatte. Mit einem Stück Tau und je einer Kerze ausgestattet, warfen sie jeden Abend tanzende Schattenspiele an die Wände.
Doch was ich noch mehr liebte als die Kerzen oder mein warmes Bett war der Kamin.
Im Winter konnte ich mich stundenlang mit einem Buch und einer Wolldecke in den Stuhl vor dem Feuer kuscheln, ohne dass mir langweilig wurde. Manchmal leistete Amanda mir dabei Gesellschaft und wenn wir heißen Kakao kochten und Kekse backten, wurde sogar Isolde vom Duft der frischen Plätzchen angelockt.
Ich griff nach dem Goldlack, füllte die Vase am Fenster mit frischem Wasser und stellte die Blumen zurück an ihren Platz. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne trafen die Blüten und brachten sie zum Leuchten. Diese Zeit am Tag war mir die liebste. Wenn der Abend anbrach und sich die Stille auf die Welt legte. Es hatte etwas Reines an sich.
Die nächsten zwei Stunden verbrachte ich damit, mein verdientes Gold in der Kaffeedose im Küchenschrank zu verstauen, zu fegen und einen letzten Schnitt am Birnenbaum vorzunehmen.
Dann beeilte ich mich hinunter zum Bach zu kommen.
Auch hier führte ein Pfad von platt getretenem Gras vom Cottage vorbei am winzigen Holzschuppen nebenan durch die Wiese bis hin zum Wald, durch den sich der Fluss schlängelte. Ich konnte das Plätschern schon von weitem hören und machte mich noch im Laufen daran, die Schnüre an meinem Kleid zu öffnen. Mit einer Hand band ich mir das Haar zusammen, mit der anderen streifte ich das Kleid von den Beinen. Genießerisch seufzte ich auf, als das warme Wasser meine Füße berührte.
Endlich.
Den ganzen Tag hatte ich darauf gewartet.
Ich wusch mir den Dreck von den Beinen, entknotete die letzten Strähnen meines Haares und ließ mich schließlich ganz ins Wasser gleiten. Der Sonnenuntergang tauchte die Szenerie in goldenes, rotes Licht. Der Wald schien in Flammen zu stehen und das Wasser glänzte in einem warmen Orangeton.
Ich schloss die Augen und ließ mich eine Weile treiben. So, wie es meine Gedanken taten.
Sie schweiften zum heutigen Markt und das, was dort geschehen war.
Unwillkürlich musste ich lachen.
Ein Lord, einer der drei Lords der Königsgarde, war hier.
Hier in unserem kleinen Dorf Telua, in dem es mehr Hühner als Menschen gab. Lord Henrik Harrington und sein grimmiger Begleiter Jero. In Gedanken spielte ich unsere Konversation noch einmal ab, doch ich konnte einfach nicht begreifen, wieso Jero mich hasste.
Denn das war es, was ich in seinen Augen gesehen hatte.
Ich war mir sicher.
Bodenloser Hass.
Ich seufzte und räkelte mich im warmen Wasser.
Wahrscheinlich hatte ich mir diesen ganzen Tag nur eingebildet.
Lord Harrington würde sich niemals so lange mit einem Bäckers-Mädchen unterhalten, das sich nicht einmal ein anständiges Kleid leisten konnte. Er war Anführer einer Armee, starker Krieger. Er hatte gewiss wichtigere Dinge zu tun als auf dem Markt Kekse zu naschen.
Und doch hatte ich heute so viele Goldtaler verdient, wie schon seit langem nicht mehr.
Dank ihm.
Dank Lord Hendrik Harrington.
Abermals entfloh mir ein Lachen, bevor ich die Augen wieder aufschlug und mich auf den Bauch drehte. Das Wasser umspielte meine Brüste, meinen Bauch und genüsslich reckte ich meinen Rücken der letzten Sonne entgegen. So ließ es sich aushalten. So konnte ich - Ich hielt inne.
Was war das?
Dieses merkwürdige Kribbeln in meinem Nacken.
Ich wagte es nicht mich zu bewegen, horchte in mich hinein und versuchte das seltsame Gefühl einzuordnen. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Das Kribbeln wurde stärker, drängte mich dazu, mich umzudrehen.
Jemand beobachtete mich.
Ich wusste es genau.
Spürte es genau.
Ich war nicht länger alleine.
Mein Blick huschte hinüber zum Ufer, an dem mein Kleid lag.
Mit einer Hand bedeckte ich meinen Oberkörper, bevor ich mich auf der flachen Flussstelle aufsetzte. Nervös starrte ich hinüber zu den Bäumen. Die Sonne war nun fast hinter den letzten Wipfeln verschwunden.
„Amanda? Isolde? Wenn ihr das seid, ist es euch gelungen, ja? Ich habe mich erschreckt!“, rief ich mit bemüht ruhiger Stimme.
Ich schwamm hinüber zum Ufer, ohne die dunklen Stellen des Waldes außer Sicht zu lassen.
Irgendwo in der Nähe knackte ein Zweig und ich zuckte so heftig zusammen, dass ich beinahe den Halt verlor. Hastig stieg ich aus dem Wasser und verzichtete ausnahmsweise darauf, mich von der Sonne trocknen zu lassen.
Ich streifte mir mein Kleid über, stolperte dabei beinahe über meine eigenen Füße und bahnte mir rasch einen Weg durch die Bäume bis hin zu meinem Cottage.
Erst, als ich den Garten erreichte, ließ das Kribbeln nach. Hörbar atmete ich aus, während die Anspannung aus meinen Schultern wich.
Ich schloss die Pforte hinter mir und warf einen letzten Blick hinüber zu den Bäumen.
Mein Herz setzte aus. Mein Atem stockte. Hatte sich da gerade etwas im Wald bewegt? Ein Schatten?
Ein Schatten so groß wie ein...Mensch?
Ich blinzelte. Und der Schatten war verschwunden.
„Naja, vielleicht stand ich doch etwas zu lange in der Sonne heute“, murmelte ich.
Ja, das musste es sein. Meine Sinne spielten mir bloß einen Streich, mehr nicht.
Sobald die Sonne ihren Platz mit Mond und Sternen tauschte, kroch eine Kälte über das Land, die mich sogar dazu brachte, ein Feuer im Kamin zu entfachen. Mit einem Buch und einer heißen Tasse Tee bewaffnet kuschelte ich mich in meinen Stuhl vor dem Feuer und versuchte mich auf andere Gedanken zu bringen. Doch immer wieder ertappte ich mich dabei, wie mein Blick hinüber zum Fenster huschte, hinter dem die Sterne meinen Apfelbaum und den Holunderstrauch in weißem Glanz erleuchteten.
Ich nahm einen tiefen Atemzug, erhob mich und ging hinüber zur Tür. Es war das dritte Mal an diesem Abend, dass ich den schweren Holzriegel überprüfte, den ich nachts vor die Eingangstür schob.
„Du bist einfach zu paranoid, Hazel“, sprach ich mir selbst zu.
Kopfschüttelnd wandte ich mich ab und setzte mich zurück ans Feuer.





























