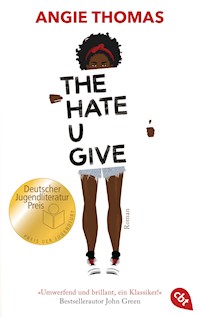
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Umwerfend und brillant, ein Klassiker!« Bestsellerautor John Green
Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welten: in dem verarmten Viertel, in dem sie wohnt, und in der Privatschule, an der sie fast die einzige Schwarze ist. Als Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen von einem Polizisten erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Khalil war unbewaffnet. Bald wird landesweit über seinen Tod berichtet; viele stempeln Khalil als Gangmitglied ab, andere gehen in seinem Namen auf die Straße. Die Polizei und ein Drogenboss setzen Starr und ihre Familie unter Druck. Was geschah an jenem Abend wirklich? Die Einzige, die das beantworten kann, ist Starr. Doch ihre Antwort würde ihr Leben in Gefahr bringen...
Angie Thomas bei cbj & cbt:
The Hate U Give
On The Come Up
Concrete Rose
Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Angie Thomas
Aus dem Amerikanischen
von Henriette Zeltner
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Angela Thomas
Published by Arrangement with Angela Thomas
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Hate U Give« bei Balzer + Bray,
an Imprint of HarperCollins Publishers, New York.
© 2017 für die deutschsprachige Ausgabe by
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Amerikanischen von Henriette Zeltner
Lektorat: Antje Steinhäuser
Umschlaggestaltung: Init GmbH
Umschlagmotiv: Jacket art © 2017 by Debra Cartwright Jacket design by Jenna Stempel
he · Herstellung: AnG
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20014-5V010
www.cbj-verlag.de
Für Grandma, die mir gezeigt hat,
dass es in der Dunkelheit auch Licht geben kann.
Teil 1
ALS
ES PASSIERT
Kapitel 1
Ich hätte nicht auf diese Party gehen sollen.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da überhaupt hingehöre. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mich für was Besseres halte. Es gibt nur einfach ein paar Orte, wo es nicht reicht, ich selbst zu sein. Wo keine Version von mir reicht. Die Spring-Break-Party von Big D ist einer davon.
Ich quetsche mich zwischen schwitzenden Körpern durch und folge Kenya mit ihren wippenden Locken. Der Raum liegt wie im Nebel, es riecht nach Gras und die Musik bringt den Fußboden zum Vibrieren. Irgendein Rapper fordert jeden auf, Na-Naa zu singen, darauf folgen ein paar »Heys«, weil die Leute sich ihre eigene Version ausdenken. Kenya hält ihren Becher hoch und tänzelt durch die Menge. Bei dem Kopfweh von der scheißlauten Musik und der Übelkeit von dem Grasgestank würde es mich wundern, wenn ich es durch den Raum schaffe, ohne meinen Drink zu verschütten.
Wir lösen uns aus der Masse. Big Ds Haus ist knallvoll. Ich wusste schon, dass – nun ja, außer mir – echt alles, was laufen kann, zu seinen Spring-Break-Partys kommt, aber, verdammt, ich habe nicht gedacht, dass es so viele sind. Die Mädchen tragen ihre Haare getönt, gelockt, gelegt und geglättet. Deshalb fühle ich mich mit meinem Pferdeschwanz auch total basic. Jungs in ihren saubersten Sneakern und Saggy Pants raspeln so eng an den Mädchen entlang, dass sie fast ein Kondom bräuchten. Meine Nana pflegt zu sagen, der Frühling bringt die Liebe. In Garden Heights bringt er zwar nicht immer Liebe, dafür verspricht er aber Babys im Winter. Sollte mich nicht wundern, wenn eine Menge davon in der Nacht von Big Ds Party gezeugt würden. Er veranstaltet sie immer am Freitag der Ferien, weil man den Samstag zum Erholen braucht und den Sonntag fürs Bereuen.
»Hör auf, mir nachzulaufen, und geh tanzen, Starr«, sagt Kenya. »Die Leute sagen sowieso schon, du denkst wohl, du wärst was Besseres.«
»Wusste gar nicht, dass in Garden Heights so viele Gedankenleser wohnen.« Oder dass man mich als was anderes wahrnimmt als »Big Mavs Tochter, die im Laden aushilft«. Ich nippe an meinem Drink und spucke ihn wieder zurück in den Becher. Mir war schon klar, dass da mehr als Hawaii-Punsch drin ist, aber dieses Zeug ist viel stärker, als ich es gewohnt bin. So was sollte man überhaupt nicht Punsch nennen. Das ist schlicht harter Sprit. Während ich den Becher auf den Couchtisch stelle, sage ich zu ihr: »Leute, die meinen, sie wüssten, was ich denke, gehen mir auf den Zeiger.«
»Hey, ich sag’s dir ja nur. Du benimmst dich, als würdest du keinen kennen, bloß weil du auf diese Schule gehst.«
Das höre ich jetzt schon sechs Jahre. Seit meine Eltern mich in die Williamson Prep schicken. »Egal«, murmle ich.
»Und es würde dich auch nicht umbringen, wenn du dich nicht …«, sie rümpft die Nase und mustert mich von den Sneakern bis zu meinem Oversize-Hoodie, »… so anziehen würdest. Ist das nicht der Hoodie von meinem Bruder?«
Von unserem Bruder. Kenya und ich haben einen gemeinsamen älteren Bruder, Seven. Aber sie und ich, wir sind nicht verwandt. Ihre Momma ist auch Sevens Momma, und mein Dad ist auch Sevens Dad. Verrückt, ich weiß. »Ja, der gehört ihm.«
»Klar. Und weißt du, was die Leute noch sagen? Du hast es echt schon so weit gebracht, dass man dich für mein Girlfriend hält.«
»Seh ich so aus, als würde es mich kümmern, was die Leute denken?«
»Nein. Und genau das ist das Problem!«
»Mir egal.« Hätte ich gewusst, dass Mitgehen auf die Party so was bedeutet wie eine Folge von Extreme Makeover – Das Umstyling von Starr Carter, dann wäre ich gleich zu Hause geblieben und hätte mir im Fernsehen Wiederholungen von Der Prinz von Bel-Air angeschaut. Meine Jordans sind bequem und verdammt noch mal neu. Das ist immerhin etwas. Der Hoodie ist zwar viel zu groß, aber ich mag das. Außerdem rieche ich das Gras nicht so, wenn ich ihn mir über die Nase ziehe.
»Na schön, ich werde jedenfalls nicht den ganzen Abend deinen Babysitter spielen, also überleg dir gefälligst was«, sagt Kenya und lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Kenya könnte ein Model sein, und das meine ich total ernst. Sie hat makellose dunkelbraune Haut – ich glaube, sie kriegt nie auch nur einen einzigen Pickel –, braune Mandelaugen und lange Wimpern, die nicht gekauft sind. Sie hätte auch die perfekte Größe zum Modeln, ist aber ein bisschen dicker als diese Zahnstocher auf den Catwalks. Nie trägt sie ein Outfit zweimal. Dafür sorgt ihr Daddy King.
Kenya ist ungefähr der einzige Mensch aus Garden Heights, mit dem ich abhänge. Ist ja auch nicht so einfach, Freunde zu finden, wenn du in eine Schule gehst, die fünfundvierzig Minuten entfernt ist, und du ein Schlüsselkind bist, das man nur im Laden seiner Familie antrifft. Mit Kenya was auszumachen, ist wegen unserer gemeinsamen Verbindung zu Seven einfach. Trotzdem ist sie manchmal höllisch schwierig. Immer streitet sie mit irgendwem und sagt schnell mal, ihr Daddy würde jemandem den Arsch versohlen. Das stimmt zwar, aber ich wünschte mir trotzdem, sie würde aufhören, immer Streit zu suchen, nur damit sie ihre Trumpfkarte zücken kann. Verdammt, ich könnte das ja auch. Jeder weiß, dass man sich mit meinem Dad, Big Mav, besser nicht anlegt, und definitiv nicht mit seinen Kids. Trotzdem gehe ich nicht rum und mache solchen Bullshit.
Zum Beispiel schaut sie auf Big Ds Party Denasia Allen an, als wäre die Abschaum. Ich weiß nicht mehr viel über Denasia, ich erinnere mich nur noch, dass sie und Kenya sich praktisch seit der vierten Klasse nicht ausstehen können. Heute Abend tanzt Denasia mit irgendeinem Typen auf der anderen Seite des Raums und achtet überhaupt nicht auf Kenya. Aber egal, wo wir hingehen, sobald Kenya Denasia erspäht, starrt sie sie wütend an. Und das Blöde an dieser Glotzerei ist ja, dass du es irgendwann spürst. Das ist dann sozusagen die Einladung, jemandem einen Arschtritt zu verpassen oder selber einen zu kassieren.
»Aah! Ich halt die nicht aus«, zischt Kenya. »Letztens standen wir in der Schulcafeteria in der Schlange, ja? Und sie hinter mir, verrenkt sich den Hals und tuschelt. Sie hat meinen Namen nicht genannt, aber ich wusste, dass sie mich meinte. Jedenfalls hat sie behauptet, ich hätte versucht, was mit DeVante anzufangen.«
»Echt jetzt?«, sage ich, weil mir sonst nichts einfällt.
»Mhm. Aber ich will ihn gar nicht.«
»Klar.« Ganz ehrlich? Ich weiß nicht mal, wer DeVante ist. »Also, was hast du gemacht?«
»Was glaubst du denn? Ich hab mich umgedreht und sie gefragt, ob sie ein Problem mit mir hat. Alter Trick, dann zu kommen mit ›Ich hab gar nicht von dir gesprochen‹. Dabei wusste ich, dass sie genau das gemacht hat! Du hast so ein Glück, dass du auf diese Weißen-Schule gehst und dich mit solchen Schlampen nicht abgeben musst.«
Ist das nicht total bescheuert? Vor nicht mal fünf Minuten wurde ich noch für eingebildet gehalten, weil ich auf die Williamson gehe. Und jetzt ist das mein Glück? »Glaub mir, an der Schule gibt’s auch Schlampen. Die hast du einfach überall.«
»Pass mal auf, heute Abend erledigen wir sie.« Kenyas Killerblick wird noch tödlicher. Denasia spürt ihn und schaut Kenya direkt an. »Aha«, bestätigt Kenya, als könne Denasia sie auf die Entfernung hören. »Jetzt pass auf.«
»Moment mal. Wir? Hast du mich deshalb angebettelt, auf diese Party zu kommen? Damit du noch jemand in deiner Mannschaft zum Auswechseln hast?«
Sie traut sich tatsächlich, ein beleidigtes Gesicht zu ziehen. »Als ob du was Besseres zu tun gehabt hättest! Oder irgendwen anderen zum Abhängen. Ich tu dir doch bloß einen Gefallen damit.«
»Ach ja, Kenya? Du weißt aber schon, dass ich Freunde habe, oder?«
Sie verdreht die Augen. Aber wie. So, dass ein paar Sekunden lang nur das Weiße zu sehen ist. »Diese kleinen Spießermädchen von deiner Schule zählen nicht.«
»Das sind keine Spießermädchen und sie zählen wohl.« Glaube ich. Zwischen Maya und mir läuft es cool. Wie es zwischen mir und Hailey steht, da bin ich mir gerade nicht so sicher. »Und ganz ehrlich? Wenn du mir zu mehr Anschluss verhelfen willst, indem du mich in einen Streit reinziehst, dann danke nein. Mein Gott, du musst immer so ein Drama veranstalten.«
»Ach bitte, Starr!« Sie zieht das »bitte« extra in die Länge. Zu sehr. »Das hab ich mir überlegt: Wir warten, bis sie sich von DeVante entfernt, ja? Und dann können wir …«
Mein Handy vibriert an meinem Oberschenkel und ich werfe einen Blick aufs Display. Seit ich seine Anrufe ignoriere, schickt Chris mir stattdessen Nachrichten.
Können wir reden?
Ich wollte nicht, dass es so läuft.
Klar, dass nicht. Gestern dachte er nämlich, es würde total anders laufen. Genau das ist ja das Problem. Ich schiebe das Handy zurück in die Tasche. Was ich antworten werde, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall kümmere ich mich erst später darum.
»Kenya!«, schreit jemand.
Das große hellhäutige Mädchen mit Haaren, die wie gebügelt aussehen, schiebt sich durch die Menge auf uns zu. Ein großer Typ mit schwarz-blondem Afro-Irokesen folgt ihr. Beide umarmen Kenya und versichern ihr, wie süß sie aussieht. Ich existiere nicht mal.
»Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass du herkommst?«, sagt das Mädchen und schiebt sich ihren Daumen in den Mund. Davon hat sie schon einen Überbiss. »Du hättest doch bei uns mitfahren können.«
»Nee. Ich musste noch Starr abholen«, sagt Kenya. »Wir sind zusammen hergelaufen.«
Erst da nehmen sie mich zur Kenntnis, obwohl ich nur eine Handbreit neben Kenya stehe.
Der Junge kneift die Augen leicht zusammen und mustert mich von oben bis unten. Nur eine Millisekunde lang runzelt er die Stirn, aber ich hab’s trotzdem gesehen. »Bist du nicht Big Mavs Tochter, die im Laden arbeitet?«
Was hab ich gesagt? Die Leute tun so, als wäre das der Name auf meiner Geburtsurkunde. »Genau. Die bin ich.«
»Ohhhh!«, macht das Mädchen. »Ich wusste doch, dass ich dich kenne. Wir waren zusammen in der Dritten. In der Klasse von Ms. Bridges. Ich saß hinter dir.«
»Oh.« Jetzt sollte ich mich wohl an sie erinnern, tue ich aber nicht. Wahrscheinlich hat Kenya doch recht – eigentlich kenne ich keinen mehr. Ihre Gesichter sind irgendwie vertraut, aber man kriegt ja die Namen und Lebensgeschichten von Leuten nicht mit, bloß weil man ihre Lebensmittel in eine Tüte packt.
Dann lüge ich eben. »Stimmt, ich erinnere mich auch an dich.«
»Mädel, lass das Lügen«, sagt der Typ. »Du weißt genau, dass du ihre Visage nicht kennst.«
»Why you always lying?«, stimmen Kenya und das Mädchen den aktuellen Song von Nicholas Fraser an. Der Typ fällt auch noch mit ein und dann prusten sie alle vor Lachen.
»Bianca und Chance, seid jetzt mal nett«, sagt Kenya schließlich. »Das hier ist Starrs erste Party. Ihre Familie lässt sie nirgends hin.«
Ich werfe ihr einen demonstrativen Blick von der Seite zu. »Ich gehe aber auf Partys, Kenya.«
»Habt ihr sie hier schon mal auf irgendeiner Party gesehen?«, fragt Kenya.
»Nope!«
»Eben. Und bevor du damit kommst, Vorstadtpartys von kleinen, langweiligen weißen Kids zählen nicht.«
Chance und Bianca kichern. Verdammt, ich wünschte, dieser Hoodie könnte mich auf der Stelle komplett verschlucken.
»Ich wette, die werfen Molly und solchen Scheiß ein, was?«, fragt Chance mich. »Weiße Kids lieben es ja, Pillen zu schlucken.«
»Und dazu hören sie Taylor Swift«, fügt Bianca hinzu, an dem Daumen in ihrem Mund vorbei.
Okay, damit liegen sie zwar nicht ganz daneben, aber das werde ich bestimmt nicht zugeben. »Nö, eigentlich sind ihre Partys ziemlich cool«, sage ich. »Einmal hatte dieser Junge J. Cole für einen Auftritt auf seiner Geburtstagsparty da.«
»Verdammt. Echt jetzt?«, fragt Chance. »Shiiit, Girl, das nächste Mal nimmst du mich mit. Dafür mach ich auch mit weißen Kids Party.«
»Wie auch immer«, geht Kenya laut dazwischen. »Wir haben gerade davon gesprochen, uns Denasia vorzuknöpfen. Die Bitch tanzt da drüben mit DeVante.«
»Alte Schlampe«, nuschelt Bianca. »Du weißt, dass sie sich über dich das Maul zerreißt? Das war letzte Woche im Unterricht von Mr. Donald, als Aaliyah mir erzählt hat –«
Chance verdreht die Augen. »Uaaah! Mr. Donald.«
»Du bist doch bloß sauer auf den, weil er dich rausgeschmissen hat«, sagt Kenya.
»Na klar, verdammt!«
»Wie auch immer, Aaliyah hat mir jedenfalls –«, setzt Bianca noch mal an.
Ich höre nicht mehr hin, während es um Klassenkameraden und Lehrer geht, die ich nicht kenne. Dazu habe ich nichts beizutragen. Macht aber nichts. Ich bin sowieso unsichtbar.
Das geht mir hier oft so.
Während sie sich noch über Denasia und ihre Lehrer beklagen, sagt Kenya irgendwas von wegen ›neuen Drink besorgen‹, und alle drei ziehen ohne mich davon.
Plötzlich bin ich wie Eva im Paradies, nachdem sie diese Frucht gegessen hat – als würde mir plötzlich klar, dass ich nackt bin. Ich bin allein auf einer Party, auf der ich eigentlich nicht sein sollte und kaum jemanden kenne. Und die Person, die ich tatsächlich kenne, hat mich gerade stehengelassen.
Kenya hat mich wochenlang bearbeitet, mit auf diese Party zu gehen. Ich wusste, dass ich mich total unwohl fühlen würde, aber jedes Mal, wenn ich Kenya das erklärte, sagte sie, ich würde mich aufführen, als sei ich »zu gut für eine Garden-Heights-Party«. Ich war es irgendwann leid, mir diesen Shit anzuhören und beschloss, ihr zu beweisen, dass sie unrecht hat. Das Problem ist nur, es hätte Black Jesus gebraucht, um meine Eltern davon zu überzeugen, mich da hingehen zu lassen. Jetzt muss Black Jesus mich retten, falls sie rauskriegen, dass ich hier bin.
Ein paar Leute schauen zu mir rüber und haben dabei einen Blick, der sagt: »Wer ist denn die da drüben, die so lahm allein an der Wand lehnt?« Ich schiebe die Hände in meine Hosentaschen. Solange ich die Coole spiele und für mich bleibe, sollte es einigermaßen gehen. Aber der Witz an der Sache ist, dass ich an der Williamson gar nicht die Coole spielen muss – da bin ich als eine der wenigen schwarzen Kids automatisch cool. Mir Coolness in Garden Heights zu verdienen, ist dagegen schwerer, als Retro-Jordans an dem Tag zu ergattern, wenn sie in die Läden kommen.
Trotzdem komisch, wie das mit den weißen Kids läuft. Es ist cool, schwarz zu sein, bis es schwer wird, schwarz zu sein.
»Starr!«, höre ich da eine vertraute Stimme.
Das Meer der Gäste teilt sich für ihn, als wäre er ein Moses mit brauner Haut. Jungs hauen ihre Faust gegen seine, Mädchen verrenken sich den Hals, um einen Blick zu ergattern. Er lächelt mich an und seine Grübchen ruinieren seine ganze Gangster-Aura.
Khalil ist heiß. Kann man nicht anders sagen. Und ich hab früher mit ihm gebadet. Nicht so, sondern damals, als wir noch rumkicherten, weil er einen ›Pippi‹ hatte und ich eine ›Pippa‹, wie seine Grandma das nannte. Ganz ehrlich, das hatte überhaupt nichts Perverses.
Er umarmt mich und riecht nach Seife und Babypuder. »What’s up, Girl? Hab dich schon ewig nicht gesehen.« Er lässt mich wieder los. »Du schreibst keine Nachrichten, nix. Wo hast du gesteckt?«
»Hab viel mit der Schule und dem Basketballteam zu tun«, sage ich. »Aber ich bin ja immer im Laden. Du bist derjenige, den man nicht mehr sieht.«
Seine Grübchen verschwinden, und er reibt sich über die Nase, wie er das immer macht, bevor er lügt. »Hatte zu tun.«
Anscheinend. Die brandneuen Jordans, das strahlend weiße T-Shirt, die Diamanten in seinen Ohren. Wenn du in Garden Heights aufwächst, weißt du, was »zu tun haben« bedeutet.
Fuck. Ich wünschte, er hätte nichts in dieser Art zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich in Tränen ausbrechen oder ihm eine scheuern soll.
Aber so, wie Khalil mich mit seinen Haselnuss-Augen ansieht, kann ich ihm kaum böse sein. Ich fühle mich, als wäre ich wieder zehn, stünde im Keller der Christ Temple Church und würde ihn in der Ferien-Bibel-Schule zum ersten Mal küssen. Plötzlich fällt mir wieder ein, dass ich einen schlabbrigen Hoodie anhabe, nach nichts aussehe … und dass ich eigentlich auch einen Freund habe. Zwar antworte ich gerade nicht auf die Anrufe und Nachrichten von Chris, aber er gehört immer noch mir, und ich will auch, dass das so bleibt.
»Wie geht’s deiner Grandma?«, frage ich. »Und Cameron?«
»Sind okay. Grandma ist allerdings krank.« Khalil nippt an seinem Becher. »Die Ärzte sagen, sie hat Krebs oder so.«
»Mist. Tut mir leid, K.«
»Hmhmm, sie kriegt Chemo. Sorgen macht sie sich nur, weil sie sich eine Perücke besorgen muss.« Er lacht gekünstelt; diesmal ohne Grübchen. »Sie wird’s schon schaffen.«
Das ist eher ein Gebet als eine Prophezeiung. »Hilft deine Momma mit Cameron?«
»Die gute alte Starr. Immer noch auf der Suche nach dem Guten im Menschen. Du weißt genau, dass sie nicht hilft.«
»Hey, war nur eine Frage. Letztens war sie mal im Laden. Sie sieht besser aus.«
»Zurzeit«, sagt Khalil. »Sie behauptet, sie würde versuchen, clean zu werden, aber es ist nur das Übliche. Ein paar Wochen bleibt sie clean, dann beschließt sie, sich noch einen einzigen Schuss zu genehmigen, und damit ist alles wieder beim Alten. Aber wie schon gesagt. Mir geht’s gut, Cameron geht’s gut, Grandma geht’s gut.« Er zuckt mit den Achseln. »Das ist alles, was zählt.«
»Klar«, sage ich, aber ich erinnere mich an die Abende, die ich mit Khalil auf seiner Veranda verbrachte, als wir darauf warteten, dass seine Mutter nach Hause kam. Ob es ihm passt oder nicht, er hängt an ihr.
Die Musik ändert sich und Drake rappt aus den Lautsprechern. Ich nicke im Rhythmus und rappe leise mit. Alle auf der Tanzfläche schreien mit bei: »started from the bottom, now we’re here«. An manchen Tagen sind wir hier in Garden Heights tatsächlich ganz unten, aber irgendwie verbindet uns trotzdem noch das Gefühl, es könne, verdammt noch mal, auch noch schlimmer sein.
Khalil beobachtet mich. Als seine Lippen sich schon zu einem Lächeln verziehen wollen, schüttelt er den Kopf. »Kann nicht glauben, dass du diesen Jammerlappen Drake immer noch magst.«
Ich starre ihn mit offenem Mund an. »Sag nichts gegen meinen Ehemann!«
»Deinen schmalzigen Ehemann. Baby, you my everything, you all I ever wanted«, singt Khalil mit weinerlicher Stimme. Ich remple ihn mit der Schulter an, er lacht und sein Drink schwappt über. »Du weißt schon, dass er so klingt!«
Da zeige ich ihm den Stinkefinger. Er zieht die Lippen zusammen und macht ein Kussgeräusch. Obwohl wir uns all die Monate nicht gesehen haben, ist sofort alles normal zwischen uns.
Khalil schnappt sich eine Serviette vom Couchtisch und wischt seine Jordans ab – die 3 Retros. Die kamen schon vor ein paar Jahren raus, aber ich würde schwören, dass seine hier nagelneu sind. Sie kosten um die dreihundert Dollar – und das auch nur, wenn man jemand Gutmütigen auf eBay findet. Das hat Chris geschafft. Ich habe meine für hundertfünfzig bekommen, aber ich trage auch die günstigere Kindergröße. Dank meiner kleinen Füße können Chris und ich im Partnerlook gehen. Ja, genau so ein Paar sind wir. Aber verdammt, wir sind auch ziemlich cool. Wenn er es hinkriegt, keinen Blödsinn mehr zu machen, werden wir richtig gut sein.
»Mir gefallen deine Sneaker«, sage ich zu Khalil.
»Danke.« Er rubbelt weiter mit der Serviette. Ich zucke zusammen. Denn mit jedem festen Rubbeln schreien die Schuhe nach meiner Hilfe. Ungelogen, jedes Mal wenn ein Sneaker nicht korrekt gereinigt wird, stirbt ein Katzenbaby.
»Khalil«, sage ich, kurz davor, ihm die Serviette zu entreißen. »Entweder vorsichtig drüberreiben, vor und zurück, oder abtupfen. Nicht rubbeln. Echt jetzt.«
Grinsend schaut er zu mir hoch. »Okay, Ms. Sneakerhead.« Und Black Jesus sei Dank, er tupft. »Da du Schuld dran bist, dass ich meinen Drink verschüttet hab, solltest du sie sauber machen.«
»Das macht dann sechzig Dollar.«
»Sechzig?«, schreit er und richtet sich wieder auf.
»Yeah, verdammt. Und wenn sie Icy-Sohlen hätten, wären es achtzig.« Durchsichtige Sohlen sind fies zu reinigen. »Reinigungssets sind nicht billig. Und außerdem scheinst du eine Menge Kohle zu machen, wenn du dir die leisten kannst.«
Khalil nippt an seinem Drink, als hätte ich nichts gesagt. Dann murmelt er: »Verdammt, ist das Zeug stark«, und stellt seinen Becher auf dem Tisch ab. »Ach, sag deinem Pops, dass ich ihn bald mal anrufe. Da passieren Sachen, über die ich mit ihm reden muss.«
»Was für Sachen?«
»Das ist nur was für Erwachsene.«
»Genau, weil du ja so was von erwachsen bist.«
»Fünf Monate, zwei Wochen und drei Tage älter als du.« Er zwinkert mir zu. »Hab ich nicht vergessen.«
In der Mitte der Tanzfläche gibt’s irgendeinen Tumult. Schimpfwörter fliegen hin und her.
Mein erster Gedanke? Kenya hat sich wie angekündigt Denasia vorgeknöpft. Aber die Stimmen sind tiefer als die der beiden.
Peng! Ein Schuss knallt. Ich ducke mich.
Peng! Ein zweiter Schuss. Die Menge trampelt Richtung Tür, was noch mehr Fluchen und wüstes Gedrängel erzeugt, weil es nicht alle auf einmal raus schaffen.
Khalil packt mich bei der Hand. »Komm.«
Da sind viel zu viele Leute und viel zu viele Locken, als dass ich Kenya irgendwo entdecken könnte. »Aber Kenya –«
»Vergiss sie, los, weg hier!«
Er zieht mich durch die Menge, schubst Leute aus dem Weg und tritt anderen auf die Füße. Das allein könnte uns schon ein paar Kugeln einbringen. Zwischen panischen Gesichtern suche ich nach Kenya, aber keine Spur von ihr. Ich bemühe mich, nicht hinzusehen, wer angeschossen wurde und von wem. Wer nichts gesehen hat, kann auch keinen verpfeifen.
Draußen rasen Autos davon und die Leute rennen in die Nacht. In alle Richtungen, wo nicht geschossen wird. Khalil führt mich zu einem Chevy Impala, der unter dem schwachen Schein einer Straßenlaterne parkt. Er schiebt mich von der Fahrerseite aus hinein und ich klettere auf den Beifahrersitz. Mit quietschenden Reifen rasen wir los. Das Chaos lassen wir im Rückspiegel hinter uns zurück.
»Immer ist irgendein Scheiß«, murmelt er. »Kann man nicht mal mehr eine Party feiern, ohne dass einer erschossen wird?«
Er klingt wie meine Eltern. Und genau darum lassen sie mich »nirgends hin«, wie Kenya es ausdrückt. Zumindest nicht in Garden Heights.
Ich schicke Kenya eine Nachricht und hoffe, sie ist okay. Zwar bezweifle ich, dass diese Kugeln für sie gedacht waren, aber Kugeln fliegen ja hin, wo sie wollen.
Kenya antwortet ziemlich schnell.
Bin ok.
Aber ich seh die Schlampe. Werde ihr gleich i d Arsch treten.
Wo bist du?
Ist das Mädel noch bei Trost? Wir sind gerade um unser Leben gerannt und sie ist schon wieder zum Streiten aufgelegt? Auf diesen Bullshit antworte ich nicht mal.
Khalils Impala ist nett. Nicht so protzig wie manche Autos der Jungs. Beim Einsteigen habe ich keine besonderen Felgen gesehen, und das Leder auf den Vordersitzen hat ein paar Risse. Aber innen ist alles limettenfarben, also muss es schon gepimpt sein.
Ich zupfe an einem Riss im Sitz herum. »Wer glaubst du, wurde angeschossen?«
Khalil nimmt seine Haarbürste aus dem Seitenfach in der Tür. »Wahrscheinlich ein King Lord«, sagt er und bürstet über die Seiten seines Fade-Cuts. »Als ich ankam, gingen gerade ein paar Garden Disciples rein. Da war schon irgendwas im Busch.«
Ich nicke. Garden Heights war in den letzten zwei Monaten Schauplatz irgendwelcher bescheuerter Revierkämpfe. Ich bin als »Queen« geboren, weil Daddy früher ein King Lord war. Aber als er aus dem Gangleben ausstieg, war es auch mit meinem königlichen Status auf der Straße vorbei. Doch selbst wenn ich damit aufgewachsen wäre, würde ich nicht kapieren, warum man um Straßen kämpft, die ja sowieso keinem gehören.
Khalil lässt die Bürste wieder in das Seitenfach fallen und dreht die Stereoanlage auf. Die plärrt einen alten Rap-Song, den Daddy auch schon tausendmal gespielt hat. Ich verziehe das Gesicht. »Warum hörst du dir immer dieses alte Zeug an?«
»Mann, du kannst gleich aussteigen! Tupac war das einzig Wahre.«
»Vor zwanzig Jahren.«
»Nee, auch heute noch. Wie das hier.« Er zeigt mit dem Finger auf mich, was bedeutet, dass jetzt gleich einer von Khalils philosophischen Momenten kommt. »Pac hat gesagt, Thug Life steht für ›The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody‹.«
Ich ziehe die Augenbrauen in die Höhe. »Was?«
»Hör zu! The Hate U – also mit dem Buchstaben U geschrieben – Give Little Infants Fucks Everybody. T-H-U-G L-I-F-E. Das bedeutet, was die Gesellschaft uns als Kinder antut, das kriegt sie später zurück, wenn wir raus ins Leben ziehen. Kapiert?«
»Yeah, verdammt.«
»Siehst du? Hab doch gesagt, dass er wichtig ist.« Er nickt zu den Beats und rappt mit. Ich aber frage mich, was genau die Gesellschaft von ihm gerade zurückkriegt. Ich kann es mir zwar denken, aber hoffentlich irre ich mich. Ich muss es einfach von ihm selbst hören.
»Warum hattest du wirklich zu tun?«, frage ich. »Vor ein paar Monaten meinte Daddy, du hättest im Laden gekündigt. Seither hab ich dich nicht mehr gesehen.«
Er beugt sich tiefer übers Lenkrad. »Wo soll ich dich hinbringen, zu dir nach Hause oder zum Laden?«
»Khalil –«
»Nach Hause oder zum Laden?«
»Wenn du dieses Zeug verkaufst –«
»Kümmer dich um deine eigenen Angelegenheiten, Starr! Mach dir um mich keine Sorgen. Ich tue, was ich tun muss.«
»Bullshit. Du weißt, mein Dad würde dir helfen.«
Er wischt sich vor der nächsten Lüge wieder über die Nase. »Ich brauch von niemand Hilfe, okay? Und dieser kleine Mindestlohn-Job, den dein Pops mir gegeben hat, damit konnte ich ja wohl nichts reißen. Ich war es leid, mich zwischen Kippen und Essen zu entscheiden.«
»Ich dachte, deine Grandma würde arbeiten.«
»Hat sie auch. Als sie krank wurde, haben diese Clowns im Krankenhaus behauptet, sie würden sie unterstützen. Aber als sie zwei Monate später ihr Pensum nicht mehr schaffte – denn wenn man eine Chemo durchmacht, kann man eben keine verfluchten Riesenmülleimer rumschieben –, da haben sie sie gefeuert.« Er schüttelt den Kopf. »Witzig, was? Das Krankenhaus hat sie gefeuert, weil sie krank war.«
Im Impala ist es still bis auf Tupac, der fragt Who do you believe in? Ich weiß es nicht.
Mein Handy vibriert wieder. Wahrscheinlich ist das entweder Chris, der um Entschuldigung bittet, oder Kenya, die Verstärkung gegen Denasia anfordert. Stattdessen erscheinen aber die Großbuchstaben meines großen Bruders auf dem Display. Keine Ahnung, warum er das macht. Wahrscheinlich glaubt er, mich damit einzuschüchtern. Stattdessen ärgert es mich echt maßlos.
WO BIST DU?
DU U KENYA SEID BESSER NICHT AUF DER PARTY.
HAB GEHÖRT DA WURDE GESCHOSSEN
Das Einzige, was noch schlimmer ist als behütende Eltern, sind ältere Brüder, die einen beschützen wollen. Nicht mal Black Jesus kann mich vor Seven retten.
Khalil wirft mir einen Blick zu. »Seven, was?«
»Woher weißt du das?«
»Weil du jedesmal aussiehst, als würdest du am liebsten auf irgendwas einschlagen, wenn er mit dir redet. Erinnerst du dich noch an deine Geburtstagsparty damals, als er dir dauernd sagen wollte, was du dir beim Kerzenausblasen wünschen solltest?«
»Und ich hab ihm eine runtergehauen.«
»Dann war Natasha sauer, weil du so gemein zu ihrem ›Boyfriend‹ warst«, erzählt Khalil lachend weiter.
Ich verdrehe die Augen. »Sie ist mir dermaßen auf die Nerven gegangen, weil sie in Seven verknallt war. Ich glaube, jedes zweite Mal ist sie nur vorbeigekommen, um ihn zu sehen.«
»Nee, das war, weil du die Harry-Potter-Filme hattest. Wie haben wir uns damals genannt? Das Hood-Trio. Das enger zusammenhält, als es –«
»In Voldemorts Nase je sein könnte. Das war schon ziemlich schwach.«
»Ja, oder?«, sagt er.
Wir lachen, aber irgendwas fehlt. Irgendjemand fehlt. Natasha.
Khalil schaut auf die Straße. »Verrückt, dass das schon sechs Jahre her ist.«
Das Aufheulen einer Sirene lässt uns zusammenzucken. Im Rückspiegel flackert Blaulicht.
Kapitel 2
Als ich zwölf war, führten meine Eltern zwei Gespräche mit mir.
Das eine war das übliche, über Blumen und Bienen. Also, nicht wirklich die übliche Version, denn meine Mom Lisa ist ausgebildete Krankenschwester. Sie erklärte mir, was wohin gehört und was wo nicht hin darf, also verdammt noch mal nirgendwohin, bis ich erwachsen wäre. Damals bezweifelte ich sowieso, dass irgendwas irgendwo hinkäme. Während alle anderen Mädchen zwischen der sechsten und siebten Klasse Brüste bekamen, blieb meine Vorderseite so flach wie mein Rücken.
Das zweite Gespräch handelte davon, was zu tun ist, wenn man von einem Cop angehalten wird.
Momma regte sich auf und meinte zu Daddy, ich sei noch zu jung dafür. Er konterte, dass ich auch nicht zu jung sei, um verhaftet oder erschossen zu werden.
»Starr-Starr, du machst alles, was sie sagen«, meinte er. »Halt deine Hände so, dass man sie sieht. Mach keine plötzlichen Bewegungen. Red nur, wenn du was gefragt wirst.«
Mir war klar, wie ernst die Angelegenheit war. Daddy hat die größte Klappe von allen, die ich kenne. Und wenn er sagt, sei still, dann musste man unbedingt still sein.
Ich hoffe, jemand hat dieses Gespräch auch mit Khalil geführt.
Er flucht leise, dreht die Lautstärke von Tupac runter und lenkt den Impala an den Straßenrand. Wir befinden uns auf der Carnation, wo die meisten Häuser leer stehen und die Hälfte der Straßenlaternen kaputt ist. Kein Mensch zu sehen, außer uns und dem Streifenwagen.
Khalil macht die Zündung aus. »Ich frag mich, was der Idiot will.«
Der Polizist parkt ebenfalls und schaltet sein Fernlicht ein. Ich blinzle, weil es mich blendet.
Dann erinnere ich mich an noch etwas, das Daddy mir gesagt hat. Wenn du mit jemand anderem unterwegs bist, kannst du nur hoffen, dass die bei dem nichts finden, sonst seid ihr beide verloren.
»K, du hast doch nichts im Auto, oder?«, frage ich.
Er beobachtet den Cop im Außenspiegel. »Nee.«
Der Polizist kommt zur Fahrertür und klopft an die Scheibe. Khalil kurbelt sie runter. Als wären wir nicht schon genug geblendet, leuchtet er uns auch noch mit seiner Taschenlampe ins Gesicht.
»Führerschein, Zulassung und Versicherungsnachweis.«
Khalil bricht eine Regel – er tut nicht, was der Cop will. »Warum haben Sie uns angehalten?«
»Führerschein, Zulassung und Versicherungsnachweis.«
»Ich sagte, warum haben Sie uns angehalten?«
»Khalil«, flehe ich. »Tu, was er sagt.«
Khalil stöhnt auf und holt seine Brieftasche heraus. Der Polizist folgt seinen Bewegungen mit der Taschenlampe.
Mein Herz hämmert laut, aber ich habe Daddys Anweisungen im Ohr: Sieh dir das Gesicht von dem Cop genau an. Wenn du dir seine Dienstnummer merken kannst, noch besser.
Während das Licht der Taschenlampe auf Khalils Hand gerichtet ist, kann ich die Nummer auf seinem Abzeichen erkennen – einhundertfünfzehn. Er ist weiß, ungefähr Mitte dreißig, Anfang vierzig, hat einen braunen Bürstenhaarschnitt und eine feine Narbe an der Oberlippe.
Khalil gibt ihm seine Papiere und den Führerschein.
Hundertfünfzehn sieht sie sich flüchtig an. »Wo kommt ihr beiden gerade her?«
»Nunya«, sagt Khalil und meint damit, geht dich nichts an. »Warum haben Sie mich angehalten?«
»Dein Rücklicht ist kaputt.«
»Krieg ich dann jetzt einen Strafzettel oder wie?«, fragt Khalil.
»Weißt du was? Steig mal aus, du Klugscheißer.«
»Mann, gib mir einfach meinen Strafzettel –«
»Aussteigen! Und die Hände hoch, sodass ich sie sehen kann.«
Khalil steigt mit erhobenen Händen aus. Hundertfünfzehn zerrt ihn am Arm und drückt ihn gegen die hintere Tür.
Ich habe Mühe, meine Stimme wiederzufinden. »Er wollte doch gar nicht –«
»Hände aufs Armaturenbrett!«, fährt der Polizist mich an. »Keine Bewegung!«
Ich tue, was er sagt, aber meine Hände zittern zu sehr, um ruhig liegen zu bleiben.
Er tastet Khalil ab. »Okay, Klugscheißer, dann wollen wir mal sehen, was wir heute bei dir finden.«
»Sie werden gar nichts finden«, sagt Khalil.
Hundertfünfzehn tastet ihn noch zweimal ab und findet nichts.
»Bleib da stehen«, befiehlt er Khalil. »Und du«, er schaut durchs Fenster zu mir. »Rühr dich nicht.«
Ich schaffe es nicht mal zu nicken.
Dann geht der Beamte zu seinem Streifenwagen zurück.
Meine Eltern haben mir nicht beigebracht, die Polizei zu fürchten, sondern mich in ihrer Gegenwart einfach klug zu verhalten. Sie haben mir erklärt, dass es nicht klug ist, sich zu bewegen, während ein Cop dir den Rücken zudreht.
Khalil macht genau das. Er kommt zur Fahrertür.
Eine plötzliche Bewegung ist auch nicht klug.
Khalil macht aber genau das. Er öffnet die Fahrertür.
»Starr, bist du okay –«
Peng!
Khalils Körper zuckt. Von seinem Rücken spritzt Blut. Er klammert sich an die Tür, um sich auf den Beinen zu halten.
Peng!
Khalil keucht auf.
Peng!
Khalil sieht mich erstaunt an.
Er stürzt zu Boden.
Ich bin wieder zehn und sehe Natasha fallen.
Ein ohrenbetäubender Schrei dringt aus meiner Kehle, explodiert in meinem Mund und nutzt jeden Zentimeter meines Körpers für seine Resonanz.
Mein Verstand sagt mir, ich soll mich nicht bewegen, aber alles andere drängt mich, nach Khalil zu sehen. Ich springe aus dem Wagen und renne auf die andere Seite. Khalil starrt in den Himmel, als hoffe er, Gott zu sehen. Sein Mund ist wie zu einem Schrei geöffnet. Ich schreie laut genug für uns beide.
»Nein, nein, nein«, ist alles, was ich sagen kann. So als wäre ich erst ein Jahr alt und könnte noch kein anderes Wort. Ich weiß nicht, wie ich neben ihm auf dem Boden lande. Meine Mom hat mal gesagt, wenn jemand angeschossen wird, dann versuch, die Blutung zu stoppen, aber da ist so viel Blut. Zu viel Blut.
»Nein, nein, nein.«
Khalil rührt sich nicht. Sagt kein Wort. Er sieht mich nicht einmal an. Sein Körper verkrampft sich und dann ist er tot. Ich hoffe, er sieht Gott.
Jemand anders schreit.
Ich blinzle gegen meine Tränen an. Der Polizeibeamte Hundertfünfzehn schreit mich an und zielt mit derselben Waffe auf mich, mit der er gerade meinen Freund getötet hat.
Ich hebe die Hände.
Kapitel 3
Sie lassen Khalil auf der Straße liegen wie ein Ausstellungsstück. Entlang der Carnation Street stehen Polizeiautos und Krankenwagen mit Blaulicht. Am Rand sind auch Leute, die versuchen zu sehen, was passiert ist.
»Verdammt, Bro«, sagt irgendwer. »Die haben ihn umgebracht!«
Die Polizei ruft den Leuten zu, sie sollen verschwinden. Keiner reagiert.
Die Sanitäter können einen Dreck für Khalil tun, also setzen sie wenigstens mich hinten in einen Krankenwagen, als würde ich Hilfe brauchen. Das helle Licht macht auf mich aufmerksam, und die Leute recken den Hals, um irgendwas zu sehen.
Ich fühle mich nicht wie etwas Besonderes. Ich fühle mich elend.
Die Cops durchwühlen Khalils Auto. Ich versuche, ihnen zu sagen, sie sollen das lassen. Bitte, deckt ihn zu. Bitte, schließt seine Augen. Bitte, schließt seinen Mund. Nehmt die Pfoten von seinem Wagen. Fasst seine Haarbürste nicht an. Aber es kommt kein Laut über meine Lippen.
Hundertfünfzehn sitzt am Bordstein und hat das Gesicht in den Händen vergraben. Andere Polizisten klopfen ihm auf die Schulter und versichern ihm, alles würde gut.
Endlich breiten sie ein Laken über Khalil. Da drunter kann er nicht atmen. Ich kriege keine Luft.
Ich kann nicht.
Atmen.
Ich schnappe nach Luft.
Schnappe wieder danach.
Und wieder.
»Starr?«
Braune Augen mit langen Wimpern direkt vor mir. Sie sehen aus wie meine.
Ich konnte den Cops nicht viel sagen, aber immerhin habe ich die Namen und die Telefonnummern meiner Eltern herausgebracht.
»Hey«, sagt Daddy. »Komm, wir gehen.«
Ich öffne den Mund, um zu antworten. Es kommt nur ein Schluchzen heraus.
Da wird Daddy beiseite geschoben und Momma nimmt mich in die Arme. Sie streicht mir über den Rücken, spricht leise auf mich ein und erzählt mir Lügen.
»Alles ist gut, Baby. Ist schon gut.«
So verharren wir lange. Irgendwann hilft Daddy uns aus dem Krankenwagen. Er legt den Arm um mich, schirmt mich damit gegen neugierige Blicke ab und führt mich zu seinem Chevrolet Tahoe, der ein Stück die Straße runter steht.
Er fährt los. Im vorbeiziehenden Licht einer Straßenlaterne sehe ich, wie fest er die Zähne zusammenbeißt. An seinem kahlen Kopf treten die Adern hervor.
Momma trägt ihre Schwesternkleidung, die mit den Entchen drauf. Sie war heute für eine Sonderschicht in der Notaufnahme. Ein paarmal wischt sie sich über die Augen. Wahrscheinlich weil sie an Khalil denkt oder daran, dass auch ich auf der Straße hätte liegen können.
Mein Magen krampft sich zusammen. Das ganze Blut, das aus ihm raus kam. Etwas davon ist an meinen Händen, auf Sevens Hoodie und meinen Sneakern. Vor einer Stunde haben wir noch gelacht und Neuigkeiten ausgetauscht. Jetzt ist sein Blut …
Heiße Spucke in meinem Mund. Mein Magen zieht sich noch heftiger zusammen. Ich muss würgen.
Momma wirft im Rückspiegel einen Blick auf mich. »Halt an, Maverick!«
Ich hechte über die Rückbank und drücke die Tür auf, bevor der Truck ganz zum Stehen kommt. Es fühlt sich an, als käme alles aus mir heraus. Und ich kann nichts tun, als es zuzulassen.
Momma springt aus dem Wagen und kommt zu mir gelaufen. Sie hält mir die Haare aus dem Gesicht und streichelt über meinen Rücken. »Es tut mir so leid, Baby«, sagt sie.
Als wir zu Hause sind, hilft sie mir beim Ausziehen. Sevens Hoodie und meine Jordans verschwinden auf Nimmerwiedersehen in einer schwarzen Mülltüte.
Ich setze mich in die heiße Badewanne und schrubbe meine Hände wund, um Khalils Blut abzuwaschen. Daddy trägt mich ins Bett und Momma streicht mir mit den Fingern durchs Haar, bis ich eingeschlafen bin. Immer wieder wecken mich Albträume auf. Momma erinnert mich daran zu atmen. So wie früher, als ich noch Asthma hatte. Ich glaube, sie bleibt die ganze Nacht in meinem Zimmer, denn jedes Mal wenn ich aufwache, sitzt sie an meinem Bett.
Aber jetzt ist sie nicht da. Meine Augen blinzeln gegen die Helligkeit meiner neon-blauen Wände an. Der Wecker zeigt fünf Uhr an. Mein Körper ist das Aufwachen um fünf so gewöhnt, dass es keine Rolle spielt, ob Samstag ist.
Ich starre auf die Leuchtsterne an meiner Zimmerdecke und versuche, mich an den vergangenen Abend zu erinnern. Die Party fällt mir ein, die Schießerei dort. Hundertfünfzehn, der Khalil und mich zum Anhalten zwingt. Der erste Schuss dröhnt in meinen Ohren. Dann der zweite. Der dritte.
Ich liege im Bett. Khalil liegt im Leichenschauhaus des Bezirks.
Dort ist auch Natasha gelandet. Das war vor sechs Jahren, aber ich erinnere mich noch an alle Einzelheiten von jenem Tag. Ich wischte damals den Boden in unserem Lebensmittelladen, um mir mein erstes Paar J’s zusammenzusparen, als Natasha reingerannt kam. Sie war stämmig (ihre Momma sagte immer, das sei noch Babyspeck), hatte dunkle Haut und eine Flechtfrisur, die immer wie neu gemacht aussah. Ich wünschte mir so sehr eine Frisur wie ihre.
»Starr, der Hydrant an der Elm Street ist kaputt!«, rief sie.
Sie hätte ebenso gut sagen können, wir haben einen gratis Wasser-Fun-Park. Ich erinnere mich, Daddy angesehen und stumm gebettelt zu haben. Er sagte, ich könne gehen, wenn ich verspräche, in einer Stunde wieder da zu sein.
Ich glaube, ich habe Wasser noch nie so weit in die Höhe schießen gesehen, wie an jenem Tag. Fast alle aus der Nachbarschaft waren auch da. Einfach um Spaß zu haben. Ich war zunächst die Einzige, die das Auto bemerkte.
Ein tätowierter Arm streckte sich aus einem der hinteren Fenster, in der Hand eine Glock. Die Leute rannten weg. Ich nicht. Meine Füße verschmolzen mit dem Gehweg. Natasha planschte weiter fröhlich im Wasser. Dann –
Peng! Peng! Peng!
Ich sprang in einen Rosenstrauch. Als ich daraus wieder aufstand, schrie jemand: »Ruft die 911!« Zuerst dachte ich, das wäre meinetwegen, weil an meinem Shirt Blut klebte. Ich war an den Dornen des Rosenbuschs hängen geblieben. Mehr nicht. Aber es ging um Natasha. Ihr Blut vermischte sich mit dem Wasser und man sah nur einen roten Bach die Straße runterlaufen.
Sie sah verängstigt aus. Wir waren zehn und wussten nicht, was passiert, wenn man tot ist. Ich weiß es immer noch nicht, und sie wurde gezwungen, es herauszufinden, obwohl sie das gar nicht wollte.
Ganz sicher wollte sie das nicht. Ebensowenig wie Khalil.
Meine Zimmertür öffnet sich einen Spalt breit und Momma schaut herein. Sie versucht zu lächeln. »Wer ist denn da schon wach?«
Sie setzt sich an ihre übliche Stelle aufs Bett und befühlt meine Stirn, obwohl ich kein Fieber habe. Aber sie kümmert sich so oft um kranke Kinder, dass das bei ihr eine Art Reflex ist. »Wie fühlst du dich, Mümmel?«
Mein Spitzname. Meine Eltern behaupten, seitdem ich kein Fläschchen mehr bekam, hätte ich dauernd irgendwas gemümmelt. Meinen großen Appetit habe ich nicht mehr, aber den Spitznamen werde ich nicht los. »Müde«, sage ich. Meine Stimme klingt besonders tief. »Ich will im Bett bleiben.«
»Ich weiß, Süße, aber ich möchte nicht, dass du allein hier bist.«
Dabei will ich genau das, allein sein. Sie sieht mich durchdringend an, aber es kommt mir vor, als würde sie mich sehen, wie ich früher war: ihr kleines Mädchen mit Zöpfen und Wackelzahn, das Stein und Bein schwor, ein Powerpuff Girl zu sein. Es ist seltsam, aber irgendwie auch wie eine Decke, in die ich eingewickelt werden möchte.
»Ich hab dich lieb«, sagt sie.
»Ich dich auch.«
Da steht sie auf und streckt mir die Hand hin. »Komm. Lass uns mal was zu essen für dich finden.«
Langsam gehen wir Richtung Küche. Black Jesus hängt in einem Bild auf dem Flur am Kreuz, daneben ein Foto von Malcolm X mit Gewehr. Nana beklagt sich immer noch über diese Anordnung.
Wir wohnen in ihrem früheren Haus. Sie hat es meinen Eltern überlassen, nachdem sie in das gigantische Haus meines Onkel Carlos in die Vorstadt gezogen ist. Onkel Carlos war es nie recht, dass Nana allein in Garden Heights lebte, vor allem weil dort überdurchschnittlich häufig bei älteren Leuten eingebrochen wird und Raubüberfälle passieren. Nana hält sich allerdings nicht für alt. Sie weigerte sich selbst dann noch, wegzuziehen, als jemand einbrach und ihr den Fernseher klaute. Ungefähr einen Monat später behauptete Onkel Carlos, er und Tante Pam bräuchten ihre Hilfe mit den Kindern. Da Tante Pam nach Nanas Aussage »diesen armen Babys rein gar nichts Anständiges kochen kann«, willigte sie schließlich ein. Unser Haus hat trotzdem immer noch viel von Nana: Überall riecht es nach Potpourris, die Tapeten haben Blümchenmuster und in fast jedem Zimmer gibt es irgendwas Pinkfarbenes.
Daddy und Seven unterhalten sich, bevor wir die Küche erreichen. Als wir reinkommen, verstummen sie.
»Guten Morgen, Baby Girl.« Daddy steht vom Tisch auf und küsst mich auf die Stirn. »Konntest du einigermaßen schlafen?«
»Ja«, lüge ich, während er mich zu einem Stuhl führt. Seven schaut mich nur an.
Momma öffnet den Kühlschrank, dessen Tür mit Magneten in Obstform und Speisekarten von Take-Out-Restaurants zugepflastert ist. »Also, Mümmel«, sagt sie, »möchtest du Putenschinken oder normalen?«
»Normalen.« Die Auswahl wundert mich. Wir haben eigentlich nie Schweinefleisch da. Wir sind aber keine Muslime. Eher »Christlime«. Momma wurde noch in Nanas Bauch Mitglied der Christ Temple Church. Daddy glaubt an Black Jesus, hält sich aber eher an das Zehn-Punkte-Programm der Black Panthers als an die Zehn Gebote. In einigen Punkten stimmt er der Nation of Islam zu, aber darüber, dass sie Malcolm X getötet haben könnte, kommt er nicht hinweg.
»Schwein in meinem Haus«, knurrt Daddy und setzt sich zu mir. Seven hinter ihm grinst. Er und Daddy sehen sich total ähnlich. Wenn man jetzt noch meinen kleinen Bruder Sekani dazusetzt, meint man, dieselbe Person mit acht, siebzehn und sechsunddreißig zu sehen. Alle drei sind dunkelbraun, schlank und haben kräftige Augenbrauen sowie lange Wimpern, die fast feminin wirken. Sevens Dreadlocks sind so lang, dass er dem kahl rasierten Daddy und Sekani mit seinem Kurzhaarschnitt beiden noch einen Kopf voll davon abgeben könnte.
Bei mir scheint Gott die Hautfarben meiner Eltern in einem Farbeimer gemischt zu haben, um meinen mittelbraunen Teint hinzukriegen. Ich habe auch Daddys Wimpern geerbt – und bin mit seinen Augenbrauen gestraft. Ansonsten komme ich eher nach meiner Mom, mit großen braunen Augen und einer etwas zu hohen Stirn.
Momma geht mit dem Schinken hinter Seven vorbei und drückt seine Schulter. »Danke, dass du gestern bei deinem Bruder geblieben bist, damit wir –« Ihre Stimme erstirbt, aber die Erinnerung an die Ereignisse gestern Abend stehen im Raum. Sie räuspert sich. »Wir wissen das zu schätzen.«
»Kein Problem. Ich musste sowieso da raus.«
»Ist King über Nacht geblieben?«, fragt Daddy.
»Eher eingezogen. Iesha redet schon davon, dass wir eine Familie sein könnten –«
»Hey«, sagt Daddy. »Das ist deine Momma, Junge. Nenn sie nicht beim Vornamen, als wärst du schon erwachsen.«
»Einer in dem Haus muss ja erwachsen sein«, meint Momma. Sie holt die Pfanne raus und ruft in den Flur: »Sekani, ich werd’s dir nicht noch mal sagen. Wenn du übers Wochenende zu Carlos willst, solltest du besser mal aufstehen! Deinetwegen komme ich nicht zu spät zur Arbeit.« Bestimmt muss sie heute die Tagschicht übernehmen, um gestern auszugleichen.
»Pops, du weißt doch, wie es laufen wird«, sagt Seven. »Er schlägt sie, sie schmeißt ihn raus. Dann kommt er zurück, sagt er habe sich geändert. Der einzige Unterschied ist, dass ich diesmal nicht zulassen werde, dass er mir gegenüber handgreiflich wird.«
»Du kannst jederzeit bei uns einziehen«, sagt Daddy.
»Ich weiß, aber ich kann Kenya und Lyric nicht zurücklassen. Der ist irre genug, um die beiden auch noch zu schlagen. Dabei kümmert es ihn nicht, dass sie seine Töchter sind.«
»Na gut«, meint Daddy. »Sag nichts zu ihm. Wenn er dir gegenüber handgreiflich wird, lass mich das regeln.«
Seven nickt, dann schaut er mich an. Er öffnet den Mund, und es vergeht eine Weile, bevor er sagt: »Das mit gestern Abend tut mir leid, Starr.«
Endlich spricht jemand die Wolke an, die über der Küche schwebt, was aus irgendeinem Grund auch bedeutet, mich zur Kenntnis zu nehmen.
»Danke«, sage ich, obwohl das eigentlich unpassend ist. Nicht ich verdiene Mitgefühl, sondern Khalils Familie.
Man hört den Schinken in der Pfanne zischen. Ich komme mir vor, als hätte ich einen »Zerbrechlich«-Aufkleber auf der Stirn, und anstatt das Risiko einzugehen und etwas zu sagen, das mich zerbrechen könnte, sagen sie lieber gar nichts.
Aber Schweigen ist das Schlimmste.
»Ich hatte mir deinen Hoodie geliehen, Seven«, murmle ich. Das ist banal, aber immer noch besser als nichts. »Den blauen. Momma musste ihn wegschmeißen. Khalils Blut …« Ich schlucke. »Sein Blut war drauf.«
»Oh …«
Eine Minute lang sagt niemand mehr was.
Momma wendet sich der Pfanne zu. »Ergibt überhaupt keinen Sinn. Das Kind –«, sagt sie mit belegter Stimme. »Er war doch noch ein Kind.«
Daddy schüttelt den Kopf. »Der Junge hat nie jemand was getan. Er hat das nicht verdient.«
»Warum haben die ihn erschossen?«, fragt Seven. »War er vielleicht eine Bedrohung oder so?«
»Nein«, sage ich leise.
Ich starre auf den Tisch und spüre, wie sie mich alle wieder beobachten.
»Er hat gar nichts gemacht«, sage ich. »Wir haben gar nichts gemacht. Khalil hatte ja nicht mal eine Waffe.«
Daddy atmet langsam aus. »Wenn das die Leute hier erfahren, werden sie ausrasten.«
»Bei denen aus der Gegend ist schon auf Twitter davon die Rede«, sagt Seven. »Hab ich gestern Abend gesehen.«
»Wurde deine Schwester erwähnt?«, fragt Momma.
»Nein. Nur RIP Khalil-Nachrichten, Fuck the police, solches Zeug. Ich glaube nicht, dass die Einzelheiten kennen.«
»Was wird mit mir passieren, wenn die Einzelheiten rauskommen?«, frage ich.
»Was meinst du damit, Baby?«, fragt meine Mom.
»Außer dem Cop bin ich der einzige Mensch, der dabei war. Und ihr habt so was doch schon erlebt. Das kommt in die landesweiten Nachrichten. Leute kriegen Morddrohungen, die Polizei nimmt sie ins Visier, lauter solches Zeug.«
»Ich werde nicht zulassen, dass dir irgendwas passiert«, sagt Daddy. »Keiner von uns.« Er sieht Momma und Seven an. »Wir erzählen keinem, dass Starr dort war.«
»Sollte Sekani Bescheid wissen?«, fragt Seven.
»Nein«, sagt Momma. »Es ist am besten, wenn er nichts weiß. Jetzt reden wir erst mal nicht mehr darüber.«
Ich habe es immer wieder erlebt: Ein Schwarzer wird erschossen, nur weil er schwarz ist, und die Hölle bricht los. Ich habe RIP-Hashtags getweetet, Bilder auf Tumblr weitergebloggt und jede Petition, die es gab, unterzeichnet. Immer habe ich gesagt, wenn ich dabei wäre, wenn so was passiert, dann hätte ich die lauteste Stimme und würde dafür sorgen, dass die Welt erfährt, was passiert ist.
Jetzt bin ich genau diese Person und habe zu viel Angst, den Mund aufzumachen.
Ich würde am liebsten zu Hause bleiben und Der Prinz von Bel-Air, meine absolute Lieblingsserie, anschauen. Wahrscheinlich kenne ich jede einzelne Folge auswendig. Klar ist sie urkomisch, aber mir kommt es auch vor, als würde ein Teil meines eigenen Lebens auf dem Bildschirm widergespiegelt. Ich kann mich sogar mit dem Titelsong identifizieren. Denn ein paar Gangmitglieder, die nichts Gutes im Sinn hatten, haben in meiner Nachbarschaft Ärger gemacht und Natasha ermordet. Meine Eltern bekamen es mit der Angst zu tun und schickten mich zwar nicht zu Tante und Onkel in eine Reichengegend, aber zumindest auf eine Privatschule für bessere Leute.
Ich wünschte nur, ich könnte an der Williamson ich selbst sein, so wie Will in Bel-Air.
Irgendwie will ich auch zu Hause bleiben, damit ich Chris zurückrufen kann. Nach gestern Abend kommt es mir dämlich vor, auf ihn wütend zu sein. Ich könnte auch Hailey und Maya anrufen. Die Mädchen, von denen Kenya behauptet, sie wären nicht meine Freundinnen. Ich kann schon verstehen, warum sie das sagt. Nie lade ich sie zu mir ein. Warum sollte ich? Sie wohnen in Mini-Villen. Mein Zuhause ist einfach nur mini.
In der siebten Klasse habe ich den Fehler gemacht, sie zu einer Übernachtungsparty einzuladen. Momma hätte uns erlaubt, die Fingernägel zu lackieren, die ganze Nacht aufzubleiben und so viel Pizza zu essen, wie wir wollten. Das wäre genauso toll geworden wie die Wochenenden, die wir bei Hailey verbracht hatten. Die wir immer noch manchmal dort verbringen. Ich hatte Kenya auch eingeladen, damit ich endlich mal etwas mit allen Dreien zusammen unternehmen konnte.
Hailey kam nicht. Ihr Dad wollte nicht, dass sie in »dem Ghetto« übernachtete. Das hörte ich meine Eltern sagen. Maya kam zwar, rief dann aber noch am selben Abend ihre Eltern an, damit sie sie abholten. Um die Ecke hatte jemand aus einem fahrenden Auto geschossen, und das Geräusch der Schüsse hatte sie erschreckt.
Da erkannte ich, dass Williamson eine Welt ist und Garden Heights eine andere. Und dass ich die beiden voneinander trennen musste.
Es spielt jedoch keine Rolle, was ich heute gern tun würde – meine Eltern haben sich etwas anderes für mich überlegt. Momma erklärt mir, ich würde heute mit Daddy in den Laden gehen. Bevor Seven zur Arbeit aufbricht, kommt er in seinem Best Buy-Elektromarkt-Poloshirt und Khakihose in mein Zimmer und umarmt mich.
»Hab dich lieb«, sagt er.
Genau deshalb hasse ich es, wenn jemand stirbt. Weil die Leute dann Sachen machen, die sie sonst nicht machen. Selbst Momma umarmt mich länger und fester und mit mehr Mitgefühl als »nur so«. Sekani dagegen klaut mir Schinken vom Teller, späht auf mein Handy und trampelt mir beim Rausgehen absichtlich auf den Fuß. Für all das liebe ich ihn.
Unserem Pitbull Brickz bringe ich eine Schüssel Hundefutter und den Rest vom Schinken nach draußen. Daddy hat ihm diesen Namen gegeben, weil er schon immer so schwer wie bricks, also Ziegelsteine, war. Sobald er mich sieht, springt er auf und ab und versucht, sich von seiner Kette zu befreien. Als ich nah genug bei ihm bin, hüpft der hyperaktive Kerl meine Beine hoch, sodass ich fast das Gleichgewicht verliere.
»Platz!«, sage ich. Da kauert er sich auf den Rasen und schaut jaulend aus seinen großen Hundeaugen zu mir hoch. Das ist Brickz’ Version einer Entschuldigung.
Ich weiß, dass Pitbulls aggressiv sein können, aber Brickz ist meistens wie ein Baby. Ein großes Baby. Würde aber jemand versuchen, in unser Haus einzubrechen, bekäme derjenige es nicht mit Baby Brickz zu tun.
Während ich ihn füttere und seine Wasserschüssel auffülle, pflückt Daddy ein paar Kohlköpfe in seinem Garten und schneidet Rosen ab, deren Blüten so groß sind wie meine Handflächen. Jeden Abend verbringt er Stunden dort, mit Umgraben, Pflanzen und Reden. Er behauptet nämlich, ein guter Garten brauche gute Gespräche.
Ungefähr eine halbe Stunde später fahren wir mit offenen Fenstern in seinem Truck. Im Radio fragt Marvin Gaye, was los sei. Draußen ist es noch dunkel, aber lange wird es nicht mehr dauern, bis die Sonne hinter den Wolken hervorkommt. Auf der Straße ist kaum jemand zu sehen. So früh am Morgen dringt das Rumpeln der Sattelzüge vom Freeway herüber.
Daddy summt bei Marvin mit, obwohl er einen Ton nicht mal halten könnte, wenn er ihn auf dem Präsentierteller überreicht bekäme. Er trägt ein Trikot der Lakers mit nichts drunter, sodass die Tattoos, die seine Arme überziehen, gut zu erkennen sind. Eines meiner Babyfotos schaut mich von dort an. Darunter der Schriftzug Something to live for, something to die for. Seven und Sekani teilen sich seinen anderen Arm, darunter derselbe Satz. Liebesbriefe in ihrer einfachsten Form.
»Möchtest du noch weiter über gestern Abend reden?«, fragt er.
»Nee.«
»In Ordnung. Wann immer du willst.«
Noch eine Liebesbotschaft in einfachster Form.
Wir biegen in die Marigold Avenue, wo Garden Heights gerade wach wird. Ein paar Damen, die Kopftücher mit Blumenmuster tragen, kommen mit großen gefüllten Waschkörben aus dem Waschsalon. Mr. Reuben schließt die Ketten vor seinem Restaurant auf. Sein Neffe Tim, der Koch, lehnt an der Mauer und reibt sich den Schlaf aus den Augen. Ms. Yvette betritt gähnend ihren Kosmetiksalon. Im Spirituosen- und Weinladen Top Shelf brennen die Lichter, aber das tun sie immer.
Daddy parkt direkt vor Carter’s Grocery, dem Laden unserer Familie. Er hat ihn dem früheren Besitzer, Mr. Wyatt, abgekauft, als der Garden Heights verließ, um den ganzen Tag lang nur noch am Strand zu sitzen und hübschen Frauen nachzuschauen. (Das waren Mr. Wyatts Worte, nicht meine.) Mr. Wyatt war der einzige Mensch, der bereit war, Daddy einzustellen, nachdem er aus dem Gefängnis kam. Und später sagte er, Daddy sei der einzige Mensch, dem er den Laden anvertrauen würde.
Verglichen mit dem Walmart an der Ostseite von Garden Heights ist unser Lebensmittelladen winzig. Weiß gestrichene Metallgitter schützen die Fenster und die Tür. Sie lassen das Geschäft wie ein Gefängnis aussehen.
Mr. Lewis vom Friseurladen nebenan steht genau vor unserer Tür und hat die Arme über seinem dicken Bauch verschränkt. Aus schmalen Augen starrt er Daddy an.
Der seufzt. »Da haben wir’s.«
Wir springen aus dem Wagen. Mr. Lewis schneidet mit die besten Frisuren in Garden Heights – Sekanis hoher Fade beweist es –, aber selbst trägt er einen unordentlichen Afro. Sein eigener Bauch versperrt ihm den Blick auf seine Füße, und seit seine Frau gestorben ist, sagt ihm niemand mehr, dass seine Hose zu kurz ist oder die Socken nicht zusammenpassen. Heute ist einer gestreift, der andere kariert.
»Früher hatte der Laden pünktlich um 5 Uhr 55 geöffnet«, sagt er. »Um 5 Uhr 55!«
Es ist fünf nach sechs.
Daddy schließt die Vordertür auf. »Ich weiß, Mr. Lewis, aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich den Laden nicht genauso führe wie Wyatt.«
»Das kann man wohl sagen. Zuerst hängen Sie seine Bilder ab – wer zum Teufel ersetzt Dr. Martin Luther King durch irgendeinen Niemand –«
»Huey Newton ist kein Niemand.«
»Jedenfalls ist er nicht Dr. King! Und dann heuern Sie diese Taugenichtse an, die hier arbeiten. Hab gehört, dass dieser Junge Khalil sich gestern Abend hat erschießen lassen. Wahrscheinlich hat er dieses Zeug verkauft.« Mr. Lewis schaut von Daddys Trikot zu seinen Tattoos. »Man fragt sich, wo er die Idee wohl herhatte.«
Daddy beißt die Zähne zusammen. »Starr, wirf für Mr. Lewis die Kaffeemaschine an.«
Damit er hier verdammt noch mal verschwindet, vollende ich Daddys Satz in Gedanken.
Sofort schalte ich die Maschine am Selbstbedienungstisch ein, über dem Huey Newton mit für Black Power erhobener Faust wacht.
Eigentlich sollte ich den Filter wechseln, frischen Kaffee und frisches Wasser einfüllen, aber weil er so schlecht über Khalil geredet hat, bekommt Mr. Lewis seinen Kaffee aus dem einen Tag alten Satz.
Er humpelt durch die Gänge, nimmt sich eine Honigschnecke, einen Apfel und eine Packung Sülze. Das Gebäck gibt er mir. »Mach das mal warm, Mädchen. Aber ja nicht zu heiß.«
Ich lasse die Schnecke in der Mikrowelle, bis die Plastikverpackung ganz prall ist und aufplatzt. Mr. Lewis beißt hinein, kaum dass ich sie ihm gegeben habe.
»Das Ding ist ja glutheiß!« Gleichzeitig kaut und pustet er. »Das hast du zu lang drin gelassen, Mädchen. Hab mir fast den Mund verbrannt!«
Als Mr. Lewis geht, zwinkert Daddy mir zu.
Dann kommt die übliche Kundschaft. Etwa Mrs. Jackson, die darauf besteht, ihr Gemüse nur bei Daddy und sonst niemandem zu kaufen. Vier rotäugige Jungs in besonders schlabbrigen Saggy Pants kaufen fast unseren gesamten Chipsbestand auf. Daddy sagt ihnen, es wäre noch zu früh, um dermaßen zugedröhnt zu sein, und sie lachen viel zu laut darüber. Einer von ihnen leckt im Gehen schon den nächsten Joint an. Gegen elf kauft Mrs. Rooks ein paar Rosen und Knabberzeug für das Treffen ihres Bridge-Clubs. Sie hat hängende Augenlider und vergoldete Schneidezähne. Ihre Perücke ist auch goldfarben.
»Ihr bräuchtet hier ein paar Lottoscheine, Baby«, sagt sie, während Daddy kassiert und ich ihre Sachen einpacke. »Da gibt’s heute Abend dreihundert Millionen!«
Daddy lächelt. »Im Ernst? Was würden Sie denn mit dem ganzen Geld machen, Mrs. Rooks?«
»Hach, Baby, die Frage ist doch eher, was würde ich mit dem ganzen Geld nicht machen. Bei Gott, ich würde in den ersten Flieger steigen, der mich von hier wegbringt.«
Daddy lacht. »Wirklich? Wer soll denn dann Red Velvet Cake für uns backen?«
»Jemand anders, weil ich weg wäre.« Sie zeigt auf das Zigarettensortiment hinter uns. »Baby, gib mir eine Schachtel von den Newports.«
Das ist auch Nanas Lieblingssorte. Und es war Daddys, bevor ich ihn gebeten habe aufzuhören. Ich nehme ein Päckchen und gebe es Mrs. Rooks.
Sie wendet den Blick nicht von mir ab, klopft mit der Schachtel gegen ihren Handrücken, und ich warte darauf, dass es kommt. Das Mitgefühl. »Baby, ich hab gehört, was mit Ms. Rosalies Enkelsohn passiert ist«, sagt sie. »Es tut mir so leid. Ihr wart doch befreundet, nicht wahr?«
Das »wart« tut weh, aber ich sage nur »Yes, Ma’am.«
»Hmm!« Sie schüttelt den Kopf. »Lord have Mercy. Mir brach fast das Herz, als ich es gehört habe. Ich wollte gestern Abend noch zu ihr rübergehen, aber da waren schon so viele Leute bei Ms. Rosalies Haus. Arme Ms. Rosalie. Was sie sowieso schon alles durchmacht und jetzt das. Barbara meinte, Ms. Rosalie sei sich gar nicht sicher, wie sie seine Beerdigung bezahlen soll. Wir haben uns überlegt, dass wir etwas Geld sammeln. Würdest du auch was beisteuern, Maverick?«
»Natürlich. Sagt mir einfach Bescheid, was ihr braucht, dann erledige ich das.«
Lächelnd lässt sie ihre Goldzähne aufblitzen. »Junge, es ist gut zu sehen, was der Herr aus dir gemacht hat. Deine Momma wäre stolz.«
Daddy nickt bedächtig. Grandma ist jetzt schon zehn Jahre tot – lange genug, dass Daddy nicht mehr täglich um sie weint, aber auch noch nicht so lange, dass es ihn nicht traurig stimmen würde, wenn jemand sie erwähnt.
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












