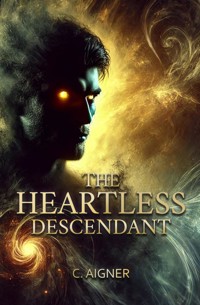
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was geschieht, wenn Liebe über die weltliche Sicht und jede bisher gemachte Erfahrung hinausgeht? Kannst du diese unsichtbare Bindung begreifen, die man nicht sehen aber bis ins tiefste Innere spüren kann? Bist du bereit für tiefe Sehnsucht und einen Einblick ins Übernatürliche? Wahre Liebe ist das reinste Geschenk des Lebens, das von nichts auf der Welt aufgewogen werden kann. Halte an deiner Liebe fest, denn sie ist das Licht in der Dunkelheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 1
Der Regen prasselte in schweren Tropfen gegen die Fensterscheiben des kleinen Cafés, das an einer verlassenen Straßenecke lag. Das Licht der Straßenlaternen flackerte und spiegelte sich in den Pfützen, während der Abend sich in eine undurchdringliche Dunkelheit hüllte. Fergus saß allein an einem Tisch in der Ecke, die Hände um eine Tasse schwarzen Kaffee geschlossen, die längst kalt geworden war.
Sein dunkles, langes Haar war sorgfältig gestylt. Die kurzen Seiten gaben den Blick auf ein markantes Gesicht frei, mit scharf geschnittenen Wangenknochen, einer geraden Nase und einem Kinn, das von einer leichten Schattenlinie geziert wurde. Doch es waren seine Augen, die auffielen. Sie glühten wie flüssiger Bernstein, ein Farbton, der in der Dunkelheit zu leuchten schien. Ein Blick aus diesen Augen genügte, um die meisten Menschen nervös zu machen, auch wenn sie nie genau wussten, warum. Fergus war es gewohnt, dass sie sich abwandten, dass sie ihn nur als einen Fremden sahen, der zu perfekt, zu anders wirkte, um wirklich hierher zu gehören.
Er beobachtete die Menschen, die draußen durch den Regen eilten, ihre Köpfe gesenkt, ihre Schritte hastig. Sie schienen so voller Leben, und doch vollkommen blind für alles um sie herum. Fergus verstand sie nicht. Diese ständige Hast, die Suche nach etwas, das die Menschen nie fanden. Er hatte Jahrhunderte damit verbracht, sie zu studieren, doch er war ihnen nie nähergekommen. Ihre Welt war nicht die seine. Er fühlte sich wie ein Schatten in einer Realität, die ihn niemals ganz aufnehmen würde.
Doch heute war etwas anders.
Er spürte es, bevor er es sah. Eine Präsenz, die sich wie ein leises Flüstern durch die Luft zog. Ein schwaches Zittern, das sich in seinem Inneren ausbreitete, wo seit Jahrhunderten nichts war. Es wirkte, als hielte die Dunkelheit selbst den Atem an.
Die Tür des Cafés öffnete sich mit einem leisen Klingeln und sie trat ein.
Eine junge Frau, kaum älter als Mitte zwanzig, mit heller Haut und müden Augen. Sie war blond. Ihr Haar hing in nassen Strähnen an ihrem Gesicht herab, doch es verlor nichts von seinem goldenen Glanz. Ihre Haut war bleich, fast durchsichtig, und betonte die zarte Struktur ihrer Wangenknochen und das helle Blau ihrer Augen, das einen starken Kontrast zu ihrem kränklichen Teint bildete. Ihre Lippen waren voll, aber nahezu ohne Farbe, wie ein dunkles Rot, das mit der Zeit verblasst war. Trotz ihrer offensichtlichen Schwäche, den trägen Bewegungen und dem leichten Zittern ihrer Hände, war sie wunderschön. Eine Schönheit, die Fergus für einen Moment innehalten ließ.
Doch es war nicht ihr Aussehen, das ihn wirklich fesselte. Es war ihre Seele. Fergus fühlte die merkwürdige Energie, die sie ausstrahlte. Schwach, flackernd wie eine Kerze im Wind, und doch unverkennbar besonders. Ihre Seele schien halb im Jenseits zu sein, halb noch an diese Welt gebunden.
Die junge Frau trug einen dicken grauen Mantel, der jedoch nicht ihre Statur verbarg, die schmal und zerbrechlich wirkte. Ihr Körper war zierlich, fast zu leicht für die Welt. Und dennoch ging sie mit einem merkwürdigen Anflug von Würde, als weigerte sie sich, sich ihrer Krankheit zu beugen.
Fergus wusste sofort, was es war. Auf ihr lag der Schatten eines sterbenden Herzens. Sie litt an einer schweren Krankheit, vermutlich einer seltenen Form von Herzinsuffizienz. Ihr Körper war beinahe am Ende, aber ihre Seele... Ihre Seele brannte wie ein Stern, etwas zu trüb und trotzdem unendlich faszinierend.
Seine Augen folgten ihr, wie sie sich vorsichtig umsah, als ob sie etwas suchte, das sie nicht benennen konnte. Dann fiel ihr Blick direkt auf ihn.
Sie hielt inne und für einen Moment schien sie die Luft anzuhalten. Ihre blauen Augen musterten ihn, verweilten auf seinen Bernsteinaugen, als versuchte sie, den Mann vor sich zu entschlüsseln. Fergus konnte die Faszination spüren, die von ihr ausging, aber auch die Unsicherheit. Sie wusste nicht, wer oder was er war, doch seine Präsenz ließ sie nicht los.
»Du bist... anders«, sagte sie schließlich. Ihre zarte Stimme so leise, als hätte sie gar nicht bemerkt, laut zu sprechen.
Er hob eine Augenbraue. »Anders?« Seine Stimme war tief und hatte einen leichten Unterton, der wie ein verborgenes Grollen klang.
Sie senkte den Blick, als ob sie plötzlich verlegen wäre. »Entschuldige. Ich meine... Du siehst nicht aus, als würdest du hierher gehören. Du wirkst...« Sie hielt inne und suchte nach Worten. »Unwirklich.«
Ein schwaches Lächeln spielte um Fergus’ Lippen. Unwirklich. Es war nicht das erste Mal, dass er so beschrieben wurde. Doch diesmal klang es anders. Es war keine bloße Beobachtung, sondern eine Art Bewunderung, die sich in ihren Worten verbarg.
»Vielleicht gehöre ich das auch nicht«, antwortete er gelassen, seine Stimme ein geheimnisvolles Flüstern.
Sie setzte sich langsam auf einen Stuhl in seiner Nähe, die Finger um das dunkle Holz der Lehne geklammert. Trotz ihrer Schwäche, zwang sie sich, ihn anzusehen. »Was machst du hier? In einer Stadt wie dieser?«
»Ich warte«, erklärte Fergus und lehnte sich zurück, seine Augen suchten erneut die ihren.
»Worauf?«
Er hielt inne. »Vielleicht auf dich.«
Die junge Frau schien von seiner Antwort überrascht. Für einen Moment suchte sie nach Worten, aber ihr Blick blieb an ihm haften, als versuchte sie den Schleier, der ihn umgab, zu durchdringen. Sie zog ihren nassen Mantel enger um die Schultern und ließ sich schließlich ganz auf den Stuhl sinken, der sich schräg gegenüber von Fergus befand.
»Auf mich?« Ihre Stimme war mehr ein Hauch als ein Ton, doch die Neugier in ihren tiefblauen Augen war nicht zu übersehen.
Fergus beobachtete sie schweigend. Er spürte, wie seine Anwesenheit wie ein Magnet auf sie wirkte. Es war nichts Neues, dass man so auf ihn reagierte. Und doch fühlte es sich diesmal anders an. Normalerweise war es Furcht, die die Menschen fesselte. Ein instinktives Unbehagen, das sie packte. Doch diese Menschenfrau hatte ganz offensichtlich keine Angst.
»Vielleicht«, antwortete er gelassen und ließ die Andeutung absichtlich vage. Er nahm einen Schluck von seinem kalten Kaffee, als wäre das Gespräch nichts weiter als eine beiläufige Unterhaltung. Doch seine bernsteinfarbenen Augen blieben unablässig an ihr haften.
Sie runzelte die Stirn, ihre Neugier wuchs mit jedem seiner Worte, die mehr Fragen aufwarfen, als sie beantworteten. »Das ist kein richtiger Grund. Niemand kommt in dieses Café, um zu... warten.« Sie machte eine Geste in Richtung des fast leeren Raumes, in dem nur eine ältere Kellnerin gelangweilt über ihr Handy wischte. »Was also machst du hier?«
Ein Lächeln huschte über seine Lippen, schmal, kaum sichtbar, doch es ließ seine Augen für einen Moment aufblitzen. »Ich könnte dich dasselbe fragen«, erwiderte er ruhig.
Sie zögerte, bevor sie sich etwas aufrechter setzte. Trotz ihrer Gebrechlichkeit schien sie nicht gewillt, sich einschüchtern zu lassen. »Ich... brauchte einen Moment Ruhe«, gestand sie schließlich. »Einen Ort, an dem ich einfach atmen kann.« Sie sprach die letzten Worte mit einer Melancholie aus, die Fergus zaudern ließ.
»Und das ist schwer für dich.« Es war keine Frage.
Ihre Augen weiteten sich leicht, perplex von seiner Treffsicherheit. »Ja«, murmelte sie. »Aber wie kommst du darauf?«
»Na ja, man sieht es dir an.« Fergus sprach die Wahrheit, aber nicht die ganze. Er hatte die Schatten unter ihren Augen, den blassen Teint und die Art, wie sie ihre Schultern hielt, sofort bemerkt. Doch was es wirklich verriet, war ihre Seele. Ein schwaches, aber unerschütterliches Licht, das gegen die Dunkelheit ankämpfte, die sich um sie legte.
»Du bist ziemlich gut darin, Menschen zu lesen«, bemerkte sie und ein müdes Lächeln umspielte ihre Lippen.
»Menschen zu lesen«, wiederholte er mit einem Anflug von Ironie in der Stimme. »Das ist... quasi mein Job.«
»Dein Job?« Ihre Stirn legte sich in Falten. »Du bist also hier, um zu arbeiten?«
»Gewissermaßen.« Fergus verschränkte die Arme vor der Brust. Er hatte nicht vor, ihr mehr zu verraten, als sie ohnehin schon vermuten konnte. »Ich arbeite... mit Menschen. Ich beobachte sie. Beurteile sie.«
Ihre Augen glitten über sein Gesicht und Fergus konnte förmlich sehen, wie sie versuchte, die Lücken in seiner Antwort zu füllen. »Das klingt... ungewöhnlich. Was bist du? Ein Psychologe? Ein Ermittler?«
Ein leises Lachen entkam ihm, trocken und ohne echte Freude. Es war eine naive menschliche Schlussfolgerung von ihr. »Etwas in der Art.«
»Du bist merkwürdig, weißt du das?« Sie schüttelte ungläubig den Kopf, doch ihr Lächeln blieb bestehen. »Aber irgendwie gefällt mir das.«
Fergus musterte sie für einen langen Moment, ließ die Worte in der Luft hängen. Merkwürdig. Das hatte noch nie jemand mit einem derartigen Hauch von Zuneigung zu ihm gesagt.
»Die meisten Menschen halten sich fern von Dingen, die ihnen merkwürdig erscheinen«, erklärte er. »Du anscheinend nicht.«
Die junge Frau hob leicht die Schultern. »Vielleicht, weil ich selbst ein bisschen merkwürdig bin.»
Er sagte nichts darauf, doch er konnte nicht anders, als ihre Worte in sich aufzunehmen. Sie war besonders, das hatte er sofort erkannt. Und während die Menschen, die er üblicherweise traf, in Furcht oder Ignoranz lebten, war sie bereit, ihn anzusehen, wirklich anzusehen.
»Also?«, fragte sie daraufhin, ihre Stimme etwas fester. »Wenn du mich beobachtest, was siehst du?«
Ein Gedanke huschte durch Fergus’ Geist. Er könnte ihr die Wahrheit sagen, ihr alles offenbaren, was er wusste. Über die Krankheit, die sie langsam von innen heraus zerstörte, und die unausweichliche Tatsache, dass ihre Zeit fast abgelaufen war. Doch etwas hielt ihn zurück.
»Ich sehe eine junge Frau«, antwortete er stattdessen, seine Stimme gedämpft und ernst. »Eine, die mehr Stärke hat, als man ihr zutrauen würde. Eine, die dem Regen trotzt, obwohl sie weiß, dass er sie schwächer macht.«
Ihre Lippen öffneten sich leicht und Fergus wusste, dass er sie mit seinen Worten verblüfft hatte. Doch bevor sie etwas sagen konnte, fuhr er fort: »Und ich sehe jemanden, der versucht, immer einen Weg zu finden. Selbst wenn unklar ist, wohin er führt.«
Sie senkte ihren Blick für einen Moment und atmete tief durch. Ihre Hände ruhten ineinander verschränkt auf ihrem Schoß, die blassen Finger leicht zitternd. Der Regen klopfte weiterhin unnachgiebig gegen die Fenster, als wollte er sie beide zwingen, ihre Worte lauter werden zu lassen, als sie beabsichtigt waren.
»Du hast recht«, gestand sie, ihre Tonlage ganz klar. »Ich suche einen Weg. Aber ich weiß, dass er enden wird, bevor ich ihn wirklich finden kann.«
Kapitel 2
Fergus schwieg, seine bernsteinfarbenen Augen blieben auf ihr Gesicht gerichtet. Jede ihrer Bewegungen, jeder Atemzug, der etwas zu schwer schien, offenbarte ihm mehr, als sie selbst vielleicht wusste. Doch er sagte nichts.
»Ich habe eine Herzkrankheit«, fuhr sie fort, ohne ihn anzusehen. Ihre Finger spielten nun unruhig mit einer Falte in ihrem Ärmel, als suche sie Halt in der Bewegung. »Sie wurde vor zwei Jahren diagnostiziert. Anfangs war es nicht so schlimm. Nur ab und zu Schmerzen und ein bisschen Müdigkeit. Aber es wird schlimmer, jeden Tag etwas mehr.«
Sie hob ihren Blick und Fergus sah die Anstrengung in ihren Augen, die Wahrheit auszusprechen, ohne sich der Hoffnungslosigkeit hinzugeben. »Die Ärzte haben gesagt, es gibt kaum etwas, was sie tun können. Vielleicht eine Transplantation, aber die Chancen stehen schlecht.«
Er wusste das alles bereits, zumindest auf die eine Art, die er nicht erklären konnte. Die Dunkelheit in ihrer Seele trug die Geschichte ihrer Krankheit wie eine unauslöschliche Narbe. Doch etwas an der Art, wie sie sprach, mit einer Mischung aus Akzeptanz und Trotz, ließ ihn ihre Geschichte hören wollen.
»Und was tust du?«, fragte er. Seine Stimme ruhig, aber mit einem Hauch von Interesse, das ihn selbst überraschte.
Sie lächelte leicht, ein Schatten von Bitterkeit in ihrem Ausdruck. »Ich lebe.« Sie zuckte die Schultern, als wäre das die einfachste Antwort der Welt. »Ich weiß, wie kitschig das klingt, aber... ich habe keine Wahl. Ich kann mich entweder in meiner Wohnung verkriechen und warten, oder ich kann versuchen, etwas zu fühlen. Etwas Echtes, weißt du?«
Fergus neigte leicht den Kopf, als würde er ihre Worte abwägen. Etwas Echtes. Es war eine Idee, die ihm so fremd war wie die Menschen selbst. Sein Leben war eine Kette von Pflichten, ein endloser Kreislauf von Aufgaben, die weder Raum für Freude noch für Verzweiflung ließen. Doch als er in ihre Augen blickte, die trotz allem einen Funken Hoffnung trugen, spürte er etwas Neues.
Es war nicht mehr als ein Flüstern in der tiefsten Dunkelheit seines Inneren. Ein Anflug von Wärme, die ihn verunsicherte. Fergus konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so etwas gefühlt hatte. Oder ob er es überhaupt je getan hatte.
»Das ist mutig«, bemerkte er nach einer Weile, seine Stimme fast unhörbar.
Die junge Frau kicherte leise. Ein raues, aber ehrliches Geräusch. »Mutig? Nein. Es ist einfach stur. Ich will nicht, dass mein Leben nur aus Traurigkeit und Schmerz besteht. Wenn ich sowieso nicht lange habe, dann will ich am Ende wenigstens wissen, dass es Momente gab, die es wert waren, gelebt zu haben.«
Er spürte, wie ihre Worte sich in ihm festsetzten, wie kleine Dornen, die eine ungewollte Veränderung bewirkten. Er betrachtete sie einen Moment lang und ließ das Gewicht ihrer Menschlichkeit auf sich wirken.
»Und heute«, fragte er langsam, »ist einer dieser Momente?«
Sie sah ihn nachdenklich an und für einen Augenblick schien die Zeit stillzustehen. Dann nickte sie. »Vielleicht. Es ist selten, dass ich mit jemandem spreche, der nicht sofort Mitleid hat oder mich wie eine wandelnde Tragödie behandelt. Wie ich schon sagte, du bist... anders.«
Anders. Das Wort ließ ihn innerlich aufhorchen. Doch Fergus zeigte keine Reaktion. Er hielt ihrem Blick wortlos stand. Bemerkte, wie etwas an ihr ihn unaufhaltsam anzog. Nicht nur ihre Verletzlichkeit, sondern auch ihre Stärke, die durch all die Risse hindurch schimmerte.
Er hätte etwas sagen können, irgendetwas, um die Spannung zu brechen. Doch er schwieg, ließ die Stille sprechen, während er in sich selbst suchte und dabei nur noch mehr Fragen fand.
Nach einer Weile seufzte die Frau leise und lehnte sich zurück. »Entschuldige, ich wollte dich nicht mit meiner Lebensgeschichte belasten.«
»Du hast mich nicht belastet.« Seine Antwort kam schnell, fast zu schnell, und er konnte den Anflug von Verwunderung in ihren Augen sehen. »Manchmal müssen Dinge eben einfach gesagt werden.«
Sie musterte ihn, als suche sie nach einer tieferen Bedeutung hinter seinen Worten. Dann lächelte sie wieder, dieses Mal ohne Bitterkeit. »Vielleicht hast du recht.«
Fergus sah zu, wie sie ihren Blick kurz zum Fenster wandte, wo der Regen immer noch unnachgiebig fiel. Und für einen Moment, der länger dauerte, als er hätte sein dürfen, fragte er sich, ob es tatsächlich ein Schicksal gab, das ihn hierher geführt hatte. Hierher zu ihr.
Sie schüttelte leicht den blonden Kopf, als wollte sie sich aus ihren eigenen Gedanken befreien. Die Uhr an der Wand hinter Fergus zeigte bereits, dass der Abend weit fortgeschritten war.
»Es ist schon spät«, bemerkte sie leise, ohne ihn anzusehen, ihre Stimme plötzlich gedämpft. »Ich sollte gehen.«
Fergus nickte langsam, als ob er es erwartet hatte. »Ja. Es ist wohl besser, wenn du jetzt gehst.«
Ihre Augen trafen sich und für einen Wimpernschlag hielt die Welt den Atem an. Die junge Frau spürte, wie eine unerklärliche Schwere sich in ihrer Brust festsetzte. Vielleicht lag es an der Art, wie der Fremde sie ansah. Mit einer Intensität, die sie nicht einordnen konnte. Vielleicht lag es an dem Gefühl, dass sie ihm mehr von sich selbst preisgegeben hatte, als beabsichtigt.
»Ich... danke dir«, sagte sie schließlich und stand vorsichtig auf, den grauen Mantel enger um sich ziehend. Ihre Beine fühlten sich schwach an und draußen wartete die Kälte auf sie. Doch das Gespräch mit ihm hatte ihr mehr gegeben, als sie erwartet hatte.
»Es war eine durchaus interessante Unterhaltung«, erwiderte Fergus, während er sich ebenfalls erhob. Er blieb einen Moment länger stehen, als überlegte er, ob er noch etwas hinzufügen sollte. Doch schließlich verschwand der Gedanke und er sagte nur: »Pass auf dich auf, Lisha.«
Ihre Augen weiteten sich ein kleines Stück. »Woher weißt du meinen Namen?«
Fergus lächelte leicht. Aber es war kein wirkliches Lächeln, eher ein schattenhaftes Zucken der Lippen. »Du hast es mir gesagt, als du reinkamst.«
Nachdenklich runzelte sie die Stirn. Sie konnte sich gar nicht daran erinnern. Doch dann stimmte sie ihm zu: »Richtig. Ich habe es dir ja erzählt.« Ihre Gedanken schienen sich in seiner Gegenwart zu verirren, als ob er eine Fessel für ihre Aufmerksamkeit war, die sie nicht ganz abschütteln konnte.
»Wie auch immer«, fuhr sie fort, sich von ihm abwendend. »Ich muss jetzt wirklich los. Ich wollte nicht die ganze Nacht hier sitzen.«
Fergus nickte, als sie sich in Richtung der Tür bewegte. Doch gerade als sie die Hand auf den Griff legte, drehte sie sich ein letztes Mal zu ihm um. »Meinst du, wir werden uns mal wiedersehen?« Ihre Stimme war leiser geworden, fast wehmütig.
Ein merkwürdiges Gefühl schlich sich in Fergus’ Brust. Es war nichts, das er wirklich begreifen konnte, eher ein unruhiges Flimmern, das ihm den Atem raubte. »Vielleicht«, erwiderte er ruhig. »Vielleicht werden wir das.«
Für einen Augenblick schien alles wie eingefroren. Lisha zögerte, als würde sie nach einem letzten Funken Hoffnung in seinen Worten suchen, die er gerade ausgesprochen hatte. Doch dann öffnete sie die Tür und trat hinaus in den Regen, der nun wieder stärker fiel, als sie ihre Schritte beschleunigte.
Fergus stand noch einen Moment regungslos da, seine bernsteinfarbenen Augen auf den regennassen Boden gerichtet, der draußen durch den Schein der Straßenlaternen glitzerte.
Er wusste nicht, warum diese Begegnung ihn so berührte. Warum die Worte von Lisha, dieses leise, unaufdringliche Dankeschön, ihn nicht losließen. Die meisten Menschen hatten die Flucht vor ihm gesucht, hatten ihn gemieden, ihn als das Unheimliche wahrgenommen, das er war. Doch sie hatte das nicht.
Lisha. Ihre Stärke, ihre Zerbrechlichkeit, ihre ungewöhnliche Akzeptanz des Schmerzes. All das zog ihn auf eine Weise an, die er nicht begreifen konnte.
Ein seltsames, ungewohntes Gefühl raste durch ihn, wie ein Strom aus Eis und Feuer zugleich. Fergus war sich nicht sicher, was es war, aber er konnte nicht leugnen, dass er sich schon jetzt nach ihr sehnte. Nach etwas, das er nicht greifen konnte, aber dennoch fühlte.
Schließlich schüttelte er den Kopf, als wollte er den Gedanken vertreiben. Es war sinnlos, sich damit aufzuhalten. Er hatte keine Zeit für solche Emotionen, keinen Raum, um sich von ihnen leiten zu lassen. Doch etwas sagte ihm, dass dies nicht das letzte Mal war, dass ihre Wege sich kreuzen würden.
Und als er die Tür des Cafés hinter sich schloss, konnte er das Gefühl nicht loswerden, dass der Regen nicht nur draußen fiel, sondern auch tief in ihm drinnen.
Kapitel 3
Fergus betrat das halb verfallene Haus, in welchem sich sein nächster Auftrag befand. Die Luft in den Fluren war dick und stickig. Der Geruch von altem Holz und abgestandenem Staub schien alles zu erdrücken. Die Treppenstufen unter seinen Füßen knirschten bei jedem Schritt, den er nach oben in den dritten Stock stieg.
Vor einer roten Tür, deren Lack beinahe vollständig abgeplatzt war, blieb Fergus stehen. Er machte sich nicht die Mühe, die Klinke zu betätigen, sondern trat die Tür einfach ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Während der Rahmen ächzend nachgab, fiel das Türblatt krachend nach innen.
In der Ecke des Zimmers, das von schwachem, vergilbtem Mondlicht durchflutet wurde, hockte eine Gestalt. Corey. Ein Mann, mittleren Alters, mit wilden, verzweifelten Augen. Seine Hände begannen zu zittern, als er Fergus ansah.
»Bist du hier, um mich zu holen… oder?« Nur mit Mühe schaffte er es, die Worte herauszubringen. Angst kroch aus der Frage, als wäre sie ein lebendiges Wesen, das mit den feinen Rissen der Wände tanzte.
»Ja«, antwortete Fergus trocken und kalt, fast schon gelangweilt.
Er machte einen Schritt auf sie zu. Die Dunkelheit um ihn herum schien sich wie ein lebendiger Schatten zu weiten, als er die zitternde Gestalt des Mannes weiterhin im Blick behielt. Der Raum, in dem sie standen, war ein Verlies aus Gestank und Erbärmlichkeit. Fergus ließ seinen Blick schweifen, als wäre er in einem Museum und betrachtete ein besonders hässliches Kunstwerk an einer der Wände.
»A–a–aber... warum?«, stotterte Corey angsterfüllt.
Ein verächtliches Seufzen entwich Fergus’ Kehle. »Du hast also geglaubt, du könntest entkommen«, säuselte er, seine Stimme noch kälter als zuvor. Die Worte waren nicht an den Mann gerichtet, sondern schienen eher eine Reflexion seiner eigenen Gedanken zu sein. »Aber du kannst nicht entkommen.«
Der Mann hob den Kopf, die Augen weit aufgerissen. »Hey, Mann, ich habe niemanden getötet! Ich habe... ich habe doch nur ein paar Fehler gemacht!«
Fergus’ Blick verfinsterte sich und ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen. »Ein paar Fehler? Du meinst all die Leben, die du zerstört hast? Die Frauen, die du missbraucht hast? Die Kinder, die du verletzt hast?... Das sind nur ein paar Fehler?«
Corey zuckte zusammen, als hätte er einen Schlag erhalten. »Komm schon. Ich... ich versuche doch schon, mein Leben zu ändern, mich zu ändern. Ich will das alles hinter mir lassen! Es war... es waren doch nur ein paar Jahre. Ich war ein Idiot, aber ich...« Seine Stimme zerbrach, als er versuchte, sich zu rechtfertigen.
Fergus’ Augen verengten sich. »Du hast dein eigenes Todesurteil unterzeichnet, mein Freund. Mit all den Frauen, an denen du dich vergangen hast. All den Kindern, denen du Leid zugefügt hast, weil du dich nicht unter Kontrolle halten kannst!«, warf er ihm fast tonlos vor, als würde er einen Bericht ablesen.
Doch die Worte hatten Gewicht und der Mann wusste, dass dies nicht einfach nur eine Lektion war. Es war sein Urteil. Er sprang auf, seine Hände vor sich ausstreckend, als wolle er Fergus anflehen. »Ich habe nie jemanden getötet! Ich habe niemandem das Leben genommen! Es war... nur Sex! Nur ein bisschen... nur etwas Spaß. Ich habe das nie ernst gemeint!«
Fergus schüttelte unbarmherzig den Kopf. »Du hast das Leben vieler zerstört. Die Seelen, die du gequält hast, sind in der Dunkelheit gefangen.«
Corey wankte, als ob er die Tragweite seiner Sünden nun wirklich spüren konnte. Doch es war zu spät. Der Moment war längst gekommen.
»Bist du... der Teufel?«
»Nein«, erwiderte Fergus mit einem Hauch von Ironie. »Ich bin nur der Bote.«
Die Finsternis im Raum schien sich zu verdichten, als würde sie Fergus’ Worte verstärken. Als sei seine Präsenz genug, um die Luft selbst zu ersticken. Das Dunkel in seinem Inneren wuchs, wurde immer dichter. Ein ewiger Begleiter.
Der Mann begann zu weinen, seine Tränen liefen in dicken Strömen über sein von Angst entstelltes Gesicht. »Ich habe mein Leben verschwendet«, heulte er. »Ich weiß es! Aber bitte...«
Fergus schaute zu ihm hinab, sein Gesicht kalt und ausdruckslos. Seit er denken konnte, hatte er solche Szenen gesehen. Die Schwachen, die Verzweifelten, die Schuldigen, die von der Welt abgewandt und vom Schicksal eingeholt wurden. Sie schrien, bettelten, versuchten zu verhandeln. Doch in Fergus’ Augen waren sie alle dasselbe, nichts als Schatten. Nichts, das ihm etwas bedeutete.
Er hatte keine Emotionen, die sich mit dieser Art von Tod verbanden. Kein Mitleid. Keinen Hass. Das war der Preis für seine Unsterblichkeit. Er, der niemals alterte, niemals wirklich starb. Ein Gefangener seines eigenen Daseins, verdammt, die Arbeit für seinen Vater zu erledigen, indem er diese verkorksten Seelen einholte und zur Rechenschaft zog.
»Es ist zu spät, um zu bereuen«, mahnte er leise. »Du wirst keine Erlösung finden. Es gibt keine Befreiung. Es gibt nur das Ende.«
Mit einer schnellen Bewegung trat er näher an Corey heran. Der Raum schien zu erzittern, als Fergus’ dunkle Aura sich um die Gestalt des Verurteilten legte. Die Luft verdichtete sich und der Mann stieß einen erstickten Schrei aus, als er die Kälte in Fergus’ Augen spürte. Eine Kälte, die tiefer ging als die eisigste Nacht.
»W–warte! Bitte! Bitte, tu es nicht!« Er rang verzweifelt nach Luft.
»Du bist doch schon nichts mehr als ein Schatten deiner selbst«, unterbrach Fergus ihn angewidert. »Die Welt wird dich nicht vermissen.«
Der Mann weinte weiter, doch Fergus fühlte nichts für diesen jämmerlichen Versager. Der Auftrag war einfach, die Aufgabe immer dieselbe. Es war seine Pflicht und doch brachte es ihm nichts. Keinen Trost. Keinen Abschluss. Keine Befriedigung.
Fergus stand einfach nur unbekümmert da. Und für den Bruchteil einer Sekunde konnte er sich sogar vorstellen, was Lisha gemeint hatte, als sie sich vor ein paar Wochen voneinander verabschiedet hatten und sie sagte, dass sie etwas Echtes erleben wollte. Etwas, das nicht von Schuld und Strafe überschattet war. Ein Leben jenseits der Dunkelheit.
Würde Fergus jemals wirklich verstehen, was sie damit gemeint hatte? Oder war er für immer dazu verdammt, in dieser Leere zu existieren? In diesem unbarmherzigen Zyklus der Pflicht, der niemals ein Ende fand, während er selbst nie in der Lage war, sich von der Dunkelheit zu befreien?
Ein bitteres Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Du kannst deine Fehler nicht mehr korrigieren. Du hast nie verstanden, was du getan hast, oder?« Fergus’ Stimme klang mitleidlos. »Du bist ein Teil der Unmenge von Sündern. Menschen, die glauben, sie könnten ohne Konsequenzen weiterleben. Aber das geht nicht. Nicht für dich, nicht für irgendwen deiner Art.«
In diesem Moment streckte Fergus die Hand aus und der Raum schien sich plötzlich zu verformen, als stünde die Zeit selbst still. Das Dunkel um ihn herum verdichtete sich, wurde sichtbar wie eine undurchdringliche schwarze Wolke, die über den Raum kroch. Es war der Beginn des Prozesses, den er in seiner Unsterblichkeit immer wieder vollzog.
Mit einer fließenden Bewegung seiner Hand wirbelte der Raum um den Mann und der Boden unter ihm begann zu vibrieren, als die Wände von unsichtbaren Kräften ergriffen wurden. Fergus’ bernsteinfarbenen Augen glühten wild, als er sich auf die Seele von Corey konzentrierte, die nun wie ein schattenhafter Abglanz vor ihm schwebte. So zerbrechlich, so leicht, dass sie fast durchsichtig wirkte.
»Du hast nie etwas gefühlt, was über dein eigenes Vergnügen hinausging«, flüsterte Fergus. »Aber jetzt wirst du fühlen, jede deiner Sünden. Jeden Moment, in dem du anderen Schmerz zugefügt hast.«
Der Mann starrte ihn an, als hätte er die Ausmaße seines Verbrechens erst jetzt verstanden. »Bitte... bitte nicht! Es tut mir leid... Ich habe nie...« Doch seine Worte brachen ab, als Fergus die dunklen Energien bündelte, die in seiner Hand pulsierten.
Der Raum begann zu brennen, jedoch nicht mit Feuer, sondern mit einer zerrissenen, schwarzen Energie, die die Luft selbst zerfraß. Ein Knistern war zu hören, als Corey von innen heraus zu verfallen schien und seine Umrisse sich aufzulösen begannen.
Fergus’ Worte hallten in der Finsternis wider: »Deine Zeit ist gekommen.«
Die Seele des Mannes verzog sich, warf sich in letzter Verzweiflung in der Luft hin und her. Doch es war vergebens. Unter einem lauten Zischen riss Fergus sie aus der Materie, aus der Welt der Lebenden, und schickte sie ins Jenseits. In das unendliche Schwarz, das nicht einmal die Erinnerung an ihn bewahren würde.
Der Mann war nicht mehr.
Fergus stand noch immer da, die Hand gesenkt. Die Kraft, die gerade einen weiteren Menschen in den Abgrund geschickt hatte, verflog langsam. In seinem Inneren jedoch blieb nur das gleiche Nichts, das ihn immer wieder heimsuchte. Es war eine Anklage an das Leben, das er führte. An die Schuld, die sein Vater auf ihn abgeladen hatte.
Ein letzter Blick in den Raum, dann wandte Fergus sich ab. Dieser Kerl war eine der vielen Seelen, die er in seiner Unsterblichkeit geerntet hatte. Doch anders als bisher, hatte der Moment etwas in ihm hinterlassen, das ihm noch weniger Frieden brachte. Es war die Leere. Die gleiche Leere, die er schon so lange kannte. Doch jetzt, mehr denn je, fühlte sie sich erdrückend an.
»Vielleicht ist es das, was du gemeint hast, Lisha«, murmelte Fergus leise, als er sich aus dem Haus zurückzog. »Vielleicht ist das Leben wirklich das, was wir daraus machen. Aber ich...«
Er wusste nicht, was er sagen sollte. Die Dunkelheit in ihm blieb und der Regen draußen fiel weiter, als wäre nichts geschehen.
Kapitel 4
Die Nacht war noch jung. Der leichte Wind trug den Geruch von Kälte, die in der Luft lag. Der Park, von alten Laternen schwach beleuchtet, lag ruhig da, als Lisha langsam den Kiesweg entlangging. Jeder Schritt war schwer, ihr Herz pochte dabei unregelmäßig, als suchte es einen eigenen Rhythmus, den ihr Körper nicht mehr finden konnte. Der vertraute Druck in ihrer Brust machte das Atmen mühsam, doch sie ging weiter.
Sie konnte nicht zu Hause bleiben. Die Enge der Wände, das monotone Ticken der Uhr, die Erinnerung daran, wie wenig Zeit ihr blieb. All das hatte sie hinausgetrieben. Der Park war Lishas Zufluchtsort. Ein Ort, an dem sie sich wenigstens für einen Moment lebendig fühlte.
Fergus stand im Schatten einer alten Eiche, unsichtbar für die Welt. Er vertrieb sich die Zeit, während er auf seinen nächsten Auftrag wartete. Er hatte nicht geplant, hier zu sein. Oder vielleicht doch? Es war, als hätte ihn etwas Unsichtbares hergeführt, eine sanfte, unaufhaltsame Kraft, die ihn zu diesem Ort zog.
Und dann sah er sie.
Lisha bewegte sich fast zögerlich. Das Licht der Laternen zeichnete einen silbrigen Schein auf ihr blondes Haar, das wie ein zerbrechlicher Heiligenschein wirkte. Sie war blass, ihre Bewegungen wirkten steif. Und doch war da etwas in ihr, eine leise Stärke, die Fergus fasziniert aus der Ferne beobachtete.
Plötzlich blieb Lisha stehen. Ihre Hand wanderte zu ihrer Brust und sie beugte sich leicht nach vorn. Ein Schmerz durchfuhr sie, ihre Lippen formten stumme Worte. Benommen taumelte sie und griff nach einer Laterne, um das Gleichgewicht zu halten. Doch ihre Finger rutschten ab.
Fergus war bei ihr, bevor er überhaupt darüber nachdenken konnte. Zielsicher griff er ihr unter die Arme.
»Du solltest nicht allein draußen unterwegs sein«, sagte er fast schon mahnend, doch mit ruhiger Stimme.
Lisha sah auf, überrascht, aber auch erleichtert, als sie ihn erkannte. »Was... was machst du denn hier?«
»Das könnte ich dich auch fragen«, entgegnete er. Seine bernsteinfarbenen Augen musterten sie eindringlich.
»Ich...« Lisha holte tief Luft, ihr Atem war flach. »Ich wollte einfach nur raus. Denn, weißt du, manchmal fühlt es sich an, als würde ich ersticken, wenn ich drinnen bleibe. Aber ich bin wohl zu weit gegangen.«
Fergus half ihr, sich auf eine nahegelegene Bank zu setzen. Seine Bewegungen waren geschmeidig, beinahe unnatürlich, und doch schien sie keinen Verdacht zu schöpfen. Für Lisha war er einfach da. Wie eine ungreifbare Konstante.
»Was genau ist es, das dich so quält?«, wollte er wissen. Seine hochgezogenen Brauen zeugten von Ernsthaftigkeit.
Lisha zögerte. Für sie war es ein intimer Moment. Und doch fühlte sie sich nicht unwohl, ihm zu antworten. »Mein Herz... durch die Krankheit schlägt es nicht so, wie es sollte. Die Ärzte sagen, es könnte jederzeit aufgeben.« Sie versuchte, ein Lächeln aufzusetzen, doch es wirkte brüchig. »Manchmal fühle ich mich, als würde ich mit einem tickenden Countdown in der Brust leben. Es ist seltsam. Aber ich versuche, nicht daran zu denken.«





























