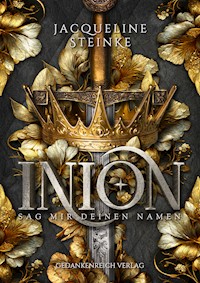Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eisermann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Bei einem mysteriösen Autounfall verliert die junge Alexis Colt ihre Familie. Ihr Elternhaus wird abgebrannt und wichtige Utensilien, darunter der Dolch ihres Vaters, werden gestohlen. Auf der Suche nach dem Erbstück gerät Alexis in einen Kampf mit einem Dämon, der sie fast das Leben kostet. Ihr Retter, Raymund Tray, nimmt Alexis unter seine Fittiche und schult sie darin, dass übernatürliche Böse in Amerikas Straßen aufzuspüren und zu töten. Als dann auch noch der Engel Jophiel bei ihr auftaucht, gerät sie immer tiefer zwischen die Fronten von Himmel und Hölle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Stopp, geh noch nicht!
The Huntress – Der Kampf um die Siegel E-Book-Ausgabe 4/2020 Copyright ©2020 by Eisermann Verlag, Bremen Ein Imprint der Eisermann Media GmbH Umschlaggestaltung: Jaqueline Kropmanns Satz: André Piotrowski Lektorat: Christiane Hochberger Korrektur: Daniela Höhne http://www.Eisermann-Verlag.de ISBN: 978-3-96173-181-7
Warnung: Bei diesem Buch handelt es sich um eine Fan-Fiction zu Supernatural. Mögliche Ähnlichkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.
Prolog
Meine Eltern hatten keine zwei Stunden gebraucht, um zu bemerken, dass ich verschwunden war – auf eine Party, die sie mir verboten hatten.
Der Regen rieselte trübsinnig an den beschlagenen Fenstern des Camaros herab, mit dem sie mich abgeholt hatten.
Die beiden waren stocksauer. Sie stritten sich darum, wer Schuld hatte, dass das unartige, sechzehnjährige Mädchen verschwunden war. Emmy, meine kleine Schwester, saß neben mir und lächelte mich mitfühlend an, während sie mit den Händen einen Schmetterling formte.
Als der Stresspegel und die Lautstärke unerträglich wurden, unterbrach ich wütend und leicht lallend die hitzige Diskussion meiner Eltern.
»Könnt ihr bitte aufhören zu streiten!« Ihre Stimmen waren wie Hammerschläge, die gegen meinen Schädel schlugen und heftige Schmerzen verursachten. In meinem Kopf drehte sich alles und das ständige Ruckeln des Autos verursachte mir Übelkeit.
»Wärst du einfach zu Hause geblieben, hätten wir keinen Grund zum Streiten! Wirklich, Alexis, was hast du dir dabei gedacht?«
Mir entschlüpfte ein Seufzen. »Ich dachte, ich könnte einmal in meinem Leben Spaß haben.«
Mein Vater war einer dieser regelgetreuen Kirchgänger, der uns jeden Sonntag in das heilige Haus Gottes zerrte. Alkohol, Partys und Jungs gehörten zu den Dingen, die strikt untersagt waren. Zugegeben, im Nachhinein war die Menge an Alkohol keine gute Idee gewesen.
Mein Blick traf den meines wütenden Vaters im Rückspiegel. Frustriert ließ ich mich zurück in meinen Sitz sinken.
Der Regen wurde schlimmer und schlug unerbittlich gegen das Glas. Mein Vater sah sich hektisch um. Er drückte eine Hand auf sein Ohr, als wolle er ein Geräusch ausblenden.
»Alles okay, Schatz?«, fragte meine Mutter besorgt.
Er nickte und griff nach ihrer Hand.
Emmy musste niesen und verteilte ihren Rotz überall in ihrem Gesicht. Mir wurde übel. Als sie dann auch noch mit der Zunge versuchte, den Schleim abzulecken, musste ich mich abwenden. Galle stieg meine Kehle empor und ich war mir sicher, dass ich nicht mehr lange fähig sein würde, meinen Mageninhalt bei mir zu behalten.
»Könntest du deiner Schwester die Nase putzen?«, bat meine Mutter mich und reichte mir ein Taschentuch.
Ich sah Emmy noch einmal an, spürte den Würgereflex in meiner Kehle und wandte mich schnellstmöglich ab, um mich nicht vor Ort übergeben zu müssen. Ich schüttelte den Kopf.
Sie schnallte sich ab und lehnte sich über ihren Sitz zu uns nach hinten, um an Emmy heranzukommen.
In diesem Moment riss mein Vater das Lenkrad herum.
Meine Mutter wurde zur Seite geschleudert und stieß sich den Kopf an der Decke. Der Wagen rutschte über den nassen Asphalt. Mein Vater ruderte wie wild an dem Lenkrad, was jedoch nichts half. Unser Wagen schoss über den Grünstreifen. Meine Schwester schrie auf. Panik überkam mich. Mir blieb die Luft weg.
Die Beifahrertür krachte so heftig an einen Baum, dass mich mein Sicherheitsgurt in den Sitz presste. Ich klammerte mich fest. Glassplitter prasselten durch den Wagen. Reflexartig presste ich die Augen zu, um mich vor ihnen zu schützen. Der Wagen schlitterte unkontrolliert weiter, drehte sich um die eigene Achse. Mein Herz raste, das Blut rauschte in meinen Ohren. Ich öffnete die Augen und sah noch, wie die Fahrerseite einen weiteren Baum rammte. Mein Kopf prallte gegen die Tür.
Dann wurde es schwarz und still.
Ich schlug orientierungslos meine Augen auf. Was ich sah, war verschwommen und leicht verzerrt. Ich fasste vorsichtig an meine pochende Schläfe, von der eine warme Flüssigkeit herunterrann. In meinem Kopf hämmerte es unerträglich. Meine Glieder schmerzten. Ich kniff kurz die Augen zusammen, um die Sicht scharf zu stellen. Das Atmen fiel mir unerträglich schwer. Der Gurt hatte sich straff um meinen Brustkorb gelegt.
Ich sah mich um, konnte im ersten Moment aber nur Umrisse erkennen. Ich hatte Mühe, klar sehen zu können, auch weil es dunkel war. Vorsichtig drehte ich den Kopf.
Meine Schwester war still … zu still. Sie hatte die Augen geschlossen und bewegte sich nicht. In ihrer Brust steckte ein großes Stück Glas, das vermutlich von der zerbrochenen Frontscheibe stammte. Ich erkannte nur schemenhaft, dass ihre Kleidung von einer dunklen Flüssigkeit durchtränkt war. Meine Mutter lag zusammengekrümmt über das Armaturenbrett gebeugt. Ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen.
Ich begann zu schreien, doch meine Stimme drang nur gedämpft an meine Ohren.
Mein Vater bewegte sich. Ich sah durch den Tränenschleier, wie er sich mir zuwandte und etwas sagte. Ich verstand ihn nicht, konnte ihn einfach nicht hören. Mein Kopf pulsierte heftig und der Schmerz nahm unerträgliche Ausmaße an, bevor sich mein Körper den Qualen ergab, und ich zurück in den Nebel sank.
Das Erste, das ich registrierte, als ich zu Bewusstsein kam, war eine Hand, die sanft auf meiner Schulter lag. Ich hob den Blick und sah in ein hellblaues Augenpaar. Schemenhaft erkannte ich, dass die Augen zu einem Mann gehörten, den ein heller Schein umgab. Ich versuchte, die Hand wegzuschieben, schaffte es aber nicht. Meine Kraft war vollkommen erschöpft. Jede noch so kleine Bewegung fühlte sich an, wie tausend kleine Messerstiche.
»Bring sie hier raus!«, befahl mein Vater, dessen Stimme ich nur undeutlich hörte, dem Fremden.
Ich löste meinen Blick von dem Mann, dessen Hand weiter auf meiner Schulter lag. Mein Kopf fuhr ruckartig herum, was das Rauschen in meinen Ohren verschlimmerte. Ich kniff kurz die Augen zusammen, um den Schmerz zu verdrängen, und fixierte meinen Vater, der sich mir und dem Fremden zugewandt hatte. Er röchelte. Blut lief ihm aus dem Mundwinkel. Tränen brannten in meinen Augen, rannen über meine Wangen. Ein erstickter Laut entwich meiner Kehle, die sich merkwürdig eng anfühlte.
Dad sah mich an. »Hab keine Angst. Er wird auf dich aufpassen.«
Der Fremde löste meinen Sicherheitsgurt und zog an mir. Ich schlug gegen seine Arme, schrie um mein Leben. Sofort setzte ein brennender Schmerz ein, der mich heftig zusammenzucken ließ. Ich ignorierte ihn und strampelte nur stärker, als der Mann an mir zerrte. Auf keinen Fall wollte ich den Wagen ohne meinen Vater verlassen. Aber so wie Dad mich ansah, würde genau das passieren.
Das Knirschen von Metall ließ mich aufhorchen. Abrupt brach ich meine Gegenwehr ab und beobachtete, wie sich das Blech auf der Motorhaube verbeulte. Es sah aus, als stehe etwas darauf, aber es war nichts zu erkennen. Ich vernahm ein Kratzen wie von Krallen und ein leises Knurren.
Wir starrten auf die Motorhaube.
»Schaff sie sofort hier raus!«, schrie mein Vater voller Panik. Er wandte sich mir ein letztes Mal zu, seine Augen vor Schreck und Entsetzen geweitet, bevor er wieder zur Motorhaube sah.
Ohne zu zögern, beugte sich der Fremde vor, umschloss mich mit seinen starken Armen und hievte mich mühelos aus dem Auto. Ich schrie und kämpfte gegen den Griff des Fremden an. Auf keinen Fall wollte ich meinen Vater zurücklassen. Doch es half nichts. Ich war zu schwach. Der Fremde brachte ein wenig Abstand zwischen mich und das Wrack, das Feuer gefangen hatte. Ich zappelte in seinem festen Griff und schrie mir die Seele aus dem Leib. Es war unsinnig, das wusste ich, aber ich wollte einfach nur zurück zu meiner Familie.
Der Mann mit den blauen Augen versuchte, mich so sanft wie möglich festzuhalten. Doch auch diese leichten Berührungen fühlten sich wie kleine Messerstiche an. Er sah sich besorgt nach meinen Eltern und meiner kleinen Schwester um, schüttelte jedoch den Kopf, als er bemerkte, dass ich ihn hoffnungsvoll ansah.
Ich sah zurück und bereute es augenblicklich. Ein grauenhafter Schrei bohrte sich tief in mein Innerstes und ich sah, wie sich die Flammen unaufhaltsam über ihre Beute hermachten. Erneut schossen mir Tränen in die Augen. Das Auto stand lichterloh in Flammen. Auch wenn ich wusste, dass es nur Sekunden waren, die vergangen waren, fühlte es sich wie Stunden an. Mein Körper begann unkontrolliert zu zittern und mein Herz raste. Der Fremde bemerkte es und drückte mich sanft an seine Brust. Eine angenehme Wärme umfasste mich und brachte mich ein wenig zur Ruhe. Sein angenehmer Geruch nach Sandelholz umhüllte mich. Plötzlich war alles still. Friedlich. Ruhig. Für einen Moment schien das Chaos um mich herum an Bedeutung verloren zu haben und in den Hintergrund gerückt zu sein.
Ich schaute zu dem Wrack, das zur Todesfalle meiner Familie geworden war. Mein Körper wurde taub und meine Emotionen zogen sich zurück. Versteckten sich im hintersten Teil meines Bewusstseins und ließen nichts als ein stumpfes Gefühl zurück.
Nach einer Weile setzte er mich am Straßenrand ab. Ich hörte das Quietschen herannahender Reifen. Der Mann kniete sich vor mich, wie ein Ritter vor eine Prinzessin. Er musterte meinen Körper und ich fühlte mich plötzlich schrecklich entblößt. Als würde er nicht nur meine Wunden, sondern auch meine Seele durchleuchten. Ich begann zu wimmern. Seine Hand strich sacht über meinen Rücken. Er flüsterte irgendetwas in einer Sprache, die ich nicht verstand, aber allein der Klang seiner Stimme schaffte es, meinen Puls zu beruhigen.
In der Ferne hörte ich Stimmen. Ein Rettungstrupp hatte sich um den Unfallort versammelt. Versuchte zu helfen, wo nichts mehr zu helfen war. Und dann …
Da stand ein Mann neben dem Fahrzeug.
Dunkle Kleidung. Helle Zähne, die in der Dunkelheit boshaft grinsten. Er hielt eine Leine in der Hand, die zu einem Hund führte, der neben ihm saß. Zumindest sah es auf den ersten Blick aus wie ein Hund. Als ich mich auf das Wesen konzentrierte, um herauszufinden was da tatsächlich saß, fiel mir auf, dass er viel größer als ein normaler Hund war. Sein Fell sah zerrissen aus und eine Flüssigkeit tropfte von seinen gefletschten Zähnen. Das Vieh sah in meine Richtung.
Ich erstarrte. Ein plötzlicher Adrenalinschub jagte durch meinen Körper und hinterließ eine Gänsehaut auf meinen Armen.
Obwohl er so weit weg war, sah ich deutlich die Aggressivität in seinen Augen. Ich kroch ein Stückchen weiter nach hinten. Der Mann, der eben noch vor mir gehockt hatte, war verschwunden, und als ich zurücksah, war auch der Kerl mit dem Hund fort.
Kälte breitete sich in mir aus. Ich sackte in mich zusammen. Rollte mich auf den Boden zu einer Kugel. Verängstigt und allein lag ich auf dem nassen Asphalt. Der Regen bedeckte mich und versteckte meine Tränen.
Eine mit Latex überzogene Hand griff nach mir. Die Hand einer Frau, die mit einer Taschenlampe in meine Augen leuchtete. Sie rief ihrem Kollegen etwas zu, der sofort mit einem Koffer angerannt kam.
»Alles wird gut«, flüsterte sie. Eine glatte Lüge. Nichts würde gut werden.
Dann ergaben sich mein Körper und mein Verstand, und die Welt um mich herum versank in Dunkelheit.
Vier Jahre später …
Kapitel 1
Der Mann war stark. Er warf mich quer durch den Raum, als wöge ich nichts. Ich schlug mit dem Kopf gegen die Wand, rappelte mich schnell wieder auf, leicht schwankend und mit pochendem Schädel. Was zum Teufel ist er?
Seine Augen glühten in einem tiefen Schwarz. Er nahm den Dolch, der einst meinem Vater gehört hatte, aus seinem Gürtel und schwenkte ihn vor mir hin und her.
»Hast du wirklich geglaubt, es wird so einfach?« Er zog den linken Mundwinkel nach oben, was ihm ein tölpelhaftes Aussehen verlieh.
Ich erstarrte für einen Moment, als er direkt vor mir stehen blieb. Er legte mir eine Hand auf die Schulter, und sofort durchzog mich ein eisiger Schauer. Als er versuchte, mir noch näher zu kommen, und sich vorbeugte, verpasste ich ihm eine schallende Ohrfeige, die ihn allerdings nur zu amüsieren schien. Mist!
»Na, na. Nicht doch. Wir werden eine Menge Spaß miteinander haben.«
Er hatte kaum den Satz beendet, da holte er aus. Obwohl ich versuchte, ihm auszuweichen, streifte sein Messer meine rechte Seite. Die Waffe zerschnitt mein Top und Blut lief an meinem Körper hinab. Der Mann hob das Messer in die Luft und musterte für einen Moment mein Blut an der Klinge, bevor er es genüsslich ableckte. Fassungslos starrte ich ihn mit offenem Mund an.
»Ausgezeichnet im Geschmack. So jung und unverbraucht.«
Was zur Hölle …? Schockiert sah ich ihm zu, wie er auch die andere Seite des Messers ableckte, bevor er auf mich losging.
Ich wehrte ihn ab, verpasste ihm ein paar kräftige Hiebe mit geballten Fäusten, doch auch er traf mich mit Schlägen und der verdammten Klinge des Messers, und das nicht zu knapp. Immer wieder schlug er auf mich ein, prügelte mich zu Boden und ließ mir keine Chance auf eine Gegenwehr, sodass mir am Ende keine Möglichkeit blieb, mich zur Wehr zu setzen. Ich sackte zu Boden, rollte mich zu einer Kugel zusammen und versuchte, mit meinen angewinkelten Armen sowohl meinen Magen als auch meinen Kopf zu schützen, nicht wissend, wie lange ich den stetig heftiger werdenden Tritten standhalten würde. Meine Rippen gaben irgendwann knirschend nach und ein enormer Schmerz erfasste meinen Körper. Mein Schrei hallte durch den Raum und ich rollte mich auf die weniger verletzte Seite, um davonzurobben. Doch die Schmerzen ließen mich innehalten und aufkeuchen. Mein Angreifer erwischte meinen Kopf, ein- oder auch zweimal, bevor sich mein Sichtfeld zu einem kleinen Punkt zusammenzog. Sterne tanzten vor meinen Augen.
Wie aus weiter Ferne bemerkte ich einen anderen Mann, der mit einem Messer die Brust meines Angreifers durchbohrte. Eine Art Blitz durchzog ihn und dann fiel er kraftlos zu Boden. Jemand rüttelte mich an der Schulter und zog meinen Arm von meinem Gesicht weg. Ich wimmerte, zitterte, dann versank ich in Dunkelheit und Stille.
Ein stetiges Piepen holte mich langsam aus meinem Schlaf. Im ersten Moment dachte ich, es würde sich um meinen Wecker handeln, doch den hatte ich seit knapp vier Jahren nicht mehr zu hören bekommen. Und der wäre garantiert wesentlich nervtötender gewesen.
Ich versuchte, meine Lider zu öffnen, und blinzelte gegen ein viel zu grelles Licht an, das den gesamten Raum flutete. Schnell kniff ich die Augen wieder zusammen. Ich brauchte einen Moment, bevor ich einen erneuten Versuch startete. Dieses Mal war es nicht mehr ganz so unangenehm. Ich spürte ein leichtes Wummern in meinem Kopf. Meine Kehle war trocken und als ich versuchte, mich aufzusetzen, um meine Umgebung genauer zu betrachten, durchzog mich ein stechender Schmerz, der von meiner linken Seite in meinen gesamten Körper strahlte. Ich keuchte auf, versuchte, den Schmerz zu umgehen, indem ich mich ein kleines Stück auf die rechte Körperhälfte rollte. Es half. Ich atmete ein paarmal tief durch und konzentrierte mich auf meine Umgebung, sorgsam darauf bedacht, mich nicht weiter zu bewegen. Das Erste, das ich wahrnahm, war der Schlauch, der in meiner linken Hand steckte und zu einem Infusionstropf neben meinem Bett führte. Das Zweite war, dass ich nur einen Kittel trug und drittens klebten auf meiner Brust kleine Elektroden, die zu einem zweiten Gerät rechts von mir führten. Wie es aussah, überwachte das Ding meine Vitalwerte. Ich wollte mit der rechten Hand an die Elektroden kommen, schaffte es aber nicht. Mein Arm war zu taub und jede kleine Bewegung erinnerte mich daran, dass meine Rippen immer noch da waren. In dem Raum gab es nicht viele Möbel. Ein abschließbarer Schrank zu meiner Linken mit angrenzender Tür zum Badezimmer, zu meiner Rechten stand ein kleiner Beistelltisch und ein Fenster gewährte den Blick auf die Natur. Draußen war es dämmrig, was darauf schließen ließ, dass es entweder Morgen oder bereits Abend war. Ich versuchte, mich erneut auf meine Ellbogen zu stützen. Eine verdammt schlechte Idee. Sofort hatte ich das Gefühl, tausend kleine Messer würden sich in meine Seite bohren. Ich keuchte auf, kniff die Augen fest zusammen und drängte meine Tränen zurück.
»Ich würde liegen bleiben«, empfahl mir eine raue Stimme, die mich zusammenzucken ließ. Ich blickte in die Richtung, aus der diese kam und sah einen dunkel gekleideten Mann, der in der Ecke des Zimmers in einem Sessel saß und eine Zeitung in den Händen hielt. Er war mir zuvor gar nicht aufgefallen. Auf den ersten Blick war mir klar, dass er kein Angestellter des Krankenhauses sein konnte. Da er auch kein Bekannter von mir war – ich hatte genau genommen keine Bekannten –, fing mein Herz sofort an, wild zu hämmern. Er blickte über den Rand seiner Zeitung, legte sie auf den kleinen Tisch neben dem Sessel und bückte sich nach seiner Tasche, die vor ihm auf dem Boden lag.
Misstrauisch beobachtete ich ihn.
»Weißt du, wo du bist?«, fragte er, während er seine Tasche durchsuchte.
Ich nickte, was er natürlich nicht sah, da sein Blick nach unten gerichtet war. Als er keine Antwort bekam, blickte er kurz auf. Zögerlich bewegte ich meinen Kopf erneut, sorgsam darauf bedacht, nur den Kopf zu bewegen. Er nahm es zur Kenntnis und wandte sich wieder seiner Tasche zu, schob sie zur Seite, erhob sich und kam mit einer länglichen Schatulle in der Hand auf mich zu.
Der Kerl war schätzungsweise etwas unter zwei Meter groß, hatte kurz geschorene Haare und eine dunkle Haut. Meine Musterung endete abrupt, als er sich auf der Bettkante niederließ. Reflexartig wich ich zur Seite, was meine Rippen sofort abstraften. Trotz des Schmerzes schaffte ich es, die Bettdecke schützend bis unter mein Kinn zu ziehen. Meine zitternden Hände krallten sich in den rauen Stoff. Die Maschine piepte immer schneller.
Der Mann schaute auf den Monitor und runzelte die Stirn, bevor er mich ansah. Er hatte dunkelbraune Augen, unter denen sich ein lila Schatten auf die Haut gelegt hatte. Vorsichtig versuchte ich, noch weiter von ihm wegzurobben. Er blickte auf die Schatulle in seiner Hand und streckte sie mir entgegen, was mich erneut zusammenschrecken ließ.
»Ich dachte, das möchtest du wiederhaben«, sagte er in einem Ton, der klang, als würde er mit einem verängstigten Tier sprechen.
Zugegeben, wirklich zutraulich war ich in dem Moment nicht. Aber wer war das schon, wenn er in einem Krankenhaus aufwachte und plötzlich ein fremder Mann im Zimmer war, der sich dann auch noch auf das Bett setzte?
Er betrachtete mich eindringlich. Vermutlich begutachtete er die Wunden, die mit absoluter Sicherheit mein Gesicht entstellten. Sie brannten und juckten, ein Zeichen dafür, dass der Heilungsprozess bereits eingesetzt hatte. Vielleicht sah er sich aber auch einfach nur mein schmutziges Gesicht an. Ich lebte seit drei Jahren auf der Straße und war mit Sicherheit kein schöner Anblick. Nach dem Unfall meiner Eltern hatte ich in verschiedenen Pflegefamilien gelebt, bei denen ich es allerdings nie lange ausgehalten hatte. Ich hatte die erzwungene Nähe und das greifbare Mitleid, das ständig in der Luft hing, einfach nicht ertragen und war weggelaufen. Ich nächtigte auf Parkbänken und bettelte um ein paar Dollar, um mir wenigstens einmal am Tag eine Mahlzeit zu finanzieren. Ich war auf die schiefe Bahn geraten, prügelte mich oft, um den angestauten Frust loszuwerden, und beging mehrere Ladendiebstähle. Ich nahm nie etwas, was ich nicht dringend brauchte, hatte mir nur Nahrung, Kleidung und einen Schlafsack für die kalten Winternächte besorgt. Mir war bewusst, dass ich vermutlich unangenehm roch, auch wenn mir das selbst nicht mehr auffiel. Aber wer sich nicht jeden Tag wusch, stank nun einmal. Ich selbst nahm den Geruch überhaupt nicht mehr wahr.
Als ich keine Anstalten machte, die Schachtel entgegenzunehmen, öffnete er sie und zeigte mir den Inhalt. Sprachlos starrte ich in das längliche Kästchen. In ihr lag der Dolch meines Vaters, das einzige Erbstück, das mir geblieben war. Er war von dem Blut befreit worden und glänzte in dem künstlichen Licht der Deckenleuchten. Überrascht, aber vor allem erleichtert ließ ich die Decke sinken und griff nach dem Dolch. Tränen traten mir in die Augen, als ich mit den Fingern vorsichtig über die feinen Maserungen des Holzgriffs strich.
»Danke«, flüsterte ich heiser.
Er lächelte kurz, zog den Beistelltisch näher an das Bett und hob die gelbliche Abdeckung einer Schüssel an, unter der eine widerlich stinkende Suppe zum Vorschein kam. Ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht in laute Würgegeräusche auszubrechen. Normalerweise lehnte ich Essen nicht ab, vor allem nicht, wenn es umsonst war, aber diese Suppe stank derart nach faulen Eiern, dass sich mir der Magen umdrehte. Vielleicht lag meine empfindliche Reaktion auch daran, dass ich ziemlich angeschlagen war. Ich schob das Tablett zur Seite, wodurch ich mir einen strengen Blick des Fremden einfing.
»Du solltest etwas essen.«
»Nur wenn du willst, dass ich dir vor die Füße kotze«, gab ich zurück.
Er schnaufte kurz und ging zurück zum Sessel. Ich betrachtete den Fremden eine Weile und war froh, dass er wieder Abstand zu mir aufgebaut hatte. Trotzdem wunderte mich, dass er das Zimmer nicht verließ. Jetzt mal ehrlich, welcher Kerl setzte sich in ein Zimmer zu einer Patientin, die er nicht kannte? Und da der letzte mir unbekannte Mann mich in dieses Krankenhaus befördert hatte, hatte ich jeden Grund, misstrauisch zu sein. So wie der Typ aussah, hätte er auch als Gangmitglied irgendeiner Straßenbande durchgehen können. Vielleicht trug er sogar eine Waffe bei sich. Zugegeben, jetzt wurde ich ein wenig paranoid, aber wer wäre das in dieser Situation nicht geworden?
Ohne Vorwarnung wurde die Zimmertür aufgestoßen und zwei Frauen kamen herein. Eine von ihnen war schätzungsweise Mitte vierzig und steuerte auf mein Bett zu. Sie musterte mich kurz, schüttelte missbilligend den Kopf, umrundete das Bett, um die Maschine neben mir zu betrachten und die Werte in eine kleine Tabelle einzutragen, die auf dem Tisch daneben lag. Ohne ein einziges Wort riss sie mir die Elektroden unsanft von der Brust, dass ich zusammenzuckte. Allerdings wusste ich nicht, ob vor Überraschung oder Schmerz.
»Verdammte Scheiße, geht das auch vorsichtiger?«, keifte ich die Frau an.
Sie würdigte mich keines Blickes und kümmerte sich ungerührt um den Infusionsschlauch. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie einfach daran gerissen hätte, um mich vom Tropf zu nehmen.
»Miss Colt, wissen Sie, wo Sie sind?«, fragte mich die zweite Frau. Sie trug einen langen Kittel und um ihren Hals hing ein Stethoskop.
Ich musste das Namensschild nicht lesen, um zu wissen, dass dies die behandelnde Ärztin war. Das verriet bereits ihre Körpersprache. Gestraffte Schultern, die Augen nur auf das Klemmbrett in ihrer Hand gerichtet, aus dem sie vermutlich meine Diagnosen entnahm.
»Entweder in einem echt miesen Hotel, oder, was die schlimmere Alternative wäre, in einem beschissenen Krankenhaus«, antwortete ich und sah mich noch einmal in dem Raum um. Ja, ich war definitiv in einem verdammten Krankenhaus und das war überhaupt nicht gut.
Sie stand so weit abseits, dass ich mir sicher war, noch nach Straße und Mülltonnen zu riechen. Ich meine, müsste die Frau nicht irgendetwas an mir überprüfen? Vermutlich reichte ihr die Tatsache, dass ich atmete vollkommen aus.
Sie blickte kurz auf, um den fremden Mann zu mustern. Missbilligend schüttelte sie den Kopf und warf ihm einen wütenden Blick zu. Anscheinend kannten sich die beiden. Wie sie ihn ansah, war das nicht mit positiven Erinnerungen verbunden.
Das letzte Mal, dass ich an so einem Ort festgesessen hatte, war nach dem Tod meiner Familie gewesen. Die schlimmste Zeit, die ich je hatte mitmachen müssen. Mutterseelenallein lag ich in meinem Zimmer, und durch die Stille, die dieser Ort mit sich brachte, hatte ich genug Zeit, meinen Gedanken hinterherzuhängen. Und das war das Letzte, was ich wollte. Auch die Krankenschwestern waren damals keine große Hilfe gewesen. Entweder sie hatten Mitleid mit mir oder waren so charmant wie die Dame, die gerade mit dem Beistelltisch mein Bett gerammt hatte. Ich stöhnte kurz auf und warf ihr einen vernichtenden Blick zu, den sie jedoch nicht realisierte.
Die Ärztin kam nun doch näher. »Sie haben sich zwei Rippen geprellt und einige Blutergüsse zugezogen. Sie werden ein paar Tage hierbleiben müssen, vorausgesetzt, Sie sind versichert.«
Oh, na klar, das liebe Geld. Tja, Pech für sie. Wenn man auf der Straße lebte, besaß man diesen Luxus nicht.
Der Mann in dem Sessel räusperte sich geräuschvoll.
Die Ärztin wandte sich ihm zu, und beide tauschten böse Blicke aus.
»Tja, nein, habe ich nicht. Also werde ich wohl heute noch gehen können«, stellte ich zufrieden fest. Das hier war der letzte Ort, an dem ich bleiben würde.
»Sie können jemanden anrufen, der Sie abholen kann«, war ihre knappe Antwort.
Wieder funkelten sich die Frau und der Fremde wütend an. »Bevor ich es vergesse: Zwei Polizisten möchten noch mit Ihnen über den Vorfall sprechen. Ich werde Sie gleich kontaktieren. In der Zeit können Sie Ihren Anruf tätigen.«
»Kann ich kurz mit Ihnen sprechen«, warf der Fremde ein. Ohne auf eine Antwort zu warten, stapfte er zur Tür hinaus.
Schnaubend folgte die Ärztin dem Mann. Auch die andere Dame verließ das Zimmer.
Ich nutzte die Gelegenheit und testete meine Belastbarkeit. Jede Bewegung verursachte so schreckliche Schmerzen, dass ich hätte schreien können. Doch wenn ich hier herauskommen wollte, musste ich mich zusammenreißen. Ich warf die Decke zur Seite, stemmte mich auf meine Unterarme und blieb einen Moment in der Position. Ich atmete stoßweise aus, wartete, bis der Schmerz sich legte, und wagte einen weiteren Schritt in Richtung Freiheit. Als ich dann tatsächlich auf den Beinen stand, wurde mir kurz schwarz vor Augen. Ich krallte mich am Bettgestell fest, drängte die aufkommende Ohnmacht zurück, atmete erneut tief durch und befreite meinen Arm von dem Infusionsschlauch samt der daran befestigten Nadel. Eine wirklich miese Idee, denn es tat ziemlich weh und fing sofort an zu bluten. Schnell griff ich nach dem Zipfel meines Hemdes und drückte ihn auf die kleine Einstichstelle. Ich seufzte auf, wagte ein paar Schritte in Richtung Tür und lehnte mich erschöpft gegen den Kleiderschrank. Ich war nicht einmal zwei Meter weit gekommen und hatte das Gefühl, einen verdammten Marathon gelaufen zu sein. Meine Glieder schrien nach Erlösung, ich keuchte angestrengt. Die beste Voraussetzung, um aus dem Krankenhaus zu fliehen.
Da ich befürchtete umzukippen, wenn ich noch einen weiteren Schritt wagen würde, lehnte ich mich mit dem Rücken gegen das Holz des Schrankes und ließ den Kopf nach hinten sinken. Von der Tür drangen gedämpfte Stimmen. Ich mobilisierte meine verbliebenen Kräfte und erreichte schlussendlich die Tür. Blöderweise unterhielten sich die Ärztin und der Fremde angestrengt auf dem Flur, sodass jede Flucht unmöglich war. Ich stützte mich an der Wand ab und verfolgte das Gespräch.
»Raymund, ich werde jetzt die Polizei informieren. Die werden sich um das Mädchen kümmern«, erklangt die helle Stimme der Ärztin.
Raymund? Das musste der Name des Fremden sein.
»Du kannst diese Idioten nicht anrufen, solange ich nicht mit ihr gesprochen habe. Ich muss wissen, woran sie sich erinnern kann. Wenn sie etwas Falsches aussagt, könnte das für sie schwerwiegende Konsequenzen haben.«
»Blödsinn. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie die Kleine in eine Irrenanstalt einweisen, weil ihr niemand glaubt. Oder sie wird aufgrund ihrer Vorstrafen verhaftet und in ein Gefängnis gesteckt.«
Irrenanstalt? Was hätte ich denn bitte sagen sollen, um in einer Irrenanstalt zu landen? Da war ein Mann, der mich angegriffen hat. Dass er mein Blut von der Klinge geleckt hatte, machte ihn zum Irren und nicht mich.
»Das würde die Situation natürlich besser machen«, spottete der Mann aufgebracht. »Was meinst du mit: Vorstrafen?«
»Als wenn du das nicht wüsstest. Wie ich dich kenne, hast du die Kleine bereits komplett abgecheckt.«
Was meinte die Ärztin damit?
»Abgesehen davon hat der Polizist, der heute Morgen zufällig auf der Intensivstation war, sie erkannt. Es liegt ein Haftbefehl vor und eine Vermisstenanzeige. Vermutlich von den letzten Pflegeeltern. Sie hat es nie lange mit anderen Menschen ausgehalten. Das Mädchen hat die letzten Jahre auf der Straße verbracht, und genauso sieht sie auch aus.«
»Jetzt mach mal halblang!«, erwiderte der Fremde aufgebracht.
»Wenn du mich fragst, ist das Mädchen nicht dein Problem.«
»Marissa. Aus irgendeinem Grund wollte das Mädchen an den Dolch der Engel kommen. Vielleicht ist sie selbst ein Jäger. Bitte, lass mich nur kurz mit ihr sprechen. Nur damit ich im Klaren bin, ob das Mädchen vielleicht mehr weiß, als gut für sie ist«, flehte er fast.
Dolch der Engel? Meinte er etwa das Ding, das mein Vater mir hinterlassen hatte?
»Ich werde jetzt die Polizei informieren …«
»Marissa, du weißt, dass diese Trottel nach mir suchen! Ich will nicht in ihrem Zimmer stehen, wenn sie hier eintreffen«, unterbrach er sie.
Ich schlug mir die Hand vor den Mund. Kacke, verdammte! Der Kerl wurde also von der Polizei gesucht.
»Dann solltest du dich beeilen. Die Polizeiwache ist höchstens zehn Minuten von hier entfernt.« Ich hörte Schritte im Flur widerhallen, dann war es still.
Die Tür wurde aufgerissen.
Erschrocken sprang ich zur Seite, rammte mit meinem Becken gegen den Schrank und sank auf die Knie. Ich schrie auf, stieß ein paar Flüche aus und kauerte mich auf den Boden zusammen. Die Schmerzen waren so stark, dass sie mir die Tränen in die Augen trieben. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie der Fremde sich zu mir beugte und die Arme nach mir ausstreckte. Fluchtartig wich ich zur Seite, stemmte mich in die Höhe und stolperte ein paar Schritte rückwärts. Die Angst und das Adrenalin verdrängten für einen Augenblick den Schmerz. Leider hielt das Ganze nicht lange an.
»Was hast du gemacht?« Der Mann deutete auf das Ende meines Hemdes, an dem das Blut von meinem Arm klebte.
»Wer bist du?«, keuchte ich. Verdammter Schmerz, er schnürte mir die Kehle zu. Oder war es die Angst?
»Alexis«, sagte er sanft und hob die Hände beschwichtigend in die Höhe. »Ich werde dir nichts tun. Ich will dir helfen.«
»Das beantwortet nicht meine Frage«, flüsterte ich fast schon. Meine Stimme zitterte so sehr, dass ich mir nicht sicher war, ob er mich gehört hatte. Ich sah mich nach einer Fluchtmöglichkeit um und hatte die Wahl zwischen einem Sprung aus dem Fenster oder dem Einschließen im Badezimmer. Ich machte einen Satz nach vorn, doch der Fremde war schneller.
Er hielt mit einer Hand den Griff der Badezimmertür fest und stand mir dabei gefährlich nahe. Ich wollte von ihm wegkommen, konnte mich aber nicht mehr bewegen. Mein Kopf pochte wie verrückt, und ich hatte das Gefühl, mein Gleichgewicht zu verlieren.
Ich hatte nicht nur das Gefühl, tatsächlich zur Seite zu kippen. Bevor ich den Boden berührte, fingen mich zwei starke Arme auf. Ich zappelte, wollte mich befreien und machte damit alles nur noch schlimmer.
»Alexis, beruhig dich, bitte!« Seine Stimme war eine Mischung aus Besorgnis und Befehl.
»Lass mich los«, schrie ich aufgebracht.
»Sei leise!« Er drückte mir die Hand auf den Mund, erneut war ich den Tränen nah. »Versprichst du mir, nicht mehr zu schreien, wenn ich die Hand wegnehme?«
Natürlich nicht! Ich werde mein Schicksal nicht einfach so akzeptieren.
Er sah mich an. Ich erkannte die Entschlossenheit in seinen Augen. Wenn ich mich wehren würde, würde er mich gewaltsam mitnehmen, und das wäre für meinen geschundenen Körper noch weniger erfreulich. Ich nickte langsam. Erst als ich mich beruhigt hatte, ließ der Mann von mir ab und durchsuchte die leeren Schränke.
»Wo sind deine Sachen?«
»Keine Ahnung. Vermutlich hat man sie verbrannt. Wer würde sich auch die Mühe machen die dreckigen Kleider einer Obdachlosen zu waschen?« Der Satz brachte mir einen strafenden Blick von dem Fremden ein.
»Wir werden jetzt von hier verschwinden, und ich würde dich ungern in diesem Hauch von Nichts durch die Flure tragen.«
»Angst, dass ich mich erkälten könnte?«, entfuhr es mir. Keine Ahnung was mein krankes Hirn dazu antrieb, in dieser Situation einen miesen Witz zu machen. Das passierte mir oft, wenn ich mit einer Situation überfordert war.
»Es wäre zu auffällig!«, antwortete er streng.
Er ging ins Bad und kam mit leeren Händen zurück. »Verdammter Mist!« Er überlegte einen Moment, schnappte sich den Dolch, den ich unter der Decke versteckt hatte, bückte sich nach seiner Tasche, zog eine Jogginghose und ein T-Shirt heraus und hielt sie mir entgegen. »Zieh das an!«
»Nein!« Schon gar nicht, wenn man mir in einer Tour Befehle erteilte.
»Alexis, wir haben keine Zeit. Zieh die Sachen an oder du kommst so mit!«
»Du willst mich entführen?« Erschrocken wich ich zurück. Mir war natürlich schon vorher klar gewesen, dass er mich gegen meinen Willen mitnehmen würde. Es laut auszusprechen, machte die Situation nur realer.
»Nicht, wenn du freiwillig mitkommst.«
»Nein! Ich gehe doch nicht mit einem völlig Fremden mit!«
Ich schien seine Geduld auf die Probe zu stellen, denn er schnaufte verächtlich und mahlte mit dem Kiefer. Stimmen auf dem Flur ließen uns beide aufhorchen.
»Okay, du hattest genug Zeit.« Bevor ich fragen konnte, was er damit meinte, schlang er seine Arme um meinen Körper und hob mich mühelos hoch. Ein Arm ruhte unter meinen Knien, der andere umschlang meinen Rücken. Ich bäumte mich auf vor Schmerz und konnte mir einen Aufschrei nicht verkneifen.
Obwohl der Kerl wahnsinnig schnell agierte, waren seine Berührungen so sanft wie möglich. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, als hätte er mir absichtlich noch mehr wehtun wollen. Er wartete kurz, bis ich mich beruhigt hatte, und trat dann fest entschlossen mit mir auf den Flur. »Kannst du mir mal die Sachen abnehmen?«
Ich griff nach der Kleidung. Zum Festhalten fehlte mir die Kraft, also legte ich sie mir einfach auf den Bauch.
Er legte die Stirn in Falten »Alles in Ordnung?«
»Fantastisch! Wirklich, besser geht’s nicht!«
Seine Mundwinkel zuckten verräterisch. Irgendwie nahm das einen Teil meiner Anspannung.
»Hey! Stehen bleiben!«, rief eine dunkle Stimme, die vom anderen Ende des Flurs kam.
Der Mann drehte sich mit mir um und ich sah einen Polizisten, der in unsere Richtung sprintete. Ich blickte abwechselnd zwischen dem Polizisten und dem Fremden hin und her. Ich sollte schreien! Ich sollte erkenntlich machen, dass ich nicht mit dem Typen mitgehen wollte! Ich tat nichts dergleichen. Im Gegenteil, ich war völlig bewegungsunfähig.
Der Polizist hatte tiefschwarze Augen. Sofort blitzte das Bild meines Angreifers von letzter Nacht vor mir auf. Bevor der Mann uns erreichen konnte, standen wir plötzlich in einem Fahrstuhl. Die Türen schlossen sich und wir waren allein.
»Mist!«, fluchte der Fremde. »Kannst du stehen?«
Ich war mir zwar sicher, gleich umzukippen, aber ich nickte tapfer.
Er ließ mich vorsichtig runter und hielt mich so lange am Arm gepackt, bis er sicher war, dass ich standfest genug war.
Die Kleidung fiel zu Boden.
Er bückte sich, um sie mir wiederzugeben. »Zieh die Sachen über das Hemd«, wies er mich an.
Ich schaffte es nicht, meine Arme weit genug zu heben, um mir das Shirt überzustreifen. Außerdem zitterte mein ganzer Körper, was es schon schwierig genug machten, den Stoff zu packen.
Ohne zu zögern, nahm der Mann mir das Oberteil aus der Hand. »Kannst du dich ein wenig nach vorn beugen und die Arme ausstrecken?«
Ich versuchte es, bis sich der Schmerz bemerkbar machte. Offenbar reichte ihm meine nur wenig veränderte Position, denn er zog mir das Shirt ohne größere Probleme über. Auch bei der Hose half er mir. Er kniete sich vor mich, ließ mich in die Löcher steigen und zog die Hosen nach oben. So vorsichtig, dass er mich kaum berührte. Er verknotete die Kordeln der Jogginghose am Bund miteinander und betrachtete dann die geschlossene Tür.
»Wer bist du?«, wagte ich einen neuen Versuch.
»Raymund. Raymund Tray.« Er machte eine kurze Pause, sah zur Seite, dann wieder zu mir. »Ich will dir nichts tun, Alexis. Ich versuche, dir zu helfen.«
»Inwiefern?« Der Typ entführte mich und behauptete dann, mir helfen zu wollen.
»Ich erkläre dir alles, sobald wir hier raus sind. Solange musst du tun, was ich dir sage.«
»Woher weißt du, wie ich heiße?«
»Einer der Polizisten war heute Morgen in der Notaufnahme. Er muss dich durch ein Fahndungsfoto erkannt haben.« Er sah mich skeptisch an. »Du bist also wegen Körperverletzung vorbestraft, ja?«
»Ich musste mich auf der Straße oft durchsetzen. Also leg dich lieber nicht mit mir an«, warnte ich ihn. Dass ich die Anzeige bekommen hatte, weil ich meinen aggressiven Pflegevater mit einem Baseballschläger eine übergebraten hatte, nachdem er mich betatscht hatte, verschwieg ich.
»Mit deinen Verletzungen könntest du es nicht mit mir aufnehmen. Ich merk mir die Info aber für danach.«
»Für danach? Glaubst du, ich bleibe für immer bei dir, oder was sollte der Satz jetzt?« Ich war geschockt und wütend. Der glaubte doch wohl nicht, dass ich nach diesem ganzen Mist nur das Geringste mit ihm zu tun haben wollte? »Woher weißt du von meinen Vorstrafen?«
Etwas verlegen blickte er zu Boden. »Ich habe mich in den Polizeiserver gehackt.«
»Warum überrascht mich das nicht«, nuschelte ich in mich hinein. »Ich verstehe nicht, warum du so einen Aufriss machst und mich aus dem verdammten Krankenhaus bringen willst. Warum überlässt du mich nicht meinem Schicksal und lässt mich von der Polizei festnehmen?«
Raymund betrachtete mich eine ganze Weile, bevor sich ein Lächeln in sein Gesicht stahl. »Ehrlich gesagt: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber es fühlt sich richtig an.« Dann wurde er wieder sehr ernst. »Einen Grund gibt es doch. Diese Polizisten, das sind keine richtigen Beamten. Diese Männer sind hinter dir her …«
»Wegen der Fahndung?«, unterbrach ich ihn ungehalten. Natürlich wollten diese Polizisten mich hinter Gitter sperren.
Er schüttelte den Kopf. Raymund zog den Dolch hinter seinen Rücken hervor und wedelte damit vor meiner Nase herum. »Nicht wegen dir. Wegen dem hier.«
»Einem Erbstück?« Ich legte den Kopf schräg und sah ihn fragend an.
»Nein.« Er seufzte und überlegte scheinbar fieberhaft, wie er diese ganze Situation begründen sollte. »Ich werde dir alles erklären. Aber fürs Erste müssen wir hier raus.«
Der Fahrstuhl kam abrupt zum Stehen. Ein Poltern auf dem Dach ließ uns aufhorchen.
»Was war das?«, fragte ich alarmiert und krallte mich mit den Händen an dem hölzernen Griff vor dem Spiegel fest. Ich sah wirklich fertig aus. Als hätte ich mehrere Nächte durchgefeiert und Drogen eingeworfen. Meine Haut war so blass, dass ich aussah wie ein verdammtes Gespenst. Die spröden Lippen und die filzigen Haare machten das Ganze nicht besser.
»Nichts Gutes«, sagte Raymund.
Meine Alarmglocken schrillten. »Du machst mir wirklich Hoffnung.«
Die Dachluke öffnete sich und ein junger Mann in Polizeiuniform beugte sich über die Öffnung. Seine Lippen formten sich zu einem bösen Grinsen. Im nächsten Moment streckte er die Arme nach mir aus und versuchte mich zu packen.
Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich die schwarzen Augen erkannte.
Raymund baute sich vor mir auf. Wo auch immer er einen Revolver herhatte, er zielte damit auf den Kopf des Polizisten und drückte ab. Der Knall war so laut, dass ich zusammenschrak, und meine Rippen mir das mit einem fürchterlichen Stechen dankten. Ein schriller Pfeifton hallte in meinen Ohren nach und ließ alle anderen Geräusche um mich dumpf klingen.
Der Mann fiel in den Fahrstuhl und landete vor meinen Füßen. Zugegeben, er lag vor Raymunds Füßen; ihn nahm ich in dem Moment allerdings nicht wirklich wahr. Alles was ich anstarren konnte, war das Loch in der Stirn des Polizisten. Unweigerlich entfuhr mir ein Schrei.
Sofort legte Raymund mir seine großen Hände auf die Schultern. »Alexis, beruhig dich.«
»Du hast ihn erschossen. Du hast einen Polizisten erschossen!«, kreischte ich panisch. Ich war mit einem irren Entführer, der unnötigerweise auch noch eine scheiß Waffe besaß, in einem verdammten Fahrstuhl eingesperrt. Das war zu viel. Die Schmerzen, die Entführung und jetzt auch noch der tote Beamte. Ich stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Meine Hände wurden feucht, mein Puls raste und ich war einer Ohnmacht nahe. Ich versuchte mich von Raymund zu lösen, doch das ließ er nicht zu.
»Atme tief durch. Alles ist gut.« Ich hatte Schwierigkeiten, ihn richtig zu verstehen. Seine Stimme war leise und verzerrt. Es klang, als würde er meilenweit entfernt stehen, dabei presste er mich fest gegen seinen Körper.
Verarschte der Kerl mich? »Nichts ist gut! Überhaupt nichts ist gut!«, schrie ich ihn an, wodurch Schmerzen und Panik nur noch mehr zunahmen.
»Du musst jetzt ganz ruhig ein- und ausatmen.«
Ich verfluchte diesen Mistkerl, befolgte aber seinen Rat. Nach einer gefühlten Ewigkeit war ich wieder einigermaßen zurechnungsfähig.
»Ich bringe dich hier raus, aber du musst mir vertrauen, okay?« Raymund sah mich abwartend an.
»Okay …« Was auch immer mich dazu trieb, diesem Kerl zu vertrauen, ich tat es. Ich wollte nur hier raus.
Er hockte sich vor mich und faltete die Hände ineinander. Ratlos starrte ich ihn an, bis ich begriff, dass er durch den Fahrstuhlschacht flüchten wollte.
»Ich kann nicht«, stammelte ich.
»Du wirst.«
»Aber … aber da sind Spinnen. Ich … ich hasse Spinnen.« Das war der Moment, in dem ich meine Zurechnungsfähigkeit wieder verlor. Als wären Spinnen derzeit mein größtes Problem.
»Und hier drinnen liegt ein Dämon. Glaub mir, der Typ ist nicht tot, und eine Austreibung kann ich hier nicht durchführen«, sagte er ernst. Scheinbar hatte der Gute sich verplappert, denn er runzelte die Stirn und suchte vermutlich gerade nach einer Ausrede.
»Ein Dämon?« Erst da fiel mir seine Andeutung wieder ein. »Warte, was meintest du damit? Dass diese Beamten keine normalen Polizisten sind?«
»Alexis, ich erkläre dir alles später. Wir müssen hier schleunigst weg. Das wird nicht der einzige Dämon sein, der hinter uns her ist.«
Trotzig verschränkte ich die Arme vor der Brust. »Wenn du mir nicht sofort sagst, was hier vor sich geht, bewege ich mich keinen Millimeter mehr!«
Raymund funkelte mich wütend an, erhob sich, packte mich an den Schultern und sah mir fest in die Augen. »Sagt dir der Begriff Dämon etwas?«
Ich nickte. Ich kannte diese Wesen aus unzähligen Horrorfilmen, aber sie mir im realen Leben vorzustellen, gelang mir einfach nicht.
»Gut. Der Mann, der dich letzte Nacht angegriffen hat, war einer von ihnen. Ich bin schon eine ganze Weile hinter ihm her gewesen.«
»Warum?« Ich und meine blöde Neugierde. Spielte das in diesem Moment wirklich eine Rolle?
»Der Mann war derjenige, der meine Frau ermordet hat. Mehr sage ich nicht dazu. Und, um zum Thema zurückzukommen, du bist durch deinen bescheuerten Einfall, dich dem Typen allein zu stellen, direkt zwischen die Fronten geraten. Die Dämonen, die zu dem Mörder meiner Frau gehörten, wissen jetzt über dich Bescheid und sie werden dich solange jagen, bis sie dich erwischen. Was danach folgt, werde ich dir nicht erläutern. Sieh dir den Polizisten genau an. Sieht er für dich normal aus?« Er machte einen Schritt zur Seite, sodass ich den Mann auf dem Boden genauer betrachten konnte.
Seine Augen waren aufgerissen und komplett schwarz. Weder das Weiß des Augapfels noch die Iris waren zu sehen. Durch die Einschusswunde am Kopf trat kein Blut.
Raymund beugte sich zu dem Mann hinunter und öffnete vorsichtig dessen Mund. »Hier. Sieh dir das an.« Er entblößte eine Reihe spitzer Zähne, die mich sofort an das Gebiss eines Haifisches erinnerten. Ich hatte zwar noch nie von Dämonen mit Haifischgebiss gehört, aber ich hatte auch nie in Betracht gezogen, dass dieser Scheiß tatsächlich existierte. »Nicht ich bin dein Feind. Das da ist das wahre Böse.« Er stemmte sich in die Höhe und betrachtete mich flehend.
Das Ganze war mehr als surreal, aber was, wenn dieser Kerl tatsächlich die Wahrheit sagte? Was, wenn es da draußen noch mehr von diesen Dingern gab und sie tatsächlich hinter mir her waren? Aus irgendeinem mir unbegreiflichen Grund nickte ich. Ich stimmte ihm zu, mich von hier wegzubringen. Mich zu beschützen. Zumindest für den Moment.
Raymund lächelte mich an. Scheinbar war das seine Masche, mein Vertrauen zu gewinnen und blöderweise funktionierte sie ziemlich gut. Er kniete sich unter die Lucke und wartete, bis ich meinen Fuß in seine Hände gestellt hatte. »Du musst dich nur abstützen. Ich werde dich so weit nach ob schieben, dass du dich auf den Rand setzen kannst. Wenn ich oben bin, werde ich dir aufhelfen.«
Gesagt getan. Der Kerl war ziemlich stark. Er hob mich so weit an, dass er meine Füße auf seinen Schultern platzieren konnte, und ich keine Probleme hatte, mich auf den Fahrstuhl zu setzen.
Ich sah mich um. Es war ziemlich düster. Nur die offene Tür drei Stockwerke weiter oben ließ ein wenig Licht in den Schacht strahlen. Meine Haut kribbelte schon beim bloßen Gedanken daran, wie viele kleine Achtbeiner sich hier tummelten. Ich stützte meine Hände hinter meinem Rücken ab und machte sofort Bekanntschaft mit einem feinen, klebrigen Gewebe. Als mir dann auch noch etwas über die Finger flitzte, schrie ich auf.
»Was ist?«, rief Raymund alarmiert.
»Ich habe in ein Spinnennetz gefasst.« Angeekelt rieb ich meine Hände aneinander, um das widerliche Kribbeln loszuwerden. Unter mir erklang ein gedämpftes Lachen.
»Das ist nicht witzig«, fauchte ich.
»Schon gut, schon gut. Rutsch mal ein Stück zur Seite, damit der alte Mann hier auch herauskommt«, wies er mich immer noch lachend an.
Ich gab den Versuch, meine Beine anzuheben, schnell auf, da meine Rippen mir grausam verdeutlichten, dass sie noch da waren. Ich unterdrückte ein Stöhnen.
»Bleib so. Ich werde es schon schaffen«, sagte Raymund sanft.
Ich lehnte mich zurück, wanderte mit meinem Blick den Schacht empor und erstarrte. Durch die offene Tür grinste ein Mann auf mich herunter. Er machte einen Satz nach vorn und fiel mir entgegen.
»Raymund!«, kreischte ich panisch und kniff die Augen zusammen. Auf gar keinen Fall wollte ich sehen, wer da genau vor mir gelandet war. Eins war jedoch sicher: Polizisten sprangen nicht durch Fahrstuhlschächte! Ich hörte das Scheppern von Blech. Es knallte laut und plötzlich vibrierte der Boden. Zwei Hände legten sich auf meine Oberschenkel. Sofort schlug ich nach ihnen.
»Hey, hör auf. Ich bin’s!«
Ich öffnete zögerlich die Augen und blickte direkt in Raymunds Gesicht, das mich grimmig anstarrte. »Sorry.«
»Schon gut. Bereit, hier zu verschwinden?«
Ich nickte und sah mich noch einmal um. Der Mann, der eben noch auf mich zugesprungen war, lag regungslos auf dem Boden. Ich hatte vor lauter Panik überhaupt nicht mitbekommen, dass Raymund geschossen hatte.
Er hockte sich vor mich, sodass ich auf seinen Rücken klettern konnte. Ich schlang die Beine um seinen Körper und hielt mich mit den Händen an seiner Schulter fest.
Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und Raymund schwankte gefährlich zur Seite, fing sich dann aber wieder. »Verdammte Scheiße!«, fluchte er und stampfte mit dem Fuß auf, wie ein wütendes Kind.
Wir fuhren nach oben.
Raymund sah die offene Tür und ich schüttelte heftig den Kopf, bevor er auch nur andeuten konnte, was er vorhatte. »Halt dich gut fest.« Er sprang, ohne zu zögern, in den Flur. Netterweise wurden wir dort bereits von einem Arzt und einer Schwester empfangen. Ich hätte erleichtert aufgeschrien, hätten die schwarzen Augen der beiden nicht jede Euphorie in die Flucht geschlagen.
»Na, wo wollt ihr beide denn hin?«, fragte der Arzt mit einem breiten Grinsen. Er trug einen langen Kittel, hatte kurze Haare und eine kräftige Statur. Was allerdings wichtiger als die äußerliche Erscheinung war: Der Kerl trug eine Axt, die er definitiv nicht aus dem Krankenhausinventar hatte.
Raymund setzte mich vorsichtig auf dem Boden ab, richtete sich blitzschnell auf und baute sich vor mir auf, als der Arzt auf uns losging. Mein Begleiter hatte keine Schwierigkeiten, den Axthieben auszuweichen. Er bekam das Ding sogar zu fassen und rang mit dem Arzt um die Waffe.
Während sie sich in einem erbitterten Kampf befanden, schlenderte die Schwester fast gelangweilt auf mich zu. Wie in Trance nahm ich wahr, wie Raymund und der Arzt strauchelnd zu Boden gingen.
Er sah zu mir, bemerkte die Krankenschwester und ließ den Dolch über den glatten Boden in meine Richtung schlittern. Ich griff danach und richtete ihn auf die Frau.
Sie stoppte, betrachtete die Klinge und hob beschwichtigend die Hände. »Gib mir den Dolch, dann lasse ich dich am Leben«, sagte sie ruhig und machte noch einen Schritt in meine Richtung.
»Tu es nicht! Das ist eine Falle!«, rief mir Raymund entgegen, während er sich von dem Arzt befreien konnte.
»Ach, wirklich«, antwortete ich sarkastisch. Natürlich war das eine Falle! Ich hatte genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass die mich nicht lebend gehen lassen würden. Aber kampflos gab ich mich definitiv nicht geschlagen. Ich umklammerte den Holzgriff fester. Mein Herz schlug so schnell, dass ich Angst hatte, es würde mir aus der Brust springen. Meine Hände wurden feucht, was es mir schwerer machte, den Dolch festzuhalten. Wie aus dem Nichts stürmte der Arzt auf mich zu. Ich war so fixiert auf die Krankenschwester, dass ich ihn überhaupt nicht mehr wahrgenommen hatte. Gerade noch rechtzeitig schaffte ich es auf die Beine, streckte ihm das Messer entgegen und wurde zu Boden gerissen. Schwarze Punkte und ein unheimlicher Nebel tanzten um mein Sichtfeld. Der Raum begann zu pulsieren. Ich schloss die Augen. Die Luft wurde aus meinen Lungen gepresst und ich konnte das Keuchen und die Tränen nicht unterdrücken. Ich japste und keuchte. Der Schmerz war wieder da, tausendmal schlimmer als zuvor. Das unangenehme Gewicht wurde von meinem Körper gezerrt. Sofort rollte ich mich auf die Seite, versuchte, den Qualen zu entkommen, aber sie waren überall. In meinem Kopf, meinen Rippen, meiner Lunge. Nichts blieb verschont.
Gedämpft vernahm ich Raymunds Stimme, die beruhigend auf mich einredete. Ich öffnete kurz die Augen, konnte jedoch nichts erkennen. Die schwarzen Punkte verbanden sich zu einer Wand und die Welt um mich herum versank in Dunkelheit.
Ein schepperndes Geräusch ließ mich aufschrecken. Sofort hatte ich das Bild aus dem Fahrstuhl vor Augen. Schwer atmend richtete ich mich auf und bemerkte, dass ich mich nicht mehr in dem Krankenhaus befand. Ich lag auf einem unbequemen Sofa in einem schmutzigen, in Dämmerlicht getauchten Raum.
»Du bist wieder wach«, stellte eine mir bekannte Stimme hinter mir überflüssigerweise fest.
Ich sah zu Raymund, der gerade einen vollen Beutel mit irgendeiner durchsichtigen Flüssigkeit an einen Haken an der Wand hängte. Er nahm den daran befestigten Schlauch und knickte ihn ab, damit die Flüssigkeit nicht entweichen konnte. Raymund deutete mit dem Zeigefinger auf meinen Arm. Erst da bemerkte ich die Kanüle in meiner Hand.
»Darf ich?«
Ich streckte ihm meinen Arm entgegen und stellte erleichtert fest, dass die Schmerzen so gut wie weg waren.
Er tauschte den alten durch einen neuen Schlauch aus. »Wie geht es dir?«
»Besser. Was ist das?« Ich deutete mit einem kurzen Kopfnicken zu dem Beutel an der Wand.
»Ein Schmerzmittel.«
»Was ist da drinnen?« Ich hatte im Krankenhaus auch Schmerzmittel bekommen, die aber nur mäßig halfen. Das Zeug, das mir Raymund gab, war fantastisch. Ich spürte nichts mehr. »Wo bin ich?«
»Die Schmerzmittel sind von einer Freundin. Das Zeug ist eigentlich noch in der Testphase und soll später mal Tumorpatienten helfen. Ich soll ihr unbedingt berichten, ob das Mittel die gewünschte Wirkung hat.«
»Bedeutet, ich bin ein Testobjekt? Was, wenn mir von dem Zeug ein zusätzlicher Arm wächst?« Entsetzt riss ich die Augen auf.
»Ein dritter Arm wird dir nicht wachsen. Ich würde mir eher um den Schwanz an deinem Hintern Gedanken machen«, sagte Raymund so ernst, dass ich ihm tatsächlich glaubte und panisch mein Heck inspizierte.
Er lachte lauthals.
»Ich hasse dich! Das ist nicht witzig«, fuhr ich ihn an.
»Kommt auf die Sichtweise an«, erwiderte er und zwinkerte mir zu. »Du bist übrigens in meinem Haus.«
»Was?« Ich sah mich genauer um. Die Möbel waren staubbedeckt und alte Pizzaschachteln stapelten sich auf dem Boden, neben jeder Menge leerer Bierflaschen und haufenweise ungewaschener Wäsche. Auf einem Regal über einem alten Röhrenfernseher, reihten sich mehrere angebrochene Whiskyflaschen. »Dein Haus?«, fragte ich stirnrunzelnd.
Er nickte ernst, betrachtete das Chaos und seufzte.
»Ich geh mal davon aus, dass du entweder keinen Staubsauger besitzt, oder du nicht weißt, wie man damit umgeht.«
»Benutzen kann ich ihn schon, aber …« Er sah sich um, als suche er etwas.
»Aber?«
Er sah mich nachdenklich an.
Ich musste fast lachen, als mir eine mögliche Erklärung einfiel. »Du hast keine Ahnung, wo du ihn zuletzt gesehen hast, oder?«
Er rieb sich den Nacken und hob dann entschuldigend die Schultern. »Ich denke ich mache dir jetzt erst einmal etwas zu essen.« Er stand auf und war schon fast in den Durchgang zu einem weiteren Raum, in dem ich die Küche vermutete, verschwunden, als ich ihm nachrief: »Warum bin ich hier Raymund?«
Er wandte sich mir zu, machte ein paar Schritte in meine Richtung. »Weil ich nicht fähig bin, dich gehen zu lassen.«
Ich zog die Augenbrauen zusammen und musterte ihn skeptisch. »Was soll das heißen?«
»Shades of Grey«, antwortete er mit einem frechen Grinsen.
Ich legte den Kopf schräg. »Hä?«, fragte ich nur noch verwirrter.
»Das heißt nicht hä, sondern Wie bitte«, belehrte er mich. »Und der Spruch ist aus diesem Kinofilm, wo der Typ ein Sadist ist und auf Sex mit Mädchen steht, die sich gerne auspeitschen lassen.«
»Warum habe ich das Gefühl, es handelt sich bei dem Film um einen Porno?« Ich zog eine Augenbraue in die Höhe und musste leicht schmunzeln.
»Das ist kein Porno. Es ist ein Liebesdrama. Irgendwann schauen wir uns den mal zusammen an.«
»Ich denke eher nicht.«
Der kleine Themenwechsel hatte mich etwas gelockert. Ich hatte keine Angst vor Raymund. Was komisch war, wenn ich bedachte, dass er mich entführt hatte. Mal ganz ehrlich: Immerhin hatte ich ein Dach über dem Kopf, bekam Essen und konnte auf einem Sofa liegen. Das waren alles Dinge, die ich schon ewig nicht mehr hatte, und ein bisschen genoss ich auch das Gefühl, dass sich jemand um mich kümmerte.
Ich sank in die Kissen zurück und schaute zur Decke.
»Möchtest du etwas essen?«, fragte Raymund schon fast schüchtern.
Ich hatte Hunger, aber der verging mir schnell, als mir klar wurde, dass die Küche vermutlich ähnlich aussah wie das Wohnzimmer. Wenn nicht sogar noch schlimmer.
»Nein, danke.«
Raymund strafte mich mit einem durchdringenden Blick. Er wandte sich von mir ab und verschwand in den Durchgang.
»Ich will wirklich nichts essen.«
Er streckte den Kopf ins Wohnzimmer. »Erzähl das mal deinem Magen. Als du geschlafen hast, war der so laut, dass ich Angst hatte, du würdest mich auffressen, sobald du wach bist.« Er verschwand erneut.
Ich musterte das Zimmer genauer und blieb an einem Bild hängen, das eine jüngere Version von Raymund und einer wirklich hübschen, blonden Frau zeigte, die herzhaft in die Kamera lachte. Da das Foto auf dem kleinen Couchtisch stand, streckte ich den Arm danach aus, um es mir genauer anzusehen. Blöderweise war meine Kraft noch nicht zurück und so glitt mir das Bild aus den Händen und landete klirrend auf dem Boden. Ich zuckte zusammen, als Raymund plötzlich neben mir stand.
Er hob das Bild auf und betrachtete es.
»Entschuldigung«, murmelte ich verlegen.
»Schon gut.« Er betrachtete das Bild ein paar Sekunden. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem traurigen Lächeln.
»Ist das deine Frau?«, fragte ich, weil ich das Gefühl hatte, irgendetwas sagen zu müssen.