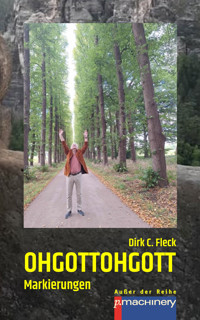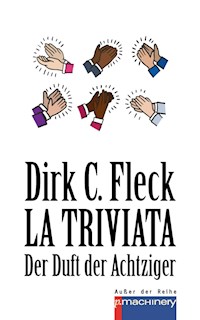5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Er möchte seine Sinne für das Unverfälschte schärfen, er möchte zurück zu der umfassenden Natur, die zwar vor Ausscheidungen wimmelt, vor Aas und vor Millionen von Keimen, die aber nicht verdreckt ist, die keinen Unrat kennt und keine Müllberge – dann wird er die Landschaften wieder in sich aufnehmen, sie werden ihn aufnehmen, und er wird sie nicht nur wie ein Zuschauer von außen betrachten, dann wird er tief in die Natur eintauchen, bis zu dem Punkt, an dem sie sich mit ihm selbst aus allen gesetzten Spannungen und Gegensätzen löst. Dort, dort wo er nicht mehr allein ist, liegt seine wahre Existenz. HANS-WILHELM PRECHT (1952–2016)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dirk C. Fleck
The Notes 66
Außer der Reihe 66
Dirk C. Fleck
The Notes 66
Außer der Reihe 66
Die Beiträge in diesem Buch sind auf der Internetplattform apolut.net erschienen, ausgenommen diejenigen, bei denen eine anderslautende Quelle angegeben ist.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Oktober 2022
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Elias (Pixabay)
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: Schaltungsdienst Lange oHG, Berlin
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 304 8
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 801 2
Von der Jetzigkeit und anderen wichtigen Dingen
wie zum Beispiel dem Realometer
Den Begriff Jetzigkeit hörte ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal. Eine bulgarische Freundin hatte ihn geprägt. Jetzigkeit. Wunderbar. Wie hölzern klingt dagegen das Wort Gegenwart. Außerdem erinnert die Bezeichnung Jetzigkeit viel intensiver als das Wort Gegenwart an das, was wir uns mehr und mehr in Erinnerung rufen sollten, bis wir es endlich verinnerlicht haben: die unumstößliche Tatsache nämlich, dass das Leben ausschließlich im Jetzt stattfindet. Nur so gewinnen wir die Kontrolle über unsere Gedanken, die uns bisher doch permanent in Vergangenheit und Zukunft zerren und auf diese Weise Trugbilder von uns selbst erschaffen. Wir nehmen Rollen an und agieren vor der wahren Wirklichkeit wie unter einem Schleier, der uns nicht frei atmen lässt.
Bleiben wir bei dem entzückenden Wesen, das die Jetzigkeit erfand. Mit ihr hat sich für mich eine Tür in eine neue Welt geöffnet. Eine Welt aus purer Liebe. Zärtlich und vertrauensvoll. Mit der bulgarischen Königin bleibt die Zeit stehen. Naja, sie bleibt nicht direkt stehen, sie zeigt sich von ihrer wahren Seite: Rund ist sie und dauerhaft in Bewegung. Für Seelen, die wiedergeboren werden, ist sie an jeder Stelle der Menschheitsgeschichte zugänglich. Meine schöne Freundin verwandelt die Welt ganz automatisch in etwas, was dir eine andere Zeiterfahrung beschert. Diese ist nicht, wie wir es gewohnt sind, linear ausgerichtet, nein, um sie herum ist ein changierendes Universum entstanden, in dem man sich selbst immer wieder zwischen jung und alt verorten kann.
Jetzt habe ich mich aber verrannt. Oder scheint es nur so, weil ich in Gegenwart dieser Frau meiner Worte beraubt werde? Sie erscheinen mir lächerlich in dem Bemühen, die Essenz zu beschreiben, den Geschmack, den Duft, die Anmut, mit der jede Sekunde in ihrer Gegenwart spielerisch um sich wirft. Musik ist das Einzige, mit dem man sich einer solchen Glückseligkeit nähern kann. Ich fand eben zufällig (?) ein Foto im Internet, das eine Frau zeigt, die bei geschlossenen Augen Violine spielt, während ihr die Tränen übers Gesicht laufen. Das meine ich: Bilder, Gedanken, Gefühle fügen sich in Ekaterinas wunderbarer Welt auf magische Weise zusammen. In meinem Buch »La Triviata« von 1985 steht der Satz: »Es besteht kein Zweifel daran, dass wir trotz aller geistigen Beschränktheit doch immer zu Hause sind, wo denn auch sonst. Wir müssen nur ein Gefühl dafür entwickeln.«Mit Ekaterina an meiner Seite ist das nicht schwer. Sie findet, dass sie in den Geheimnissen der Natur gut aufgehoben ist und die Geheimnisse in ihr ebenso.
Die US-amerikanische Schriftstellerin Djuna Barnes (1892–1982), deren Buch »Solange es Frauen gibt, wie sollte da etwas vor die Hunde gehen?« mir in lebendiger Erinnerung geblieben ist, hat in nur einem Satz beschrieben, wie es geht: »Furchtlos auf das Schreckliche zugehen und es in Schönheit verwandeln!«Das funktioniert.Selbst wenn wir vom Leben wieder einmal durch die Schreckensarsenale der sogenannten Realität gejagt werden, funktioniert es. Dazu braucht es Mut und ein Herz, das weiß, wie und wo Harmonie und Frieden zu finden sind.
Bevor ich der schönen Bulgarin begegnete, kam mir mein Leben vor, wie eine letzte Sünde, die ich mir gestattete. Ich nahm die Tage kaum zur Kenntnis. Die Impressionsbeute war gering. Zu viel wiederkehrende Bilder. In dem Film »Die Frau nebenan« steht Fanny Ardant am Fenster und fragt: »Wohin fahren all die Autos?« So ging es mir auch häufig. Es lag ein Netz aus banalen Worten über der Stadt, in der sich täglich Hunderttausende verfingen. Wenn es regnete – und es regnet oft in Hamburg –, bemerkten die Menschen sich unter den Schirmen nur noch knieabwärts. Ich war auf Geschenke angewiesen. Auf einen offenen Blick aus einem vorbeifahrenden Bus etwa. Wie viel Verlorenheit doch in solch flüchtigen Augenblicken liegt, wie viel unerfüllte Sehnsucht.
Max Frisch hat es in »Die Schwierigen« auf den Punkt gebracht: »Wir nehmen es an, das große Stirb und Werde, wir treten über die Schwelle unserer Jugend, ein für alle Mal. Es fallen die schillernden Schleier der Wehmut; es kommt eine kühle, klare Härte in alles, hinter alles, und man erschrickt nicht mehr, wenn jemand aufsteht und jünger ist. Man spielt nicht mehr mit dem Schrecken, mit dem Grauen vor dem Tod. Es öffnet sich über allem ein ganz anderer Raum. Was hilft uns der Rausch? Er hat keine Flügel, er trägt nicht in Gottes kühler Geräumigkeit. Es tut nichts, ob einer schwärmt, ob einer stehen bleibt, wie ein störrischer Esel und ohne ein Wort nicht weiter will. Es trägt nicht, sowenig wie der Schrei der Verzweiflung, wie das Grinsen des Spötters. Man tritt in den Dienst von Leben und Tod; gemeint ist ein Leben, das über uns ist, das auch in Herbsten nicht trauert, ein außerpersönliches.«
Es öffnet sich über allem ein ganz anderer Raum.
So ist es. Und da dieser Artikel von Zitaten lebt, füge ich eine Botschaft bei, die ich von den Lakota übernommen habe: »Nur jemand der weiß, was Schönheit ist, blickt den Wind, die Bäume, die Sterne oder das funkelnde Wasser eines Flusses mit völliger Hingabe an und wenn wir wirklich sehen, befinden wir uns im Zustand der Liebe.«
Der großartige US-amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau (1817–1862) wollte die Distanz, die wir Menschen zum Leben entwickelt haben, zum Wohle zukünftiger Generationen eindeutig markieren. Er schrieb: »Wir wollen uns die Ärmel aufkrempeln und unseren Weg bahnen durch den Dreck und Schlamm von Meinung, Vorurteil, Tradition, Blendung und Schein, die den Erdball überschwemmen, durch Paris und New York, durch Kirche und Staat, durch Dichtung, Philosophie und Religion, bis wir auf festen Grund und solide Felsen stoßen. Diesen Ort können wir Wirklichkeit nennen und sagen: Das IST, einen Irrtum gibt es nicht. Und dann beginne ein Realometer einzurammen, damit künftige Zeiten erfahren, wie hoch die Wellen von Trug und Schein zeitweilig schlugen.«
Zum Schluss noch ein paar Sätze meiner Freundin Maja Feràn, die sie neulich auf Facebook postete: »so ich morgen gehen müsste, wüsste ich eins … ich habe nicht viel erreicht (doch nach welchem maßstab), ich habe nicht viel gelebt (doch nach welchem maßstab) … aber ich habe zutiefst geliebt und wurde der gnade gewahr, nicht nur für einen augenblick … nein, für eine ewigkeit … und DAS kann mir niemand stehlen … niemals … auch wenn ich sicher noch ein tollpatsch bin … ein anfänger der kunst dieses liebens, das seinen namen verdient …«
So ist das mit den erwachten Frauen. Sie zeigen dir die heiligen Himmel, voll und brennend mit Sternen, dass du dich zu fragen beginnst, ob du immer noch auf dem gleichen Planeten bist, auf dem du geboren wurdest. »Es ist ein gewaltiges Risiko eine erwachte Frau zu lieben«, mahnt Sophie Bashford in ihrem großartigen Essay »Wenn du dich entscheidest, eine erwachte Frau zu lieben«, »weil es plötzlich keinen Ort mehr gibt, an dem du dich verstecken kannst. Sie sieht alles und damit kann sie dich mit einer Tiefe und Präsenz lieben, nach der sich dein Herz und Körper so lange gesehnt haben., so heftig …du wirklich am Leben all die Zeit, in der sie nicht da war«?
Nein, war ich nicht.
Wirre Rede, kurzer Sinn
»Die einzige Möglichkeit, die Unvernunft zu überwinden, ist, alt zu werden«, hat Orson Welles einmal gesagt. Ich bin alt geworden, siebenundsiebzig Jahre, um genau zu sein. Aber wenn ich mich, was allerdings immer seltener geschieht, auf eine Diskussion einlasse, oder auch nur auf ein Gespräch unter Bekannten, rede ich unvernünftig und wirr, wie meine Gesprächspartner nicht müde werden zu betonen. Dass erschreckt mich, denn immer wenn dieser Vorwurf erhoben wird, bin ich der Meinung, besonders überzeugend gewesen zu sein. Auf Nachfrage sagt man mir häufig, dass ich nicht bei der Sache bleibe, immer wieder abschweife, mir selbst widerspreche, um das eigentliche Thema schließlich ganz in den Hintergrund zu rücken. Wow! Das kann nicht unbeantwortet bleiben.
Wirr. Oder auch verworren, chaotisch, konfus, unübersichtlich, verwickelt, durcheinander. Das Substantiv von wirr ist übrigens Wirrnis, es ist feminin, was mich ein wenig beruhigt. Es wird mit Verworrenheit im Denken in Bezug gebracht, die wiederum nur dem Wirrkopf zu eigen ist, der seiner Wirrsal erliegt, also dem Wahnsinn schlechthin, welcher für alle Tragödien und Mythen der Weltliteratur unabdingbar war. Im Gegensatz zu meinen Mitmenschen muss ich aus diesem Napf einige Löffelchen zu viel zu mir genommen haben, anders ist das Unverständnis nicht zu erklären, auf das die meisten meiner Worte inzwischen treffen.
Zurzeit ist doch Corona-Zeit, richtig? Also rutschten mir vor ein paar Tagen bei einem Maskenball in der U-Bahn folgende nicht gerade leise gesprochenen Sätze gegenüber einer Freundin heraus: »Mir ist unerklärlich, mit welcher Arroganz die Spezies Mensch, die im entkleideten Zustand auf dem ästhetischen Niveau von Nacktmullen anzusiedeln ist, sich über alle anderen Lebewesen erhebt. Das kann nur mit ihrem Unverständnis gegenüber dem filigranen Netzwerk der Natur zu tun haben. Und da der Mensch die Natur nicht versteht, begreifen ihn seine Viren und Parasiten besser als er sich selbst …«
Kess und provokant, zugegeben. Ich schaute in die mühsam gezähmten Gesichter der Umstehenden und empfand so etwas wie Mitleid.
Die Unbewussten gehören immer zur Mehrheit und dieses Wissen reicht aus, damit sie ihrer Arroganz und ihrem Zynismus lustvoll freien Lauf lassen können, was sie, die Reihen fest geschlossen, nun auch reichlich tun. Corona sei Dank. Würde man sie auch nur für einen Tag aus ihrer fürchterlichen »Solidargemeinschaft« reißen und sie unter sensible, mitfühlende Menschen stecken, sie würden vor Angst zerbröseln. Dabei ist jeder Einzelne von ihnen viel mehr, als das, was er in der Gesundheitsdiktatur darzustellen versucht. Jeder von uns hat eine Vorstellung von sich selbst. Wir definieren uns über Eigenschaften wie schüchtern, großzügig, eifersüchtig, ehrgeizig, galant, abergläubisch, tierlieb, zärtlich, treu, flatterhaft, pedantisch, vergesslich, gutgläubig, verantwortungsbewusst und was uns sonst noch alles einfallen mag. Nichts davon ist in den Laboren der Wissenschaft beweisbar. Nach den Regeln der Vernunft (»Ich glaube nur, was ich sehe«) gibt es uns gar nicht. Und trotzdem haben wir eine genaue Vorstellung von unserem Wesen, obwohl es sich jedem wissenschaftlichen Beweis entzieht. Der Mensch besitzt nichts, weder seinen Körper, der ihm jederzeit genommen werden kann, noch irgendeine Wahrheit, die ihm beim nächsten genaueren Hinsehen ohnehin wieder abhandenkommt. Wir sagen, dass unser Herz blutet, wenn wir traurig sind. Und wenn wir glücklich sind, sagen wir, dass es überfließt vor Freude. Alles, was auf uns Eindruck macht, jede Idee, »die uns kommt«, gehört uns nicht, es sind flüchtige Leihgaben. Wir sind Gespenster, die sich über ihre Einbildungen definieren …
Ich bin der Tage überdrüssig, ich ertrage sie nicht mehr, diese ewig gleichen Impressionen, aus denen sich die sogenannte Realität zusammensetzt. Ich ertrage die Abstand haltenden maskierten Figuren in den Läden der Stadt nicht mehr und auch nicht die »Ereignisse«, die das Straßenbild prägen: Ein Mann schlägt den Kofferraumdeckel zu, ein Hund pinkelt dahin und dorthin, ein Flugzeug, nein, zwei am Himmel, »und ich sag noch zu Erwin, nee, sag ich …«, ein Bus hält, ein Kind tritt gegen die Litfaßsäule und andere kauen lustlos auf dem Stück Zeit herum, das ihnen zugeworfen wurde. Ich möchte mir die Tage ausziehen wie ein schmutziges Hemd, ich möchte der Mann sein, der seinen Kopf durch das Himmelszelt steckt und verzückt ins Nichts starrt …
»Wir gehen hindurch, wir nehmen es an, das große Stirb und Werde«, schrieb Max Frisch in seinem zwischen 1941 und 1943 entstandenem Roman»Die Schwierigen«,»es fallen die schillernden Schleier der Wehmut; es kommt eine kühle, klare Härte in alles, hinter alles. Man spielt nicht mehr mit dem Schrecken, mit dem Grauen vor dem Tod. Es öffnet sich über allem ein ganz anderer Raum. Was hilft uns der Rausch? Er hat keine Flügel, er trägt nicht in Gottes kühler Geräumigkeit. Es tut nichts, ob einer schwärmt, ob einer stehen bleìbt, wie ein störrischer Esel und ohne ein Wort nicht weiter will. Es trägt nicht, sowenig wie der Schrei der Verzweiflung, wie das Grinsen des Spötters. Man tritt in den Dienst von Leben und Tod; gemeint ist ein Leben, das über uns ist, das auch in Herbsten nicht trauert, ein außerpersönliches.«
Eben rief ein Freund an und teilte mir mit, dass er etwas später als verabredet kommen würde. Im Haus gegenüber löscht jemand die Kerze auf dem Klavier und schaltet den Fernseher ein. Ein Kind tobt um den Tisch. Warum habe ich plötzlich das Bedürfnis, die Menschen in Schutz zu nehmen? Und gegen wen? Angesichts der Tatsache, dass wir in jeder Sekunde gemeinsam von diesem Planeten gefegt werden können, heben sich die Feindbilder auf, sind wir allesamt Staub vor dem Wind. Der kollektive Tod, das Aus für alle, für Opfer UND Peiniger, für Gerechte UND Ungerechte, für Reiche UND Arme – das ist der Orgasmus, auf den die Geschichte hinausläuft. Warum mache ich mich plötzlich zum Anwalt der Banalität, der Dummheit, des unnützen Zeitvertreibs, des kleinen Alltags?
Ganz einfach: weil es ihn noch gibt, den kleinen Alltag. Er ist meine Heimat, mein Leben. Zwar ist bereits die Lunte an ihn gelegt worden und nichts von ihm wird übrig bleiben, aber er atmet noch. Noch sind in ihm alle Missverständnisse geborgen, noch wird in ihm gelogen und betrogen, gehasst und manchmal sogar geliebt. An Tagen wie diesen reicht das aus, um mit ihm Frieden zu schließen. Um die Wunden zu kühlen, die ich mir im Umgang mit ihm bisher zugezogen habe. An Tagen wie diesen liebe ich unser aller Entsetzen in meiner kleinen Straße, in der sich jeden Abend zur Tagesschau der Widerschein aus den Fernsehapparaten in den Zweigen der kranken Kastanien bricht.
Ich rede wirr, nicht wahr? Ist nicht schlimm, ich bin in guter Gesellschaft. Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung (1875–1961) sprach aus, was auch für mich zutrifft: »Ich bin über mich erstaunt, enttäuscht, erfreut. Ich bin betrübt, niedergeschlagen, enthusiastisch. Ich bin das alles auch und kann die Summe nicht ziehen. Ich bin außerstande, einen definitiven Wert oder Unwert festzustellen, ich habe kein Urteil über mich und mein Leben. In nichts bin ich ganz sicher. Ich habe keine definitive Überzeugung – eigentlich von nichts. Ich weiß nur, dass ich geboren wurde und existiere, und es ist mir, als ob ich getragen würde. Ich existiere auf der Grundlage von etwas, das ich nicht kenne. Trotz all der Unsicherheit fühle ich eine Solidität des Bestehenden und eine Kontinuität meines Soseins.«
Wissen Sie, wie man die Aufgeregtheit einer gesellschaftspolitischen Debatte entschärfen kann? Man betrachte alles, was wir Menschen darzustellen versuchen, denken oder tun vor der Folie der Vergänglichkeit. Dann wird mit einem Schlag unbedeutend, wenn nicht lächerlich, worüber wir uns die Köpfe eingeschlagen haben. Wir sind nicht mehr. Garantiert. Unsere Spuren werden ausgelöscht wie Fußabdrücke am Strand, wenn die Flut kommt.
Stellt man sich alle Ereignisse, die auf der Erde stattfinden, als einen lebendigen »Ereigniskörper« vor, käme man zu der Erkenntnis, dass die Struktur dieses Körpers in jedem Augenblick aus dem Fundus sich endlos wiederholender Handlungen erwächst. Die Messer, die in diesem Augenblick in Hälse gerammt werden, sind immer in Aktion, wenn auch nicht ganz so häufig wie die Nationalhymnen, die in diesem Augenblick gesungen werden, oder die Masken, die sich Menschen aller Glaubensgemeinschaften jetzt rund um den Globus aufsetzen. Jedes Ereignis hat ein ganz bestimmtes Volumen, ein bemessenes Potenzial, mit dem es zu jeder Zeit zum allumfassenden Leben beiträgt. Dieses allumfassende Leben bleibt in seiner wahren Dimension unerkannt, was natürlich nichts an seiner Vollkommenheit ändert. Wir Menschen gewinnen lediglich einen extrem beschränkten Eindruck von der Wirklichkeit. Das Fatale daran ist, dass wir diesen Eindruck für die Realität halten. Aber unsere sogenannte Realität hat den Tiefgang einer Badeente.
Wir leben in einer Zeit, in der die Mediengesellschaft das Wort Krieg prüfend in ihren Händen wiegt wie einen Kohlrabi auf dem Gemüsemarkt, in der man das Denunziantentum hoffähig macht und den Maulkorb zum Accessoire erhebt. Deshalb halte ich es für dringend notwendig, uns gegenseitig wieder mehr Geschichten zu erzählen. Schließlich gibt es noch ein Leben außerhalb des politischen Ränkespiels, dem die alternativen Medien so gerne analytisch auf den Grund gehen, obwohl es unsere Seelen immer mehr zu vergiften droht. Dabei braucht es über den riesigen Misthaufen, den das von Gier gesteuerte System permanent produziert, weder weitere Informationen noch Aufklärung – wir wissen doch seit Jahrhunderten, nach welchen Gesetzen das menschen- und naturverachtende System funktioniert.
Die Kraftspeicher für die Wachgebliebenen in unserer narkotisierten Zivilgesellschaft sind fast leer. Jetzt gilt es, angesichts des globalen Treibens einer durchgeknallten Finanz- und Politelite nicht den Verstand zu verlieren. Vergessen wir ihr dämliches Spiel, bleiben wir bei uns selbst, das lohnt sich. Es ist das Einzige, was sich noch lohnt. Vor allem dann, wenn wir füreinander in Liebe da sind. Davon haben die seelenlosen Killer und Psychopathen aus Wirtschaft und Politik nämlich nicht die geringste Ahnung.
Ich hoffe, dass Ihnen der kleine, etwas wirr geratene Ausflug in meine Gedankenwelt gefallen hat. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Emile Cioran (1911–1995), dem radikalsten Kulturkritiker der Nachkriegszeit. »Derjenige, der weiß, hat sich von allen Fabeln getrennt, die die Begierde und das Denken schaffen, er hat sich aus dem Stromkreis ausgeschaltet, er willigt nicht mehr in den Trug ein.«
P.S.: Nach der Sprache kommt das Schweigen. Ich versuche schon seit Längerem, mich sprachlich zu reduzieren, fast in die Poesie hinein. Über die Dichtung oder besser Verdichtung, in das Schweigen. Das mühsam erkämpfte Schweigen soll uns eine Erquickung sein und kein Schrecken.
Zurück auf LOS? Never!
Werden wir vom Rechen der Zeit nicht alle gnadenlos aus diesem Leben geschoben? Und brechen dabei nicht alle mühsam erbauten Sicherheitssysteme in sich zusammen – einfach so: holterdipolter? Diese unumstößliche Gewissheit kann einem Angst machen. Es sei denn, wir übergeben uns freiwillig. Aber an wen, an was sollen wir uns übergeben, bevor die Metastasen der Angst vollständig von uns Besitz ergriffen haben? Der Ausweg ist einfach: Wir müssen uns ins Urvertrauen begeben. Ich komme noch drauf.
Am 28. April bin ich von der Palliative Aargau in die Schweiz eingeladen worden, um im Anschluss an den Film »Das Ende ist mein Anfang« über den Tod zu diskutieren. Zunächst hatte man mich gebeten, einen Vortrag über den Tod zu halten, das habe ich jedoch abgelehnt. Als Alternative hat man mir ein Podiumsgespräch vorgeschlagen, dem ich dann zugestimmt habe.
»Das Ende ist mein Anfang« basiert auf einem Interview von Folco Terzani mit seinem Vater Tiziana. Der bekannte italienische Journalist und Schriftsteller Tiziana Terzani (1938–2004; im Film gespielt von Bruno Ganz) arbeitete dreißig Jahre lang als Auslandskorrespondent für den Spiegel. Überdies war er bei verschiedenen italienischen Zeitungen und Zeitschriften als freier Mitarbeiter tätig, u. a. bei Il Giorno, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, La Repubblica. Seine Reportagen und Erzählungen wurden weltweit gelesen. Er war Autor von etlichen Romanen, insgesamt verkauften sich seine Bücher über zweieinhalb Millionen mal. Terzani hat mit seiner Frau, Angela Staude, selbst Autorin, und seinen Kindern in Singapur, Hongkong, Peking, Tokio, Bangkok und Delhi gelebt (Wikipedia).
Der Journalist reflektiert, teils in ungewöhnlich humorvoller Form, seine Erkenntnisse über das Leben und Sterben, insbesondere über seinen bevorstehenden Tod aufgrund einer Krebserkrankung. Ich habe den Film bereits vor einigen Jahren gesehen und war zutiefst berührt. Tiziana Terzani konnte deshalb so gelassen über den Tod sprechen, weil er sich ins Urvertrauen begeben hatte, von dem ich sprach. Er hat erkannt, dass das Leben ein ewig gleich bleibendes Muster umwälzender Ausdruckskraft ist, dem man mit dem Verstand nicht auf die Schliche kommt. Im Grunde geht es darum, sich aufzugeben, nicht mehr festzuhalten an der Vorstellung, die man von sich selbst hat.
Das ist nicht einfach, denn jeder Mensch hat eine Vorstellung von sich selbst. Wir definieren uns über Eigenschaften wie schüchtern, großzügig, eifersüchtig, ehrgeizig, galant, abergläubisch, tierlieb, zärtlich, treu, flatterhaft, pedantisch, vergesslich, gutgläubig, verantwortungsbewusst und was uns sonst noch alles einfallen mag. Nichts davon ist in den Laboren der Wissenschaft beweisbar. Die Wissenschaft begreift das Leben als Versuchskaninchen, dem man seine Geheimnisse auf dem Seziertisch entreißt. Das ist dumm und anmaßend. Sie können noch so tief in den Mikro- oder Makrokosmos steigen, sie können die Dinge in Zahlen fassen oder ihnen Namen geben, dem Geheimnis unserer Existenz kommen sie damit nicht auf die Spur. Es sind nur Zahlen und Namen, es sind nur Etiketten. Etiketten sind keine Weisheiten, Etiketten haben keine Seele. Und sie berauben uns der Ehrfurcht. Ein ehrfürchtiger Mensch akzeptiert den Zusammenhalt materieller und nichtmaterieller Existenz, er weiß, dass sich das Mysterium des Lebens niemals zu Wissen reduzieren lässt. Bewusstsein ist keine Frage des Lernens, es ist eine Frage des Verlernens geworden. Irgendwann wird es Zeit, zu akzeptieren, dass der Mensch nichts wirklich besitzt, weder seinen Körper, der ihm jederzeit genommen werden kann, noch irgendeine Wahrheit, die ihm beim nächsten genauen Hinsehen ohnehin wieder abhandenkommt. Alles, was auf uns Eindruck macht, jede Idee, »die uns kommt«, gehört uns nicht, es sind flüchtige Leihgaben. Wir sind Gespenster, die sich über ihre Einbildungen definieren.
Um dieser Einsicht folgen zu können, braucht es eine gewisse Lebenserfahrung. Auch eine gewisse Lebensmüdigkeit, die sich mit den Jahren als Sediment in unserer Seele absetzt. Diese Müdigkeit ist ein Naturprodukt, sie hilft uns, ruhig und gelassen zu werden. Ich denke oft an die Geschichte eines indischen Heiligen, der im Land sehr verehrt wurde und sich schließlich in den Bergen des Himalaja jedem menschlichen Kontakt entzog. Eines Tages kam das Gerücht auf, dass er an Krebs erkrankt war. Einem englischen Journalisten gelang es, ihn aufzusuchen. Er fragte ihn, warum er nicht zurückkomme, um sich in einem Hospital behandeln zu lassen. Darauf soll der Mann ziemlich überrascht geantwortet haben, dass er doch kein Recht habe, die Krebszellen, die sich seinen Körper als Lebensraum erkoren hatten, zu bekämpfen und womöglich zu töten.
Der Schriftsteller Max Frisch (1911–1991) hat in seinem 1943 veröffentlichen Roman »Die Schwierigen« etwas geschrieben, was mir mit den Jahren immer verständlicher wurde: »Wir gehen hindurch, wir nehmen es an, das große Stirb und Werde, wir treten über die Schwelle unserer Jugend, ein für alle Mal. Es fallen die schillernden Schleier der Wehmut; es kommt eine kühle, klare Härte in alles, hinter alles, und man erschrickt nicht mehr, wenn jemand aufsteht und jünger ist. Man spielt nicht mehr mit dem Schrecken, mit dem Grauen vor dem Tod. Es öffnet sich über allem ein ganz anderer Raum. Was hilft uns der Rausch? Er hat keine Flügel, er trägt nicht in Gottes kühler Geräumigkeit. Es tut nichts, ob einer schwärmt, ob einer stehen bleìbt, wie ein störrischer Esel und ohne ein Wort nicht weiter will. Es trägt nicht, sowenig wie der Schrei der Verzweiflung, wie das Grinsen des Spötters. Man tritt in den Dienst von Leben und Tod; gemeint ist ein Leben, das über uns ist, das auch in Herbsten nicht trauert, ein außerpersönliches.«
Und da ich schon mal dabei bin zu zitieren, hier ein Satz von Roger Waters, dem Mitbegründer von Pink Floyd: »Die allermeisten Songs die ich geschrieben habe, stellen ein und dieselbe Frage: Kannst du dich soweit befreien, dass du das Leben in aller Wirklichkeit erfährst, wie es sich vor dir und mit dir abspielt? Wenn du das nicht hinkriegst, gehst du immer nur zurück auf LOS, solange bis du stirbst.«
Ich werde achtzig im nächsten Jahr, wie Roger Waters auch. Ich bin ein Jahr jünger als Paul McCartney und drei Jahre jünger als Ringo. Wir vier fühlen uns pudelwohl und gehen bestimmt nicht zurück auf LOS …
Auf der harten Matratze der Hilflosigkeit
Man möchte es nicht wahrhaben, man sträubt sich sogar vehement gegen die Erkenntnis, dass dieses Land, dieses Deutschland ein übel riechendes Konstrukt ist. Jedenfalls was seinen Geist angeht. Feige, arrogant und kaltherzig. Als sei es von höherer Macht dazu verdammt, auf ewig dem wahren Leben fernzubleiben. Deutschland pulsiert nicht, es atmet mit offenem Mund, dem fast nur Fäulnis entströmt. In seinen teilnahmslosen Augen liegt das Einverständnis einer schrecklichen Solidargemeinschaft. Auf den Punkt gebracht in der Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers, der mit einem verbalen Federstrich ungestraft etwa fünfundzwanzig Prozent der Bevölkerung aufs Übelste diffamieren durfte. »Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen!« Gemeint waren jene Millionen besorgter Bürger, die in den Panik schürenden, aberwitzigen und logisch schwer nachvollziehbaren Coronamaßnahmen der Regierung einen Angriff auf ihre verbrieften Grundrechte beklagen. Olaf Scholz, dessen Charme und Temperament dem eines Holzklotzes in nichts nachsteht, kann sich solche Äußerungen leisten, weil er eine durch den Mainstream manipulierte Mehrheit hinter sich weiß. Auf diese Weise hat er sich schon mal als wahrer Kanzler des Volkes vorgestellt. Einem Volk, von dem die Programmmacher des Ersten Deutschen Fernsehens glaubten, ihm am Heiligabend folgende Filme vorsetzen zu müssen: SISSI und die FEUERZANGEBOWLE! Willkommen in den Fünfzigerjahren, die bekanntlich an Spießigkeit nicht zu überbieten waren. Glückwunsch. Passt!
Weihnachten. Wie war mein Weihnachten als Impffreier? Ich wurde von einem Festessen ausgeladen, das ich die Jahre zuvor immer genossen hatte. Selber Schuld. Nun, ich wäre ohnehin nicht hingekommen, die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist mir in Hamburg nämlich verwehrt. Selbst Taxifahrer verlangen inzwischen den Impfausweis. Also blieb ich zu Hause und labte mich an einer selbst gekochten, aber stark versalzenen Gemüsesuppe.
Den Rest der Feiertage verbrachte ich am Laptop. Ich schrieb Gedanken auf, die in keinerlei Zusammenhang zu bringen sind und nur einen Zweck verfolgten: Sie sollten mich aus der der Umklammerung des Corona-Wahnsinns befreien. Flüchtige philosophische Betrachtungen über Gott und die Welt. Allerdings hatten wir Vollmond und dieses Mal war er besonders streng, sodass ich kaum schlafen konnte. Ich jagte dem Schlaf hinterher, ohne ihm mehr als zwei bis drei Stunden pro Nacht entreißen zu können. Eigentlich bin ich ein brillanter Schläfer, doch rund um Weihnachten war mir der Zugang verwehrt. Der Schlaf, den ich schließlich fand, war ganz sich selbst überlassen. Es fehlte ihm die Würze inspirierender Träume, er kam mir vor wie eine Reaktion auf ein nicht geschriebenes Buch. Ich fühlte mich wie ein Resonanzboden inmitten des großen Schweigens, gebettet auf der harten Matratze der Hilflosigkeit.
Okay, hier nun eine kleine Auswahl meiner notierten Gedanken, die quasi in Notwehr verfasst wurden:
Wir befinden uns an einem Wendepunkt der Geschichte. An solchen Wendepunkten nehmen wir Abschied von der Persönlichkeit, die wir waren. Wir begrüßen die Person, die wir gerade werden. Unsere Ängste entsprechen denen, die wir vor dem Sterben entwickeln. Aber wir müssen begreifen, dass wir nicht alleine sind mit unserer Furcht, dass die Angst uns alle erfasst, aber dass wir sie miteinander teilen können. Wir müssen erkennen, dass die Erschütterungen der alten Ordnung ein gewaltiges Potenzial an gebundener Lebenskraft freisetzt, das uns nun befähigt, etwas völlig Neues zu schaffen. Wenn wir aber vor dem Unbekannten zurückschrecken, wenn wir uns vor der Verantwortung für das Neue drücken und nur zögerlich die nächsten Schritte gehen, dann deprimieren wir die Person, die wir werden zugunsten der Persönlichkeit, die wir waren.
Jeder von uns kennt die Situation, in der ein feuchter Film den Blick verschleiert. Die Tränen sammeln sich hinter der Netzhaut, treten aber nicht hervor. Als ob ein Stausee kurz vorm Überlaufen ist. In solchen Situationen kann man sich nicht erklären, will man nicht gestört werden. Irgendeine Instanz in uns genießt den Zustand der reinen Melancholie, zu der es keines besonderen Anlasses bedarf, um eine solche Waschung herbeizuführen. Eine Waschung, ja das ist es. Wir erkennen plötzlich wieder einmal, dass die einzige Konstante, die wir erfahren, die permanente Veränderung ist. All unsere Träume und Wünsche zerschellen im Wildwasser des Lebens. Vielleicht entspringen die zurückgehaltenen Tränen der Tatsache, dass wir noch nicht gelernt haben, uns auf die Welle des Wandels zu legen, auf ihr zu surfen und dabei alle Versprechungen und Angebote, die uns gereicht werden, als das zu bergreifen, was sie sind: Illusionen, die mit der wahren Essenz unseres Seins nichts zu tun haben.
Das Leben ist ein ewig gleich bleibendes Muster umwälzender Ausdruckskraft. Wir wollen nicht wahrhaben, dass alles Erdenkliche und weit mehr ständig um uns ist. Und dies, wie es scheint, ohne unser Zutun. Hier liegt ein weiterer Irrtum: Da wir nun einmal Teil des Ganzen sind, haben wir auch unseren Einfluss. Ich bin davon überzeugt, dass jeder unserer Gedanken, dass unsere Träume und Taten, dass unsere heimlichen Wünsche und Verwünschungen immer ihre Entsprechung finden – dass wir selbst nichts als das Ergebnis solcher Wünsche und Verwünschungen sind. Das Eigentümliche der Wahrheit ist, dass sie von uns weder einen Glauben an sie noch ein Handeln in ihr verlangt.
Das alles jederzeit passiert, ist tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Deshalb ist es nicht einfach zu entscheiden, an wen und an was wir unsere Aufmerksamkeit verschenken. Normalerweise beantworten wir diese Frage nach Gutdünken. Was nicht in den persönlichen Bereich fällt, bleibt in der Regel unbedacht. Obschon wir von der Existenz des uns umgebenden Leids wissen, verdrängen wir es. Dieser Verdrängungsmechanismus schützt davor, von der Vielfalt anderer Schicksale zerrissen zu werden. Der Instinkt sagt uns, wie wir uns durchzuschlagen haben. Er ist es aber auch, der uns zu Duldern einer Welt macht, die wir so häufig bejammern. Aber selbst bei allem aufgebrachtem Mitleid: Wir werden uns immer in Distanz befinden, solange wir nicht das Gefühl haben, dies alles schon einmal an uns selbst erlebt zu haben. So gleiten die Tragödien der anderen an uns ab und unsere Empörung über die Brutalität und Ungerechtigkeit in der Welt zerstört letztlich nur uns selbst. Es gilt also, eine Technik der Ruhe zu entwickeln, und die heißt NICHTHANDELN. Vielleicht ist erst dies der Zustand, in dem sich unsere Wahrnehmungen zu einem Bewusstsein verdichten, das uns mehr Respekt vor dem Leben abnötigt, als wir bisher bereit waren zu zollen.
Man selbst bleibt unangetastet und wird doch Zeuge all der Tränen, Ängste, Missverständnisse und Vergewaltigungen, Zeuge für das gesammelte Aufgebot gegen die Lebensfreude. Es sollte doch zumindest die Kunst von den Menschen erfasst werden, jetzt, da sie von der Magie des Todes befruchtet wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nichts ist verdächtiger als die Wahrheit, die in der Kunst zu Hause ist – und so hält man sich in heuchlerischer Distanz zu ihr.
Sprache ist eben nicht nur Literatur, sie gehört allen Menschen und wird entsprechend missbraucht. Im Gegensatz zu anderen Künstlern sieht der Dichter sein Instrument permanent missbraucht. Die Meister der Sprache vermögen sich kaum Gehör zu verschaffen vor lauter banalem Wortgeklingel.
Nicht nur das, was wir tun, sondern auch, was wir denken und fühlen, steht mit allen anderen Taten, Gedanken und Gefühlen sämtlicher Mitwesen auf diesem Planeten in ständiger Verbindung und bedingt einander, sodass aus diesem Konglomerat der jeweils augenblickliche Zustand der Welt erwächst. Je mutiger unser Handeln, je klarer und gerechter unsere Gedanken und je tiefer unsere Gefühle, desto mehr tragen wir dazu bei, dass sich die »Gesamtlage« zum Positiven verändert.
Der Dichter ist der Not enthoben, erfinden zu müssen. Er findet vor. Das unterscheidet ihn von den Wortakrobaten, den Schriftstellern und Journalisten, die ihrer jeweiligen Gesellschaft die aberwitzigsten Geschichten auftischen, immer in der Hoffnung, dass man es ihnen lohnen möge. Diese Sprachklempner sind in der Regel feige und impotent, sie treiben ein hinterlistiges Spiel, sie verkaufen Scheiße für Gold. Man sollte ihnen das Wort verbieten. Zum Glück ist diese Spezies zum Aussterben verurteilt. Schon bald werden Computer die Dramaturgie übernehmen. Das Niveau der Volksbelustigung ist bereits jetzt auf ein Niveau gesunken, dass es ausreichen wird, ein paar standardisierte Verhaltensweisen von Gut und Böse ins System zu speichern, um eine hundertteilige Familiensaga nach dem Geschmack des Publikums zu basteln.
Warum empfangen wir unsere Kinder bei ihrer Geburt nicht mit der ihnen vertrauten Musik? Mozart zum Beispiel. Wolfgang Amadeus ist doch aus jenem Reich bedient worden, das den Werdenden bis eben ihre Heimat war: dem Reich der Inspiration. Mit Mozart wechselt man leichter die Seite. Anstatt unseren Nachkommen aber diese Brücke zu bauen, überfallen wir sie mit metallischem Geklapper aus dem Kreißsaal. Wir zerren sie ans Flutlicht, als wollten wir sie lediglich wissen lassen, dass sie direkt in der Hölle gelandet sind. Indem wir auf diese Weise ihre geistige Fruchtblase zertrümmern, pflanzen wir bereits den Keim der Angst in sie, jene verheerende Abwehrschwäche, die es den meisten von nun an unmöglich macht, etwas anderes zu werden als ein Zombie unter Zombies.
»We are buried beneath the weight of information, which is being confused with knowledge; quantity is being confused with abundance and wealth with happiness. We are monkeys with money and guns.« – Tom Waits.
Tom Waits, dieser Schornsteinfeger, dieser alte, kleine Junge, der seine raue Stimme von den Tasten des Pianos schlürft. Er lebt von Lied zu Lied, ein Brückenmensch an der ewigen Musicbox. Selbst im Torkeltanz beißt er seiner Traurigkeit ins Ohr, schlägt er ihr ein gedachtes Saxofonsolo ins Gesicht, schmiegt sich an das seidene Mädchen und lässt sich von ihr vor laufender Kamera entführen.
Man geht mit Situationen um wie mit vertrauten Gemälden.
Und so weiter, und so weiter. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Wie bereits erwähnt: Es war lediglich der Versuch, mir gedanklich etwas Luft zu verschaffen. Wie hatte Nietzsche gesagt? »Der deutsche Geist ist meine schlechte Luft.«Und die wollte ich nicht atmen, nicht an Weihnachten.
Ich traue ihnen nicht, den geistigen Kleingärtnern
Humor ist eine große Hilfe bei der Erklärung des Universums, hat der geniale Astrophysiker Stephen Hawking (1942–2018) gesagt. Bei der Erklärung des Corona-Universums ist er gar unerlässlich, wenn man nicht im Irrenhaus landen will. Allerdings handelt es sich hier um Galgenhumor, da lacht es sich nicht ganz so befreit.
Ich bin nicht geimpft, also ist mir die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel verboten. Logisch, oder? Obwohl ich mich schon seit Jahren höchst ungern in den Menschenzoo dort draußen begebe, bin ich doch gelegentlich auf Bus und Bahn angewiesen. Und sei es nur, um meine Bankfiliale in der Innenstadt aufzusuchen – die bei mir in der Nähe wurde freundlicherweise geschlossen.
Zum Jungfernstieg, dem Sitz der Filiale, sind es mit dem 5er sechs Stationen, etwa achtzehn Minuten. Bisher bin ich schon einmal des Busses verwiesen worden. Wenn ich während der umständlichen Personalaufnahme beim nächsten Halt nicht geflüchtet wäre, hätte ich jetzt ein saftiges Bußgeld am Hals. Seitdem halte ich angestrengt die Augen auf. Jeder der Zusteigenden wird genau taxiert, es könnte sich schließlich um einen Kontrolleur handeln, oder noch schlimmer: um eine Kontrolleurin. Mir ist zwar noch keine begegnet, aber die Bilder einer Dokumentation über die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, die zeigen, wie die wohlgenährten Aufseherinnen (viele mit Zöpfen oder Dutt) von englischen Soldaten aus dem Wachhaus begleitet werden, haben sich fest eingeprägt. Die trotzigen, teilnahmslosen Blicke dieser Frauen, die an ihren ausgemergelten Opfern vorbei marschieren, welche kaum die Kraft finden, die Augen zu heben …
Was hat das mit den Kontrolleurinnen des Hamburger Verkehrsverbundes zu tun? Natürlich nichts. Sorry. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Überlebensstrategie, die man sich als Impffreier in dieser Gesellschaft nach und nach zuzulegen hat. Bleiben wir beim Busfahren. Seit der G 2, 3, Plus oder was auch immer Regel postiere ich mich nahe an den Türen. Wann immer ich den Verdacht habe, dass es sich bei den zugestiegenen Herren (oder Damen) um Kontrolleure handelt, verlasse ich das Fahrzeug, dann nehme ich den nächsten Bus. Dauert zwar, fünf Minuten etwa, aber so bin ich jedenfalls auf der sicheren Seite. Es gibt Tage, da hat mich die Paranoia derart im Griff, dass ich mich veranlasst sehe, an jeder neuen Haltestelle auszusteigen. So dauert die Fahrt zu meiner Bank nicht achtzehn, sondern dreiundfünfzig Minuten. So viel Zeit muss sein. Immerhin bin ich seitdem nicht mehr erwischt worden.
Den besagten Galgenhumor, von dem ich anfangs sprach, bringen bei Weitem nicht alle auf. Im Gegenteil: Die Absurdität im Alltag ist inzwischen fast unbemerkt und unwidersprochen zur Normalität geworden. Gestern war ich im Bezirksamt. Ich kam an einer Glastür vorbei, auf der eine sauber ausgedruckte Mahnung prangte, und das ziemlich groß: DER SOZIALRAUM DARF LEDIGLICH VON EINER PERSON BETRETEN WERDEN. Als ich einer vorübergehenden Frau gegenüber bemerkte, dass dies nicht schlimm sei, da die Person ja mit sich selbst reden könne, vorausgesetzt sie hielte anderthalb Meter Abstand, zerrte diese ihr Kind in den Paternoster. Aus den Tiefen des Schachts klang ein schrilles Wort zu mir empor, dass sich fast anhörte wie CORONALEUGNER!
Da fällt mir dieses beeindruckende Statement des US-amerikanischen Philosophen Henry David Thoreau (1817–1862) ein: »Wir wollen uns die Ärmel aufkrempeln und unseren Weg bahnen durch den Dreck und Schlamm von Meinung, Vorurteil, Tradition, Blendung und Schein, die den Erdball überschwemmen, durch Paris und New York, durch Kirche und Staat, durch Dichtung, Philosophie und Religion, bis wir auf festen Grund und solide Felsen stoßen. Diesen Ort können wir Wirklichkeit nennen und sagen: Das IST, einen Irrtum gibt es nicht. Und dann beginne ein Realometer einzurammen, damit künftige Zeiten erfahren, wie hoch die Wellen von Trug und Schein zeitweilig schlugen.«
Aus Thoreaus Perspektive leben wir in »künftigen Zeiten«. Der Realometer ist längst eingerammt, aber die Wellen von Trug und Schein schlagen höher denn je. Viele meiner Freunde berichten, dass sie sich seit Langem in irgendeine Serie versenken, um dem Wahnsinn da draußen zu entgehen. Mache ich inzwischen genauso. Dabei fällt auf, nach welch simplen Mustern die Dinger gestrickt sind. Nur ein Beispiel: Wenn die Handlung feststeckt, kommt die Erklärung aus dem Fernseher, in irgendeiner Nachrichtensendung, die der Held am Tresen einer Bar verfolgt, zu Hause auf der Couch oder im Auto. Genau im richtigen Moment. Welch ein Zufall. Und wie langweilig.
In meinem Buch »GO! – Die Ökodiktatur« von 1993 gibt es ein ummauertes Stadtlager, in das Gesetzesbrecher verbannt werden, das aber auch Freiwilligen offen steht. Im Stadtlager gibt es keine Verwaltung, keine Polizei, nichts. In jeder Wohnung steht ein Fernseher, über den in Dauerschleife dieselbe mit Katastrophenmeldungen vollgepackte Nachrichtensendung läuft. Eine Metapher, ein Sinnbild. Der Journalismus ist ins Scheitern verliebt, nicht in sein eigenes natürlich, sondern in jenes Scheitern, das genügend Elend abwirft, um lustvoll aufgegriffen und durchgekaut zu werden, damit man es dem Publikum dann vor die Füße würgen kann. So läuft es doch. Querdenken, das Ringen um alternative Lebensformen wird diffamiert und in den Schmutz getreten. Es ist die perverse Neugier der bereits Gescheiterten, die sich in fürchterlicher Solidarität austobt.
Ich entrümpele gerade meine Bibliothek. Dabei ist mir ein Tagebuch aus dem Jahre 1985 in die Hände gefallen. Interessant. Unter anderem fand ich folgenden Eintrag: »Ich traue ihnen nicht, den geistigen Kleingärtnern, die uns über den Gartenzaun hinweg ansprechen, die charmant plaudernd, lustvoll verführend und virtuos argumentierend ihr gescheitertes Leben als Offenbarung verhökern. Sie wollen einem den Tand ihres Wissens andrehen, wo man doch unbeschwert weitergehen möchte. Am liebsten hetzten sie die Hunde auf einen, wenn es nur nicht dem guten Ruf schaden würde.«
Für solche Sätze könnte ich mir noch heute auf die Schulter klopfen, aber nur, weil ich die Autorenschaft nicht für mich reklamiere. Gut, ich habs geschrieben, aber manchmal wird man auch benutzt, wenn man ein gewisses Talent hat. Ich jedenfalls stehe voll und ganz zur Verfügung, denn inzwischen habe ich auch den Nikotindämon im Griff, was die Voraussetzung dafür ist, dass die Membran unverfälscht vibrieren kann.
Wie schwierig es ist, das vorhandene Elend und die nicht tot zu kriegende Hoffnung unter einen sprachlichen Hut zu bringen, zeigt sich in diesem Text des russischen Schriftstellers Alexander Kuprin (1870–1938) sehr deutlich:»Mir wird übel von diesen Lügnern, Feiglingen und Fresssäcken! Diese Elenden! Der Mensch ist für große Freude geboren, für ständiges Schöpfertum, in dem er sich als Gott beweist, für freie, durch nichts eingeengte Liebe zu allem: zu Baum und Strauch, zum Himmel, zum Menschen, zum Hund, zur lieben, wundermilden, herrlichen Erde, ja, besonders zur Erde mit ihrer gesegneten Mütterlichkeit, mit ihren Morgen und Nächten, mit ihren tagtäglichen Wundern. Und der Mensch hat sich so erniedrigt. Sich selbst so verdorben durch Lügen und Bettelei. Ach, es ist so traurig!«
Brüder und Schwestern im Geiste hat es immer gegeben. Es wird sie auch immer geben. Sie sind der Schutz gegen den Wahnsinn, sie legen dir den Harnisch an. Ich bin außerordentlich dankbar dafür, dass ich im Laufe meiner Jahre so wache, so schöne, so mutige und unverfälschte Menschen kennenlernen durfte, die mich immer wieder daran erinnern, wie wir, die Menschen, eigentlich gemeint waren.
Wir müssen die Gestaltungshoheit über uns selbst zurückgewinnen
Der Frühling hat sichtlich Spaß daran, dem flüchtenden Winter auf die dreckige Schärpe zu springen. In drei Wochen ist die Fassade des Jugendstilhauses gegenüber hinter dem Blätterwerk der erblühenden Kastanien verschwunden, die sich zur Siegesfeier dann Hunderte von weißen Kandelabern aufsetzen, welche bald darauf dichten Blütenschnee auf den Asphalt rieseln lassen. Was für ein Schauspiel, das wir jedoch nur in Bruchstücken wahrnehmen, da wir in einer anderen Zeit lagern. In der Menschenzeit. Und die verläuft anders als zum Beispiel die Pflanzenzeit.
Zweieinhalb Meter ist meine Yucca in den letzten acht Jahren gewachsen. Der Wachstumsprozess war mir zu keiner Zeit bewusst geworden. Die Palme war immer so groß, wie ich sie gerade vorfand. Angenommen, man hätte sie über acht Jahre hinweg gefilmt, dann stünden jetzt siebzigtausend Stunden Material zur Verfügung. Aufschluss über ihr Wachstum aber gäbe der Film nicht. Eine Menge anderer Dinge würde man in der Wiederholung sehen. Mich zum Beispiel, ich wohne ja hier. Ich würde ständig durchs Bild laufen, man würde mich essen, arbeiten und lieben sehen, man würde Tage und Nächte vorbei streichen sehen, ganze Jahre, immer schön synchron, aber die Palme würde man nicht wachsen sehen. Dazu müsste man den Film durch den Zeitraffer jagen. Erst wenn man die acht Jahre auf eine Stunde verdichtete, könnte man die Yucca sich erheben sehen. Das wäre dann immer noch ein bedächtiges Aufbäumen. Zentimeter für Zentimeter würde die Pflanze ihre Größe entfalten, während die reale Zeit zu einem nervösen Lichtgeflacker verkäme. Von mir, der ich mit der Palme gelebt hatte, fehlte gar jede Spur. Meine Bewegungen wären nicht registriert. Ich wäre allenfalls ein dubioser Nebel, der sich kreisend über das Bild bewegte, ich wäre ausgelöscht in der Welt des behutsamen Wachstums. Obwohl doch beide, die Pflanze und ich, zwei körperliche Wesen waren, obwohl wir beide in derselben Zeit am selben Ort existierten, wäre ich im Zeitraffer unsichtbar. Für die Yucca war ich eine Ahnung, ein Hauch, mehr nicht. Sicher gibt es auch für uns Menschen handfeste Wesen, die wir aufgrund ihrer andersgearteten Bewegungen, nicht zu erkennen vermögen, während sie ihrerseits ganz praktisch mit uns umgehen. Wir nennen sie Geister …
Übrigens warte ich seit Wochen darauf, dass meine Palme gegen die Zimmerdecke stößt. Obwohl ich von Pflanzenpflege keine Ahnung habe, gedieh sie zu jenem Prachtexemplar, das meine Besucher immer wieder in Erstaunen versetzt. Niemand mag glauben, dass dies ausschließlich mit verkalktem Leitungswasser möglich war. Ganze zwei Mal habe ich bisher die Erde gewechselt und die Lichtverhältnisse in einer Hamburger Mietwohnung dürften auch nicht nach dem Geschmack einer Tropenpflanze sein. Oft werde ich gefragt, wie häufig ich die Palme gieße. Ich antworte: je nach Gefühl. Es ist in der Tat so, dass ich keinen Gießplan für meine Pflanzen habe, die unter der Schirmherrschaft der Yucca prächtig gedeihen. Ich mache mir noch nicht einmal Gedanken über die Pflege. Ich weiß, wann sie Wasser brauchen, ich folge einfach ihrem Ruf. Unsere Kommunikation ist aber nicht aufs »Essenfassen« beschränkt. Wenn ich mit einer Idee schwanger gehe, die es zu formulieren gilt, wenn ich dabei bis in die letzten Winkel der Wohnung tigere, um meinen Kopf zu kühlen, dann ertappe ich mich gelegentlich dabei, wie ich eine Pflanze berühre, ihre Blätter auf Schadstellen untersuche, ihr den Staub abwische, sie ins rechte Licht rücke. Die Pflege meiner Pflanzen geschieht unbewusst, ohne dass ich dabei nachlässig wäre. Im Gegenteil: In diesen meditativen Augenblicken bin ich ihnen sehr nah. Ich erkenne ihre Bedürfnisse und gehe auf sie ein. Als Dank saugen sie jeden gedanklichen Ballast aus mir, sodass ich mit einem klaren Ergebnis an den Laptop zurückkehre. Ich benutze keine Worte, wenn ich mit ihnen spreche, ich richte nicht einmal formulierte Gedanken an sie. Unser Verständnis funktioniert auf einer anderen Ebene, es liegt jenseits aller Missverständnisse. Ich vertraue den Pflanzen. Sie richten sich ausschließlich nach dem Licht, dem inneren wie dem äußeren. Ich spüre ihre Seele. Nur die Steine wissen mehr als sie. Seit Wochen warte ich darauf, dass meine Palme an die Zimmerdecke stößt. Sie tut es nicht, sie hat aufgehört zu wachsen. Einen Zentimeter vor der Schmerzgrenze.
Sie merken vielleicht, dass ich mich in Gedanken und Betrachtungen verliere, die, wenn man sie mit einem Datum versehen würde, für nachfolgende Generationen keinerlei Rückschlüsse auf die Umstände zuließen, unter denen sie notiert wurden. Angenommen, sie wären ein noch lesbarer Bestandteil eines verkohlten Tagebuchs, von dem man sich Aufschlüsse über den Wahnsinn erhoffte, der zu jener Zeit in Europa tobte, diese letzten Texte wären wenig hilfreich. Da hätte man schon meine früheren Arbeiten und Bücher aus den Trümmern klauben müssen, da stand alles geschrieben. Aber jetzt, wo die Motorik der Dummheit so richtig ins Laufen gekommen ist, lasse ich ab. Mein Empörungspotenzial ist erschöpft.