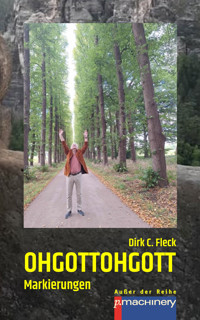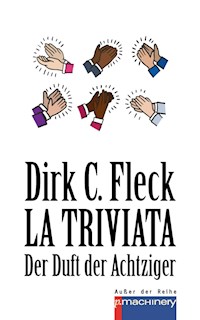
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die vorliegenden Aufzeichnungen aus dem Jahre 1985 sind das Resultat einer großen Anstrengung, eines Überlebenskampfes, wenn man so will. Nachdem ich zuvor zwanzig Jahre in diversen Redaktionen gearbeitet hatte und feststellen musste, wie mein Traumberuf langsam aber stetig vom demokratischen Korrektiv zum Handlanger von Kapitalinteressen mutierte, war ich erstmals kühn genug, den Ausstieg zu wagen. Mein journalistischer Niedergang bis hin zum Verfassen von Trivialromanen für die Regenbogenpresse ist aber nur die eine Seite der Medaille. Um meinen inneren Kompass nicht gänzlich zu verlieren, machte ich es mir zur Pflicht, mich mit täglichen Fingerübungen "frisch" zu halten. Das Manuskript ist 33 Jahre alt. Der Abstand zum Jahr 1985 ist aus zweierlei Gründen interessant: zum Einen wird klar, auf welch fatale Weise die Dinge fortgeschrieben wurden, von denen hier so häufig die Rede ist. Zum Anderen transportiert das Buch den Duft der Achtziger, ein Jahrzehnt, das dem Minimalismus in zu engen Anzügen huldigte und dem wir in Nostalgie verbunden sind. Bei der Überarbeitung des Textes habe ich mich wie auf einer Zeitreise gefühlt und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen Leser ähnlich ergeht. "Es ist schade, dass alles nur Worte sind", hat Ingeborg Bachmann einmal gesagt, "ich wünschte mir einen richtigen Scheiterhaufen." 1985 ist ähnlich zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dirk C. Fleck
La Triviata
Der Duft der Achtziger
Außer der Reihe 31
Dirk C. Fleck
LA TRIVIATA
Der Duft der Achtziger
Außer der Reihe 31
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: November 2018
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: vecteezy.com, hands-clapping-vector-set
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 149 5
Ermahnung
Ich weine vor euch. Oh ja! Meine Augen werden sich mit Tränen füllen. Und wenn ihr vorbei gegangen seid, werden meine Tränen nicht aufhören, da ich weiß, zu welchen Schlünden ihr wandert! Ich kenne besser als jeder andere den, der euch beim Umweg auflauert.
Max Jacob
Vorwort
Die vorliegenden Aufzeichnungen aus dem Jahre 1985 sind das Resultat einer großen Anstrengung, eines Überlebenskampfes, wenn man so will. Nachdem ich zuvor zwanzig Jahre in diversen Redaktionen gearbeitet hatte und feststellen musste, wie mein Traumberuf langsam, aber stetig vom demokratischen Korrektiv zum Handlanger von Kapitalinteressen mutierte, war ich erstmals kühn genug, den Ausstieg zu wagen. Ich wollte nicht länger auf »Maggies Farm« arbeiten, wie es Bob Dylan so treffend ausdrückte, ich tauschte finanzielle Sicherheit gegen Unabhängigkeit – in der guten Hoffnung, dass mir als freier Journalist, der zudem über einige Beziehungen verfügte, ein bescheidenes Einkommen beschieden sein würde. Dass mich die Marktlage, in der eine neue Kaste von Verlagsmanagern ihre Häuser inzwischen wie Schraubenfabriken führten, selbst wenn in ihnen an den Stellschrauben der Gesellschaft gedreht wurde, schneller in die Knie zwang als erwartet, war nicht vorauszusehen.
Mein journalistischer Niedergang bis hin zum Verfassen von Trivialromanen für die Regenbogenpresse ist aber nur die eine Seite der Medaille. Um meinen inneren Kompass nicht gänzlich zu verlieren, machte ich es mir zur Pflicht, mich mit täglichen Fingerübungen »frisch« zu halten.
Das Manuskript ist dreiunddreißig Jahre alt. Nachdem der Suhrkamp Verlag einer Veröffentlichung zunächst zugestimmt hatte, um dann doch wieder abzusagen, war für mich klar, dass ich es allenfalls ein paar Freunden anvertrauen würde. Ich selbst habe immer mal wieder darin geblättert und mit den Jahren wuchs die Freude über das Buch, dessen Qualitäten mir zunehmend deutlicher vor Augen traten. Einen entscheidenden Reiz bezieht die Lektüre zweifellos aus der Tatsache, dass sie einer anderen Zeit entstammt.
Der Abstand zum Jahr 1985 ist aus zweierlei Gründen interessant: Zum einen wird klar, auf welch fatale Weise die Dinge fortgeschrieben wurden, von denen hier so häufig die Rede ist. Zum anderen transportiert das Buch den Duft der Achtziger, eines Jahrzehnts, das dem Minimalismus in zu engen Anzügen huldigte und dem wir in Nostalgie verbunden sind. Bei der Überarbeitung des Textes habe ich mich wie auf einer Zeitreise gefühlt und ich hoffe, dass es dem einen oder anderem Leser ähnlich ergeht.
»Es ist schade, dass alles nur Worte sind«, hat Ingeborg Bachmann einmal gesagt, »ich wünschte mir einen richtigen Scheiterhaufen.« 1985 ist ähnlich zu verstehen.
Dirk C. Fleck,
im Juni 2018
Postscriptum: Ein Wort zum Cover dieses Buches, weil sich doch viele fragen werden, welchen Bezug das Motiv zum Inhalt hat. Einen übergeordneten, würde ich sagen. Genauso wie der Untertitel »Der Duft der Achtziger«. Mit beiden, Untertitel wie Cover, kann man unmöglich stimmig auf die unterschiedlichsten hier versammelten zweihundertachtundfünfzig Gedanken eingehen. Man kann allenfalls den Grundtenor herausfiltern. Das könnte beispielsweise der Begriff Melancholie sein. Ich habe mich allerdings für etwas anderes entschieden, weil mir bei der Digitalisierung des Textes aufgefallen ist, das ich bereits damals, acht Jahre vor meinem Roman »GO! – Die Ökodiktatur«, immer wieder auf die verhängnisvollen Entwicklungen hingewiesen habe, die so grandios ignoriert wurden und werden. Während wir seit Jahrzehnten sehenden Auges auf eine ökologische Katastrophe zusteuern, haben wir uns zu totalüberwachten, manipulierten Claqueuren entwickelt, deren Gier, Ignoranz und Gleichgültigkeit das Desaster erst möglich macht, weswegen uns die Chose demnächst zurecht um die Ohren fliegen wird. Klatsch, klatsch …
Kopf-los
Der Dichter Blaise Cendrars (1887–1961) erzählt in seinen Erinnerungen von einem achtzehnbändigen Abenteuerroman, den er geschrieben und auf dem Weg zum Verleger nach einer amourösen Begegnung in einem Pariser Stundenhotel liegen gelassen hatte, wo es vom eintreffenden Reinigungspersonal sofort der frühen Müllabfuhr übergeben wurde. Das Manuskript umfasste tausendachthundert Seiten. Der achte Band trug den Titel: EUROPA OHNE KOPF. In ihm ging es darum, dass die jungen Pariser Maler (Picasso, Braque, Léger), die Musiker (Satie, Strawinsky, Ravel) und die Dichter (Apollinaire, Max Jacob und Cendrars selber), die alle noch unbekannt waren, jedoch sehr bald berühmt werden sollten, von einer Verbrecherbande im Auftrag des Staates ermordet werden. Cendrars: »Es ging um die Frage, ob man die geistige Zukunft Europas und damit der Welt, der Vormundschaft der Journalisten, Politiker und Pseudokünstler überlassen darf.«
Es war 1985, als ich von Cendrars Missgeschick erfuhr. Die Geschichte rund um das verschollene Stück Weltliteratur faszinierte mich. Das Thema sowieso. Also beschloss ich, es neu in Angriff zu nehmen, mit Protagonisten, die der Öffentlichkeit heute ebenfalls noch nicht bekannt sind. Um die Arbeit finanzieren zu können, bewarb ich mich mit der Idee bei der Hamburger Literaturförderung um ein Stipendium. Mein Begehren wurde abgelehnt. Hier ist der Brief, den ich der Kulturbehörde anschließend schrieb:
An die
Freie und Hansestadt Hamburg
Kulturbehörde
Lieber Herr Dr. Geist (er hieß wirklich so),
vor acht (!) Monaten hatte ich Ihnen per Einschreiben mein Exposé »Europa ohne Kopf« zugeschickt, mit dem ich mich um eine »individuelle Autorenförderung« bewarb. Heute nun erfahre ich auf telefonische Anfrage von Ihrer Sekretärin, dass sich die Jury nicht entschließen konnte, Stipendien zu vergeben, da die eingereichten Ideen den Ansprüchen nicht genügten und man nicht gewillt sei, »irgendwelchen Hobbyschreibern« Geld zukommen zu lassen.
Abgesehen davon, dass auch »Hobbyschreiber« eine Antwort erwarten dürfen, vermag ich nicht einzusehen, warum »Europa ohne Kopf« dem Expertenkreis keine Mark wert sein soll. Schließlich beschäftigt sich das Projekt gerade mit jenen Zuständen am Markt, die Qualität zu verhindern suchen. Der Beweis scheint ein weiteres Mal erbracht.
Sei es drum, Sie werden das Buch zu lesen bekommen, und wenn ich mich weitere drei Monate im Journalismus suhlen muss, um es finanzieren zu können. Die Not ist mein Hobby, Sie verstehen …
Mit freundlichen Grüßen
Dirk C. Fleck
So gut wird ‘85:
Frieden, Wohlstand und Fußball …!
BILD-Headline
1
Ein Orkan beißt in die Stadt. Dachziegel heben ab, Fensterscheiben bersten, die geschundenen Straßenbäume halten ihre Äste fest, Plastikfetzen kleben knatternd in den Hecken, eine Flasche trudelt über den Asphalt. Mit offenen Mündern stemmen wir uns gegen den Sturm, der uns die Haut von den Knochen reißen möchte. Die Weide am Weiher pendelt die himmlischen Peitschenhiebe elastisch aus, während die Bogenlampe mit dem Neongebiss klappert, als beklagte sie das Ende alles Statischen. Die kleine Reinigung tut gut, ich wünschte sie mir allerdings gründlicher. Auf einer Brücke begegnet mir ein Zug weiß geschminkter Gestalten, sie tragen einen schwarzen Sarg auf ihren Schultern. DIE LEBENDEN SIND DIE TOTEN! steht drauf.
2
Novembertage sind wie Ertrinkende: Kaum dass sie sich ans Licht erheben, versagen ihre Kräfte. Sie tauchen aus Nacht und Dämmerung, tropfend, besudelt und klamm. Sie legen sich auf die Gesichter der Menschen. Bespuckte Gesichter, aufgedunsen, verzerrt. Stumpfe Masken in gezähmter Hysterie, brandsalbengetrübt und nicht gefeit gegen Fäulnis. Sie schlurfen durch den Gestank, den der Nebel bindet. Man muss in die Offensive gehen, um ihre schreckliche Macht zu brechen, von der sie keine Ahnung haben. Jemand nach der Uhrzeit fragen zum Beispiel …
3
Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das faschistische Potenzial in unserer Gesellschaft so angeschwollen ist, dass es aufbricht, um seine historische Mission in orgastischer Weise zu erfüllen. Für uns, die wir den Homo sapiens aufgrund einiger Zeugnisse aus dem Bereich der Kunst gerne anders als ein Krebsgeschwür gesehen hätten, wird es Zeit, sich der Wahrheit zu stellen.
4
Der Talmud sagt, dass die Juden wie eine Olive ihr Bestes geben, wenn sie zermalmt werden. Trifft das nicht auf uns alle zu? Zumindest auf diejenigen unter uns, die nicht leugnen wollen, dass sie eine materielle Leihgabe sind und dorthin zurückfließen werden, woher sie gekommen sind.
5
Mein Leben kommt mir vor wie eine letzte Sünde, die ich mir gestatte. Der Nikotinentzug hat meinen Kopf mit sprühenden Fäden durchwoben, über der Stirn liegt ein kaltes (heißes?) Band, die Ohren dröhnen. Wie zickig dieser kleine Dämon doch wird, sobald er die ernste Absicht spürt. Er trampelt gegen die Netzhaut und verregnet meine Bilder. Abwechselnd zerrt er mich aus bleierner Müdigkeit in die flirrende Wachheit des Augenblicks. Nichts zu machen, Kleiner, ich genieße meine Genesungsschmerzen …
Die heiligen Kühe
Ein Gedicht
Kalb Nr. 4576 (03.02.85): Dauer 67 Minuten. Tod wegen technischer Störung.
Kalb Nr. 4582 (13.02.85): Dauer 47 Minuten. Tod wegen technischer Störung.
Kalb Nr. 4583 (20.02.85): Dauer 50 Minuten. Tod wegen technischer Störung.
Kalb Nr. 4584 (24.02.85): Dauer 12,5 Stunden. Einige Reflexe. Zerreißung der Pumpmembrane. Nierenversagen.
Kalb Nr. 4587 (17.03.85): Dauer 8,25 Stunden. Nierenversagen. Sauerstoffausfall in den Geweben trotz reiner Sauerstoffbeatmung.
Kalb Nr. 4596 (20.03.85): Dauer 44 Stunden. Keine Reflexbewegungen. Keine Urinausscheidung. Künstliche Beatmung.
Indien will 260.000 Schlachtkühe kaufen, um sie vor dem Tod zu retten.
Süddeutsche Zeitung vom 30.12.1984
6
Dort steht eine Frau: nur mit einem Hemd bekleidet, die Augen ziellos geradeaus gerichtet, das Haar zerzaust, die Arme schlaff am Körper. Männer nähern sich ihr, Männer in dunklen Anzügen, glatt gescheitelte Männer, Männer mit Brillen und Aktenkoffern. Sie zupfen an der Frau herum, kneifen ihr in die Wangen, klopfen auf ihre Stirn, streicheln ihren Bauch, tasten nach ihrem Busen. Sie singen: »FRÜHLING UND SONNENSCHEIN, SOLL FÜR MICH MEINE LIEBE SEIN, WAS ICH ZU TRÄUMEN NIE GEWAGT, DAS HAT DEIN KUSS MIR GESAGT …« Die Frau bricht in die Knie. Die Männer heben sie auf. Wie eine Stoffpuppe hängt sie in ihren Armen. Jemand knabbert an ihren Fingern, ein anderer spielt mit ihrer Nase, ein dritter zieht an ihrem Haar. Die Frau versinkt in der begehrlichen Meute, liegt auf dem Rücken, weint. Die Männer versuchen sie aufzurichten, einer greift ihr in den Mund, Männerhände kraulen ihr Kinn, massieren ihre Schultern, kitzeln sie unter den Achseln, ordnen ihr Haar, lassen von ihr ab. Die Frau sucht ihren Schuh, findet ihn, humpelt davon. Die Männer zupfen an ihren Ohrläppchen und lassen sich von einer aufreizend gekleideten Lady ins Schlepptau nehmen. »GNÄDIGE FRAU, ICH BIN JA NICHT BLIND, ICH SEH, WIE SIE MIR GEFÄHRLICH SIND, DENN IN IHREN BLAUEN AUGEN STEHT GESCHRIEBEN, WENN MAN SIE EINMAL SIEHT, MUSS MAN SIE LIEBEN …« Die Musik verstummt. Übrig bleibt nur der Klang der Schritte. Einszwei, einszwei, einszwei …
7
Eine Frau schreit: »I WANT PEOPLE!« Dann kommen sie herbei in unendlichen Kolonnen. Die Frau torkelt in der Menge wie ein Korken auf See.
8
Männer und Frauen stehen aufgereiht da wie zu einem Familienfoto. Sie klatschen synchron in die Hände, um sich kurz darauf die imaginären Tränen aus den Augen zu wischen. Dieses Wechselspiel dauert solange an, wie die alte Volksweise dauert, der wir lauschen.
9
Inszenierte Gemälde, das ist es wohl, was Pina Bausch im Sinn hatte. Bei ihr aber kommt Leben ins Bild, die Porträtierten sind es nämlich leid, auf alle Zeiten in einem Gestus festgehalten zu werden. Ohne die Absicht des Malers zu verfälschen, beginnen sie miteinander zu kommunizieren. Sie flüstern, sie lächeln, sie neigen andeutungsweise den Kopf. Atmende Kunst …
10
Ein Mann reißt einen anderen um, nimmt die Faust des Gestürzten und trommelt mit ihr auf den Boden. Er nimmt auch dessen Arme und breitet sie andächtig gen Himmel …
11
»ICH BIN TÄNZER GEWORDEN, WEIL ICH EINEN UNFALL HATTE UND WEIL ICH NICHT SOLDAT WERDEN WOLLTE.«
12
»Pina, wie siehst du deine Zukunft?«
Pina Bausch: »Meine Zukunft …? I … I don’t know … because … I think there is so big problems in the world, that I’m afraid to ask myself what I wish for myself. I am sure I … I wish … I hope … strength, a lot of strength … and love, I don’t know … a lot of strength …«
Sie wird sehr kräftig sein, die Frau des Jahres 2100: schlanker, sehniger, durchtrainierter als die Frau von heute. Voll Energie. Mit 60 noch wird sie Babys haben und spielend 150 Jahre alt werden. Der Wissenschaft gelingt es, den Alterungsprozess zu stoppen. Mit 70 werden Frauen so aussehen, wie heute die 30jährigen. Computer erarbeiten für jede Frau individuelle Esspläne aus. Nur eines wird sich bis dahin kaum verändert haben: dass die Frauen immer noch zuständig sind für den Haushalt. Der einzige Trost: sie werden Roboter haben, die waschen, bügeln und kochen. Sogar Roboter fürs Baden und Wickeln von Kindern. Der Haken ist nämlich: Die Frau 2100 soll auch aggressiver, härter und seelisch kühler sein als heute!
BILD-Zeitung vom 31.12.1984
13
Viele Menschen glauben, weil sie Macht haben, hätte das etwas mit Arbeit zu tun. Es bedeutet aber nur, dass sie andere für sich arbeiten lassen.
14
Eine alte Frau bückt sich über eine frisch gegossene Betonmauer. Sie hat Schmerzen im Kreuz, hält sich den Rücken. Eine Betonmauer! Warum betrachtet sie nicht den Busch, dem diese Mauer auf die Füße tritt und dessen Schreie nicht zu überhören sind?
15
Die fünfzig- bis sechzigjährigen Männer, die an jeder Baugrube stehen und stundenlang den Wühlarbeiten zusehen.
16
Wie lange ist es her, dass ich mich nachts unter Leute wagte, weinselige Bruderschaften schloss, sie theatralisch mit den Augen versiegelte, um all die Wunden, die meine Ironie zuvor geschlagen hatte, vergessen zu machen. Derart besänftigt stolperte ich an die frische Luft, ließ die Laternenpfähle nicht zu weit nach links und nach rechts schwenken und brachte mich tief atmend in die Sicherheit eines von allen guten Geistern verlassenen Schlafes.
17
Ich nehme die Tage kaum zur Kenntnis. Die Impressionsbeute ist gering. Zuviel wiederkehrende Bilder. Wohin fahren all die Autos? Warum liegt dieses Netz aus banalen Worten über der Stadt, in der sich täglich Hunderttausende verfangen? Der Regen macht die Wimpern schwer. Die Menschen bemerken einander nur noch knieabwärts. Ich bin auf Geschenke angewiesen. Auf einen offenen Blick aus einem vorbeifahrenden Bus etwa. Wie viel Erotik doch in diesem flüchtigen Augenblick liegt, wie viel Sehnsucht und Verlorenheit …
18
Vision einer verkabelten Gesellschaft: Die Straßen sind gesperrt, sie dienen ausschließlich als Kulisse für Dreharbeiten. Das Volk ist in die Wohnungen verbannt. Realität bedeutet: Filme sehen.
19
Ein kleiner Mann mir eingefallenen Wangen, müden Augen und einer kalten Zigarre im Mund hängt an Arm einer stämmigen, fleischigen Frau. Im Vorübergehen höre ich sie beschwörend sagen: »Versetz dich doch mal in meine Lage …!« Warum rührt mich das?
20
Dieser einäugige Junge … Dort, wo das andere Auge sitzen müsste, spannt sich glatte Haut. Warum trägt er keine Augenklappe? Seine Mutter wehrt die Blicke der Entgegenkommenden ab, biegt sie um, registriert dankbar meinen Gleichmut.
21
»Erzähl etwas Interessantes«, unterbrach er sie, »erzähl von dir!« Sie ließ ihn stehen.
22
Oh, wie ich mitleide bei den Gemeinheiten, die ich austeile!
23
Mit welchem dümmlichen Ernst man den Narren in sich tötet!
24
Was ist passiert, dass niemand mehr die simpelsten Rechnungen aufmachen will? Jeder Autofahrer der Welt würde sich entschieden weigern, bei laufendem Motor auch nur zehn Minuten in einer geschlossenen Garage zu verweilen. Er würde es nicht überleben und er weiß es. Angenommen, die dreißig Millionen in der Bundesrepublik zugelassenen Kraftfahrzeuge bewegten sich nur jeweils eine halbe Stunde am Tag. Die von ihnen produzierte Giftwolke entspräche dann dem Volumen von hundertachtzig Millionen Garagen. Auf das gesamte Verkehrsaufkommen des Planeten hochgerechnet bedeutet dies nichts anderes, als dass wir alle längst Opfer der größten Vergasungsaktion geworden sind, die unsere an Massenmorden gewiss nicht arme Geschichte bisher erlebt hat.
25
Man selbst bleibt unangetastet und wird doch Zeuge all der Tränen, Ängste, Missverständnisse und Vergewaltigungen, Zeuge für das gesammelte Aufgebot gegen die Lebensfreude. Es sollte doch zumindest die Kunst von den Menschen erfasst werden, jetzt, da sie von der Magie des Todes befruchtet wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nichts ist verdächtiger als die Wahrheit, die in der Kunst zu Hause ist – und so hält man sich in heuchlerischer Distanz zu ihr.
26
Am Anfang war das Wort. Inzwischen dient die Sprache hauptsächlich als Schaufelbagger für Lügen.
27
Als er es aufgab, sich zu rechtfertigen, war er auf Freunde angewiesen.
28
Eine Weile ist es wohl so, dass man gegen Wände gedrückt wird, wenn man das Leben auf sich wirken lässt, anstatt ihm kreativ zu begegnen.
29
Wenn die Sterbenden mit den Traurigen liebende Blicke austauschten, wer von den Traurigen ließe sich wohl fallen?
30
Neurosen sind Splitter zerstörter Fantasien. Man sollte sie lieben, insbesondere, wenn es die eigenen sind.
Ein Jumbo stürzt in Japan ab, alle 524 Insassen tot. Unglaublich. Hamburgs Kaffeekönig auf der Autobahn verunglückt, tot. Unfassbar. Tödlicher Unfall auf der Rennstrecke in Kanada, schrecklich. Ein Tag, an dem man an dieser Welt verzweifeln möchte. Ein Tag, an dem Spaß und Freude vergehen. Trotzdem: Wir sollten uns unseres Lebens freuen. Wenn auch mit Schluckbeschwerden. Anlässe gibt es noch: die Blume, die blüht. Der Mensch, den man liebt. Das Hobby, das einen begeistert. Die Welt ist so schlimm, dass wir uns zu dieser Freude zwingen müssen.
Kommentar aus der Hamburger Morgenpost vom 02.01.1985
28
Die Tragödie der Menschheit besteht darin, dass sie anstelle des Glaubens den Aberglauben an die Wissenschaft gesetzt hat. Diese begreift das Leben lediglich als Rätsel, das es zu knacken gilt. Damit beraubt sie uns der Ehrfurcht, die alleine imstande ist, uns in Balance zu halten. Ehrfurcht akzeptiert den Zusammenhalt materieller und nichtmaterieller Existenz, sie hebt die Zeit auf, welche die Wissenschaft nicht zu sprengen vermag, ohne sich selbst zu verlieren. Die alten Kulturen wussten das, sie banden die Menschen in ein Gefühl der Verehrung. Wir hingegen haben uns entwurzeln lassen. Dabei wissen wir nicht einmal eine Antwort auf die Frage, welche Energie unser Herz schlagen lässt.
29
Niemand soll denken, dass er die Wahrheit ertrüge. Er würde verglühen, falls sie sich ihm mit einem Schlage offenbarte. Es ist gerade die Unwissenheit, die uns schützt. Die Geheimnisse entziehen sich dem Verstand, nur die Poesie darf sich ihnen in bescheidener Weise nähern. Poesie klingt, sie erklärt nicht. Sie ist der Resonanzboden für die Schwingungen des Lebens.
30
Wenn die Idee von der Wiedergeburt einen Sinn ergibt, dann nur wegen der Vorstellung, dass sie uns nacheinander in jede denkbare materielle Form zwingt, um so zu einem übergreifenden Verständnis zu gelangen, welches uns aus dem Leid erlöst, welches unabdingbar mit jeder körperlichen Existenz verbunden ist. Wir werden also sowohl der Baum gewesen sein, den wir gefällt haben, als auch die Ameise, die wir unter unseren Händen zerdrücken. Wir werden die Erfahrungen eines Silvesterkarpfens ebenso gemacht haben, wie die eines Tigers im Zoo. Wir werden den Autoreifen so wenig entkommen sein, wie die Kröten auf ihrer Wanderung zu eben jenem Ziel, das uns allen gemeinsam ist. Wir werden uns sowohl schuldig als auch unschuldig gefühlt haben. Wir werden Herrscher und Besiegte in uns vereinigen, jeder Schmerz, jede Freude, jeder Wahnsinn wird uns schließlich vertraut sein. Die Idee, dass uns nichts erspart bleibt, hat etwas sehr Tröstliches. Sie besagt, dass wir uns in all unserem Tun nur an uns selbst vergreifen können. Um für diese Erkenntnis offen zu werden, gilt es, den Angstknoten in uns zu lösen, jenes Geschwür der Seele, das sich in vordergründigen Sicherheiten versteckt und dessen Eiter die Ignoranz gegenüber der Tatsache ist, dass sich nichts, aber auch gar nichts an egoistischer Attitüde dem Leben gegenüber verteidigen lässt. Früher oder später müssen wir erkennen, dass wir Teil eines einzigen und einzigartigen Körpers sind. Wie hatte Friedrich Schiller so richtig gesagt: Die Natur ist ein unendlich geteilter Gott.
31
Was unterscheidet den Geistreichen, den Gebildeten, vom Genie? Seine mangelnde Identität, sein fehlender Mut zu leben und zu sterben. Während der Gebildete in feiner Distanz zum Leben bleibt, gibt sich das Genie dem Leben hin. Es kann seine Kunst, diese Arbeit am Rande des Unaussprechlichen, wie Musil sagt, nicht abtrennen. Für Genies sind die Märkte verschlossen, auf denen sich die Geistreichen tummeln, ein Genie lebt volles Risiko, ohne jegliche Spekulation auf einen zu erzielenden Vorteil. Das ist hart, denn niemand wird aus gesicherten Verhältnissen heraus gerade jene unterstützen, die diese Verhältnisse radikal in Zweifel stellen. Man ist ja froh, wenn man die Quälgeister des eigenen Gewissens los wird. Das Leben ist hart, heißt es, Sie sind den Anforderungen nicht gewachsen, mein Herr …
32
Nicht mehr eingebettet zu sein in die uns zur Verfügung stehenden Sinne – wie sieht das aus, wie fühlt es sich an?
33
Künstler sind die Analphabeten der Computergesellschaft.
34
Die Literatur, das sind wir und unsere Feinde – Heinrich Heine.
35
Es gibt sie, die Dornenfelder, in denen die Dichter solange bluten, bis sie aufgerufen werden zu schreiben.
36
Wieso haben wir so häufig das Bedürfnis, dass andere Menschen dasselbe sehen sollen wie wir selbst?
37
Worte verbrennen in der Wahrheit wie Meteore in der Atmosphäre.