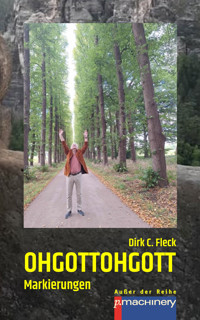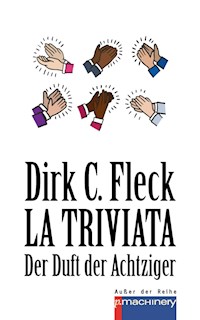5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ökoterrorismus: Notwehr oder Nötigung? Es gibt Menschen, die nicht mehr daran glauben, dass Politiker diesen Planeten vor dem Kollaps retten können. Robert Palmer ist so ein Mensch. Er handelt selbst. Er entführt einen Supertanker und führt diese schwimmende Bombe vor das UN-Hauptquartier in New York … "Mit PALMERS KRIEG ist Fleck zum Vater des deutschen Öko-Thrillers geworden. Bei der Kombination von Faktenfülle und Lesbarkeit fühlt man sich an die besten Momente von B. Traven (Das Totenschiff) erinnert, die zumeist knapp-lakonische Sprache erreicht oft die Größe von Genremeistern wie Raymond Chandler oder Dashiell Hammett." taz, 04.01.1993
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dirk C. Fleck
PALMERS KRIEG
Action, Thriller, Mystery 9
Dirk C. Fleck
PALMERS KRIEG
Action, Thriller, Mystery 9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Juni 2016
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Lothar Bauer
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgaben:
Paperback 978 3 95765 064 1
Hardcover 978 3 95765 065 8
Für Cassandra, Joelin, Danae und Alexander.
I.M. with you.
Vorwort
Die Erstausgabe dieses Romans erschien 1992 im Rasch & Röhring Verlag, der unter anderem die Bücher von Ralph Giordano und Hoimar von Ditfurth (»So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen«) im Programm hatte. Das ist lange her. Nach dem Tod des Verlegers Hans-Helmut Röhring gibt es den »für sein besonders ambitioniertes Programm« von der Hamburger Kulturbehörde ausgezeichneten Verlag nicht mehr. »Palmers Krieg« hätte sonst sicher die eine oder andere Neuauflage erfahren. Dass der p.machinery-Verlag, der schon meinen 1993 bei Rasch & Röhring erschienenen Roman »GO! – Die Ökodiktatur« neu verlegte und in diesem Herbst auch meinen aktuellen Roman »Feuer am Fuss« ins Programm genommen hat, »Palmers Krieg« nun eine neue Chance gibt, freut mich sehr. Dieses Buch, für das ich von der taz als »Vater des deutschen Ökothrillers« geadelt wurde, hat an Brisanz nämlich nichts verloren. Das Thema Ökoterrorismus wird uns aufgrund der immer dramatischer werdenden Situation auf diesem Planeten in Zukunft vermutlich noch sehr beschäftigen.
»Palmers Krieg« ist mein Romanerstling. Er ist das, was man einen typischen Thriller nennt. Ich hatte ihn ganz bewusst in der Tradition der großen US-amerikanischen Krimiautoren Dashiell Hammet und Raymond Chandler geschrieben. Knallhart, zynisch und actiongeladen. Der eigentliche Held neben dem Protagonisten Robert Palmer ist der Supertanker EVE, der quer über den Atlantik vor das UN-Hauptquartier in New York gesteuert wird. Natürlich hat sich die Technik auf den Supertankern dieser Welt in den letzten dreiundzwanzig Jahren weiter entwickelt, ebenso wie die Kommunikationstechnik. Man sollte »Palmers Krieg« daher lesen, wie man einen etwas in die Jahre gekommenen Film sieht, in dem die Autos ohne elektronische Hilfe auskamen und die Menschen noch ihre Nokia-Knochen statt des iPhones am Ohr hatten. Das hat ja durchaus Charme. Der Geschichte selbst schadet es nicht.
Ich wünsche Ihnen eine aufregende Lektüre, die Sie hoffentlich ein wenig nachdenklich macht.
Dirk C. Fleck
im Mai 2016
Palmers Krieg
Das schwarz mattierte Verwaltungsgebäude des Ölmultis BARREL OIL schien das grelle Licht regelrecht aufzusaugen, das die Mittagssonne über Dallas ausschüttete. Während im Konferenzraum des siebenundzwanzigsten Stockwerkes Fruchtsäfte und Mineralwasser bereitgestellt wurden, traf die Delegation aus Tokio in der Empfangshalle ein. Ein junger Mann von der Presseabteilung begrüßte die Herren und geleitete sie zum Expresslift. Unterdessen schnupperte Raymond Bradbury, Vizepräsident der Firma und eigentlicher Herrscher des Hauses, an einer Zigarre.
»Die Herren der Mitsubishi-Werft sind da, Sir«, meldete seine Sekretärin.
»Ich lasse bitten.«
Bradbury hob seinen massigen Körper aus dem Ledersessel. Trotz seiner Einsachtzig wirkte er ein wenig untersetzt. Der runde Kopf ruhte ansatzlos auf den Schultern. Über der wulstigen Oberlippe bildeten sich kleine Schweißperlen. Das fein geschnittene Gesicht stand im seltsamen Gegensatz zu seiner bulligen Erscheinung. Unter der hohen Stirn blinkten wache Augen, die drahtigen Brauen stießen über der geraden Nase schwungvoll zusammen. Ein dichter Haarkranz umschloss den braun gegerbten bloßen Schädel.
Bradbury nahm die Brille ab und ging seinen japanischen Geschäftsfreunden mit ausgestreckten Armen entgegen.
»Willkommen bei BARREL OIL, Gentlemen! Wie war der Flug?«
Seine dunkle Stimme klang weich und einladend. Es fiel allerdings nicht schwer, sie sich als Orkan vorzustellen, der kritische Einwände wie welkes Laub hinwegfegen konnte.
»Sagen Sie Hodes, Henderson und O’Connor, wir wären dann soweit«, befahl er der Sekretärin. »Bitte, meine Herren, was stehen wir hier herum? Gehen wir nach nebenan.«
Die Japaner setzten sich artig in eine Reihe und klappten ihre Diplomatenkoffer auf. Bradbury drehte den schwarzen Siegelring an seinem Finger und beobachtete die Vorbereitungen der Gäste mit dem heimlichen Vergnügen eines Spielers, der alle Trümpfe in der Hand hielt. Auf dem Videoschirm des Konferenzraumes leuchteten die Konstruktionszeichnungen jenes Supertankers auf, der zum Prototyp einer ganzen Flotte werden sollte, die BARREL OIL im Laufe der nächsten Jahre in Auftrag geben wollte. Die Chancen, dass Mitsubishi den Zuschlag erhielt, standen gut.
»Meine Herren«, sagte Bradbury und wies auf die Tür, »Sie kennen Mister Hodes ja bereits von unserem Besuch in Tokio.«
Die Japaner neigten die Köpfe vor dem Mann, der als Bradburys rechte Hand galt. Hodes setzte sich Mister Koawa gegenüber, dem technischen Direktor der Mitsubishi-Werft.
»Ich darf Ihnen auch Chefingenieur Henderson und Mister O’Connor vorstellen«, fuhr Bradbury fort und rieb sich das Kinn. »Die Sache mit den Bremsfallschirmen ist auf Hendersons Mist gewachsen. Mister O’Connor ist unser Sicherheitsbeauftragter, als solcher hat er natürlich das Recht, an dieser Sitzung teilzunehmen.«
Die Japaner entblößten lächelnd die Zähne.
»Kommen wir zur Sache, Gentlemen«, begann Bradbury. »Wir sind nicht abgeneigt, Ihnen den Bau unseres Prototyps anzuvertrauen. Ich gestehe offen, dass Ihre berauschend günstige Kalkulation eine entscheidende Rolle dabei spielt. Was macht Sie so billig? Stahl hat seinen festen Preis auf dem Weltmarkt. Und Mitsubishi gehört nicht zu den Werften, die auf Kosten der Qualität arbeiten …«
»Danke«, entgegnete Koawa höflich. »Unsere Kalkulation liegt in der Tat um zehn Prozent unter den abzusehenden Kosten.«
»So ungefähr«, pflichtete Bradbury bei und blies den Anwesenden den Rauch seiner Zigarre über die Köpfe. »Also, wie machen Sie das?«
»Unsere Regierung hat sich bereit erklärt, das Projekt zu subventionieren.«
»Nun gut, da wären aber noch ein paar strittige Punkte zu klären. Mister Henderson, bitte fangen Sie an …«
Der Chefingenieur blätterte nervös in einem Stapel handgeschriebener Aufzeichnungen.
»Es sind eigentlich nur Kleinigkeiten«, begann er. »Da die Schiffe hauptsächlich zwischen dem Persischen Golf und Europa verkehren sollen, haben wir uns für den kleineren der beiden infrage kommenden Typen entschieden, also für die Dreihundertdreizehntausend-Tonnen-Version.«
»Klein ist gut«, knurrte Bradbury belustigt. »Das Ding ist so hoch wie ein achtzehnstöckiges Wohnhaus und dreimal so lang wie das Spielfeld Ihres Lieblingsklubs, den Texas Rangers. Die Burschen haben übrigens lausig gespielt gestern Abend.«
Henderson räusperte sich. Er hasste Bradburys burschikosen Humor. »Aus Sicherheitsgründen sind wir an sechs unabhängig voneinander arbeitenden Feuerlöschsystemen interessiert«, fuhr er so gefasst wie möglich fort, »nicht an vier, wie es ursprünglich vorgesehen war. Zweitens: Die Maschine muss von der Brücke, von den Brückennocken und vom Maschinenkontrollraum ferngesteuert werden können. Die Automation muss auch für einen zeitweise unbesetzten MKR ausgelegt sein. Einige Daten zur Maschine selbst: vierzigtausend PS, Geschwindigkeit unter Probefahrtbedingungen bei hundert Prozent MCR und bei Sommerfreibordtiefgang fünfzehn Komma sechs Knoten. Ferner zwei HD-Wasser-Rohrkessel, ölgefeuert, Stromerzeuger ist ein Turbogenerator mit Abdampf zum Hauptkondensator …«
»Um Gottes willen, Mike!«, unterbrach Bradbury energisch. »Verschonen Sie uns mit Ihren technischen Details. Diese Dinge sind in der Order genauestens fixiert. Kommen Sie auf den Punkt!«
Hendersons Ohren liefen puterrot an. Er gehörte zu den Leuten, die man ungestraft beleidigen konnte und die einen Cowboy wie Bradbury dazu animierten, es immer wieder zu tun.
»Wir sind der Meinung«, sprang Hodes in die Bresche, »dass wir den Auftrag zur Fertigung des von Mister Henderson entwickelten Bremssystems der Firma Boeing übertragen sollten. Das System würde Ihnen dann zugeliefert.«
»Das ist äußerst bedauerlich«, bemerkte Koawa überrascht, »schließlich verfügt Misubishi über einige Erfahrungen mit Bremsfallschirmen.«
Er goss sich Mineralwasser nach. Das Zischen der Kohlensäure war für einen Moment alles, was von der Unterhaltung übrig blieb.
»Wie beurteilen Sie denn die Hendersonsche Erfindung?«, fragte Bradbury listig. »Lässt es sich so überhaupt machen?«
»Wie Sie wissen, experimentieren wir bereits seit einigen Jahren mit Bremsfallschirmen«, meldete sich der glatt gescheitelte Mann neben Koawa mit heller Stimme zu Wort. »Leider hielt bisher keines der erprobten Gewebe der extremen Belastung unter Wasser stand. Ihr Vorschlag, den Druck dadurch abzubauen, dass man statt zweier Schirme gleich eine ganze Dolde unterschiedlicher Größen abschießt, ist genial …«
»Machen Sie unseren Chefingenieur nicht nervös«, stichelte Bradbury, »das schadet seiner Kreativität …«
Henderson lächelte gequält. »Die Kammern für die Schirme kommen in die Seitentanks drei«, sagte er. »Eine Hydraulik öffnet die Klappen in der Bordwand. Die Schirme sind so angeordnet, dass sie sich nacheinander öffnen. Der Blüteneffekt bricht die Strömung, sodass auf keiner der zwölf Flächen mehr Druck lastet, als sie tatsächlich tragen können.«
»Das ergibt wie viel Bremswegersparnis?«, fragte Bradbury. »Sagen wir dreihunderttausend Tonnen, voll beladen, achtzehn Knoten?«
»In Gewässern ohne große Strömung rechnet man bei herkömmlichen Tankern mit einem Bremsweg von sechs bis sieben Meilen«, antwortete Hernderson, »Crashstopp inbegriffen. Mit ausgefahrenen Fallschirmen reduzieren wir den Bremsweg um die Hälfte.«
Bradbury schnitt eine neue Zigarre an und führte sie genüsslich unter der Nase entlang. »Bei allen bisher bekannten Unfällen«, murmelte er, ohne aufzublicken, »hätte auch das nicht geholfen. Und dafür sind mir die Dinger einfach zu teuer … Ich weiß, Mister Hodes, was Sie jetzt sagen wollen. Sagen Sie es ruhig.«
»Nun, Sir, ich meine, wir sollten auf keinen Fall auf das System verzichten. Aus drei Gründen: Erstens macht es die Schiffe nicht nur sicherer, sondern auch beweglicher. Mit der Bremskraft auf nur einer Seite kann ein Tanker im Notfall sozusagen auf dem Teller drehen, anstatt wie bisher den halben Atlantik abzugrasen.«
Bradbury hatte sich nach hinten gelehnt und die Arme verschränkt. Er stierte in den Aschenbecher. Ein kaum merkliches Nicken, eher ein Wiegen des Kopfes begleitete Hodes’ Ausführungen.
»Zweitens«, fuhr Hodes fort, »müssen wir davon ausgehen, dass die IMCO, die Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, unsere Sicherheitsbestimmungen in den nächsten Jahren drastisch verschärfen wird. Um die hätte sich dann, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, BARREL OIL rechtzeitig und freiwillig verdient gemacht. Es ist an der Zeit, dem Vorurteil einer durch Preiserhöhungen und Katastrophen verunsicherten Bevölkerung etwas entgegenzusetzen, das in Vertrauen umschlagen kann. Vertrauen macht sich auf Dauer in der Bilanz am nachhaltigsten bemerkbar.«
Bradbury deutete wie ein Zirkusdirektor auf seinen Manager. »Robert M. Hodes, Gentlemen! Ich könnte ihm stundenlang zuhören! Okay, Bob, wir wollen also an Hendersons Fallschirmen zurückschweben in die Bereiche menschlichen Vertrauens. Aber Boeing baut die Dinger. Mister Koawa, wie lange wird Mitsubishi für den Bau des Prototyps brauchen? Für die ST. LOUIS haben Sie damals zweiundachtzig Tage hingelegt, eine stolze Leistung.«
»Der Raumplan ist der gleiche wie bei der ST. LOUIS«, antwortete der Japaner. »Zwölf Seitentanks, fünf Mitteltanks. Die grundlegenden Änderungen betreffen den Aufbautenbereich. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie die vierunddreißigköpfige Besatzung in Einzelkabinen mit eigenen Dusch- und WC-Räumen untergebracht wissen.«
»Ganz recht«, grinste Bradbury. »Die Zeiten der Sklaverei sind in diesem Lande nämlich vorbei.«
»Zu den veranschlagten zweiundfünfzig Tagen im Baudock kommen weitere zehn Tage für die Installation des Bremssystems hinzu, vorausgesetzt, dass Boeing pünktlich liefert. Weitere dreißig Tage wird die Arbeit am Ausrüstungskai in Anspruch nehmen. Sie können also davon ausgehen, dass wir Ihnen das Schiff in vier Monaten fertigstellen.«
Der Sicherheitsbeauftragte O’Connor hatte die Hand gerade so weit erhoben, dass man ihn zwar bemerkte, sich aber nicht unterbrochen fühlte. Er war wie sein Freund Robert M. Hodes Mitte vierzig und von schlanker, großer Gestalt. Wie dieser verstand auch er es, sich modisch zu kleiden.
»Warum richten wir nicht zwei zusätzliche Kabinen für Bordwachen ein, Sir?«, warf er ein.
»Oh nein, Don, nicht schon wieder!«, wehrte Bradbury ab.
O’Connor rief den Grundriss für das Mannschaftsdeck auf den Screen.
»Wenn ich Bob richtig verstanden habe«, sagte er unbeirrt, »dann will er das neue Bremssystem der Öffentlichkeit auch als freiwilligen Sicherheitsbeitrag von BARREL OIL verkaufen. Warum verkaufen wir nicht mehr als das? Die Angst vor Terroranschlägen und Piraten ist mindestens so ausgeprägt wie die Furcht vor Havarien.«
»Eine Lieblingsidee von ihm«, klärte Bradbury die Japaner auf. »Mister O’Connor wünscht sich nichts sehnlicher als einen Terroranschlag, um sagen zu können, er hätte es schon immer gewusst …«
»Neben Deutschland wird nun auch Frankreich das Thema Bordwachen auf der internationalen Seerechtskonferenz zur Sprache bringen«, entgegnete der Sicherheitsberater unbeirrt. »Wir sollten uns diesem Thema auf keinen Fall verschließen.«
Bradbury wedelte energisch mit dem erhobenen Zeigefinger. »Solange ich in dieser Firma das Sagen habe, wird es solche Wachen auf unseren Schiffen nicht geben, Don! Ausbildung und Unterhalt einer solchen Truppe sind immens teuer. Unsere Tankerflotte umfasst zurzeit hundertzweiundsechzig Schiffe. Ich werde mich nicht auf den vagen Verdacht hin, dass irgendein Verrückter sich an einem Supertanker vergreift, dem Vorwurf aussetzen, wir unterhielten auf unseren Schiffen eine militante Werkschutztruppe. Das schafft mehr Vorurteile, als es beseitigen kann.
Außerdem«, schnaubte er, »was können die Jungs schon ausrichten? Sieben Achtel der Pötte sind Ladefläche. In dieser hochexplosiven Zone kann nicht geschossen werden, jedenfalls nicht von unseren Leuten. Ein Terrorkommando könnte also unter den Augen der Bordwachen schalten und walten, wie es will.«
Er schüttelte sich wie ein nasser Seehund.
»Ich halte diesen Plan nicht für effektiv. Wenn man ihn der Öffentlichkeit als solchen verkaufen will, ist das nicht seriös.«
Hodes war während der Ausführungen des Vizepräsidenten in seinem Sessel zusammengesackt, ohne dass es jemanden aufgefallen wäre. Seine Zunge fühlte sich taub an, der Klang von Bradburys Worten strapazierte sein Trommelfell und er hatte das Gefühl, dass ihm sämtliche Energie aus den Poren wich, dass sein Körper nun nichts mehr darstellte, als eine vertrocknete Hülle, über der irgendwo seine Persönlichkeit schwebte, die aller Sinne beraubt worden war.
Er zwang sich aufzustehen und stolperte, eine Entschuldigung murmelnd, aus dem Zimmer. Im Waschraum hielt er die Unterarme unter fließendes Wasser, ohne dass er Zeit gefunden hätte, die Hemdsärmel hochzukrempeln. Er kannte diese Attacken, sie kamen in den letzten Monaten häufiger vor, aber erst jetzt, da er unverwandt auf sein Spiegelbild starrte, gab er sich das Versprechen, einen Arzt aufzusuchen.
Bei dem Gedanken wurde ihm wohler. Er ordnete sein verklebtes Haar und kehrte in den Konferenzraum zurück, wo die Versammlung gerade auf einen gelungenen Abschluss anstieß.
»Ende Juli holen wir uns den Dampfer!«, grölte Bradbury. »Nicht wahr, Bob?!«
Hodes lächelte gequält.
Robert M. Hodes reichte dem Mädchen seinen Trenchcoat und schlenderte in den Salon. Der Hausherr liebte es antik: Perserteppiche, Seidentapeten, eine spanische Ottomane aus dem siebzehnten Jahrhundert, ihr zur Seite zwei bauchige Vasen aus der Mingdynastie, aus denen sich weißer Blütenregen ergoss. Hodes fragte sich, wieso ihn Doktor Mason in seine Privatvilla und nicht in die Praxis gebeten hatte. Bevor er sich einen Reim darauf machen konnte, sprang die Tür auf und ein kleiner glatzköpfiger Mann wirbelte auf ihn zu.
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich Sie habe warten lassen, Bob.« Mason schüttelte seinem Patienten herzlich die Hand. »Einen Drink?«
»Danke, nein.«
»Aber natürlich trinken Sie einen mit!«, bestimmte Mason und schenkte zwei doppelstöckige Scotchs ein. »Wie fühlen Sie sich in letzter Zeit?«, fragte er und reichte Hodes das Glas.
»Warum haben Sie mich hergebeten, Doktor?«
»Die Ergebnisse Ihrer Blutuntersuchung sind da.«
Hodes setzte sich. Mason klimperte mit den Eiswürfeln, dann kippte er den Drink in einem Zug herunter.
»Und?«, fragte Hodes. »Was haben die Werte ergeben?«
»Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, Bob, wir haben die Analysen heute zu einer weiteren Prüfung ans Pasteurinstitut nach Paris geschickt …«
Hodes spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte; er begriff, dass sein Leben ab diesem Augenblick nicht mehr ihm gehörte, dass es eine Leihgabe war, die ihm nun entzogen werden sollte.
»Sagen Sie mir die Wahrheit, Doc«, hörte er sich mit erstaunlich fester Stimme sagen.
»Thalassämie, auch Cooley-Anämie genannt.«
Doktor Masons Unterlippe hing, kaum dass das Wort ausgesprochen war, merkwürdig schlaff herunter.
»Haben Sie europäische Vorfahren?«, fragte der Arzt. Als Hodes nicht antwortete, sagte er: »Sie leiden vermutlich an einer äußerst seltenen Genkrankheit, die sich hauptsächlich unter mediterranen Typen vererbt. Ihr Körper produziert kaum noch rote Blutkörperchen. Sie kommen in das Alter, wo nur noch massive Transfusionen Erleichterung bringen.«
Seine Augen streiften Hodes mit jener Mischung aus Milde und Mitleid, die man Todgeweihten angedeihen lässt. Seltsamerweise verspürte Hodes keine Angst. Er betrachtete die Möbel, das einfallende Licht, den kleinen Mann mit seinem leeren Whiskyglas, die dösende Katze auf der Couch – und war empört über die banalen Schleichwege, die der Tod in sein Leben nahm. Er massierte die Knöchel seiner linken Hand, die Berührung mit seinem Körper erschreckte ihn.
»Wie lange habe ich noch?«, fragte er.
»Ein Jahr, fünf, vielleicht sieben. Das lässt sich schwer vorhersagen.«
»Ist es schmerzhaft?«
»Nein. Das Charakteristische an dieser Krankheit ist, dass der Betroffene in der letzten Phase regelrecht aufblüht …«
Hodes stand auf.
»Ich möchte nicht, dass irgendjemand davon erfährt«, sagte er. »Es ist gut möglich, dass meine Frau sich bei Ihnen erkundigt, falls ich ein wenig sonderbar werden sollte.«
Mason hob beschwichtigend die Hände und brachte ihn zur Tür. Als Hodes gegangen war, schenkte sich der Arzt einen Whisky ein, der bis unter den Rand des Glases reichte.
Margie legte die Zeitschrift beiseite und überließ es dem Wind, darin zu blättern. Sie blickte von der Terrasse auf den Swimmingpool, in dem die pralle Mittagssonne zitterte.
Seit Robert sich kaum noch unten blicken ließ, fühlte sie sich tatsächlich so, wie es Freunde und Familienmitglieder vor ihrer Hochzeit geweissagt hatten: eingesperrt in einen goldenen Käfig, dazu verdammt, ihre schöne Jugendblüte dort zu verleben. Sie erhob sich. Im Haus begegnete sie dem Mädchen, das mit einem Tablett auf dem Weg nach oben war.
»Lassen Sie, Maria, ich bringe es ihm selbst …«
Seit drei Tagen verkroch sich Robert in seinem Zimmer. Er hatte sich Unterlagen aus der Firma kommen lassen und wollte nicht gestört werden. Als Margie die Tür öffnete, stand ihr Mann am Fenster und blickte wie abwesend in den Garten. Sie stellte das Tablett auf den Tisch und bemerkte erst jetzt, dass er sich Kaffee anstatt Tee hatte kommen lassen. Sie hatte ihn noch nie Kaffee trinken sehen …
Hodes fuhr herum.
»Ach, du bist es, Liebes … Ich hab dich nicht kommen hören.«
Margie legte ihm die Arme um den Hals, ihre weichen Lippen tanzten über sein Gesicht. Er spürte ihren sommerwarmen Körper, hielt ihn aber nicht fest. Sie blickte über seine Schulter auf das zerwühlte Bett, dessen Kissen seinen Abdruck bewahrten, als wollten sie ihn für die Ewigkeit konservieren. Im Aschenbecher krümmten sich einige Zigarettenkippen. Robert hatte seit zwei Jahren nicht mehr geraucht! Aus irgendeinem Grund schien er einem Bedürfnis nach Schwäche nachzugeben.
Margie löste die Umarmung und ging hinaus. Als sie wieder auf die Terrasse trat, hatte sie das Gefühl, als schnüre sich ihr das Herz zu.
Hodes rührte in seinem Kaffee. Seit Doktor Mason ihm die Wahrheit gesagt hatte, löste sich seine bisherige Realität wie unter einer ätzenden Säure auf. Seine Karriere, der ganze durchtriebene Wohlstand, die Freunde, ja selbst seine Ehe mit dieser bezaubernden jungen Frau kamen ihm aufgesetzt und künstlich vor. Sein Wille, diese alten Positionen zu behaupten, war erstaunlich schnell in die Brüche gegangen. Er lebte plötzlich ein anderes Tempo, ein Tempo, das er nicht selbst zu diktieren schien. Er hatte nicht die Geduld, in Frieden zu sterben, und schon gar nicht die Ausdauer, in Frieden zu leben. Er konnte Margie unmöglich einem solchen Leben aussetzen, schon jetzt war die gemeinsame Bettdecke schwer wie Blei.
Er war überrascht, wie belebend der ungeheuerliche Plan auf ihn wirkte, der seit einigen Tagen in ihm keimte. Es erschien ihm geradezu als Akt der Befreiung, seine verbleibende Lebenszeit darauf zu verwenden, sich in einer ganz anderen Rolle zu üben als bisher. Er würde sich zum Helden seines eigenen Märchens aufschwingen, er würde Pirat werden! Ein Pirat im Dienste der Schöpfung, die von den Menschen nur allzu gerne mit Füßen getreten wurde …
Vor ihm lagen die Gerichtsprotokolle aus dem Prozess gegen die Schiffsführung des Supertankers »Amoco Cadiz«, der vor der Bretagne auf Grund gelaufen war und dessen Öl die Küsten Frankreichs und Englands mehrere Jahre wie ein Todesschleier überzog. Sie hatten den Navigator für das Unglück verantwortlich gemacht, der Kapitän war freigesprochen worden. Er erinnerte sich gut an den Fall, in dem es wieder einmal die Kleinen und nicht die Verantwortlichen getroffen hatte.
Der Name des Navigators war Prooby, Richard Prooby. Hodes schrieb den Namen in sein Notizbuch. Nach einigem Zögern fügte er einen weiteren hinzu: Mike Henderson.
Am nächsten Morgen kam Hodes bereits um neun Uhr in die Firma, eine Stunde früher als gewöhnlich. Die beschlagene Tür glitt in ihre Halterung. Es war eine jener Türen, die man nicht zuknallen konnte, die immer weich schlossen. Er setzte sich und legte die Füße auf den Schreibtisch. Alles in diesem Raum war schwer und düster, die getäfelten Wände, die Sitzmöbel, der Teppich, sogar die Aschenbecher. Bürobarock für Männer mit Verantwortung. Mit solch staubfreien Insignien der Macht im Rücken war man quasi zur Skrupellosigkeit verpflichtet.
Hodes ließ den Chefingenieur Mike Henderson zu sich bitten und blätterte in den Morgenzeitungen. Sein Blick fiel auf eine kleine Meldung in »Newsweek«:
»Paris. Die geplante Entlassung von Corporal Roger Tofaute aus dem Zuchthaus von Marseille hat in Frankreich zu einem innenpolitischen Skandal geführt. Tofaute, vor zwei Jahren wegen Waffenschieberei zu vier Jahren Haft verurteilt, war Befehlshaber der berüchtigten Schutzgarde des rechtsextremen Politikers François Tournier. Die Garde soll mehrere politische Morde ausgeführt haben, unter anderem wird sie für den Mord an Felix D’Azua verantwortlich gemacht, dem Chefredakteur der linksgerichteten Wochenzeitschrift ›Nouvelle Observateur‹.«
Hodes schnitt die Meldung aus. Ihm war bewusst, dass sich soeben die größte Schwierigkeit von allein gelöst hatte. Ein euphorisches Gefühl bemächtigte sich seiner. Sein kühner Plan und der entschiedene Wille, ihn in die Tat umzusetzen, schienen in der Realität wie ein Netz zu wirken, in dem sich alles verfing, was er zur Durchsetzung brauchte. Er wollte ihn kennenlernen, diesen Tofaute, er hatte einen Job für ihn …
Henderson steckte seinen Kopf durch die Tür. Auf ein Zeichen von Hodes setzte er sich.
»Ich habe Ihre Abrechnungen gelesen, Mike«, begann Hodes und reichte dem Ingenieur sein silbernes Zigarettenetui. »Was haben Sie sich dabei gedacht?«, fragte er, als er Henderson Feuer gab.
Die Augen des Ingenieurs schimmerten feucht, ein Eindruck, den hellgraue Augen oft erweckten. Hodes stand auf und schloss die Tür. Als er an den Schreibtisch zurückkehrte, legte er seinem Besucher jovial die Hand auf die Schulter. Henderson knetete nervös seine Hände.
»Was ist mit den Abrechnungen?«, fragte er zögernd.
»Sie sind getürkt«, entgegnete Hodes und massierte seine Nasenwurzel. »Sie haben vier Millionen Dollar zur Erprobung des Bremssystems erhalten, richtig?«
Henderson nickte.
»Wenn Ihre Abrechnungen so stimmen, dann wären Sie in der langen Geschichte dieser Firma der Erste, der den Kostenvoranschlag auf den Cent genau eingehalten hat. Es gibt also zwei Möglichkeiten: Entweder sind Sie ein Finanzgenie oder ein Betrüger.«
Henderson legte die Zigarette auf den Rand des Aschenbechers, von dort kullerte sie über die Tischkante zu Boden. Er bückte sich, und als er mit hochrotem Kopf wieder auftauchte, zog Hodes zwei Finger über die Politur.
»Wissen Sie, was mich stutzig gemacht hat, Mike? Dass Sie zu keiner Zeit eine Aufstockung des Etats beantragt haben. Ich denke, dass bereits Ihr Kostenvoranschlag extrem überzogen war. Sie sind mit weniger ausgekommen und haben am Ende die volle Summe abgerechnet. Auf den Cent genau, das war Ihr Fehler.«
»Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da sagen!«, stotterte Henderson. »Das sind doch nur Verdächtigungen, Mister Hodes. Unverschämte Verdächtigungen …«
»Nicht doch, Mike. Ganz ruhig. Ich habe mich erkundigt. Die von Ihnen beauftragten Firmen sind heute, also zwei Jahre später, in der Lage, dieselben Arbeiten um etwa hundertzwanzigtausend Dollar billiger auszuführen.«
Henderson winkte müde ab. »Meine Erfindung ist gar nicht zu bezahlen«, murmelte er. »Von Ihnen nicht und von dieser verdammten Firma auch nicht.«
»Es besteht kein Grund, dafür zu bezahlen«, antwortete Hodes. »BARREL OIL ist im Besitz des Patents, wie Sie wissen. Sie haben als Angestellter lediglich Ihre gut bezahlte Arbeit gemacht.« Er schaltete den Computer aus. »Was mache ich jetzt mit Ihnen? Normalerweise müsste ich eine hausinterne Untersuchung einleiten.« Er holte zwei Gläser aus dem Schrank und schenkte Cognacs ein. »Weiß Ihre Frau eigentlich davon?«, fragte er.
Henderson kippte den Drink herunter. Es hatte keinen Sinn zu leugnen. Hodes schien ihm ja helfen zu wollen.
»Wir sind seit einiger Zeit geschieden«, sagte er kleinlaut, »die Kinder wurden ihr zugesprochen.«
»Das tut mir leid«, sagte Hodes und schenkte nach. »Ich bin nicht daran interessiert, Ihnen noch mehr Kummer zu bereiten. Bringen Sie das Geld bei, und die Sache ist in Ordnung.«
Henderson schluckte.
»Das kann ich nicht«, stammelte er. »Es ist alles für die Scheidung und den Unterhalt draufgegangen …«
»Zu dumm«, ließ sich Hodes vernehmen, »dann bleibt mir keine andere Wahl.«
»Bitte, Sir«, flehte der Ingenieur, »das können Sie mir nicht antun. Ich wäre erledigt, das wissen Sie …«
Hodes ging ans Fenster und blickte hinunter in die Commerce Street, die von hier oben nicht breiter war als ein Lineal. Er beobachtete eine junge Frau auf ihrem zehn Zentimeter langen Weg zum Hyatt Regency, unter dessen Baldachin sie verschwand.
»Okay«, sagte er plötzlich und drehte sich um, »keine Untersuchung. Aber ich muss Sie feuern, das verstehen Sie doch. Einen Vorwand finden wir schon. Machen Sie, dass Sie aus Amerika wegkommen. Irgendwann wird ein anderer Ihren Schwindel entdecken. Das hieße dann fünf Jahre, Mike. Mindestens.«
Henderson wirkte wie paralysiert.
»Wo werden Sie hingehen?«, fragte Hodes. »Zurück nach Holland?«
»Was?« Der Ingenieur nahm die Hände vom Gesicht.
»Ob Sie zurück nach Holland gehen.«
Henderson drückte sich schwerfällig aus dem Sessel und klopfte sich die Zigarettenasche von der Hose. Seine Augen suchten vergeblich nach einem Halt. Hodes begleitete ihn zur Tür.
Tiefe Wolkenbänke schoben sich über die Bucht von Tokio landeinwärts. Durch das aufgewühlte Wasser stampften die Barkassen mit der Arbeitern der Frühschicht zu den Anlegern der Mitsubishi-Werft. Die Luft vibrierte von den Schlägen, die gegen einen ausbesserungsbedürftigen Schiffskörper prasselten. Über speckig glänzende Werkshallen hinweg streckten Kräne ihre steifen Arme. In den Pfützen spiegelte sich der sprühende Goldregen einer Schweißnaht. Hinter den Helgen stand das Verwaltungsgebäude. Von dort kamen vier Männer in Regenmänteln und blauen Schutzhelmen die Kesselschmiede entlang. Sie bogen ab in die breite Straße mit dem gigantischen, fünfhundert Meter langen Baudock, dem ein ebenso langer Schuppen gegenüberlag. Seine sechs Tore standen weit offen. Vor ihnen, wie zum Fraß, eine Reihe stählerner Viadukte, Bruchstücke aus den Mitteltanks, Innereien eines Monstrums, das heute auf Kiel gelegt werden sollte.
Die Herren überquerten die vierspurige asphaltierte Fahrbahn und gingen zwischen den Gleisen der Werksbahn weiter. Sie liefen unter einem der drei Kräne hindurch, die ihre Beine über die gesamte Breite der Straße spreizten. Oben in den gläsernen Hochsitzen warteten die Kranführer auf Sprechfunkorder. Noch aber zerrten die Sattelschlepper zu ihren Füßen an den aufgebockten Segmenten.
Die Männer in den Mänteln steuerten auf eine Gruppe zu, die sich am Rande des Baudocks versammelt hatte. Unter ihnen, in dreißig Meter Tiefe, waren auf einer Fläche von der Größe vier hintereinanderliegender Fußballfelder mannshohe Holzböcke in elf Reihen angeordnet. Sie sahen aus wie sauber ausgerichtete Grabsteine auf einem Heldenfriedhof.
Die Herren aus der Geschäftsführung schüttelten die Hände der angetretenen Ingenieure und Vorarbeiter. Dann stellte man sich um jene Stahlplastik auf, die als Erste in die Grube fahren sollte. Zwölf Arbeiter erwarteten die armdicken Trossen, die sich pendelnd herabließen. Einige kräftige Schläge mit dem Hammer, zwei, drei geschickte Handgriffe, und der Kran war mit den Gelenken der ersten Sektion verbunden.
Direktor Koawa ließ sich das Megafon reichen.
»Liebe Mitarbeiter!«, rief er. »Eine Kiellegung bedeutet dem Schiffbauer mehr als die Taufe. Sie ist der erste Schritt aus der mathematischen Fantasie in die Wirklichkeit. In den nächsten Wochen und Monaten wird an dieser Stelle ein Supertanker wachsen, von dem wir uns alle wünschen, dass er ein guter Botschafter für die hohe Kunst japanischen Schiffbaus sein wird. Es soll ein glückhaftes Schiff werden! Wir alle können mit unserer Arbeit dazu beitragen. In diesem Sinne fordere ich den Vorarbeiter auf: Geben Sie das Signal zum Baubeginn!«
Der Vorarbeiter gab dem Kranführer über Sprechfunk den entsprechenden Befehl. Die Trossen spannten sich, Zentimeter für Zentimeter hob die erste Sektion vom Boden ab. Behutsam schwebte die Konstruktion über die Köpfe der Anwesenden hinweg und senkte sich auf den Boden des Baudocks. Noch wirkte sie da unten so verloren wie ein ausgegrabener Monolith in der Wüste. Aber bald würde aus diesem Knochen ein Gerippe werden und dann ein Rumpf, der die Gebäude und Anlagen der Werft überragte, wie ein gestrandeter Wal vor Liliput. Direktor Koawa warf einen letzten Blick auf die neue Baustelle. Eine Stunde später traf in Dallas bei BARREL OIL eine E-Mail ein. Mit dem Bau des Prototyps war termingerecht begonnen worden.
Die Maynard-Klinik in São Paulo war 1984 von einem amerikanischen Milliardär gleichen Namens gebaut worden. Wie eine Trutzburg gegen Krankheit und Elend erhob sich das weiße Gebäude im Süden der brasilianischen Millionenstadt über Slums und Stadtautobahnen. Die Klinik ruhte auf einem Berg, São Paulo lag ihr zu Füßen. Manch alter Indianer wünschte sich die Pest an den Hals, um hier behandelt werden zu können. Aber der Zugang zu den Tempeln der Zivilisation erforderte mehr als Demut: Geld, viel Geld.
Im Zimmer 12 blätterte Schwester Isabella bei heruntergelassenen Jalousien in einer Illustrierten. Gelegentlich warf sie einen Blick auf das Bett, in dem sich die Decke über der Brust des Patienten kaum merklich bewegte. Gegen zwei Uhr erwachte der Mann.
»Bleiben Sie ganz ruhig«, sagte sie, »der Doktor kommt gleich …«
Der Arzt nahm auf der Bettkante Platz und betrachtete das mit Mullbinden umwickelte Gesicht. Lediglich die Augen und der Mund lagen frei.
»Ich bin Doktor Bandeira. Ich habe Ihnen gestern das Gesicht operiert. Erinnern Sie sich?«
Der Patient nickte.
»Gut. Ich werde Ihnen jetzt einige Informationen geben, und Sie antworten bitte auf meine Fragen mit einem leichten Nicken oder Schütteln des Kopfes. Die Operation ist gut verlaufen. Mit etwas Glück können wir den Verband in vierzehn Tagen entfernen. Während dieser Zeit, die Ihnen sehr lange vorkommen wird, müssen Sie der Versuchung widerstehen, Ihre Gesichtsmuskeln zu testen. Jede kleinste Zuckung könnte unsere Bemühung zunichtemachen. Denken Sie einfach, Ihr Gesicht sei aus Beton. Trauen Sie sich das zu?«
Der Patient schloss zur Bestätigung kurz die Augenlider.
»Ich werde regelmäßig nach Ihnen sehen. Nahrung nehmen Sie vorerst in flüssiger Form zu sich. Ansonsten wird Ihnen Schwester Isabella jeden Wunsch von den Augen ablesen.«
Doktor Bandeira verschwand so schnell, wie er gekommen war. Der Mann in Mull atmete, so ruhig es eben ging.
Die Beisetzung Robert M. Hodes’ auf dem Restland Memorial Park Cemetery war, wie so vieles in Dallas, in erster Linie ein gesellschaftliches Ereignis. Die Umstände seines Todes galten als spektakulär genug, um die Reichen und Schönen der Ölmetropole wieder einmal zusammenzuführen. Der junge, aufstrebende Manager von BARREL OIL war mit seiner Privatmaschine über dem Meer vor Florida abgestürzt, seine Leiche jedoch nie gefunden worden. Dadurch bekam der Abschied von dem Verstorbenen eine gespenstische Note, die man in jenen Kreisen, wo normalerweise jeder Kitzel teuer erkauft wurde, durchaus zu schätzen wusste. Auf dem Parkplatz stand eine Armada blitzblanker Nobelkarossen in Reih und Glied, die sich später wieder in der Villengegend Highland Park verlieren würden.
Etwa fünfhundert Trauergäste lauschten den Worten des katholischen Priesters. Margie Hodes saß eingerahmt zwischen Vizepräsident Ray Bradbury und Don O’Connor in der ersten Reihe. Zart, schlank, fast unkörperlich, gehörte sie zu jenen Erscheinungen, die sich unter den Attacken des Schmerzes vor aller Augen aufzulösen schienen.
Wenn ihr Mann sie jetzt hätte sehen können, er hätte ihr zwei leuchtend rote Kirschen über die Ohren gehängt, damit sich das blutleere Gesicht nicht gänzlich im Äther verlor. Genauso aber war Margie zumute, sie wäre am liebsten auf der Stelle zerstoben – nicht nur, um Robert näher zu sein, sondern auch, um dieser absurden Veranstaltung zu entkommen, die trotz allem protzigen Getues keine rechte Trauer aufkommen ließ. Und während der Priester vom Himmelreich sprach, fragte sie sich, ob sie wohl genügend Stehvermögen aufbringen würde, um nach der Feier die Beileidsbekundungen entgegenzunehmen. Sie spürte die neugierigen Blicke der Anwesenden auf sich ruhen und krallte sich umso fester in Dons Arm.
Erst als Roberts Lieblingsstück »Les Noces« von Strawinsky in der Kapelle erklang, löste sich die Verkrampfung. Ihr verschleiertes Gesicht gab sich dem Tränenfluss wie einer göttlichen Erfrischung hin, und die Kraft, die sie nun durchflutete, war mächtiger, als das alberne Bemühen, die Konvention zu wahren …
Doktor Bandeira löste die Klebestreifen an den Mullbinden und schnitt den Verband behutsam durch. Mit einer Pinzette entfernte er die Stofffetzen von den verkrusteten Narben. Sorgfältig betrachtete er sein Werk. Ab und zu stieß er mit den Fingerspitzen in das Gesicht des Amerikaners, als korrigiere er den Sitz einer Maske.
»Nicht schlecht«, brummte er, »Sie haben erstaunlich gutes Heilfleisch.«
Er führte seinen Patienten an den Spiegel. Hodes starrte in Augen, die aus einer völlig veränderten Landschaft blickten. Die Wangen waren hohl, aus seinen Mundwinkeln war die natürliche Heiterkeit gewichen, die Nasenflügel blähten sich wie bei einem bockenden Rennpferd. Zwischen den gelifteten Brauen entdeckte er zwei senkrechte Falten als Ausrufungszeichen einer neuen Männlichkeit. Er betastete seine Stirn, sie fühlte sich leblos an. Das Kinn spannte, als wäre es aus brüchigem Gips. Sein Haar war feucht und klebrig. Er verzog die Lippen. Der Mund war in Ordnung, volles Gefühl.
»Es dauert, bis man sich daran gewöhnt hat«, sagte der Arzt. Er klang zufrieden.
»Gute Arbeit, Doktor«, antwortete Hodes und versuchte zu lächeln, aber das Lächeln geriet ihm zur furchterregenden Grimasse. Das neue Gesicht hatte seinen charmantesten Ausdruck nicht mehr parat. Die vertrauten Gesten hatten keinen Platz mehr in dieser künstlichen Fassade.
»Machen Sie in den nächsten Tagen regelmäßig Gesichtsgymnastik. Ziehen Sie Fratzen, bis es wehtut. Aber halten Sie die Haut trocken, das ist wichtig. Ich glaube, dass Sie uns schon sehr bald verlassen können.«
Eine Woche lang versuchte der amerikanische Patient, sich in seinem neuen Gesicht einzunisten. Die Häutung war perfekt. Er konnte sich kaum noch daran erinnern, wie er vorher ausgesehen hatte. Robert M. Hodes war endgültig gestorben. Nach einer Schonzeit von weiteren vierzehn Tagen verließ er als Robert Palmer die Klinik.
Er hatte in vielen Hotelbetten gelegen, die lärmenden Geräusche von Großstädten waren ihm geläufig. Aber Amsterdam hörte sich anders an. Selbst das Quietschen der Straßenbahn, die unter seinem Fenster eine enge Kurve zog, konnte das Vogelgezwitscher nicht übertönen, das aus den Bäumen des Leidseplan herüberdrang. Wenn hier ein Auto hupte, war dies kein autoritärer Befehl, sondern klang wie eine bescheidene Bitte an die vielen Radfahrer und Fußgänger.
Palmer baute die Schachfiguren auf und spielte eine Partie nach, die beim Duell zweier Giganten im Sommer 1984 neue Maßstäbe gesetzt hatte. Ihr Krieg endete nach dem vierundachtzigsten Zug remis. Es war die komplizierteste Vergeudung menschlicher Intelligenz seit Erfindung der Werbeagenturen.
Gegen Mittag schnappte er sich seinen Regenmantel, warf noch einen Blick auf das Betonwerk der Schachmeister, die ihre Figuren in eine unerschütterliche Position gebracht hatten, und verließ das Hotel. Er schlenderte unter den duftenden Linden an den Grachten entlang. Von einer Brücke blickte er auf das Glasdach eines Sightseeingdampfers, unter dem sich vierzig Köpfe in Richtung einer alten Häuserzeile drehten, die nur deshalb noch stand, weil die einzelnen Gebäude so ineinander verkeilt waren, dass sie sich gegenseitig Halt gaben.
Die Hausboote in der Prinsengracht waren durch einen kleinen Steg mit der Straße verbunden. Die meisten waren frisch lackiert, bis hinein ins ölige Brackwasser, das träge an die Planken klatschte. Ein Hund stand breitbeinig an einer Reling und kläffte Palmer wütend an, als dieser sich dem Boot Nummer 47 näherte.
Der Kahn hatte nichts gemein mit der adretten Campingkultur Amsterdamer Hausboote; er sah aus, als könnte er jederzeit in See stechen. An Bord lag Werkzeug herum. Statt eines ordentlichen Stegs führten zwei abgewetzte Planken an Deck.
Palmer klopfte an die Kabinentür. HENDERSON stand auf einem Stück Pappe, das sich unter einer Heftzwecke krümmte. Es dauerte eine Weile, bis sich die Tür einen Spalt weit öffnete.
»Was wollen Sie?«, fragte eine heisere Stimme.
»Mein Name ist Palmer. Ich hätte Sie gerne gesprochen.«
Zu seinen Füßen zerplatzten die ersten Regentropfen einer Gewitterwolke, die schon seit einer Stunde über der Stadt hing.
»Sind Sie von der Finanzbehörde?«
»Keine Angst. Ich bin weder Finanzbeamter noch Polizist.«
Der Mann öffnete und trat beiseite, sein Gesicht war unrasiert und aufgedunsen. Palmer setzte sich. Die Kombüse wirkte aufgeräumter, als es das Schiff von außen vermuten ließ. An den Wänden hingen Kupferstiche alter Segelschiffe. Der Hausherr schenkte zwei Genever ein. Ihre Blicke trafen sich über den erhobenen Gläsern.
»Also bitte …«, sagte der Mann, »was wollen Sie?«
»Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten, Mister Henderson.«
»Was denn?! Sie haben einen Job für mich?! Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass ich einen Job suche, Mister?«
Palmer ignorierte die Frage.
»Ich möchte, dass Sie für mich als Erster Ingenieur auf einem Supertanker fahren«, antwortete er ruhig.
Henderson ließ sich in den Sessel fallen.
»Soll das ein Witz sein, Mister …«
»Palmer.«
»Mister Palmer! Ich nehme an, dass Ihnen irgendjemand erzählt hat, dass ich der richtige Mann für Sie bin. Dem ist aber nicht so.«
Er kramte im Sekretär nach einem Stück Papier, das er seinem Besucher reichte.
»Hier sind meine Referenzen! Lesen Sie selbst …«
Palmer betrachtete das Schreiben, welches er vor zwei Monaten selbst aufgesetzt hatte:
»BARREL OIL bestätigt, dass Mister Mike Henderson in der Zeit von … bis … in der Firma beschäftigt war. Er hat die ihm übertragenen Aufgaben an Bord unserer Schiffe sowie in der Forschungsabteilung erfüllt. Mister Henderson verlässt unsere Firma im gegenseitigen Einvernehmen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Gezeichnet Robert M. Hodes.«
Das war vermutlich das schlechteste Zeugnis, das einem amerikanischen Angestellten je ausgestellt worden war. Palmer reichte es mit einem Lächeln zurück.
»Ich weiß von Ihrer Biografie«, sagte er. »Auf legale Weise werden Sie nie wieder Arbeit finden, das steht fest. Ich an Ihrer Stelle würde mir das Angebot gründlich überlegen …«
Henderson schenkte sich einen weiteren Genever ein.
»Sie erinnern mich an jemanden«, sagte er nachdenklich. »Und wissen Sie an wen? An den Dreckskerl, der mir dieses Zeugnis geschrieben hat. Er hatte den gleichen arroganten Ton in der Stimme wie Sie …«
»Es liegt an Ihnen, ob Sie sich eine Million Dollar verdienen wollen oder nicht«, entgegnete Palmer lächelnd. »Ich komme morgen wieder. Bis dahin müssen Sie sich entschieden haben.«
Er verzichtete darauf, die Wirkung seiner Worte zu beobachten. Die Möglichkeit, mit einem Schlag viel Geld zu verdienen, hinterließ in den Gesichtern der Menschen für gewöhnlich jenen dummen Ausdruck von Ungläubigkeit und Gier, den er noch nie hatte leiden können.
Palmer schlief schlecht in der folgenden Nacht. Zwar war der Beweis erbracht, dass er nach seiner Gesichtsoperation selbst alten Bekannten gegenüber wie unter einer Tarnkappe agieren konnte, aber die neue Rolle passte noch nicht so recht zu ihm, sie musste erst einstudiert werden.
Wenn er sein Ziel erreichen wollte, durfte er sich keine Skrupel leisten. Keine Zögerlichkeit, keine Gefühlsduselei. Er hatte sich selbst verdammt. Von nun an war die Einsamkeit sein natürliches Klima. Darauf war er nicht wirklich vorbereitet.
Als er gegen Morgen wie verabredet auf dem Hausboot erschien, fand er den Ingenieur erstaunlich aufgeräumt vor. Er zeigte ihm einen Scheck auf den Namen Henderson.
»Sie verfügen zurzeit über ein Guthaben von hunderttausend Dollar, Mister Henderson. An das Geld kommen Sie allerdings erst heran, wenn ich das Okay gebe.«
Henderson griff nach dem Papier. Palmer blickte auf die Gracht. Der Moment, in dem ein Mensch sich kaufen lässt, ist beschämend und unerträglich lang.
»Was haben Sie vor?«, fragte Henderson zögernd.
»Ich plane ein Verbrechen«, entgegnete Palmer. »Der Begriff Verbrechen ist relativ, wie Sie ja aus eigener Erfahrung wissen. Zerbrechen Sie sich also nicht den Kopf darüber. Ich verlange von Ihnen nichts anderes, als dass Sie ein bestimmtes, Ihnen sehr vertrautes Schiff in verantwortlicher Position von A nach B begleiten.«
Henderson rückte den Genever heraus.
»Wie kommen Sie ausgerechnet auf mich?«
Es klang bereits wie ein Einverständnis. Palmer antwortete nicht, er war dem Mann keine Erklärung schuldig.
»Wann brauchen Sie mich denn?«, hakte Henderson nach.
»Ab sofort. Sie müssen ab jetzt jederzeit verfügbar sein. Also: keine Nebenjobs, keine Reisen. Wollen Sie das so einrichten?«
Henderson ließ sich in den abgewetzten Ledersessel fallen.
»In Ordnung«, sagte er schließlich wie in Trance, »Sie können mit mir rechnen.«
Palmer deutete auf die Geneverflasche.
»Krieg ich auch einen?«
Die beiden Männer stießen miteinander an.
»Ich hoffe, dass Sie unser kleines Geheimnis für sich behalten«, sagte Palmer. »Falls nicht, lasse ich Sie töten.«
Der Ingenieur zuckte zusammen, als hätte er jeden Moment den Gnadenschuss zu erwarten.
»Nein, nein«, stammelte er, »die Sache bleibt unter uns, verlassen Sie sich darauf …«
»Das ist gut.« Palmer lächelte. »Dann wird es bei dem Unternehmen ja keine Toten geben.«
Richard Prooby fühlte eine gottverdammte Wut gegen die geschäftigen Menschen aufsteigen, die ihn in der Aldersgate umspülten. Er hätte gegen ihre geballte Selbstzufriedenheit gerne einige Schüsse aus der Hüfte abgefeuert, stattdessen beruhigte er sich mit einem Magenbitter aus dem Tabakladen. Nach dem dritten Fläschchen fiel ihm ein Satz ein, den er einmal gelesen hatte: Ein Verrückter ist kein Mensch, der den Verstand verloren hat; ein Verrückter ist jemand, der alles verloren hat, außer seinem Verstand.
Prooby kaufte einen weiteren Flachmann und schlingerte auf den schmierigen Bohlen des Alkohols Richtung Heimat.
Als er sechs Stunden später erwachte, lag er auf der Couch vor dem Ofen, seine Freundin Meredith schaute wie immer in die Glotze.
»Was war los mit mir?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Du warst mal wieder besoffen, das war los!«
»Wie bin ich nach Hause gekommen?«
»Wie immer, Darling. Aufrecht wie ein Mann. Gekotzt hast du erst, als du in der Wohnung warst.«
Prooby zog sich das Kissen übers Gesicht.
»Was ist mit dem Job?«, fragte das Mädchen scharf. »Hast du ihn bekommen? – Natürlich nicht …«
Sie stand auf und zog den Mantel an. Beim Hinausgehen warf sie ihm ein Couvert auf den Bauch.
»Für dich. Heute abgegeben!«
Prooby hörte sie die Treppen hinuntersteigen. Er öffnete den Umschlag und zog einen Bankscheck heraus, ausgestellt auf seinen Namen und ausgestattet mit hunderttausend Dollar.
»Steh auf, Richard!« Meredith rüttelte an seiner Schulter. »Nun mach schon, es hat sich ausgepennt!« Sie klopfte mit der flachen Hand auf die Zeitung: »Harrods sucht Fahrer. Ich hab schon mit Mister Miller vom Personalbüro telefoniert. Er sagt, du sollst dich um zehn bei ihm vorstellen. Also steh endlich auf!«
Prooby drehte sich unwirsch auf die Seite.
»Hör zu, Rich! Wenn du nicht hingehst, kannst du sehen, wo du bleibst, ich hab’ die Schnauze voll!«
Er setzte sich auf die Bettkante und suchte nach seinen Socken.
»Was hat der Kerl gesagt, Meredith? Ich meine, als er den Brief abgegeben hat.«
»Nichts hat er gesagt.«
Sie schmiss ihm Hemd und Hose ins Gesicht.
»Ich meine, ruft er noch mal an oder hat er vielleicht eine Adresse hinterlassen oder so was Ähnliches?«
»Ist denn das jetzt so wichtig, mein Gott! Zieh dich an, in einer halben Stunde musst du dich vorstellen!«
Prooby gab ihr einen Kuss und verschwand in den Tiefen des giftgrün gestrichenen Mietshauses. Im Bus stieg er nach oben und setzte sich in die äußerste hintere Ecke. Dort betrachtete er noch einmal den Scheck, versuchte, ihn zu entschlüsseln, wie eine geheime Botschaft. Er fand zwar keine Erklärung für den plötzlichen Geldsegen, war aber bereits derart ins Träumen geraten, dass er bei Harrods auf dem Absatz kehrtmachte, als er die fünfzehn Mitbewerber sah. Er ging zu Fuß nach Hause, um bei Meredith keinen Verdacht zu erregen.
»Hast du die Stellung?«, fragte sie, kaum dass er durch die Tür war.
»Was erzählst du immer?«, nuschelte er. »Als ich hinkam, war der Job längst vergeben!«
Meredith begann zu weinen. Prooby nahm sie in den Arm und streichelte ihren Kopf.
»Dein Amerikaner hat angerufen«, sagte sie schluchzend.
»Welcher Amerikaner?«
»Na, der mit dem Brief …«
»Und? Was hat er gesagt?«
»Was hat er gesagt? Was hat er gesagt?«, äffte sie ihn nach. »Sprechen wollte er dich, ist doch klar, wenn er anruft. Ich hab ihm gesagt, er soll es in zwei Stunden noch einmal versuchen. Warum bist du denn so nervös?!«
Prooby packte seine Freundin bei den Schultern. »Meine Pechsträhne wird bald ein Ende haben«, sagte er, »glaub mir, das hab ich im Urin …«
»Na, Gott sei Dank«, entgegnete sie sarkastisch, »ich geh solange weiter malochen.«
Das Telefon klingelte. Prooby nahm ab.
»Haben Sie meinen Brief bekommen?«, meldete sich eine nicht unsympathische Stimme mit amerikanischem Akzent.
»Hab ich, Mister. Soll das ein Witz sein?«
»Nein.«
»Sie meinen, ich könnte jetzt zur Bank gehen und hunderttausend Dollar abheben …«
»Sie müssen sich das Geld natürlich erst verdienen. Ich schlage vor, Sie steigen in ein Taxi und kommen in die Sloane Street, Ecke Kings Road. Ich erwarte Sie dort im Café.«
Palmer hatte sich den Navigator anders vorgestellt, stämmiger, wie einen walisischen Coalminer um die fünfzig. Der Kerl, der nervös am Tresen saß, war feinnerviger und nicht älter als vierzig.
»Spielen wir eine Partie Billard zusammen, Mister Prooby?«
Der Angesprochene rutschte vom Barhocker.
»Sie sind der Mann, der angerufen hat, richtig?«
»Richtig.«
Palmer kreidete seinen Queue und ordnete die Kugeln im hölzernen Dreieck. Den ersten Stoß überließ er Prooby. Der räumte schneller ab, als vermutet. Sein Mitspieler hatte die Fähigkeit, im Wirrwarr der Positionen die effektivste mathematische Lösung zu wählen, sodass jeder seiner Stöße mehrere Kugeln gleichzeitig in strategisch günstige Stellungen brachte. Palmer hingegen landete nur Zufallstreffer. Als er im vierten Spiel wie von Geisterhand plötzlich doch noch eine Kugel nach der anderen versenkte, erinnerte er sich an die Kunst des Bogenschießens und daran, dass die Zenmeister auf immer gleicher Bahn einen Pfeil nach dem anderen spalten konnten. Kaum war ihm der Gedanke gekommen, als auch schon Schluss war mit seiner Treffsicherheit.
»Schade«, sagte Prooby grinsend, »Sie haben sich durch irgendetwas irritieren lassen.«
Sie setzten sich. Prooby zückte den Scheck und wedelte fragend damit herum.
»Betrachten Sie das Geld als Anzahlung«, sagte Palmer. »Ich zahle Ihnen eine Million Dollar, wenn Sie für mich arbeiten.«
»Was muss ich tun?«
»Nichts Besonderes. Sie sollen einen Tanker übernehmen. Nur für eine Fahrt. Dass Sie ein hervorragender Navigator sind, weiß ich.«
»Was steckt dahinter?«, fragte Prooby skeptisch. »Ich kann es mir nicht erlauben, in ein krummes Ding hineingezogen zu werden.«
»Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie sich die Million auf legale Art und Weise verdienen können, Mister Prooby. Im Übrigen sind die Dinge immer so krumm, wie man sie sieht. Sie werden an einem Verbrechen teilnehmen, das war Ihnen doch hoffentlich klar, als Sie herkamen?«
Es bereitete Palmer Vergnügen, den suspendierten Seemann in teuflische Versuchung zu führen.
»Ich gebe Ihnen einen guten Rat«, fuhr er fort, als er sich seines Sieges sicher war. »Verlassen Sie Ihre Freundin und mieten Sie sich in einem Stadtteil ein, wo Sie niemand kennt. Ich schreibe Ihnen eine Ermächtigung über monatlich zweitausend Dollar aus, die Sie ab sofort von ihrem Konto abheben können. Dafür halten Sie sich bitte zur Verfügung. Sehen Sie dienstags und donnerstags im Hauptpostamt nach, ob eine Nachricht für Sie bereitliegt. Sollten Sie unsere Abmachung nicht für sich behalten können, zahlen Sie mit Ihrem Leben …«
Die letzten Worte des Amerikaners klangen so ruhig und kamen so unvermittelt daher, dass sich Prooby erst nach dem Abgang des seltsamen Amerikaners bewusst wurde, auf was für ein gottverfluchtes Abenteuer er sich da eingelassen hatte. Aber er hatte auch eine gottverdammte Lust dazu …