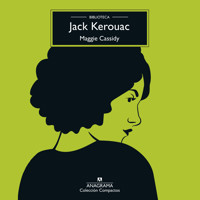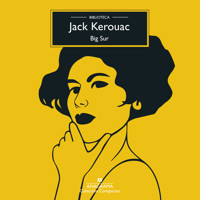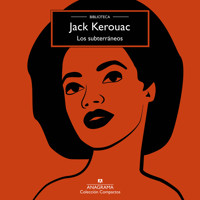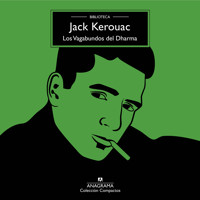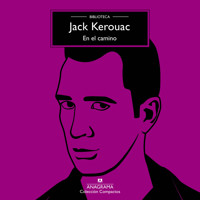9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kleinstadtidylle und Großstadtwahnsinn: In seinem Erstlingsroman beschreibt Kerouac in Erinnerung an seine eigene Kindheit und Jugend das Leben einer Großfamilie, die zunächst in einer intakten Gemeinschaft auf dem Land, später in bedrückender Enge in New York lebt. Der durch eine unsoziale Umgebung bedingte Zerfall der Familie ist sein eigenes Schicksal. Genauso wie Peter Martin am Ende dieses Buches stand auch er als junger Mann mit erhobenem Daumen an der Straße, um auf seinen Trips quer durch die USA nach Maßstäben für das eigene Leben zu suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 911
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jack Kerouac
The Town and the City
Roman
Über dieses Buch
Kleinstadtidylle und Großstadtwahnsinn: In seinem Erstlingsroman beschreibt Kerouac in Erinnerung an seine eigene Kindheit und Jugend das Leben einer Großfamilie, die zunächst in einer intakten Gemeinschaft auf dem Land, später in bedrückender Enge in New York lebt. Der durch eine unsoziale Umgebung bedingte Zerfall der Familie ist sein eigenes Schicksal. Genauso wie Peter Martin am Ende dieses Buches stand auch er als junger Mann mit erhobenem Daumen an der Straße, um auf seinen Trips quer durch die USA nach Maßstäben für das eigene Leben zu suchen.
«Kerouac brachte frischen Wind in die Welt der Literatur. Er war eine Urgewalt, eine Tragödie, ein Triumph – und ein andauernder Einfluss, bis heute.» (Norman Mailer)
Vita
Jack Kerouac, am 12. März 1922 in Lowell/Massachusetts geboren, diente während des Zweiten Weltkriegs in der Handelsmarine, trampte später jahrelang als Gelegenheitsarbeiter kreuz und quer durch die USA und Mexiko und wurde neben William S. Burroughs und Allen Ginsberg der führende Autor der Beat Generation. Mit «On the Road» schrieb er eines der berühmtesten Bücher des 20. Jahrhunderts. Er starb am 21. Oktober 1969 in St. Petersburg/Florida.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1950 unter dem Titel «The Town and the City» im Verlag Harcourt, Brace and Company, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2022
Copyright © 1984 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
«The Town and the City» Copyright © 1950 by Estate of Jack Kerouac
Copyright renewed © 1978 by Stella Kerouac
Redaktion Dietlind Kaiser
Covergestaltung Anzinger & Rasp, München
Coverabbildung selimaksan/iStock
ISBN 978-3-644-00399-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für R. G. – Freund und Lektor
Erster Teil
1
Die kleine Stadt heißt Galloway. Der Merrimac River, breit und ruhig, fließt von den Hügeln New Hampshires zu ihr herunter, macht sich nach dem Wasserfall schäumend über die Felsen her, schäumt weiter über uraltes Gestein bis zu der Stelle, wo der Fluß plötzlich in einem weiten friedlichen See zu einem großen Bogen ansetzt und dann um die Flanke der Stadt herum weiterfließt, durch Städte wie Lawrence und Haverhill, durch ein bewaldetes Tal und weiter zum Meer bei Plum Island, wo der Fluß sich in unendliche Gewässer ergießt und verschwindet. Irgendwo im Norden von Galloway, in einem fernen Quellgebiet nahe der kanadischen Grenze, wird der Fluß immerfort aus endlosen Brunnen und unergründlichen Quellen bis zum Überschäumen gespeist.
Die kleinen Kinder von Galloway sitzen an den Ufern des Merrimac und denken über diese Tatsachen und Geheimnisse nach. In der wilden widerhallenden nebligen Märznacht kniet der kleine Mickey Martin an seinem Schlafzimmerfenster und horcht auf das Rauschen des Flusses, das ferne Bellen von Hunden, das monotone Donnern des Wasserfalls, und er sinnt über die Quellen und Ursprünge seines eigenen geheimnisvollen Lebens nach.
Die Erwachsenen von Galloway sind weniger mit Grübeleien am Flußufer beschäftigt. Sie arbeiten – in Fabriken, in Betrieben und Läden und Büros und auf all den Farmen in der Gegend. Die Textilfabriken, massive Backsteinbauten mit zierlichen Türmchen, drängen sich am Fluß und an den Kanälen, und die ganze Nacht herrscht in ihnen ein reges Leben. Das ist Galloway, Fabrikstadt inmitten von Feldern und Wäldern.
Wer bei Nacht in den Wald geht, der Galloway umgibt, und sich auf eine Anhöhe stellt, der sieht das alles in einem weiten Panorama vor sich: den Fluß, der im Bogen gemächlich dahinfließt, die Spinnereien mit den langen Reihen hell erleuchteter Fenster, die Fabrikschornsteine, die höher aufragen als die Kirchtürme. Aber er weiß, das ist nicht das wahre Galloway. Irgend etwas in der unsichtbaren brütenden Landschaft rings um die Stadt, irgend etwas in den hellen Sternen dicht über der Anhöhe, wo der alte Friedhof schläft, irgend etwas in den sanft rauschenden Blättern über den Feldern und Steinwällen erzählt ihm eine andere Geschichte.
Er sieht sich die Namen in dem alten Friedhof an: «Williams … Thompson … LaPlanche … Smith … McCarthy … Tsotakos.» Er ahnt das langsame tiefe Pulsieren des Lebensstromes. Ein Hund bellt auf einer Farm, keine zwei Kilometer entfernt, der Wind flüstert über den alten Steinen und in den Bäumen. Hier berichten die Inschriften von langem, langsamem Leben und lange erinnertem Tod. John L. McCarthy, in Erinnerung als ein Mann mit weißen Haaren, der in der Abenddämmerung meditierend die Straße hinunterging; der alte Tsokatos, der lebte und arbeitete und starb, dessen Söhne immer noch das Land bebauen, nicht weit vom Friedhof; Robert Thompson – beug dich hinunter und lies die Zahlen: «Geboren 1901, gestorben 1905» –, das Kind, das vor drei Jahrzehnten im Fluß ertrank; Harry W. Williams, der Sohn des Ladenbesitzers, der im Großen Krieg 1918 fiel, dessen alte Liebste, heute die Mutter von acht Kindern, immer noch von seinem längst verschwundenen Gesicht verfolgt wird; Tony LaPlanche, der neben der alten Mauer vermodert. Es gibt alte Leute, die noch leben und sich noch erinnern, die einem so viel über Galloways Tote erzählen könnten.
Wenn dich die Lebenden interessieren, dann geh den Abhang hinunter auf die ruhigen Straßen und Häuser der Vororte Galloways zu – du wirst das ewig gleichbleibende Rauschen des Flusses hören –, geh weiter unter den dichtbelaubten Bäumen, den Straßenlaternen, vorbei an den grasgrünen Vorgärten und dunklen Veranden, den Zäunen aus Holz. Irgendwo am Ende der Straße wird es heller, und du kommst zu Kreuzungen, die zu den drei Brücken Galloways führen und damit ins eigentliche Herz der Stadt und in den Schatten der Fabrikmauern. So kommst du dann in die Mitte der Stadt, zum Square, wo um die Mittagszeit jeder jeden kennt. Blick jetzt um dich, und du siehst die geschäftige Stadt verlassen in der gespenstischen Mitternachtsstunde: den Kramladen, die drei Kaufhäuser, die Lebensmittelgeschäfte und Eisstände und Drugstores, die Kneipen, die Kinos, die Stadthalle, den Tanzschuppen, die Billardlokale, das Gebäude der Handelskammer, das Rathaus und die Stadtbücherei.
Warte erst mal, bis der Morgen kommt und die Immobilienbüros zum Leben erwachen und die Rechtsanwälte die Jalousien hochlassen und das Sonnenlicht die staubigen Büros überflutet. Sieh diese Männer an Fenstern stehen, auf denen ihre Namen in Goldbuchstaben prangen; sieh nur, wie sie ihren Mitbürgern zunicken, die unten auf der Straße vorbeigehen. Warte erst mal, bis die Busse ankommen, voll besetzt mit Arbeitern, die nun hustend und finster dreinblickend der Cafeteria zustreben, um rasch noch eine Tasse Kaffee zu trinken. Der Verkehrspolizist stellt sich mitten auf den Square und nickt einem Autofahrer zu, der ihn gutgelaunt anhupt; ein allseits bekannter Politiker überquert die Straße, das Sonnenlicht auf den weißen Haaren; der Kolumnist von der Lokalzeitung kommt verschlafen in den Zigarrenladen und begrüßt den Verkäufer. Hier sind ein paar Farmer, die mit ihren kleinen Lastwagen gekommen sind, um sich mit Vorräten und Lebensmitteln einzudecken und ihre Geschäfte abzuwickeln. Um zehn kommen die Scharen der Frauen, mit Einkaufstaschen und mit ihren Kindern im Schlepptau. Die Kneipen machen auf, Männer kippen ein Morgenbier, der Barkeeper wischt die Theke ab, es riecht nach sauberer Seife, Bier, altem Holz und Zigarrenrauch. Am Bahnhof schnaubt der Schnellzug, der nach Boston runterfährt, und er bläst seine Dampfwolken um die alten braunen Türmchen des Bahnhofsgebäudes, die Bahnschranken senken sich majestätisch, während die Glocke bimmelt und lärmt, Leute spurten zum Zug nach Boston. Es ist Morgen geworden, und Galloway erwacht zum Leben.
Draußen auf der kleinen Anhöhe beim Friedhof schickt die rosige Sonne ihre Strahlen durch das Laub der Ulmen, eine frische Brise weht durch das weiche Gras, die Steine leuchten im Morgenlicht, es riecht nach Lehmboden und Gras – und es ist eine Freude zu wissen: Leben ist Leben und Tod ist Tod.
Das sind die Dinge, die Galloways Fabriken und Geschäfte dicht umgeben; sie machen aus Galloway einen Ort, der im uralten Puls des Lebens und der Arbeit und des Todes in der Erde wurzelt, und sie machen aus seinen Bewohnern Bürger einer Kleinstadt und nicht Großstadtmenschen.
Brich am sonnigen Nachmittag in der Stadtmitte auf, am Daley Square, und geh die River Street rauf, wo der ganze Verkehr zusammenläuft, vorbei an der Bank, an der Galloway High School und dem Gebäude des YMCA, und geh immer weiter, bis die ersten Wohnhäuser auftauchen. Hast du die Innenstadt hinter dir und blickst zurück, sind die großen Fabrikmauern links und rechts davon kaum noch zu sehen. Den Fluß entlang führt eine ruhige Straße mit ein paar stillen Bestattungsinstituten, einem Waisenhaus, herrschaftlich wirkenden Backsteinhäusern und den Brücken, die den Fluß überspringen und hinüber in die Vororte führen, wo die meisten Bewohner Galloways zu Hause sind. Geh über die Brücke, die sich genau beim Wasserfall über den Merrimac schwingt und als White Bridge bekannt ist, und bleib einen Augenblick stehen, um in die Runde zu blicken. Stadtwärts siehst du noch eine Brücke, die ausgedehnte schimmernde Wasserfläche, wo der Fluß einen Bogen beschreibt, und dahinter in weiter Ferne einen dicht bewohnten Landstrich. Wende deinen Blick ab von der Stadt, über den schäumenden Wasserfall hinweg, und du siehst dunstige Weiten, die nach New Hampshire hineinreichen, viel grünes friedliches Land und stille Gewässer. Da ist die Eisenbahnlinie, die dem Flußlauf folgt, ein paar Wassertanks und Nebengleise, doch sonst ist überall Wald. Das andere Ufer des Flusses präsentiert eine Landstraße mit vereinzelten Wirtshäusern und Verkaufsständen, und ein Blick zurück zeigt stromabwärts die Vororte, ein dichtes Gewirr von Hausdächern und Bäumen. Geh über die Brücke auf diese Vororte zu, und wende dich dann stromaufwärts, vorbei an den Wohngebieten, die Landstraße entlang, und du stößt auf ein schmales schwarzes Teersträßchen, das landeinwärts führt.
Es ist die alte Galloway Road. Genau dort wo sie ansteigt und gleich wieder hinabführt, hinein in Tannenwälder und Ackerland, liegt eine Zusammenballung von Häusern, friedfertig voneinander abgesetzt – eine Villa aus efeuumrankten Mauern, das Haus eines Richters; ein getünchtes altes Haus mit runden Holzsäulen auf der Veranda – das ist eine Meierei, auf der Weide im Hintergrund sind Kühe; und ein weiträumiges viktorianisches Haus in schäbigem Grau, ringsum von einer hohen Baumhecke eingeschlossen, gewaltige und dichtbelaubte Bäume, die die Vorderseite des Hauses fast ganz verdecken, eine Hängematte auf der alten Veranda und hinter dem Haus ein ungepflegter Hof mit einer Garage und einem Schuppen und einer alten Holzschaukel.
In diesem Haus wohnt die Familie Martin.
Von der höchsten Ulme vor dem Haus – das können die ungestümen unter den Kindern der Martins bezeugen – reicht der Blick an einem guten Tag über all die Äcker und dichten Tannenwälder hinweg bis nach New Hampshire, und an außergewöhnlich klaren Tagen sind im fernen Dunst sogar die Andeutungen der White Mountains zu sehen, hundert Kilometer weiter im Norden.
Dieses Haus hatte es George Martin besonders angetan, als er 1915 erwog, es zu mieten. Er lebte damals als junger Versicherungsvertreter mit seiner Frau und einer Tochter in einer Wohnung in der Stadt.
«Bei Gott, das ist es», hatte er zu seiner Frau Marguerite gesagt. «Genau das hat mir der Doktor verschrieben!»
Und alsbald machte er sich in dem großen weiträumigen Haus daran, in den nächsten zwanzig Jahren – in Zusammenarbeit mit Mrs. Martin – acht weitere Kinder zu zeugen; drei Töchter und sechs Söhne waren es schließlich.
George Martin hatte eine Druckerei aufgemacht und war in der Stadt zu einem sehr erfolgreichen Mann geworden, anfangs als Akzidenzdrucker und später als Drucker und Verleger kleiner politischer Zeitungen, die hauptsächlich in Drehsesseln im Rathaus und in den Zigarrenläden gelesen wurden. Er war ein düster dreinschauender, oft gedankenverlorener, sehr männlich wirkender Mann, jovial, sehr freigebig mit seinem Mitgefühl, ein Mann, der plötzlich in dröhnendes, rauhes Gelächter ausbrechen oder ebensogut sentimental werden und feuchte Augen bekommen konnte. Er runzelte in einer Art grimmiger Konzentration die Stirn über den schweren schwarzen Augenbrauen; seine blauen Augen bildeten eine waagrechte Linie, und wenn ihn jemand ansprach, war es seine Gewohnheit, mit einem verdutzten Ausdruck der Verwunderung aufzublicken.
Als junger Mann war er aus Lacoshua, einem Landstädtchen in den Bergen New Hampshires, heruntergekommen, um nach der Arbeit in den Sägewerken nun sein Glück in der Stadt zu versuchen.
Im Lauf der Jahre gab seine Familie dem alten grauen Haus und seiner Umgebung einen eigenen Charakter; überall spiegelte sich ihre unbeschwerte Einfachheit, Unbekümmertheit und Fröhlichkeit. Es war ein Haus, das von allerlei Geräuschen und Gesprächen erfüllt war, von Musik und Hammerschlägen und lauten Rufen auf der Treppe. Am Abend, wenn die Familie ihren zahllosen Beschäftigungen nachging, waren fast alle Fenster erleuchtet. In der Garage standen ein neuer und ein alter Wagen, in dem alten Schuppen häufte sich all der Krimskrams, den nur eine amerikanische Familie mit vielen Jungen über die Jahre ansammeln kann, und geradezu bewundernswert waren das Durcheinander und die Vielfalt all der Gegenstände im Speicher.
Wenn die ganze Familie zur Ruhe gekommen war und schlief, wenn nachts ein paar Schritte vom Haus weg die Straßenlaterne leuchtete und die grotesken Schatten der Bäume auf das Haus warf, wenn der Fluß irgendwo im Dunkeln seufzte, wenn in der Ferne stromaufwärts die nach Montreal fahrenden Züge tuteten, wenn der Wind im weichen Laub der Bäume flüsterte und irgend etwas gegen den alten Schuppen klopfte und klapperte – dann konnte man auf der alten Galloway Road stehen und auf dieses Haus blicken und ahnen, daß es nichts Unheimlicheres gibt als ein Haus bei Nacht, wenn die Familie schläft, etwas seltsam Tragisches, etwas Schönes für alle Zeit.
2
Jedes Mitglied der in diesem Haus wohnenden Familie ist in seine eigene Vision vom Leben verstrickt und grübelt mit der Klugheit, die ihm die eigene Seele gibt, über alles nach. Mit dem Familienstempel, der irgendwie ihrem Leben aufgedrückt ist, kommen sie alle umhegt und zornig als Martins in die Welt, lauter energische, tatkräftige, ernste und nachdenkliche Leute, plötzlich voller Angst und Schwermut, plötzlich laut hinauslachend und fröhlich, naiv und listig, gedankenvoll oft und ebensooft maßlos erregt – alles starke und in der Familie verwurzelte und pfiffige Leute.
Sieh sie dir nacheinander an, die Kleinen, wie sie Eindrücke von der sie umgebenden Welt in sich aufnehmen, als erwarteten sie, ewig zu leben, bis hin zu den älteren Familienmitgliedern, die überall und jeden Tag die Bestätigung finden, daß das Leben genauso verläuft, wie sie es sich schon immer vorgestellt haben. Sieh dir alle an, wie sie ihre Tage verleben, die derb-überschwenglichen Tage, die Tage des Feierns und die Tage tiefer Betrübtheit.
Vater Martin ist ein Mann mit hundert intensiven Beschäftigungen: er leitet seine Druckerei, hält eine Linotype und eine Presse in Gang und führt die Bücher. Gleichzeitig verfolgt er die Pferderennen und wettet bei einem Buchmacher in einer kleinen Gasse in der Innenstadt, der Rooney Street. Um die Mittagszeit ist er in einer kleinen Bar, gleich beim Daley Square, und unterhält sich lärmend mit Versicherungsvertretern, Zeitungsleuten, Reisenden und Zigarrenladenbesitzern. Auf dem Nachhauseweg geht er vor dem Abendessen noch im chinesischen Restaurant vorbei, um seinen alten Freund Wong Lee zu besuchen. Nach dem Abendessen hört er seine Lieblingsprogramme, wozu er sich auf sein Zimmer zurückzieht und das Radio voll aufdreht. Nach Einbruch der Dunkelheit fährt er hinüber zu dem Kegel- und Billardzentrum, für das er die Aufsicht übernommen hat, um zusätzlich ein bißchen Geld zu verdienen. Dort sitzt er in dem kleinen Büro und unterhält sich mit alten Freunden, während die Billardkugeln klicken und die Kegelbahnen dröhnen und donnern, und die Luft ist erfüllt vom Rauch und vom Stimmengewirr. Um Mitternacht findet er sich in einer hochkarätigen Poker- oder Binokelrunde, die bis in die tiefe Nacht hinein spielt. Er kommt erschöpft nach Hause, aber am Morgen ist er schon wieder auf dem Weg in sein Geschäft, zieht Zigarrenrauch hinter sich her, ruft seinen Mitarbeitern in der Druckerei ein lautes guten Morgen zu, ißt in der kleinen Imbißstube bei den Bahngleisen ein herzhaftes Frühstück.
Sonntags muß er unbedingt in seinem Plymouth spazierenfahren, und er nimmt einen guten Teil seiner Familie mit, sofern sie mitkommen wollen. Er fährt kreuz und quer durch Neuengland, erforscht die White Mountains, die alten Städte an der Küste und im Landesinnern, er will überall anhalten, wo gutes Essen oder gute Eiscreme locken, er will an den Verkaufsständen längs der Straße Kisten voller MacIntosh-Äpfel und große Flaschen voller Most kaufen, und dann wieder Körbe voller Erdbeeren und Heidelbeeren und soviel Mais, wie er in dem Auto nur unterbringen kann. Er will all die Zigarren rauchen, in all den Pokerrunden mitspielen, all die Straßen und Küsten und Städte in Neuengland erforschen, in all den guten Restaurants essen, sich mit all den guten Männern und Frauen anfreunden, all die Pferderennen sehen und bei all den Buchmachern in all den Hinterzimmern seine Wetten abschließen, so viel Geld verdienen wie er ausgibt, die ganze Zeit herumalbern und lachen und Witze machen – er will alles tun, er tut alles.
Mutter Martin ist eine großartige Hausfrau, ihrem Mann zufolge «die beste Köchin in der ganzen Stadt». Sie bäckt Kuchen, brät mächtige Stücke vom Rind und Lamm und Schwein, hält ihren Eisschrank immer randvoll, fegt die Fußböden und wäscht Kleider und tut alles, was die Mutter einer großen Familie zu tun hat. Wenn sie einmal Pause macht und sich hinsetzt, hat sie sofort ihr Kartenspiel in der Hand, mischt die Karten, späht über den Rand ihrer Brille hinaus und blickt in die Zukunft, sieht glückliche Tage, ahnt Schicksalsschläge, hat Vorahnungen der unterschiedlichsten Art und Größe. Sie sitzt mit ihrer ältesten Tochter am Küchentisch und findet die Botschaften am Boden ihrer Teetasse. Sie sieht überall Zeichen, verfolgt interessiert das Wetter, liest die Nachrufe und die Heirats- und Geburtsanzeigen, weiß immer, wer krank ist und in Not, wer vor Gesundheit strotzt und Glück hat, sie verfolgt das Wachstum von Kindern und den Verfall alter Männer überall in der Stadt, die Vorahnungen anderer Frauen und das Herannahen neuer Zeiten. Nichts entgeht der unermeßlichen mütterlichen Weisheit dieser Frau: sie hat alles vorausgesehen, alles geahnt.
«Du brauchst es nicht zu glauben, wenn du nicht willst», sagt sie zu ihrer ältesten Tochter Rose, «aber neulich hatte ich einen Traum, da kam nachts mein kleiner Julian zu mir, er schlüpfte zu mir ins Bett, so wie früher, wenn er zu krank war, um schlafen zu können, oder wenn er vor der Dunkelheit Angst hatte, so wie in dem Jahr, in dem er starb, und er sagte zu mir: ‹Mama›, sagte er, ‹machst du dir Sorgen wegen Ruthey?› Und ich sagte: ‹Ja, mein Schatz, aber warum fragst du mich?› Und er sagte: ‹Hab keine Angst mehr um Ruthey, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles gut.› Er sagte das immer wieder: ‹Jetzt ist alles gut.› Und er hat genauso ausgesehen wie damals in den Wochen, bevor er starb, seine kleine Stirn ganz blaß und mit Schweiß bedeckt, seine traurigen Augen ganz groß, als wolle er wissen, warum es war, daß er so krank sein mußte. Es war so ein lebendiger Traum! Ich hatte ihn direkt vor mir, Rose! Und ich hab deinem Vater davon erzählt, und er bewegte den Kopf von einer Seite zur anderen, du weißt ja, wie er das immer macht, und er sagte: ‹Hoffen wir’s, Marge, hoffen wir’s.› Und jetzt ist es so gekommen!» schließt sie triumphierend. «Ruthey ist zurück vom Krankenhaus und wieder ganz gesund, und wir hatten gemeint, sie sei in so großer Gefahr!»
«Okay!» ruft Rose und hebt in einer liebenswert spöttischen Geste die Hand hoch. «Dann war es eben so.»
Die Mutter blickt langsam auf und grinst. «Meinetwegen», sagt sie dann, «du kannst sagen, was du willst, aber ich verstehe das besser als ihr alle. Ich träume, ich werde nervös, wenn etwas Ungutes auf uns zukommt, und wenn bald Glück zu uns ins Haus kommt, dann spüre ich das auch – und genau das spüre ich schon die ganze Woche, seit ich diesen Traum mit Julian hatte. Ich hab es auch in den Karten gesehen –»
«Jetzt legt sie wieder los!» ruft Rose und schüttelt den Kopf in einer Geste abgestumpfter Unterwerfung. «Gleich wird sie uns alles darüber sagen.»
«So läuft es immer ab», sagt die Mutter bestimmt, als habe das Mädchen nie den Mund aufgemacht. «Mein kleiner Julian erzählt mir all diese Dinge. Er hat uns nicht vergessen, und er kümmert sich immer noch um uns, auch wenn wir ihn nicht sehen – er ist trotzdem da.»
«Also, Ma weiß schon, wovon sie redet, mach dir da mal keine Sorgen», sagt Joe, der älteste Sohn, mit einer unverhofften friedfertigen Weichheit, wobei er verschämt zu Boden blickt und in der Küche auf und ab geht. «Was sie weiß, weiß sie.»
Und die Mutter, die ein kleines nachdenkliches Lächeln des Trostes und der Freude zeigt, weil ihre Ruthey vom Krankenhaus heimgekommen ist und weil sie es in einem Traum und in den Karten vorausgesehen hat, sitzt grübelnd über ihrer Teetasse am Küchentisch.
Die älteste Tochter, Rose, ist ein großes stämmiges Mädchen von einundzwanzig Jahren, die «große Schwester» der Familie, die ständige Begleiterin und Helferin der Mutter, eine robuste Person voller Fröhlichkeit und Vitalität und Wärme, mit einer natürlichen Größe und Großzügigkeit. Sie steht an der Seite ihrer Mutter und späht besorgt in den Eisschrank, sie geht mit den schweren Schritten eines Dickhäuters in der Küche umher, so daß jedesmal das Geschirr in der Kammer klirrt und klappert, sie schleppt Wäsche in riesigen Körben vom Hof herein. Wenn ihr Lieblingsbruder Joe von seinen ewigen Streifzügen nach Hause kommt, begrüßt sie ihn mit heiserem Gebrüll und scheucht ihn durch das Haus. Wenn die Nachricht von einer Katastrophe oder einem großen Triumph ins Haus kommt, tauscht sie mit ihrer Mutter rasch den bestürzten Blick der Wissenden.
Die paar Freunde, mit denen sie ausgeht, sind alles große stämmige Typen wie sie selbst, Burschen, die auf Farmen arbeiten oder Lastwagen fahren oder die körperlich schwere Arbeit in Fabriken erledigen. Wenn sich einer von ihnen in den Finger schneidet oder die Hand verbrennt, setzt sie ihn auf einen Stuhl und verarztet ihn erst mal und schimpft ihn fürchterlich aus. Sie ist die erste in der Familie, die morgens aufsteht, und abends geht sie als letzte schlafen. Soweit sie zurückdenken kann, ist sie immer die «große Schwester» gewesen. In der Abenddämmerung steht sie dort drüben im Hof, nimmt die Wäsche von der Leine, packt sie in Körbe und geht damit auf die Veranda zu; nur einen Moment bleibt sie stehen, um die Kinder zu tadeln, die in den angrenzenden Feldern spielen, und dann schüttelt sie den Kopf und verschwindet im Haus.
Der älteste Sohn ist Joe, derzeit etwa siebzehn Jahre alt. Seine typische Beschäftigung sieht so aus: er leiht sich den alten Wagen eines Kumpels – einen 31er Auburn – und fährt zusammen mit noch einem wilden Draufgänger nach Vermont rauf, um sein Mädchen zu besuchen. Nachdem sie sich im Polkagetrampel in Wirtshäusern mit ihren Freundinnen ausgetobt haben, fährt Joe eines Nachts mit dem Wagen aus einer Kurve und gegen einen Baum, und sie werden alle mit leichten Verletzungen aus dem Wagen geschleudert. Joe liegt mitten auf der Straße flach auf dem Rücken und denkt: «Wow! Vielleicht tu ich besser so, als ob ich tot wär – sonst krieg ich Ärger mit den Bullen, und mein Alter macht mich zur Schnecke.»
Sie bringen Joe und die anderen ins Krankenhaus, wo er zwei Tage lang in einem «Koma» liegt, nichts sagt, verstohlen um sich blickt, horcht. Die Ärzte glauben, er habe schwere innere Verletzungen erlitten. Von Zeit zu Zeit kommt jemand von der Polizei vorbei, um Fragen zu stellen. Joes Kumpel aus Galloway, der nur eine kleine Fleischwunde abbekommen hat, ist schon bald wieder auf den Beinen, flirtet mit den Krankenschwestern, hilft in der Küche beim Abwasch und überlegt dauernd, was er als nächstes anstellen soll. Zwanzigmal am Tag kommt er zu Joe ans Bett.
«He, Joe, Kumpel, wann rappelst du dich endlich wieder auf?» stöhnt er. «Was ist bloß los mit dir? Mann, warum muß das ausgerechnet uns passieren!»
Schließlich flüstert Joe: «Sei endlich still, Herrgott noch mal», und macht, während ihn der andere Junge staunend angafft, die Augen wieder zu, ernst, fast ehrfürchtig und ergeben, mit einer verrückten Zielbewußtheit.
An dem Abend kommt Joes Vater im Dunkeln über die Berge gefahren, um seinen wilden und wahnsinnigen Sohn abzuholen. Mitten in der Nacht springt Joe aus dem Bett und zieht sich an und rennt fröhlich aus dem Krankenhaus, und einen Augenblick später fährt er sie alle mit über hundert Sachen zurück nach Galloway.
«Jetzt ist endgültig Schluß mit deinen verdammten Spritztouren!» schwört Mr. Martin und zieht heftig an seiner Zigarre. «Hast du mich verstanden?»
Seine Mutter fürchtet, er werde an Krücken nach Hause kommen, ein Krüppel auf Lebenszeit, aber als sie am nächsten Morgen aus dem Fenster schaut, liegt da ihr Sohn Joe hinten im Hof unter dem alten 29er Ford ausgestreckt, mittendrin in Überholungsarbeiten; der Schmierfleck auf seiner Oberlippe erinnert an einen kleinen Schnurrbart, so daß er irgendwie «genau wie Errol Flynn» aussieht. Und tags darauf kann man Joe beim Turmspringen sehen; er springt aus dem Fenster einer Wohnung, die direkt über einem Galloway-Kanal liegt, im Fabrikviertel, wo Joe ein Mädchen wohnen hat. Joe hat immer einen Job, verdient immer Geld, und er hat offenbar nie Zeit zum Trübsalblasen oder Schmollen. Sein nächstes Ziel ist ein Motorrad, irre verziert mit Kaninchenschwänzen und glitzernden Knöpfen.
Sein Bruder, Francis Martin, ist ständig am Trübsalblasen und Schmollen. Francis ist groß und hager, und an seinem ersten Tag in der High School geht er die Gänge entlang und starrt jeden mürrisch und griesgrämig an, als frage er sich: «Wer sind bloß all diese Trottel?» Francis ist erst fünfzehn Jahre alt, aber er hat die Gewohnheit, für sich zu bleiben, zu lesen oder einfach aus dem Fenster seines Zimmers zu starren. Seine Familie «wird aus ihm nicht schlau». Francis ist der Zwillingsbruder des verstorbenen und geliebten Julian, und er ist – wie Julian, und im Gegensatz zu allen anderen Martins – gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Doch seine Mutter liebt ihn und versteht ihn.
«Man darf nicht zuviel erwarten von Francis», sagt sie immer, «er ist nicht gesund und wird wahrscheinlich nie ganz gesund werden. Er ist ein merkwürdiger Junge, man muß ihn nur verstehen.»
Francis überrascht alle, als er in der Schule ohne große Mühe mit hervorragenden Leistungen glänzt und Zeugnisse einheimst, die zu den besten in der Geschichte der Schule gehören – aber seine Mutter versteht auch das. Er ist ein mürrisch und düster dreinblickender, schmallippiger Junge mit leicht gebeugter Körperhaltung, kühlen blauen Augen und einem Auftreten, das unverletzliche Würde und Anstand ausstrahlt. Wer sich in einer großen Familie wie der der Martins von den anderen absondert, wird immer mit Argwohn betrachtet, zugleich aber mit eigenartigem Respekt. Das gilt auch für Francis Martin, und so wird ihm schon früh die Macht der Verschlossenheit bewußt.
«Man kann Francis zu nichts drängen», sagt die Mutter. «Er ist sein eigener Herr, und er tut, was er will, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Wenn er so viel für sich bleibt, dann nur, weil ihn so vieles beschäftigt.»
«Wenn ihr mich fragt», sagt Rosey, «dann stimmt’s bei ihm hier oben nicht ganz.» Und sie läßt ihren Zeigefinger um ihr Ohr kreisen. «Ihr werdet noch an mich denken.»
«Nein», sagt Mrs. Martin, «du verstehst ihn nur nicht.»
Ruth Martin ist achtzehn, und sie ist in ihrem letzten Jahr auf der High School. Sie geht zu den Tanzveranstaltungen, den Schlittschuh-Parties und den Footballspielen, die zum Leben auf der High School gehören, ein winziges, ruhiges, wohlerzogenes Mädchen von einer heiteren und offenen Gemütsart. Alle in der Familie lieben sie, und sie erwarten von ihr, daß sie einmal heiratet, ihre Kinder großzieht und mit ihrer geduldigen, verläßlichen und fröhlichen Art die Verantwortung für alles übernimmt, so wie sie das immer getan hat. Nun will sie auf die Handelsschule, um den Beruf einer Sekretärin zu erlernen und ein paar Jahre eigenes Geld zu verdienen. Ruth gehört zu der Sorte von Mädchen, die nie besonders auffallen, von denen man nie hört, die man aber überall sieht; sie ist vor allen Dingen eine Frau, die ihre Seele für sich behält und für ein Herz aufspart.
Der dreizehnjährige Peter Martin ist schockiert, als er bei einem High School-Tanz seine Schwester Ruth so eng mit einem anderen Jungen tanzen sieht – im Anschluß an die jährliche Minstrel Show im Festsaal der Schule. Beim Blick über den ganzen Tanzboden – in rosiges Licht getaucht und ein wenig dunstig und einfach herrlich – kommt er zu dem Schluß, daß das Leben erregender ist, als es nach seinen bisherigen Vorstellungen eigentlich sein dürfte. Wir sind im Jahr 1935, die Band spielt Larry Clintons «Study in Red», und jeder beginnt die erregende neue Musik zu ahnen, die im Begriff ist, sich zu entfalten und sich über alle Schranken hinwegzusetzen. Es liegen Gerüchte von Benny Goodman in der Luft, von Fletcher Henderson und von der Entstehung neuer großer Bands. In dem übervollen Tanzsaal sind es die Lichter, die Musik, die tanzenden Menschen und die ganzen Echos, die den Jungen mit unbekannten neuen Gefühlen und mit einem geheimnisvollen Kummer erfüllen.
Am Fenster starrt Peter hinaus in die brütende Frühjahrsnacht, entflammt vom Anblick der eng umschlungenen Tanzpaare, aufgewühlt von der Botschaft der Musik und erfüllt von einer grenzenlosen Sehnsucht, selber erwachsen zu werden und die High School zu besuchen, wo es auch ihm möglich sein wird, mit wohlgestalteten Mädchen im Arm zu tanzen und in der Minstrel Show mitzusingen und vielleicht auch ein Footballheld zu sein.
«Siehst du den da drüben mit dem Bürstenschnitt?» Ruth deutet in eine Richtung. «Der stämmige Typ dort, der mit dieser hübschen Blondine tanzt? Das ist Bobby Stedman.»
Für Peter ist Bobby Stedman ein auf heiligen Sportseiten gefeierter Name, eine geschmeidige verschwommene Figur in den Wochenschaubildern vom großen Thanksgiving-Spiel Lawton gegen Galloway, der Held aller Helden. Peter traut seinen Augen nicht, wie er ihn da tanzen sieht – kann das der Bobby Stedman sein? Ist er nicht der größte, schnellste, kraftvollste, geschmeidigste Halfback im ganzen Staat? Haben sie nicht seinen Namen in großen schwarzen Buchstaben gedruckt? Schwingt nicht eine majestätisch schreitende Musik mit seinem Namen und mit der stolzen düsteren Welt, die ihn umgibt?
Dann wird Peter bewußt, daß Ruth mit Lou White persönlich tanzt. Lou White – noch ein entrückter und heldenhafter Name, eine Gestalt auf regen- oder schneegepeitschten Footballplätzen, ein Gesicht in den Zeitungen, das äußerst angespannte Gesicht eines Centerspielers, unmittelbar vor dem Rückpaß …
Als Lou White ins Haus der Martins kommt, um Ruth zum Eislaufen abzuholen, steht Peter in einer dunklen Ecke und sieht ihn lange voll einfältiger Ehrfurcht an. Als Lou White eine Weile dableibt, um Jack Benny im Radio zu hören, und über die Witze lacht, ist Peter restlos erstaunt. Und als er ihn dann am Tag des großen Thanksgiving-Spiels wiedersieht, wie er tief in der gegnerischen Hälfte über dem Ball kauert, kann es Peter nicht fassen, daß dieser entrückte Gott in sein Haus gekommen ist, um seine Schwester zu besuchen und über Witze zu lachen. Die Zuschauermassen brüllen, der Herbstwind zerrt an den Fahnen rings um das Stadion, Lou White bringt weit draußen auf dem mit vielen Linien markierten Rasen den Ball ins Spiel, rammt die Gegner mit sensationellen Stößen, die lauten Jubel auslösen, trabt zurück und erhält donnernden Applaus, als er bei seinem letzten Spiel für die Schule vom Platz geht. Die Bands spielen die Schulhymne, die sich im Wind verliert.
«In zwei Jahren bin ich dabei, dann spiele ich mit», sagt Peter zu seinem Vater.
«So so, du willst mitspielen?»
«Ja.»
«Meinst du nicht, daß du dafür ein bißchen zu klein bist? So wie die Jungs gebaut sind, könnten sie’s mit einem Lastwagen aufnehmen.»
«Ich werd noch größer», sagt Peter, «und stark werd ich auch.»
Sein Vater lacht, und von dem Augenblick an wird Peter Martin endlich von all den phantastischen und sagenhaften Triumphen angestachelt, die für ihn nun in der Welt möglich sind und die er vor sich sieht.
Wenn an irgendeinem milden duftenden Abend im April die zwölfjährige Elizabeth Martin zu sehen ist, wie sie traurig unter den tropfnassen Bäumen umherstreift, schmollend und wütend und einsam, die Hände tief in den Taschen des kleinen hellbraunen Regenmantels vergraben, während sie über die Abscheulichkeiten des Lebens nachgrübelt und tief in Gedanken langsam zum Haus ihrer Familie zurückkehrt – dann kannst du sicher sein, auf die düsteren Schrecken der Zwölfjährigen werden frauliche Tage voll reifem, warmem Sonnenschein folgen.
Oder wenn dieser Junge dort mit dem forschen kleinen Gesicht, der kurz die Lippen anfeuchtet, bevor er auf eine Frage antwortet, der mit großen Schritten entschlossen und beharrlich auf sein Ziel zugeht, der im Keller oder in der Garage mit großem Ernst an irgendeinem Apparat oder einem alten Motor herumflickt, sehr wenig redet und jeden offen und blauäugig mit einem Blick absoluter Vernünftigkeit anstarrt, wenn also dieser Junge, der neunjährige Charley Martin, genau unter die Lupe genommen wird, während er den Beschäftigungen seines selbstbewußten und ernsten jungen Daseins nachgeht, dann erscheinen über ihm dunkle Flügel, wie um ein fremdes Licht in seinen nachdenklichen Augen zu verdecken.
Und wenn du schließlich an einem verschneiten Abend, an dem die tiefstehende Sonne die Flanke eines Hügels beleuchtet und in Fabrikfenstern aufflammt, ein Kind von sechs Jahren, einen kleinen Jungen namens Mickey Martin, bewegungslos mitten auf der Straße vor seinem Schlitten stehen siehst, wie gelähmt von der plötzlichen Entdeckung, daß er nicht weiß, wer er ist, wo er herkommt, was er da macht, dann solltest du dran denken, daß alle Kinder erst einmal aus dem beschützenden mütterlichen Schoß gestoßen werden, ehe sie wissen können, daß die Einsamkeit ihr Erbe und der einzige Weg für sie ist, Männer und Frauen wiederzuentdecken.
Das also ist die Familie Martin, die Alten und die Jungen und auch die Jüngsten, die flackernden letzten Flämmchen einer Sippe, die wachsen werden und mit der Zeit auch die Größe und Erfahrung und übergroße Gegenwart der anderen erlangen werden, um mit ungezähmtem Feuer durch die Tage und Nächte ihres Lebens zu stürmen und über die armseligen Dinge des Lebens ebenso zu grübeln und treffliche Aussagen zu machen wie über seine kostbaren, geheimnisvollen Seiten.
3
Über Galloway und dieses Haus ziehen die Wetter hinweg; sie wandern mit einer der Jahreszeit angemessenen Majestät über den Himmel. Der große Winter rüttelt grollend an seinen Grundmauern und schmilzt, Rinnsale bilden sich unter dem Schnee, die Eisschollen drängen sich am Wasserfall, und plötzlich erfüllen die Laute eines lyrischen Tauwetters die Luft.
Der junge Peter Martin hört das lange widerhallende Signal des Zuges nach Montreal, zerrissen und unterbrochen von mächtigen Umschichtungen in der Märzluft, er hört Stimmen, die plötzlich über den Fluß herübergeweht werden, Hundegebell, Rufe, Hammerschläge, und dann sind sie auch schon wieder weg. Wach und voller Erwartung sitzt er am Fenster, die Dachrinne tropft, ein Echo wie von einem fernen Donner ist zu hören. Er blickt nach oben, wo ausgefranste Wolken über den zerfetzten Himmel hetzen, über dem Dach dahinjagen, über den schwankenden Bäumen, abziehende Horden, vorrückende Armeen. Es riecht nach klebriger Birke, es riecht überaus stark nach dunkler und feuchter Erde, nach dunklen verfaulenden Ästen aus dem Bodenteppich des letzten Herbstes, die sich in einem süßlich duftenden Morast auflösen, nach ganzen Wogen heranrückender Märzluft, nach nebliger, dunstiger Märzluft.
Etwas Verwirrendes und Wildes bewegt sein Herz, er stürmt hinaus auf die Straße und eilt in großen Schritten über die Gehwege, rings um ihn her ist ein gewaltiges Schmelzen im stürmischen Wind, etwas Weiches und Musikalisches, ein Tauen, eine Spur von Wärme, nicht mehr als ein Hauch. Auf der Straße der absackende Schneewall, die gurgelnde Gosse, das geräuschvolle Tauen, allenthalben die lyrische Frische. Er beschleunigt den Schritt, erfüllt von unbeschreiblichen Frühlingsahnungen, er muß rasch hinüber zu Dannys Haus und mit ihm im schmelzenden Schnee spielen, Schneebälle machen, sie durch die diesige Luft gegen schwarze feuchte Baumstämme werfen, hineinschreien in all die plötzlichen Geräusche, die von überall her die Luft durchdringen.
«Sobald der Schnee weg ist, werfen wir uns die Bälle zu, aber scharf, dann kriegen wir wieder das Gefühl für die langen Bälle, was, Dan?»
«Jau!»
Das «Jau!» der beiden hallt über die Felder, laut wie eine Autohupe. Sie bauen einen Schneemann und durchlöchern ihn mit Schneebällen, und nun zieht die Dämmerung herauf, und der Märzhimmel droht finster mit düsteren, dunkelroten Wolken. Gleich wird die Sonne durchbrechen und in all den Fenstern Galloways aufflammen, die Fabrikfenster verwandeln sich in tausend rote Fackeln, etwas läuft schräg über den Himmel und über den Fluß.
«Jau!»
Dann kommen die Regenfälle, der April setzt den Schnee unter Wasser und schwemmt ihn hinunter zum wilden, brüllenden Fluß, Baumstämme kommen angeschwommen, von New Hampshire herunter, der Wasserfall ist in einem Aufruhr, graue, schmutzige Wassermassen umbrausen die Felsbrocken und schleudern Prügel und Stämme in die Luft. Die Kinder laufen das Flußufer entlang und werfen alles mögliche ins Wasser. Sie tragen Holzstöße zusammen und entzünden sie mit lautem Jubel.
Plötzlich kommt der Tag, an dem sich die Abenddämmerung mit sanfter Ruhe herabsenkt, riesig und rot geht die Sonne unter, und bald herrscht eine duftende stille Dunkelheit, die Blätter auf den Bäumen rascheln leise in der Brise, und alles duftet nach Laubwerk und lehmiger Erde. Ein großer brauner Mond steigt über den Horizont. Die alten Leute in Galloway kommen heraus und stehen eine Weile auf ihren Veranden und erinnern sich an die alten Lieder.
Am Morgen, als die Sonne wärmend aufgeht, als ungezählte Vögel überall auf den Zweigen ihr Lied anstimmen, als sich eine Ahnung lieblicher Blüten in der Luft ausbreitet, da ist es Mai.
Der kleine Mickey wacht auf und geht an sein Fenster: es ist Samstag morgen, keine Schule heute. Und für ihn liegt eine leise Musik in der Luft, wie das schwache Echo einer Fanfare über den Wäldern, wie Männer und Pferde und Hunde, die sich weit jenseits der Felder unter den Bäumen zu einem freudigen und abenteuerlichen Ausritt sammeln. Alles ist sanft und musikalisch und lieblich und voller Sehnsüchte, unbestimmte Ahnungen und unbeschreibliche Offenbarungen schweben in der überaus duftigen blauen Luft. Dort, in den blauen Schatten unter den Morgenbäumen, in dem kühlen scheckigen Schatten, in der frischen grünen nebeligen Farbe der Wälder in weiter Ferne, in dem dunklen Erdboden, noch feucht und über und über mit kleinen Blüten bedeckt, dort ahnt er den sich entfaltenden glorreichen Sommer und die Zukunft. Mickey stürmt hinaus, schlägt die Küchentür hinter sich zu, treibt seinen alten Gummireifen mit einem Stecken vor sich her. Auf der kühlen taufeuchten Teerdecke geht er die alte Galloway Road hinunter, links und rechts von ihm singen Vögel, er fragt sich, wann es wohl im Obstgarten des alten Breton Äpfel geben wird. Er rechnet sich aus, daß er in diesem Jahr den Fluß mit einem Boot auskundschaften wird. O Mann, in diesem Jahr wird er alles tun!
Später sieht Mickey all den großen Jungs auf dem Sportplatz zu, wie sie mit den Fäusten in die Fingerhandschuhe schlagen und einen nagelneuen weißen Baseball hin- und herwerfen. Einer hat einen Schläger dabei und beschränkt sich auf leichte kurze Schläge, und die Jungs bücken sich, um die Bodenroller abzufangen, und brüllen: «Aua! Ich hab’s mal wieder im Kreuz dieses Jahr!»
Einer der Jungs spottet über einen hochfliegenden Ball, rammt kurz die Faust in den Handschuh, holt den Ball aus der Luft, trabt ein bißchen herum, wirft den Ball in hohem Bogen zurück, ohne sich anzustrengen. Das Frühjahrstraining ist angelaufen, da müssen sie «mit dem alten Arm» noch vorsichtig sein. Mickey riecht den Zigarettenrauch in der Morgenluft, wo die älteren Jungs herumstehen und reden. Sein großer Bruder Joe Martin holt gemächlich aus und wirft den Ball einem anderen Jungen zu, der mit einem Fingerhandschuh in die Hocke gegangen ist. Joe ist ein Starwerfer; er versteht es, sich Zeit zu lassen und im Frühjahrstraining zur alten Lockerheit zurückzufinden. Alle sehen zu, wie er den Ball leicht und lässig zurückwirft, mit einer runden Bewegung und ohne eine Miene zu verziehen. Einen Augenblick später brüllt er vor Lachen, als einer von einem scharfen Bodenroller am Schienbein getroffen wird.
In der kühlen schattigen Küche seiner Mutter verschlingt Mickey einen Teller Haferflocken und starrt auf das Bild von Jimmy Foxx auf der Packung. Seine Kameraden kommen die Straße herauf, er kann sie hören, sie wollen den Berg rauf und Cowboy spielen. Er ist dabei immer Buck Jones. Jetzt sind sie draußen im Hof und rufen: «Mick-iie!»
Mickey kommt aus der Küche gestürzt und ballert mit beiden Kanonen: «Pow! pow! pow!», bevor er hinter einem Faß verschwindet; die anderen gehen in Deckung und erwidern das Feuer. Einer springt auf, dreht sich in der Luft, krümmt sich zusammen und sinkt tödlich getroffen ins Gras.
In der Frühlingsnacht bringt Joe den alten Ford auf Touren und braust davon, um mit seinen Kumpeln Biertrinken zu gehen. Und am ersten warmen Juniabend stauben Mrs. Martin und Ruth die alte Schaukel hinterm Haus ab, legen Kissen drauf, machen eine große Schüssel Popcorn und setzen sich hinaus unter den Mond, in den schwankenden schwarzen Schatten der hohen Hecken.
Eine Cousine sitzt bei ihnen im Abendwind und ruft aus: «Uuh! Ist der Mond nicht toll!»
Vater Martin, der sich in der Küche mit viel Gepolter ein Sandwich mit Spiegelei richtet, äfft sie bissig nach: «Ist der Mond nicht to-holl!»
Die drei Frauen hinterm Haus schwingen auf der alten knarrenden Schaukel rhythmisch hin und her und erzählen einander von den besten Wahrsagerinnen, die sie je kannten.
«Glaub mir, Marge, sie ist direkt unheimlich!»
Mrs. Martin schaukelt ruhig weiter und wartet geduldig, mit zusammengekniffenen Augen, skeptisch.
«Sie hat fast alles vorhergesagt, was in dem Jahr passiert ist, bis in die Einzelheiten, wohlgemerkt!» Und mit diesen Worten blickt Cousine Leona auf zum Mond und seufzt: «Die Ironie dieses Lebens, Marge, die Ironie des Lebens.»
Der Vater des Hauses kommt mit seinem Sandwich aus der Küche gestapft und äfft wieder bissig nach: «O ja, die Ironie des Le-hebens!»
Die Frauen wiegen sich auf der alten knarrenden Schaukel, greifen mechanisch in die Popcornschüssel, nachdenklich, zufrieden, verbunden mit der wunderbaren Dunkelheit und der reifen Juniwelt, ja, sie besitzen diese Welt in einer Weise, wie kein grob durch das Haus polternder Mann je mit irgendeinem Teil der Erde verbunden sein oder auch nur einen Zoll davon besitzen könnte.
An dem See in Neuengland tanzen die jungen Leute an einem Juliabend in einem lampiongeschmückten, von der Brise belebten Ballsaal, die Lichter verbreiten ein weiches Blau und Rosa, der Mond liegt hell auf dem dunklen Wasser jenseits der Terrasse. Die Melodien wecken süße Gefühle und werden zu süßen Erinnerungen. Auf einer schwimmenden Plattform vor dem Seeufer sitzen junge Leute, sie hängen die Füße ins milde Wasser der Nacht und lauschen der Musik aus dem Ballsaal, die über den See herübergeweht wird. In einer lärmenden Kneipe, wo Joe literweise Bier trinkt und mit stämmigen polnischen und frankokanadischen Blondinen Polka tanzt, hängt dichter Rauch in der Luft, alles vibriert von Fiedeln und stampfenden Füßen, und der Anblick des Sees und des Mondes draußen vor den Fliegengittern ist von einer geheimnisvollen Schönheit, eine einzelne Kiefer stöhnt direkt vor dem Fenster in der Abendbrise.
Auf den heißen Augustfeldern des Nachmittags gehen Farmer im flimmernden Dunst von der Sonne gepeinigt gebückt ihrer schweißtreibenden Arbeit nach. Die kleinen Kinder hopsen wie Fische im Bach herum, wie kleine weiße Elritzen springen sie vom Ufer und von den Bäumen kopfüber in den Bach. Im Schatten der Kiefern, unter ihrem windigen sinfonischen Stöhnen, ganz dort unten auf den Feldern, in den Bächen, hinter Inseln aus goldenem Sonnenschein und blaßgrünen Weiten: sieh nur die Farmer, die Kinder und noch weiter in der Ferne die aufragenden Schornsteine der Fabriken Galloways im schimmernden Dunst.
Es liegt eine träge Hitze über dem Daley Square, in den Straßen geht kein Lüftchen, es ist heiß in den Häusern, um Mittag bewegen sich die Leute in ihren weißen Hemden und Strohhüten von der Sonne umflutet in einem dumpfen Gedränge. Der Versicherungsmann bleibt in der glühenden Hitze an einer Straßenecke stehen, um sich den Schweiß vom Hutband zu wischen, der rotnackige Verkehrspolizist steht steif an seinem Platz, und Mr. O’Hara, ein Stadtrevisor, geht langsam über die dunklen stickigen Gänge im Rathaus und ruft einem Schreiber zu: «Viel heißer geht’s nicht mehr, was?»
«Die Zeitung meint, heut kommt’s noch zum Regnen.»
«Hoffen wir’s, hoffen wir’s.»
George Martin kommt abends von der Druckerei nach Hause. Erschöpft schleppt er sich ins Haus, schwitzend und mit hochrotem Gesicht und mit einem gequälten, mißmutigen Keuchen. Der kleine Mickey sieht zu, wie sein Vater das Jackett, die Krawatte, das nasse schlaffe Hemd auszieht, sieht zu, wie er sich in den alten Ledersessel in der Wohndiele fallen läßt und eine Zigarre anzündet. Die heiße rote Sonne fällt schräg durch die heruntergelassenen Jalousien, das Haus ist leblos und träge. Peter hat es sich mit einem Glas Limonade auf dem kühlen Fußboden der Glasveranda bequem gemacht, aus dem Radio kommen das schläfrige Summen, das Pfeifen und Johlen eines Baseballspiels mit den Red Sox aus dem glutheißen Boston.
«Wie steht’s?» ruft der Vater.
«Drei null für die Tigers. Bridges macht sie fertig, einen nach dem anderen.»
Mr. Martin fährt verärgert mit der fleischigen Hand durch die Luft, pafft seine Zigarre, seufzt.
Plötzlich ist eine Kühle da, die Sonne ist von einem tiefen Rot, ein Wind kommt vom Fluß her über die Wiesen. Mutter Martin brät Hamburger in Butter, Ruth hantiert in der Küche herum und deckt den Tisch, die Eisschranktür wird zugeschlagen, die Literflasche Milch kommt auf den Tisch.
«Das Abendessen ist gleich fertig!»
«Ich will noch sehen, was in diesem Durchgang passiert», ruft Peter. Er wälzt sich hinüber zu einer kühleren Stelle auf dem Linoleum, drückt seine Wange an den glatten Fußboden und wartet, am Boden ausgestreckt, auf die weiteren Ereignisse in dem heißen staubigen Innenfeld im Fenway Park in Boston.
Mr. Martin raschelt mit der Zeitung, starrt böse auf den Leitartikel und schnaubt: «Jetzt wollen diese Hunde, diese verrückten, auch noch die städtischen Gebühren erhöhen!»
Mickey schlendert hinaus auf den Hof, wo Charley in der von der Sonne aufgeheizten Garage das Fahrrad repariert, ein schwitzender, konzentrierter, fleißiger Charley. Mickey blickt auf, und er kann seinen Bruder Francis sehen, der an einem Schlafzimmerfenster sitzt und vor sich hinträumt.
Die Brise ist kühler geworden, die Sonne ist fast dunkelrot, und da kommt auch Joe in dem alten Ford angefahren, sein Arbeitstag an der Tankstelle ist beendet. Es ist Abendbrotzeit, und gleich wird der Sommerabend anbrechen.
Eines Abends also sitzt der kleine Mickey kurz vor dem Schlafengehen noch eine Weile auf der Veranda vor dem Haus – die ganze Clique ist bereits zu Hause und im Bett –, und wie er so dasitzt, spürt er die kaum merkliche Abkühlung in der Luft, den Vorboten einer Veränderung – wieder einmal stehen Schultage vor der Tür. Über ihm spannt sich ein sternenreicher Himmel, augustkühl und friedlich, voll verschleiertem Licht und leicht prickelnder Kühle. Alles riecht alt und staubig und vom langen Sommer erschöpft; und ihm wird bewußt, daß auch die Spiele, die er den ganzen Sommer mit seiner Clique gespielt hat, alt und staubig geworden sind. Mit einem vagen Gefühl der Melancholie und des Verlustes geht er ins Bett – und mitten in der Nacht fährt er plötzlich aus dem Schlaf hoch, in freudigem Entsetzen.
Sein Fenster klappert, draußen bläst ein Wind, so daß sich die Äste biegen, er hört Apfel mit dumpfem Aufprall zur Erde fallen! Im Norden sieht er von seinem Fenster aus Nachtwolken – er riecht etwas Künftiges – er macht sein Fenster fest zu – es klappert! Es fängt an zu regnen!
Er holt sich noch eine Decke. Er liegt wieder im Bett und denkt nach, unter der Steppdecke, ist voll wilder neuer Gedanken. Herbst! Herbst! Warum ist in ihm eine so gewaltige Erregung, so viel Freude und Jubel? Was ist das nur, was sich da ankündigt?
Er schläft ein und träumt von wilden Winden, zerfetzten rasenden Wolken, großen Städten im Norden an Meeresufern, wo der wilde Gischt fliegt. Und als er am Morgen aufwacht, ist es da, in der rauchig-roten Dämmerung, eine Art zartblaue Rauchspur am Morgenhimmel, einem Himmel, der an seinen Rändern braun angesengt ist – und da, reiner neuer Regen fällt auf dunkle Baumstämme, und etwas Wildes und Frisches ist in den Wolken. Den ganzen Tag lang ziehen sich die Wolken zusammen und formen große Knäuel und Figuren am Horizont, etwas pfeift über das Land, ein Blatt fliegt.
Die Tage purzeln, ein Tag deckt den anderen zu, und eines Abends schließlich wäscht sich Mickey sorgfältig Hände und Ohren, geht früh zu Bett, voll Ehrfurcht und Nachdenklichkeit, steht am frostigen Morgen auf, um am ersten Schultag rechtzeitig zur Stelle zu sein. Die Hafergrütze und das Toastbrot warten in der Küche auf ihn, etwas Duftendes und Wärmendes umgibt den Küchenherd, draußen ist es empfindlich kühl. Mit seiner nagelneuen, nach neuem Leder und Gummi riechenden Schulmappe macht er sich auf den Weg. Und sieh da! in der Schule sind auch all die anderen Kinder aus Galloway, und nicht einem von ihnen geht es deshalb schlechter!
In der tiefstehenden Oktobersonne laufen die Kinder dann am späten Nachmittag von der Schule nach Hause, werfen sich Bälle aus ausgestopften Socken zu, sie hüpfen und rennen gegen die heftigen Windböen an und kreischen vor Vergnügen. Überall brennen Feuer, beißend und lyrisch liegt der Geruch von Rauch in der Luft. Große dampfende Mahlzeiten warten in den Küchen darauf, gegessen zu werden, während draußen die rauhe Düsterkeit des Oktoberabends stärker wird und irgendwo in der Ferne ein Licht aufflackert. Die Kinder sind bei Einbruch der Dunkelheit wieder draußen, begeisterte Gruppen bilden sich vor Feuern, die stahlgrauen Wolken ballen sich zusammen und schieben sich über den Himmel. Dort an den Straßenecken haben sich die Männer und Jungen versammelt, sie bereden irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Neuigkeiten, etwas Aufregendes, das deutlich spürbar in der Luft liegt – um Football geht es vielleicht, oder um den großen Boxkampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht, oder um die Wahlen. Die Blätter häufen sich im Rinnstein, die Lampen leuchten warm über den Eßtischen in all den Häusern, Rauch kommt aus den Kaminen und wird sofort verweht, der ganze Abend hallt wider von den Rufen und vom Geschrei der Kinder, vom Gebell der Hunde. Jemand raucht eine Pfeife und geht mit großen Schritten über die Straße. Die Straßenlaterne bei dem Laden an der Ecke wiegt Schatten in einem großen schwarzen Tanz, das Ladenschild schaukelt und knarrt im Wind, Blätter fliegen umher, Äpfel plumpsen in den Obstgärten zu Boden, die Sterne flackern am düsteren Himmel – alles ist rauh und rauchig und überwältigend.
Peter Martin eilt mit großen Schritten stadteinwärts zur Bibliothek, kehrt mit Büchern und frischen Vorsätzen für die Schule zurück. Francis wickelt sich seinen Schal um den Hals und runzelt die Stirn. Der Vater kommt mit dem Ruf ins Haus: «Was gibt’s zu essen? Ich hab Hunger!»
Nun ziehen sich über den gelbbraunen Feldern die Schneewolken zusammen, es kommt zu grauen Himmeln voll dumpfer Ahnungen von Schnee, es ist November. Die ersten eisigen Winde fegen über kahle Heiden, die einst sommerliche Landschaften waren – und dann folgt Schnee, er kommt angeflogen und wird in einem gewaltigen, alles umfassenden Wirbel dahingetrieben. Die Bäche frieren zu, nachts schichten die Schlittschuhläufer große Freudenfeuer auf, Schreie erfüllen die eisige Luft, das Kratzen und Schaben von Schaufeln, eine sanfte, eingeschlossene Stille in der Luft. Hier sind die schneebedeckten Felder, zwischen denen einsame Spaziergänger an Sonntagnachmittagen ihre Spuren hinterlassen und stehenbleiben, um zuzusehen, wie das rosig schimmernde Licht über die milchigen Hügel kriecht, oder um die Schneemassen von den herabhängenden Ästen eines jungen Baumes zu schütteln. Und der strenge Dezember folgt mit heftigen Graupelschauern und Ungewittern und Nachrichten von katastrophalen Schneestürmen, die erst noch kommen sollen.
Das alte Haus trotzt auf seiner Anhöhe einem weiteren Winter, bei Tag lassen seine Fenster die Sonne aufblitzen, während windgepeitschter Schneestaub um die Dachrinne stiebt, wo die langen Eiszapfen hängen, die Äste knarren und schlagen in den langen tosenden Nächten gegen die Außenwände. Die Wäsche im Hof hinterm Haus flattert und weht steifgefroren im Wind, und hier kommt die große Rosey, wie ein Bär in ihrem dicken Mantel, ihre triefende Nase ist ganz rot, ihre großen derben Hände umklammern wieder einmal einen Wäschekorb. Joe ist in der Garage und läßt den Motor des Wagens aufheulen, sein Vater kommt auf der Suche nach ein paar alten Dosen mit Frostschutzmittel um eine Ecke der Scheuer gestolpert, der Rauch seiner ewigen Zigarre weht hinter ihm her, und jetzt flucht er, weil es so kalt ist und weil die Straßen so schlecht sind.
George Martin geht im Februarmorgen in die Stadt, um in der Imbißstube zu frühstücken. Dort schiebt er die Eingangstür zur Seite und entzieht sich mit einem raschen Schritt den eisigen Windstößen. Hier herrscht der dampfende Trubel der typischen Schnellgaststätte, Männer essen und lachen und brüllen herüber, er solle endlich die Tür zumachen, und da ist das Eis an den Fenstern, rosig in der winterlichen Morgendämmerung. George Martin, der Druckereibesitzer, verzehrt zwei Portionen Pfannkuchen mit Vermonter Ahornsirup und Butter, Schinken mit Ei, Toast und drei Tassen Kaffee, bevor er seinen Arbeitstag beginnt.
«Glaubst du, das reicht für den ganzen Morgen, Martin?» ruft ihm der Mann hinter der Theke zu.
«Wart mal ab, in einer Stunde komm ich wieder und eß die nächste Runde Pfannkuchen!»
Gelächter läßt die vereisten Scheiben klirren, als Martin die Schiebetür aufmacht und im stürmischen Wind den Weg über die Eisenbahnschienen einschlägt. Er kommt türenschlagend in seine Druckerei, schleudert die Überschuhe in die Ecke, reibt sich genüßlich die Hände, zündet eine Zigarre an und stürzt sich auf die Alltagsarbeit, die zwischen alten Hauptbüchern und langen Reihen eingeschwärzter Lettern auf ihn wartet.
«Kalt genug für dich, George?» ruft Edmund der Drucker fröhlich herüber.
Das Leben verläuft in Galloway wie die Jahreszeiten selber, in enger Verbindung mit Gottes Erde durch diese Wetterumschwünge, in denen das Leben prozessionsartig in Stimmungen und unberechenbaren Sprüngen pulsiert, während die Stimmungen des Universums sich endlos am Himmel erstrecken.
4
In einer mondhellen Nacht in einem Kiefernwäldchen, zwischen den Tischen und Bänken eines vergessenen Picknickplatzes mit Lichtgirlanden und altmodischen Walzerklängen unter den Bäumen, an irgendeinem Abend im Jahr 1910, im prächtigen Frühling Neuenglands – da hatte George Martin zum erstenmal das Mädchen erblickt, das seine Frau werden sollte. Marguerite hieß sie, und sie war französischer Herkunft und hübsch. George Martin, der junge Arbeiter, hatte über sein Leben und die Forderungen seiner Seele nachgedacht und beschlossen, dieser liebevollen, einfachen und feinfühligen Dame den Hof zu machen. Und er heiratete sie. Seine Überlegung war: «Marguerite ist eine richtige Frau.»
Marguerite Courbet war die Tochter eines frankokanadischen Holzarbeiters in Lacoshua, der sein Geld gespart und in ein einträgliches kleines Wirtshaus gesteckt hatte, doch dann erlag er urplötzlich mit achtunddreißig Jahren einem Herzschlag. So wurde sie zur Vollwaise, denn ihre Mutter hatte sie schon als kleines Kind verloren, und in der Folge wurde Marguerite von den Schwestern ihres Vaters aufgenommen, und sie machte sich mit fünfzehn Jahren aus eigenem Antrieb daran, in den Schuhfabriken in Lacoshua zu arbeiten und sich so auf eigene Beine zu stellen. Sie war eigentlich immer schon eine heitere, rotbackige, gefühlsbetonte Frau, die kaum noch Spuren einer tragischen Kindheit erkennen ließ, abgesehen davon, daß sie gelegentlich in düsteres Schweigen versank, wie man es von Waisen in Augenblicken des Nachdenkens kennt.
In den ersten Jahren ihrer Ehe, in jenen Tagen, als die Leute noch Perlenschnüre in die Wohnzimmertüren hängten und gewaltige Stoffpuppen aufs Klavier setzten, als die jungen Ehepaare ihre Sonntagnachmittage damit verbrachten, das warm verpackte Kind in einem Korbwagen durch die Gegend zu schieben, als die jungen Ehemänner hohe Stehkragen und Melonen und Röhrenhosen trugen, in denen sie spindeldürr aussahen, als die jungen Ehefrauen große Hüte und lange Kleider und ausladende Pelzkragen trugen – damals also bemühte sich das junge Pärchen, in der nervösen Anfangsphase ihrer Ehe so gut miteinander auszukommen, wie das nur ging.
An manchen Abenden blieb sie lange auf und wartete auf ihn, während er bei B. F. Keiths im Hinterzimmer mit den Jungs pokerte, und wenn er nach Hause kam, weinte sie, und er versuchte ihr die Tränen zu trocknen, und dann blieb er ganze zwei Wochen der Pokerrunde fern, und die Flitterwochen gingen weiter. Jedesmal wenn er wieder zu pokern anfing, waren ihre Verbitterung und Bestürzung geringer, und mit jeder traurigen Versöhnung – voller Sanftheit, voller Nachdenklichkeit – wurde ihre Ehe ein Stückchen robuster. Dann kamen die Kinder, Martin mietete das große Haus an der Galloway Road und stieg aus dem Versicherungsgeschäft aus, um sich als Drucker selbständig zu machen, und mit der Zeit begannen der eigentliche Charakter und Gehalt ihrer Ehe feste Formen anzunehmen.
Marguerite war eine hingebungsvolle Mutter, deren eheliche Liebe zu ihrem Mann allmählich zurückgegangen war, als ihre Familie wuchs und als sie immer mehr Zeit für die Kinder aufwandte, doch in ihrem Verhältnis zu ihm gab es eine einfache und würdevolle Zärtlichkeit, einen gelegentlichen Streit, der auf komische Art aufflammte und schnell wieder vergessen war, und ein beiden gemeinsames Gefühl staunender Liebe für die Kinder und das Zuhause, das sie enger aneinander band als alles andere. Sie waren Partner, sie waren Leute, deren Verhältnis zum Zuhause und zur Familie immer noch von einer alten angeborenen Schlichtheit und Ernsthaftigkeit geprägt war, und nach einigen Ehejahren und jenen frühen Mißverständnissen, die es bei jungen Liebenden manchmal gibt, tauchte bei keinem von ihnen jemals wieder der eigennützige Gedanke auf, wie die Ehe zum eigenen Vorteil zu nützen sei. Alles geschah nur noch im Hinblick auf die Familie, die mittlerweile festgefügt war. Auf diese Weise gelang es ihnen, auf den ureigenen Wegen zum Glück und zu einer gewichtigen Wahrheit zu finden. Sie waren ein altmodisches Paar.
Es gab keine formelle Religion in der Familie, aber die Mutter hatte diejenigen unter ihren Kindern, die am meisten daran interessiert schienen, in der Legende der katholischen Religion unterrichtet. Die Folge davon war, daß an kirchlichen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten einige der Kinder mit ihr in die Kirche gingen und die anderen nicht – das hing ganz von den Launen und Neigungen innerhalb der Familie ab. Auf diese Weise wuchsen einige der jungen Martins unter dem Einfluß einer formellen Religion auf, während die dafür weniger zugänglichen so gut wie nichts damit zu tun hatten. Es war eine außergewöhnliche Situation – vor allem nach dem Tod des kleinen Julian Martin, als es die bekümmerte und zerknirschte Mutter für ihre traurige Pflicht hielt, ihre frömmeren Kinder noch mehr mit der Kirche und ihrer Bedeutung vertraut zu machen. Es entstanden dadurch keine Spannungen in der Familie, da die Kinder in der Religion keine göttliche Ordnung, sondern ein Betätigungsfeld in der Art ihrer Schule sahen, und sie zogen nie Vergleiche.
Martin selbst war kein Kirchgänger. Mit der katholischen Religion war er durch seine Mutter in Berührung gekommen, eine fromme, aus Irland stammende Katholikin namens Clementine Kernochan. Er glaubte ebenso wie Mrs. Martin, daß es einen Gott gab und daß es Recht und Unrecht gab und daß ein tugendhaftes Leben voller Liebe und Demut ein gottgefälliges Leben war. «Und wer hat nie richtig an Jesus geglaubt?» fragte er manchmal.
«Es wird mir nie leid tun, daß ich die Kinder so aufgezogen habe», sagte sie dann. «Es war eine Erziehung, die sie nirgendwo sonst hätten bekommen können; damit haben sie etwas, was jetzt und später im Leben immer richtig und gut für sie sein wird. Und wenn ich an meine Kinder insgesamt denke, dann habe ich sie alle so erzogen, daß sie wissen, was Recht und Unrecht ist und was Gott von ihnen will.»
«Marge», sagte Martin daraufhin langsam und schüttelte den Kopf, «Marge, ich hatte nie etwas daran auszusetzen, wie du die Kinder großgezogen hast. Was dir für sie richtig schien, das war auch mir immer recht, weiß Gott.»
Und nun, da die meisten ihrer Kinder erwachsen waren und in das Alter kamen, wo sie sich anschickten, ihr eigenes Leben zu führen, hatte die ungetrübte Liebe dieser Mutter zu ihren Kindern nicht nachgelassen. Sie war