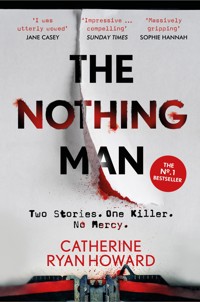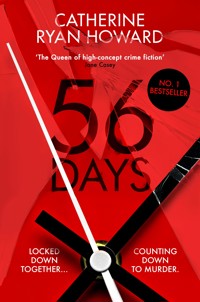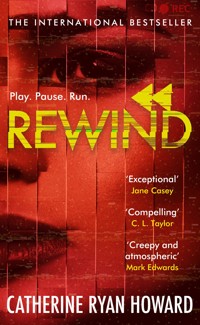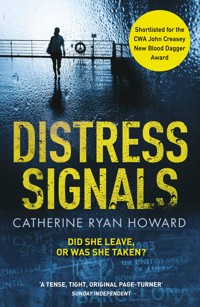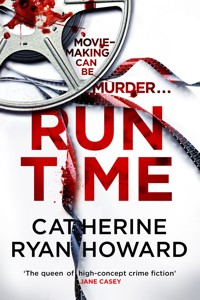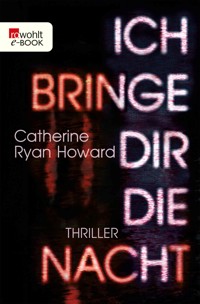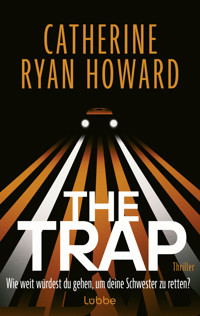
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die perfekte Falle für einen grausamen Mörder
Mitten in der Nacht steigt eine junge Frau zu einem Mann ins Auto. Es ist genau das Horrorszenario, vor dem jede Frau gewarnt wird, und sie kennt die Gefahren nur zu gut. Aber sie hat keine andere Wahl.
Während der Fahrt schwankt sie zwischen Angst und Erleichterung: Ist ihr Fahrer wirklich nur ein normaler, hilfsbereiter Mann - oder vielleicht doch ein Monster? Als er sie sicher zu Hause abliefert, ist klar, dass ihre Ängste unbegründet waren. Dafür schlägt die Enttäuschung zu.
Denn sie ist auf der Suche nach einem Monster.
In der nächsten Nacht wird sie es wieder versuchen. Doch kann sie den Mann, der ihre Schwester entführt hat, in eine Falle locken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Mitten in der Nacht steigt eine junge Frau zu einem Mann ins Auto. Es ist genau das Horrorszenario, vor dem jede Frau gewarnt wird, und sie kennt die Gefahren nur zu gut. Aber sie hat keine andere Wahl.
Während der Fahrt schwankt sie zwischen Angst und Erleichterung: Ist ihr Fahrer wirklich nur ein normaler, hilfsbereiter Mann – oder vielleicht doch ein Monster? Als er sie sicher zu Hause abliefert, ist klar, dass ihre Ängste unbegründet waren. Dafür schlägt die Enttäuschung zu.
Denn sie ist auf der Suche nach einem Monster.
In der nächsten Nacht wird sie es wieder versuchen. Doch kann sie den Mann, der ihre Schwester entführt hat, in eine Falle locken?
ÜBER DIE AUTORIN
Catherine Ryan Howard, geboren 1982, stammt aus Cork in Irland. Sie hat Seminare bei der Faber Academy, den Guardian Master Classes und Publishing Ireland absolviert und auch geleitet. Sie arbeitet als freie Social-Media-Marketingexpertin für Penguin Ireland. Nebenbei macht sie ihren Abschluss in Englisch am Trinity College in Dublin.
CATHERINERYAN HOWARD
THE
TRAP
Wie weit würdest du gehen, um deine Schwester zu retten?
Thriller
Übersetzung aus dem Englischenvon Dietmar Schmidt
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Catherine Ryan Howard
Titel der britischen Originalausgabe: »The Trap«
Originalverlag: Bantam, an imprint of Transworld Publishers
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- undData-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Ulrike Strerath-Bolz, Friedberg
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde; © Cover design by kid-ethic
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-6121-5
luebbe.de
lesejury.de
Sie ist groß ausgegangen, und in der Stadt war jede Menge los. Nachdem sie aus dem Club gestolpert ist, hat sie feststellen müssen, dass sie kein Taxi bekommen wird. Eine Stunde lang hat sie versucht, mit der einen Hand eins heranzuwinken, während sie mit der anderen in einer App herumprobierte, und sich dann resigniert auf den Weg zum vollgepackten Nachtbus gemacht. Er fährt ungefähr in die Richtung, in die sie muss, aber nicht weit genug. An der Endstation – in einem kleinen Nest auf dem Land, verschlafen bei Tag und nachts wie ausgestorben – wollte sie jemanden anrufen, sich entschuldigen, dass sie mitten in der Nacht stört, und darum bitten, dass man sie abholt. Aber kaum war sie aus dem Bus gestiegen, hat sie bemerkt, dass ihr Akku leer ist. Sie war die letzte Passagierin, und der Bus ist wieder abgefahren, bevor sie daran denken konnte, den Fahrer zu bitten, sie mit seinem Handy telefonieren zu lassen. Vier Uhr morgens war es, und es hatte zu nieseln angefangen, daher ging sie los. Denn ehrlich, was blieb ihr schon anderes übrig?
Dies ist die Geschichte, die sie sich erzählt, als sie das Dorf verlässt und in die Dunkelheit vordringt, die von der Straßenbeleuchtung auf Abstand gehalten worden ist. Überall um sie herum scheint die Nacht missbilligend zu brummen.
Dummes Ding. Genau davor hat deine Mutter dich immer gewarnt. Hast du denn auch nur einen Funken Verantwortungsgefühl?
Ein Exfreund hat ihr einmal erzählt, der nächtliche Fußweg nach Hause sei für ihn das Beste am Ausgehen. Er allein mit seinen Gedanken auf menschenleeren Straßen, während die Brust noch warm ist von dem Spaß, den er am Abend hatte. Er musste nicht angespannt auf ein Taxi warten. Er brauchte nicht mit den Schlüsseln zwischen den Fingern zur Haustür zu gehen, bereit, damit zuzustechen, jemanden kampfunfähig zu machen. Er hat vor dem Schlafengehen nie ein Daumen-hoch-Emoji an jemanden gesimst, damit dieser jemand auch endlich beruhigt einschlafen konnte.
Den Teil des Abends, der ihm am liebsten war, musste sie überleben.
Als sie ihm das erwiderte, hat er sie an sich gezogen, sie geküsst und geflüstert: »Es tut mir so leid, dass du glaubst, du würdest in solch einer Welt leben«, und das in einem so herablassenden Tonfall, dass sie kurz in Versuchung gewesen war, seinen Sack mit ihrem Schlüsselbund bekanntzumachen.
Das Nieseln wird zu strömendem Regen. Als der Fußweg endet, stolpert sie mit ihren hohen Absätzen über den bröckeligen Fahrbahnrand der Straße. Ihre Fußballen brennen, und das Riemchen am rechten Schuh scheuert ihr die Haut wund.
Eine Weile ermutigt ein wässriges Mondlicht Umrisse, Gestalt anzunehmen und sich aus der Schwärze zu schälen – ein Telefonmast, eine Hecke, ein Schlagloch –, aber dann biegt die Straße in einen Hohlweg aus überhängenden Bäumen ab, und die Finsternis verdichtet sich. Sie kann die eigenen Beine unter dem Saum ihres Kleides nicht mehr sehen. Ihr Körper verschwindet wortwörtlich in der Nacht.
Und dann, durch das Brüllen des Regens …
Ein mechanisches Dröhnen.
Das lauter wird.
Ein Motor, denkt sie. Als sie nach hinten sieht, wird sie vom schwenkenden Fernlicht geblendet. Zwei Leuchtkugeln schweben noch in ihrem Blickfeld, als das Auto ruckartig neben ihr hält. Silbergrau ist es, irgendeine Limousine. Sie bleibt ebenfalls stehen. Das Beifahrerfenster fährt mit einer sanften Bewegung hinunter, und eine Stimme fragt: »Ist mit Ihnen alles in Ordnung?«
Sie senkt den Kopf, damit sie in den Wagen schauen kann. Im Fahrersitz sieht sie die Beine des Fahrers, beleuchtet vom bläulichen Schimmer des Armaturenbretts. Er trägt Jeans.
»Äh … ja, ja.« Sie bückt sich tiefer, damit ihr Gesicht auf gleiche Höhe mit dem offenen Fenster kommt. Der Fahrer schaltet die Innenraumbeleuchtung ein. Ein Mann Mitte dreißig, kurze rote Haare; eine Hautreizung färbt sein Gesicht rosa. Das T-Shirt trägt er auf links; sie kann die Nähte sehen und das Schildchen am Nacken. Im Fußraum des Beifahrersitzes liegt allerlei Müll: Einwickelpapier von Hamburgern, eine Boulevardzeitung, ein einzelner schlammiger Wanderschuh. Auf der Rückbank ist ein Babysitz zu sehen, in dem ein kleines grünes Bündel festgeschnallt ist. »Ich bin mit dem Nachtbus ins Dorf gekommen und wollte jemanden anrufen, der mich abholt …«
»Tut mir leid.« Der Mann klopft sich mit dem Zeigefinger an eine Stelle gleich hinter dem linken Ohr, eine Bewegung, die sie an ihre verstorbene Mutter erinnert, wenn sie ein Parfüm auftupfe, das ihr zu teuer war, um sich damit einzusprühen. »Ich höre nicht besonders gut.«
»Ich bin mit dem Nachtbus gekommen«, sagt sie lauter.
Er beugt sich stirnrunzelnd zu ihr. »Wie bitte?«
Das Beifahrerfenster ist nicht vollständig heruntergefahren. Die Kante der Fensterscheibe drückt sich in ihre Handfläche, als sie sich darauf stützt und Kopf und Schultern in die Öffnung steckt, so weit, dass das Rauschen des Regens zu einem Hintergrundgeräusch wird und ihr der widerlich-künstliche Fichtenduft des Lufterfrischers in die Nase steigt. Ihr fällt auf, dass sich der Schwerpunkt ihres Körpers dabei ins Wageninnere verschiebt.
Wenn er jetzt plötzlich losfahren würde, würde er sie mitreißen.
»Ich bin im Dorf aus dem Nachtbus gestiegen«, sagt sie. »Ich wollte zu Hause anrufen, damit mich jemand abholt, aber mein Akku ist leer.«
Sie holt das Handy aus der Tasche, ein toter schwarzer Spiegel, und zeigt es ihm.
»So ein Mist«, sagt er. »Und ich hab meins nicht dabei. Aber vielleicht …« Er fängt an herumzusuchen, tastet in der Seitentasche der Fahrertür, den Getränkehaltern zwischen den Vordersitzen und im Handschuhfach. Im Auto scheint eine Menge Zeug zu sein, aber nicht das, wonach er sucht. »Ich dachte, ich hätte vielleicht ein Ladekabel hier, aber von wegen. Tut mir leid.«
»Schon okay«, sagt sie automatisch.
»Hören Sie, ich fahre nur zur Tankstelle, aber die Circle K hat rund um die Uhr geöffnet, und hinten drin gibt es so einen kleinen Sitzbereich. Vielleicht kann Ihnen dort jemand ein Ladegerät leihen oder lässt Sie sogar sein Handy benutzen. Das wäre doch auf jeden Fall ein besserer Warteplatz, oder?«
»Ja.« Sie zieht sich aus dem Fenster zurück und blickt die Straße entlang in die schwarze Leere. »Ist das weit?«
»Fünf Minuten Fahrt.« Er streckt schon die Hand vor und öffnet die Beifahrertür, und sie tritt zurück, damit sie aufschwingen kann. »Steigen Sie ein.«
Irgendwie ist der letzte Augenblick, in dem sie hätte entscheiden können, es nicht zu tun, bereits vorüber. Denn wenn sie jetzt zurücktritt, die Beifahrertür wieder schließt und sagt: Danke, aber ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß, könnte sie auch gleich sagen: Danke, sehr freundlich von Ihnen, aber ich glaube, Sie sind ein Monster, also lassen Sie mich bloß in Ruhe.
Und falls er ein Monster ist, dann bräuchte er nicht mehr so zu tun, als wäre er keins, und sie könnte ihm nicht davonlaufen, nicht hier draußen, nicht in diesen Schuhen – und wohin sollte sie auch fliehen?
Und falls er kein Monster ist, nun, dann …
Dann ist es völlig sicher, zu ihm ins Auto zu steigen.
Sie steigt ins Auto.
Sie zieht die Beifahrertür zu. Tschunk. Die Leuchte unter dem Dach erlischt, und das einzige Licht kommt jetzt vom gespenstischen Schimmer des Armaturenbretts und dem Streulicht der Scheinwerfer. Ihr Fenster fährt hoch. Der Motor röhrt, und als der Mann losfährt, hört sie noch ein Geräusch.
Tschak.
Die Zentralverriegelung.
»Also«, fragt er, »war es denn wenigstens ein toller Abend?«
Der Sicherheitsgurtsensor meldet sich, und sie tastet im Dunkeln erst nach dem Gurt, dann nach dem Schloss. Beides fühlt sich leicht klebrig an.
»War ganz okay«, sagt sie. »Wenn ich gewusst hätte, wie schwer es ist, wieder wegzukommen, wäre ich vielleicht einfach zu Hause geblieben. Und Sie?«
Warum fahren Sie um vier Uhr morgens durch den Regen?
»Ich habe fest geschlafen«, sagt er, »als ich einen Ellbogen in die Rippen bekam. Ich muss Rennies holen. Meine Frau erwartet unser erstes Kind, und sie kann gerade nichts essen, ohne Sodbrennen zu bekommen. Haben Sie Kinder?«
»Gott, nein!«, sagt sie, bevor sie daran denkt, sich ein bisschen weniger entsetzt zu geben über das, was dieser Mann und seine Frau getan haben.
Er lacht. »Dafür bleibt ja noch genügend Zeit.«
Vor ihnen schießt die Fahrbahn unter den Rädern dahin. Die Scheibenwischer zucken wütend über die Windschutzscheibe, hin und her, hin und her. Nirgendwo ist Lichtschein zu sehen.
Keine anderen Autos.
Er fragt sie, wo sie wohnt, und sie nennt den Namen der Gemeinde; genauere Angaben vermeidet sie bewusst.
Ein Seitenblick. »Wohnen Sie da allein, oder …«
Sie möchte Nein sagen und es dabei belassen, aber mit dieser Antwort würde sie riskieren, unfreundlich rüberzukommen, misstrauisch, voll Argwohn. Andererseits, wenn sie sagt, dass sie mit ihrem Freund zusammenwohnt, teilt sie ihm mit, dass sie einen Freund hat, und es könnte so klingen, als versuchte sie zu verhindern, dass er auf dumme Gedanken kommt. Womit sie ihm unterstellen würde, dass er dumme Gedanken hätte. Und wenn sie ihn beleidigt, verärgert sie ihn vielleicht, diesen Mann, den sie nicht kennt und der das Auto steuert, in dem sie eingeschlossen ist.
Aber Ja zu sagen würde ihm verraten, dass niemand auf die junge Frau mit dem toten Handy wartet, die er gerade von der Landstraße aufgelesen hat. Dass niemand sich fragt, wo sie ist, und dass es, wenn sie heute Nacht nicht nach Hause kommt, Stunden oder sogar Tage dauern könnte, bevor jemand bemerkt …
»Ich wohne mit meiner Schwester zusammen«, lügt sie.
»Und Ihre Schwester kommt Sie abholen?«
»Wenn ich eine Möglichkeit finde, sie anzurufen, ja.«
»Diese verdammten Handys sind ätzend. Immer, wenn man sie wirklich braucht, muss man sie aufladen.«
Und trotzdem ist er ohne Handy unterwegs.
Wärst du ohne Handy unterwegs, fragt sie sich, wenn du zu Hause eine schwangere Frau hast?
Vielleicht, räumt sie ein, wenn du nur kurz zur Tankstelle fährst.
»Sie kommen mir irgendwie bekannt vor«, sagt er und dreht den Kopf, um sie genauer zu betrachten, einen Sekundenbruchteil länger, als es ihr auf dieser Straße unter diesen Bedingungen recht ist. »Sind wir uns schon einmal begegnet?«
»Nicht, dass ich wüsste.« Ganz sicher hat sie diesen Mann noch nie zuvor gesehen.
»Wo arbeiten Sie?«
Sie antwortet, dass sie für eine ausländische Bank tätig sei, in einem Bürohaus in Flughafennähe, und er brummt leise vor sich hin.
Zwanzig, dreißig Sekunden verstreichen in Schweigen. Sie bricht es, indem sie fragt: »Ist es noch weit?« Denn alles, was sie in der Nacht vor sich sieht, ist mehr Nacht.
Noch immer keine Autos. Noch immer keine Lichter.
Kein Anzeichen für irgendetwas außer mehr Straße, mehr Dunkelheit und mehr Regen.
»Nein.« Er reißt mit größerer Kraft als zuvor am Schaltknüppel, und sie spürt, wie seine warmen Finger ihr dabei über die kalte, feuchte Haut ihres nackten Knies streichen. Die Berührung ist genau auf der Grenze zwischen einem beiläufigen Versehen und einem absichtlichen Übergriff. Er nimmt die Augen nicht von der Straße. »Wir sind fast da.«
»Gut«, sagt sie geistesabwesend.
Sie weiß nicht, was sie tun soll. Falls es keine Absicht gewesen ist, würde er sich dann nicht entschuldigen? Oder entschuldigt er sich nicht, weil es nichts gibt, wofür er sich entschuldigen müsste, denn er hat nicht einmal bemerkt, was er getan hat, und das deswegen, weil er eben gar nichts getan hat?
Der Regen ist stärker geworden. Ununterbrochen prasselt er aufs Dach.
»Schreckliche Nacht«, sagt er. »Sie sind nicht gerade passend gekleidet, was?«
Jetzt wendet er sich ihr zu und mustert sie offen, daran kann absolut kein Zweifel bestehen. Sein Blick wandert über ihren Schoß, streicht über die dünne Baumwolle ihres Kleides, das, nass wie es ist, ihre Oberschenkel nachzeichnet.
Es fühlt sich an, als glitte ihr ein leises Raubtier kalt und ölig über die Haut.
Sie legt die Hände über die Knie, um sie zu bedecken, und wartet darauf, dass er die Augen wieder auf die Straße richtet. Dabei steigt ihr ein kaltes Grauen aus der Magengrube hoch.
Allerdings ist sie wirklich nicht passend für dieses Wetter gekleidet. Das ist eine Tatsache.
Herr im Himmel, heutzutage darf man wirklich gar nichts mehr sagen, was?
»Ja, stimmt.« Mit einem flüchtigen Lächeln hofft sie, ihn weder zu ermutigen noch zurückzustoßen. »Ich dachte, ich könnte einfach in ein Taxi springen.«
»Die sollten wirklich mal etwas gegen die Taxiknappheit unternehmen.«
»Ja, die …«
»Besonders jetzt, wo diese Frauen vermisst werden.« Er sieht sie an. »Wie viele sind es jetzt schon? Drei? Oder vier?«
Die Temperatur ihres kalten Grauens ist um ein paar Grad zu eisiger, Übelkeit erregender Angst gesunken.
Aber was, wenn am Lenkrad eine Frau sitzen würde? Sie würde an nichts von alledem denken. Sie würden sich nur unterhalten. Sie würden über das reden, wovon jeder spricht, sie würden diskutieren, was in den Nachrichten kam.
Er zeigt nun auf den Müllhaufen vor ihren Füßen.
»Haben Sie den neuesten Artikel gelesen?«, fragt er. »Steht gleich auf der ersten Seite.«
Es scheint ihr das Sicherste zu sein, nach der zusammengefalteten Zeitung zu greifen. Als sie sie aufhebt, entfaltet sie sich gehorsam und offenbart die Schlagzeile auf dem Titelblatt, die sie in Großbuchstaben anschreit. VERMISSTE FRAUEN: SUCHE IN WICKLOW MOUNTAINS GEHT WEITER. Darunter sind zwei Fotos: Ein großes zeigt Leute in weißen Overalls, die in einer Wildnislandschaft herumstochern, das kleinere eine brünette junge Frau, die lächelt und einen Hund in den Armen hält.
Sie ist jedem vertraut, der die Nachrichten verfolgt. Nicht die Person an sich, nur genau dieses Bild von ihr.
»Das ist gar nicht so weit weg von hier, wissen Sie.« Er weist mit dem Kinn zur Straße vor ihnen. »Wenn Sie eine Viertelstunde in die Hügel dort fahren, könnten Sie wahrscheinlich die Flutlichter sehen.« Ein kurzes Schweigen. »Das machen sie aber auch ständig, oder? Suchen durchführen. Alle sind ganz aufgeregt, aber sie finden nie irgendwas. Die Sache ist die: Die Leute kapieren einfach nicht, wie weit das Land hier oben ist, wissen Sie? Mein alter Herr sprach ständig davon, damals in den Neunzigern, als zum ersten Mal Frauen verschwunden sind. Da gab es immer irgendeinen Reporter oder Verwandten oder was auch immer, der sagte: ›Aber sie ist oben in den Wicklow Mountains, wir müssen sie nur suchen.‹ Sie dachten immer, wenn man nur überall sucht, würde man sie auch finden. Man kann aber nicht überall suchen, wissen Sie. Nicht in dieser Gegend. Dafür ist das Land zu weit.« Er schweigt wieder, einen Hauch länger. »Also sind sie wahrscheinlich irgendwo da draußen, aber niemand wird sie jemals finden.«
In ihrer Brust tobt ein kneifender Schmerz. Sie kämpft darum, einen Atemzug in die Lunge zu bekommen, damit er nachlässt, aber wie es scheint, kommt der Sauerstoff nicht weiter als bis zu ihrer Kehle.
»Wissen Sie«, sagt er, indem er sich ihr wieder zuwendet, »Sie sehen aus wie eine von diesen Frauen.«
Sie lässt die Zeitung fallen.
Sie denkt an das Tschunk, mit dem die Beifahrertür ins Schloss gefallen ist. Vor ein paar Minuten stand diese Tür noch für ihre Rettung. Ein Tor ins Warme und Trockene, zu Licht und einer Gelegenheit zum Mitfahren, zu anderen Menschen, die bereit sind, sie vor dem schwarzen Abgrund der endlosen Nacht zu retten.
Aber was, wenn alle Gefahren, die in der Dunkelheit lauern, mit ihr ins Auto gestiegen sind?
Was, wenn sie jetzt in der Falle sitzt, zusammen mit ihnen?
Mit ihm?
»Ist es noch weit?«, fragt sie wieder.
Er gibt keine Antwort.
Sie hat einen Fehler begangen, das erkennt sie jetzt genau. Sie ist töricht gewesen, voller schlechter Ideen. Sie ist für so etwas nicht geschaffen.
Den Blick starr nach vorn gerichtet, schiebt sie ihre linke Hand unter ihren linken Oberschenkel und erkundet mit den Fingerspitzen verstohlen die Tür. Nirgends ertastet sie einen Knopf, der das Schloss öffnen würde. Und selbst wenn sie die Tür aufbekäme, was dann? Sie ist angeschnallt, und das Lösen des Sicherheitsgurts würde einen Alarm auslösen. Dann wüsste er Bescheid. Sie trägt eine kleine umgehängte Handtasche. Sie könnte sie abnehmen und ihm den Riemen um den Hals schlingen, aber es ist eine billige Tasche, Wegwerfmode. Der Riemen könnte reißen, und selbst wenn er hält, was dann? Um ihn zu erwürgen, müsste sie hinter ihm sein, aber wenn sie erst loslegt, hat sie keine Zeit mehr, um auf die Rückbank des Wagens zu klettern. Und er fährt. Wenn sie ihm etwas antut, hat das Auto einen Unfall. Sie sieht sein Gesicht über sich aufblitzen, nur Zentimeter entfernt. Seine Haut ist noch röter, seine Miene angestrengt. In ihrer Fantasie drückt er eine raue Hand an ihren Hals, die andere zerrt an ihrer Unterwäsche, während er sich anschickt, den Brand seines Körpers in ihre verletzlichen Tiefen zu zwingen. Sie denkt, dass es vielleicht besser wäre, bei einem Autounfall zu sterben. Sie könnte unvermittelt hinübergreifen und das Lenkrad verreißen, damit sie von der Straße abkommen, oder die Handbremse ziehen, wodurch die Räder vielleicht blockieren und der Wagen ins Schleudern gerät.
Aber wenn, wenn das nicht nötig ist?
Was, wenn sie überreagiert? Was hat er denn wirklich getan?
Was, wenn sie einen Unfall verursacht und sich herausstellt, dass er nur ein gewöhnlicher Mann ist und kein Monster?
Aber was, wenn er gerade will, dass sie so etwas denkt, damit sie nichts unternimmt, bis es zu spät ist, um noch irgendetwas zu tun?
»Meine Schwester wird ausrasten«, bringt sie hervor. Die Worte fühlen sich trocken und staubig an auf ihrer Zunge, klingen sogar in ihren Ohren schlaff und unwahr.
»So spät in der Nacht?« Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie er mit den Schultern zuckt. »Ach was. Sie schläft bestimmt tief und fest, tot für die Welt.«
Tot für die Welt.
Der Wagen ist eine dekomprimierte Luftschleuse, deren Schott durch diese Worte ins All gesprengt wird. Luft zum Atmen gibt es darin nicht mehr. Das Kneifen in ihrer Brust lodert auf, brennt, und jetzt wird jeder Versuch zu atmen von einem sengenden Schmerz begleitet. Ihre Brust will sich nicht bewegen, sich nicht heben, und es fühlt sich an, als würde sie immer kleiner, ballte sich zusammen wie eine Faust. Ihre Kehle schließt sich, und sie …
Lichter.
Vor ihnen. Viele Lichter.
So nah, dass sie glaubt, sie müssten ein Trugbild sein.
Die Scheinwerfer haben ein Loch in die Nacht gestanzt, groß genug, damit eine ganze Tankstelle hindurchpasst. Es ist, wie er versprochen hat, die Circle K. Sie kann einen hell beleuchteten Außenbereich ausmachen. Ein Vordach in Farben, die sie erkennt, ein vertrautes Logo, das von einem Spot angestrahlt wird. Ein gleißendes Quadrat aus weißen Leuchtstofflampen – der Shop – mit Stapeln aus Torfbrikettsäcken vor der Schaufensterscheibe und handgeschriebenen Schildern mit Sonderangeboten. Sie sieht sogar andere Menschen: Ein Mann lehnt an einem Jeep, der an einer Tanksäule steht, eine Frau kommt durch die Automatiktür des Shops und lässt ihre Autoschlüssel um den Finger wirbeln.
Als er einbiegt und vor dem Shop parkt, ist es so hell wie am Tag. Nachdem sie ihren Sicherheitsgurt gelöst hat, findet sie mühelos den Handgriff, der ihre Tür öffnet, aber er funktioniert nicht.
Die Zentralverriegelung ist noch aktiv.
»Oh«, sagt er. »Moment …«
Tschak.
Sie zieht wieder am Griff, und diesmal öffnet sich die Tür ohne Widerstand.
Eine Welle der Erleichterung vertreibt das ganze Adrenalin aus ihren Adern, sodass sie kalt und klamm zurückbleibt. In ihrem Magen schwappt etwas, und ihr steigt ein saurer, gallebitterer Geschmack in den Mund, den sie nicht herunterschlucken kann, wie es scheint. Sie begreift, dass sie sich übergeben muss. Sie stößt die Tür auf und steigt aus dem Wagen, steht unsicher auf weichen Knien.
Ein Schild an der Ecke des Shops verkündet TOILETTEN, und ein Pfeil leitet Personen, die sie benutzen wollen, um die Seite nach hinten.
»Mir ist so …« Sie zeigt zur Erklärung auf das Schild. »Danke … Ich danke Ihnen fürs Mitnehmen.«
Falls er etwas antwortet, hört sie es nicht.
Den Waschraum erhellt eine einzige flackernde Leuchtstofflampe, in deren Gehäuse eine große Motte gefangen sitzt und mit panischen Flügelschlägen gegen das gerippte Plastik trommelt. Es gibt zwei Kabinen, zwei Waschbecken und kein Fenster. Die Luft ist warm und abgestanden und riecht schlecht. Auf dem Fußboden haben sich Wasserpfützen gebildet, und die Waschtische sind mit Klumpen aus nassem Toilettenpapier übersät.
Sie betritt die erste Kabine so eilig, dass die Tür gegen die Trennwand knallt, und hält den Kopf über die Kloschüssel.
Ihr Inneres verkrampft sich, aber sie würgt nur trocken; nichts als Speichel kommt hoch. Tränen mischen sich mit Make-up, das ihr in den Augen brennt und sie noch stärker tränen lässt. Säure brennt sich in ihrer Speiseröhre hoch zur Brust.
Dann folgt eine erdrückende Masse an Enttäuschung.
Weil er einfach nur ein Mann gewesen ist, kein Monster.
Nicht der Mann, den sie so verzweifelt sucht.
Nächte wie diese hat es viele gegeben. Sie schaltet ihr Handy aus und geht ziellos Landstraßen entlang, für einen Abend in der Stadt gekleidet, tut so, als wäre sie ein Mädchen, das es nicht geschafft hat, nach Hause zu kommen, und hofft, dass ein Monster anhält, um sie mitzunehmen.
Das Monster.
Das Monster, das ihre Schwester mitgenommen hat.
Und die anderen Frauen.
Sie richtet sich auf und wendet sich dem Papierhandtuchspender an der Wand zu. Sie zieht und zerrt und reißt, bis sämtliche Papiertücher draußen sind, bis sie ein Bündel in der Hand hält, gerade groß genug, um den Laut zu dämpfen, den sie ausstößt, als sie ihr Gesicht hineinpresst und schreit.
Der Fehlschlag dieser Nacht kommt ihr anders vor als die vorherigen, denn diesmal war sie sich für einen Augenblick sicher, dass ihre Suche ein Ende hätte.
Ein Samariter, der zufällig zu einer unchristlichen Stunde auf der Straße ist, von seiner schwangeren Frau zum Einkaufen geschickt. Ohne Handy, wie passend, und mit einem beruhigenden Babysitz auf der Rückbank. Er hat von den verschwundenen Frauen gesprochen.
Und es gibt noch einen anderen, bedeutenderen Grund, enttäuscht zu sein. Als sie das Gefühl hatte, ihn gefunden zu haben, hat sie auch Angst empfunden. Sie hat Panik bekommen. Sie hat begonnen, ihre Flucht zu planen.
Wenn sie ihn also eines Nachts wirklich finden sollte, nun …
Jetzt kann sie nicht einmal darauf vertrauen, dass sie ihren Plan durchführt.
Er hatte sogar gesagt, ihre Schwester sei tot für die Welt – was der Wahrheit entspricht. Vermisst, vermutlich tot, sagt jeder, dessen Job darin besteht, sie zu finden. Die Gardaí und damit die Einzigen, die über die nötigen Mittel verfügen, sagen es. Auch die Medien, die ihre Lieblinge unter den Vermissten haben und die immer eine andere bevorzugt haben. Jeder in der Öffentlichkeit, der ganz zu Anfang vielleicht mit ihr und Chris gehofft und gebetet, aber mittlerweile aufgegeben hat und wieder sein normales Leben führt.
Und davon hat es in Anbetracht der Umstände von vornherein nicht besonders viele gegeben.
An den meisten Tagen lässt sich unmöglich sagen, was schlimmer ist: die Qual des geduldigen Wartens auf irgendeine Art von Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen oder die Reue, die einfach nie nachlässt.
Wo ist sie? Was ist ihr zugestoßen? Werden wir es jemals erfahren?
Ist es überhaupt denkbar, dass ich daran nicht schuld bin?
Mit Sicherheit weiß sie nur die Antwort auf die letzte Frage.
Manchmal sieht sie ungewollt etwas im Fernsehen, wo Leute den Augenblick beschreiben, in dem sie erfahren haben, dass ein geliebter Mensch ein unerwartetes, gewalttätiges Ende gefunden hat. Das Klopfen an der Tür. Das Telefon, das mitten in der Nacht klingelt. Ein unangekündigter Besuch, der zu einer schrecklichen Entdeckung geführt hat. Eine Szene, die ihnen für den Rest ihres Lebens vor Augen stehen wird.
Und dann stellt sie fest, dass sie Neid empfindet.
Sie muss herausfinden, was ihrer Schwester zugestoßen ist, koste es, was es wolle. Und bis sie die Suche beendet hat, erscheint es verrückt, mit dem Trauern anzufangen.
Es ist viel zu früh, um schon aufzugeben.
Oder?
In dem gesprungenen Spiegel über dem einen Waschbecken sieht sie ihr zerteiltes Abbild. Sie betrachtet sich, wie sie ihr Handy einschaltet und es benutzt, um ein Taxi zu rufen. Es ist kein Problem, eines zu bestellen, auch wenn es eine Weile dauern wird, bis es den weiten Weg hierher zurückgelegt hat.
Der Spiegel, der über dem anderen Waschbecken hängen sollte, fehlt; das Rechteck aus hellerer Farbe ist die einzige gespenstische Spur von ihm.
WIRBELSCHLEPPEN
Als Lucy die Augen öffnete, genoss sie einen wunderbaren Herzschlag, in dem sie nicht erinnerte, in dem sie nur war, bevor im nächsten Moment die Fragen auf sie einstürmten.
Was ist Nicki zugestoßen? Wo ist meine Schwester? Wo wacht sie heute Morgen auf, oder ist sie gar nicht mehr aufgewacht, seit ich sie zuletzt gesehen habe?
Seit vierhundertvierzig Tagen erhielt sie keine Antworten auf diese Fragen.
Aber sie sah blauen Himmel. Und sie spürte drückende, trockene Hitze. Als sie sich bewegte, schoss ihr ein Schmerz durch die Halsseite.
»Geht es Ihnen so weit gut?«, fragte eine gedämpfte Stimme.
Ein Mann, den sie nicht kannte, beugte sich stirnrunzelnd über sie. Als sie seine Frage nicht beantwortete, klopfte er mit den Fingerknöcheln an die Glasscheibe, die sie trennte.
Zum zweiten Mal, wie sie nun begriff.
Mit dem ersten Klopfen hatte er sie geweckt.
Die letzten verbleibenden Tentakel des schläfrigen Nebels verzogen sich, und Lucy konnte sich endlich zusammenreimen, wo sie war: Sie war in ihrem Auto eingeschlafen. Das sie vor dem hiesigen SuperValu geparkt hatte. Der Mann, der draußen stand, trug eine gelbe Sicherheitsweste über dem T-Shirt, auf der WACHDIENST stand, und nach der blendend hellen Sonne zu urteilen, der Anzahl der Leute, die ihre Einkaufswagen durch ihr Blickfeld schoben, und dem Ausmaß, in dem sie sich beschissen fühlte, hatte sie sich weit länger hier aufgehalten als geplant.
»Ja«, sagte sie. Sie fuhr das Seitenfenster hinunter und wiederholte: »Ja. Alles in Ordnung. Nur, Sie wissen schon … eine lange Fahrt.« Sie lächelte; er nicht. »Ich dachte, ich würde am Lenkrad einschlafen, deshalb habe ich für ein Power Nap angehalten.«
»Sie waren schon hier, als meine Schicht anfing«, erwiderte er tonlos. »Das ist zwei Stunden her.«
»Zwei …« Die Uhr auf dem Armaturenbrett ging nur an, wenn der Motor lief, und sie wusste nicht, wo sie ihr Handy gelassen hatte. »Wie spät ist es denn?«
»Kurz nach neun.«
Das bedeutete, dass sie mindestens drei Stunden hier gewesen war. Sie war nur fünf Minuten von zu Hause entfernt, aber sie war so spät – oder so früh – unterwegs gewesen, dass sie nicht hatte riskieren wollen, direkt dorthin zu fahren. Wenn Chris gehört hätte, dass sie um fünf Uhr morgens eintraf, hätte er genau gewusst, wo sie gewesen war und was sie getan hatte.
Und sie hatte ihm versprochen, damit aufzuhören.
Hatte ihm versichert, dass sie bereits aufgehört hätte.
»Mist«, sagte sie. »Wirklich?«
Der Parkwächter zeigte eine steinerne Miene, und sein Mangel an Anteilnahme verriet, dass er sie nicht erkannte – was ihr letztlich nur recht war. Lucy zog jederzeit die Anonymität dem Mitleid vor.
»Gehen Sie hinein und holen Sie sich einen Kaffee.« Mit einer Kinnbewegung zeigte er auf das Geschäft. »Und dann fahren Sie weiter.«
»Mach ich. Danke. Tut mir leid.«
Sie hatte absolut keine Absicht, hineinzugehen. Seit Monaten hatte sie die Schwelle des SuperValu nicht mehr überschritten – oder ein anderes Geschäft im Ort betreten. Sie bemühte sich nach Kräften, ihren Nachbarn aus dem Weg zu gehen.
Sie bemühte sich nach Kräften, Menschen ganz allgemein aus dem Weg zu gehen.
Die Welt, hatte sie entdeckt, war einfach nicht für Menschen mit offenen Wunden geschaffen. Vielmehr schien sie mit den Privilegierten und ihren banalen Problemen vollgestopft zu sein, ihren beschissenen Standpunkten, ihrer offenen Undankbarkeit. Sie drückten auf die Hupe, weil es schon vor einer ganzen Sekunde grün geworden war und der Fahrer vor ihnen es noch nicht bemerkt hatte. Sie beschwerten sich beim Filialleiter, weil das Essen, das sie in einem Imbiss bestellt hatten, nach einer halben Stunde Fahrt nicht brühheiß geliefert worden war. In den sozialen Medien bedrängten sie andere unermüdlich und unaufgefordert mit ihren unmaßgeblichen Ansichten und fassten es als Beleidigung auf, wenn ihnen jemand widersprach, der vom Thema mehr verstand als sie.
Seit Nicki verschwunden war, kam es Lucy vor, als würde sie immerfort versuchen, einen stillen Schrei zu unterdrücken und zu verhindern, dass er zu einem bösartigen Geschwür in ihrer Kehle wurde.
Kapiert ihr denn nicht, was für ein verdammtes Glück ihr habt!?
Was hätte sie für einen einzigen Augenblick des Friedens gegeben, in dem Nicki nicht fort war oder in dem sie auch nur wüsste, wohin sie gegangen war (und wie und warum). Vor sich sah sie diese vielen Menschen, die nichts anderes hatten als solche Augenblicke und sie verschwendeten. Lucy hätte sie am liebsten gepackt und geschüttelt und ihnen begreiflich gemacht, wie gut sie es hatten.
Und dann wollte sie in der Zeit zurückreisen zu der Lucy, die existiert hatte, bevor Nicki verschwand, und mit ihrem vergangenen Ich das Gleiche tun.
Der Parkwächter wandte sich zum Gehen.
»Tut mir leid«, sagte Lucy noch einmal zu seinem Rücken.
Sie drehte den Rückspiegel zu sich, bis er eine Frau mit verquollenen Augen und aufgedunsenem Gesicht zeigte, deren verschmierte Wimperntusche die dunklen Ringe unter ihren Augen noch betonte. Ihre Haare waren kraus, eine Wange gerötet, weil sie damit im Schlaf an der Seitenscheibe gelehnt hatte.
So konnte sie nicht nach Hause kommen. Genauso gut konnte sie zur Haustür gehen und ein Neonschild tragen, das flackernd LÜGNERIN verkündete.
In dem Geschäft gab es eine Kundentoilette. Und eine Kosmetikabteilung. Sie konnte sich Abschminktücher kaufen, eine Zahnbürste und Zahncreme, dazu ein Haargummi, um sich die Haare zurückzubinden. Sie konnte sich das Gesicht waschen und es so aussehen lassen, als hätte sie die Nacht durchgeschlafen. Oder überhaupt ein Auge zugemacht. Und auf dem Weg hinaus konnte sie sich einen Eimer Kaffee mitnehmen, den sie trinken würde, bis sich das Gefühl einstellte, als wäre es wirklich so gewesen.
Aber hineinzugehen war das Letzte, was sie wollte.
Dass man selbst dann, wenn im Leben ein menschengroßes Loch klaffte, ab und zu in einen Supermarkt gehen musste, war für Lucy eine bestürzende Entdeckung gewesen. Man musste essen, auch wenn man keinen Appetit hatte. Und ganz egal, was sonst im Leben vorging, ohne Toilettenpapier und Müllbeutel kam man nicht zurecht.
Lucy war sich nie darüber klar gewesen, wie viele alltägliche Dinge man benötigte, um den vollständigen und unumkehrbaren Zusammenbruch zivilisierten Lebens hinauszuschieben.
Sie war jedoch immer darauf bedacht, zu einem Supermarkt zu gehen, der weit weg war, und immer spät abends, damit sie nicht so oft von Blicken getroffen wurde und seltener das nicht sonderlich leise Geflüster hinter ihrem Rücken hörte, diese Neugier, die sich als Anteilnahme verkleidet. Der SuperValu war jedoch klein und mehr ein zentraler Treffpunkt der Umgegend als ein Lebensmittelgeschäft. Und sie war um neun Uhr morgens hier, in der ersten Woche nach den Ferien. Das hieß, sie müsste den Spießrutenlauf durch die schwatzenden, verschwitzten Muttis antreten, die ihre Kinder abgesetzt hatten und sich jetzt einen Magermilch-Latte gönnten.
Schlimmer als das wäre nur ein neuer Streit mit Chris über ihre nächtlichen Exkursionen. Dafür fehlte ihr die Energie, und außerdem wäre er sinnlos gewesen. Denn nach dem Fehlschlag der vergangenen Nacht hatte sie die Entscheidung getroffen, ihre Versuche einzustellen. Sie würde akzeptieren, dass Nicki nicht mehr nach Hause käme. Sie würde mit ihrem Leben weitermachen.
Ab heute.
Ab sofort.
Und diesmal war es ihr damit ernst.
Lucy nahm ihr Portemonnaie und stieg aus dem Wagen, steif von drei Stunden Schlaf in aufrechter Haltung hinter dem Lenkrad.
Die frühmorgendliche Luft fühlte sich nach den Regenfällen der vergangenen Nacht kühl und frisch an, aber der Boden war schon wieder trocken, und die Wärme der Sonne versprach einen weiteren Tag mit Extremhitze. Der Sommer war lang und unerwartet heiß gewesen, ein Sommer von der Art, an den weder gewöhnt noch dafür geschaffen zu sein Irland sich rühmte. Nirgendwo gab es noch Ventilatoren zu kaufen; die Außengastronomie, die hastig eingerichtet worden war, um die Lockdown-Bestimmungen zu umgehen, konnte zeigen, was sie draufhatte, und die Nachrichten waren voll mit Ginsterbränden und Ertrinkungsfällen.
Lucy hatte geglaubt, die Kundentoiletten wären gleich hinter dem Eingang, aber entweder war es nie so gewesen, oder man hatte umgebaut. Während sie bei den Blumen stand und nach den Waschräumen suchte, wurde sie wie mit einem Schraubstock am Oberarm gepackt.
Sie drehte sich um und sah Mrs Daly, ihre achtzigjährige Nachbarin, zu ihr hochspähen.
»Lucy«, sagte die Frau ernst. »Wie geht es dir, Liebes?«
»Danke, gut. Und Ihnen?«
Mrs Daly wohnte im Haus gegenüber, seit die Siedlung in den Neunzigern gebaut worden war, und behauptete, mit Lucys und Nickis verstorbener Mutter befreundet gewesen zu sein, auch wenn beide sich nicht erinnern konnten, zu Lebzeiten ihrer Mutter jemals etwas gesehen zu haben, was darauf hindeutete. In Wirklichkeit verhielt es sich vermutlich so, dass selbst damals eine alleinerziehende Mutter Menschen wie Mrs Daly anlockte, die auf Material aus waren, über das sie mit ihren gleichermaßen missgünstigen Freundinnen tratschen konnten. Seit Nickis Verschwinden schien die Frau dauerhaft an ihrer Haustür stationiert zu sein, normalerweise im Gespräch mit einer oder mehreren Nachbarinnen. Stundenlang standen sie da und schwatzten, nestelten geistesabwesend an den kleinen goldenen Kruzifixen, sie am Hals trugen, die Blicke ständig auf Lucys Haus gerichtet, und ergötzten sich an ihrem Unglück wie an einem Sportereignis auf einem Pay-TV-Kanal.
Chris nannte sie die Grauen Tratschen.
»Gut?« Als Mrs Daly das Wort wiederholte, klang es wie ein Vorwurf.
»Ich komme zurecht«, verbesserte sich Lucy.
Die andere Frau entspannte sich und bekundete ihre Billigung dieser weit annehmbareren Antwort mit einem Nicken. Für die Außenwelt musste man immer im genau richtigen Maß am Boden zerstört sein. So aussehen, als würde man gleich zusammenbrechen, ohne dass es jemals wirklich dazu kam. Dankbar sein, dass die Leute einen fragten, wie es einem ging, und ihnen seine Dankbarkeit dadurch zeigen, dass man sie niemals mit der ungeschminkten schrecklichen Wahrheit belastete. Man musste okay sein, aber nicht zu okay.
Ein Goldlöckchen der Trauer.
»Wissen Sie vielleicht, wo die Kundentoi…«
»Ich hoffe, du achtest auf dich, Liebes. Schläfst du denn gut?«
Übersetzung: Du siehst furchtbar aus.
»Ja«, sagte Lucy. »Sicher, danke.«
Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie sich zum letzten Mal am Morgen in irgendeiner Weise erholt gefühlt hatte.
»Und ich habe gesehen, dass das ZU-VERKAUFEN-Schild wieder aufgestellt ist«, fuhr Mrs Daly fort.
Übersetzung: Hat eure Mutter das Haus nicht euch beiden überlassen? Versuchst du, dich mit dem Erbteil deiner vermissten Schwester davonzumachen?
Lucy nickte. »Das stimmt.«
Aber jedes Mal, wenn der Makler anrief, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, wimmelte sie ihn ab.
»Und wie geht es Chris?«
Übersetzung: Wohnst du noch immer mit ihrem Freund zusammen, nur ihr beide, in dem Haus, das du dir mit ihr geteilt hast?
»Ihm geht’s gut.«
Mrs Daly hob die kaum vorhandenen Augenbrauen.
»Er kommt zurecht«, korrigierte sich Lucy.
»Wir beten heute Morgen alle für dich.« Mrs Daly hielt ihren Arm noch immer fest umklammert und fixierte sie an Ort und Stelle. Lucy roch etwas Eierartiges in ihrem Atem und die widerliche Süße eines Körperpuders oder Parfüms mit Magnolienduft. »Was sagen die Gardaí? Haben sie irgendwelche Neuigkeiten über Nicki?«
Über Nicki gab es niemals irgendwelche Neuigkeiten, und trotzdem war sie ständig in den Nachrichten.
Seit ihr Verschwinden sechs Monate später mit zwei anderen Fällen in Zusammenhang gebracht worden war, den »Vermissten Frauen« – im Land gab es viele weitere, aber mit diesem Begriff wurden genau diese drei Menschen bezeichnet –, hatte es landesweit die Schlagzeilen dominiert, Social-Media-Diskussionen, Podcast-Charts und Radiosendungen … Lucy hatte gehört, dass jemand bereits an einem Buch über das Thema schrieb.
Aber niemand hatte jemals irgendwelche neuen Informationen, und die große Mehrheit der Berichte konzentrierte sich auf Jennifer Gold, die als letzte der drei vermisst gemeldet worden und mit siebzehn bei Weitem die jüngste unter ihnen war.
»Nein, nichts Neues«, gab Lucy ihre Standardantwort.
In den Wicklow Mountains wurden tatsächlich neue Suchaktionen unternommen, aber Lucy hatte längst gelernt, sich deswegen keine Hoffnungen zu machen. Solche Aktionen gab es immer wieder. Beim ersten Mal war sie zwei Tage lang wach geblieben, ohne das Handy auch nur einmal aus der Hand zu legen. Sie war überzeugt gewesen, wenn man Dutzende von Gardaí zusammenzog und mit Erdbaumaschinen auf eine Hügelflanke schickte, dann geschehe das aus gutem Grund. Mittlerweile registrierte sie derartige Anstrengungen kaum noch.
Erst dann begriff Lucy, was Mrs Daly wirklich gesagt hatte. Wir beten heute Morgen alle für dich.
Wieso ausdrücklich heute Morgen?
Es war, als hätte jemand an der Stereoanlage den Lautstärkeregler heruntergedreht. Die Geräuschkulisse des Supermarkts – schwatzende Kunden, piepende Kassen, quietschende Einkaufswagenräder auf dem Linoleumboden, Mrs Daly, die etwas davon faselte, die armen Mädchen zurück nach Hause zu holen – trat langsam in den Hintergrund, bis sie von der Kante in die Stille stürzten; bis kein anderer Laut mehr Lucys Ohren erreichte als das Pochen ihres eigenen Herzens.
Dann wusste sie es.
Etwas war geschehen.
Sie entriss Mrs Daly ihren Arm und suchte nach ihrem Handy, bevor ihr einfiel, dass es irgendwo im Auto lag, dass sie nicht darauf geschaut hatte, nachdem sie aufgewacht war, dass es stummgeschaltet oder sogar ausgestellt sein konnte, und wenn jemand versuchte, sie zu erreichen …
Lucy drehte sich zur Eingangstür und wollte losgehen.
In diesem Moment sah sie die Schlagzeilen, die sie vom Zeitungsständer anschrien.
Garda: »Großer Durchbruch« bei Vermisstenfällen
Schockierende Wende im Fall der vermissten Frauen?
Gardaí-Quelle behauptet, vermisste Frauen könnten noch leben
Chris musste gehört haben, wie sie vorfuhr, denn er öffnete die Haustür, gerade als sie ihren Schlüssel ins Schloss stecken wollte.
»Irgendwas ist passiert«, sagte sie zu ihm, während er im gleichen Moment sprach: »Denise ist hier.«
Verzweifelt suchten sie im Gesicht des anderen nach weiteren Informationen.
»Ich weiß nicht, worum es geht«, sagte Chris. »Sie ist gerade gekommen.«
Er hielt schon ihre Hand, und nun zog er sie daran ins Haus und zur Küche. Diese Art beiläufigen Körperkontakts kam häufig vor. Lucy bemerkte, dass sie sich an ihn lehnte oder auf der Couch an ihn kuschelte oder dass sich beim Essen ihre Knie unter dem Tisch berührten. Sie konnte sich dann nie erinnern, wie es dazu gekommen war. Und sie konnte schon gar nicht feststellen, von wem es ausgegangen war.
Keiner von ihnen hatte es je zur Sprache gebracht.
Am Ende des Flurs drehte er sich zu ihr um. »Wo warst du? Wir haben versucht, dich zu erreichen.«
Lucy hatte ihr Handy ganz unten in ihrer Handtasche gefunden, versehentlich stummgeschaltet. Auf dem Display standen so viele Benachrichtigungen, dass sie es zurückgelegt hatte, ohne auch nur eine davon zu lesen. Sie hatte an nichts anderes gedacht, als wieder nach Hause zu kommen.
»Ich war im Café«, sagte sie.
»Du warst im Café«, wiederholte Chris. Sein Tonfall wäre genauso passend gewesen, wenn sie behauptet hätte, gerade vom Mond zu kommen. Jetzt erst schien er ihr Äußeres zu bemerken. »Hast du auch im Café geschlafen?«
»Willst du jetzt wirklich davon anfangen?«
»Luce, du hast versprochen …«
Sie drängte sich an ihm vorbei und öffnete die Tür.
Family Liaison Officer Denise Pope, ihre Opferschutzbeamtin, stand am Küchentisch. Sie war groß und schlank wie eine Balletttänzerin und trug das Haar immer zu einem festen, glatten Nackenknoten zurückgebunden. Lucy fragte sich jedes Mal, ob sie irgendwann wirklich eine Ballerina gewesen sei. Denise war Kriminalbeamtin, daher trug sie keine Uniform, aber sie schien ihre eigene inoffizielle Kleiderordnung einzuhalten: dunkle Jeans, gestärkte weiße Bluse, dunkelblauer Blazer, der perfekt passte, wenn man von der kleinen Beule an der rechten Hüfte absah. Sie wirkte wie eine Frau im obersten Stockwerk eines Glasturms, die ein blinkendes Bluetooth-Headset trug und einen teuren Espresso trank, während sie mit leichter Hand einen Konzern leitete. Stattdessen stand sie jetzt vor einer Wand aus gestapelten, sich schon durchbiegenden Umzugskartons an Lucys zerkratztem Küchentisch.
»Ich habe keinerlei Neuigkeiten zu Nicki«, sagte sie. »Es tut mir leid.«
Irgendeine Variante davon war immer das Erste, was aus Denise’ Mund kam. Nicht, weil sie herzlos gewesen wäre, sondern weil sie ein Herz hatte.
»Aber«, fuhr sie fort, »ich muss trotzdem mit Ihnen reden.«
Sie schlug vor, dass sie sich alle setzten.
Die Küche roch nach Kaffee – die Glaskanne auf der Kaffeemaschine neben der Spüle war voll und dampfte –, aber vor Denise stand ein Glas Wasser, aus dem sie nun rasch einen kleinen Schluck trank.
Lucy war überzeugt, dass das Wasser irgendeine FLO-Taktik war, ein Tipp, den Opferschutzbeamte bei der Ausbildung bekamen. Selbst wenn der Familie etwas Schreckliches zugestoßen war, die gesellschaftlichen Normen der irischen Gastfreundschaft waren jedem ins Gehirn eingebrannt, und man fühlte sich verpflichtet, einem Besucher irgendetwas zu servieren: eine Tasse Kaffee, einen Teller mit einem Fächer aus Gebäck, einen Riegel Schokolade irgendeiner Billigmarke. Aber ganz egal, was man Denise anbot, sie sagte nur: »Ein Glas Leitungswasser wäre wunderbar, vielen Dank.« Das war ein Geniestreich. Etwas anzunehmen bedeutete, dass die Strapaze des endlosen Anbietens zügig und endgültig abgeschlossen wurde, und weil es nur Wasser war, brauchte der traumatisierte Gastgeber lediglich ein sauberes Glas und einen Wasserhahn zu finden.
Mitten auf dem Tisch lag ein Papierstapel, wahrscheinlich die Morgenpost. Alle üblichen Verdächtigen waren zugegen: überfällige Rechnungen, Postkarten von Verrückten, Briefe, die mit Trotz zahlreicher Versuche, Sie zu kontaktieren … begannen. Ganz oben lag ein dicker großer Umschlag mit einem roten Stempel über dem Adressfenster und einem Barcode-Aufkleber, der verriet, dass es sich um ein Einschreiben handelte.
Das war ungewöhnlich und konnte nichts Gutes bedeuten.
Lucy fegte den Haufen vom Tisch auf einen leeren Stuhl und spürte dabei zwei Augenpaare auf sich.
Ein Herzschlag verstrich.
»Vielleicht haben Sie heute Morgen schon etwas gesehen oder gehört«, begann Denise. »Aber ich wollte Sie persönlich aufsuchen, um sicherzugehen, dass Sie alle Fakten erfahren. Die Geschichten in den Medien … Im Augenblick sind es nur Spekulationen, nichts weiter. Und das werden sie für absehbare Zeit auch bleiben, deshalb würde ich ihnen an Ihrer Stelle ausweichen, so weit ich nur kann. Bitte, vertrauen Sie mir. Sie werden von mir alle relevanten Informationen erhalten.«
»Was für Geschichten?«, fragte Chris.
Lucy beugte sich vor. »Ist es Roland Kearns? Ist er verhaftet worden?«
Der Exmann der ersten Vermissten Frau, Tana Meehan, war niemals offiziell als Verdächtiger benannt worden, weder was ihr Verschwinden anging noch das der anderen, aber er war auch die einzige Person, die zu allen drei Fällen vernommen worden war, und mehrere Frauen hatten sich mit Fotos an die Medien gewandt, die zeigten, wie er sie mit bloßen Fäusten blutig geschlagen hatte.
»Luce«, sagte Chris tadelnd.
»Nein«, sagte Denise. »Um Roland geht es nicht.« Sie schwieg kurz. »Haben Sie den Namen Lena Paczkowski schon einmal gehört?«
Beide schüttelten sie den Kopf.
»Lena ist von ihren Eltern vor zwei Wochen als vermisst gemeldet worden«, erklärte Denise. »Sie ist an einem Samstagabend in Maynooth gewesen und war mit Freundinnen in einem Pub. Ihr Freund erwartete sie danach bei sich; er wohnt etwa eine Viertelstunde von dem Pub entfernt. Sie traf nie bei ihm ein. Er vermutete, dass sie es sich anders überlegt hatte und mit Freundinnen weitergezogen war, aber am nächsten Tag fand er auf dem Weg zur Arbeit nicht weit von seiner Tür entfernt ihr Handy im Gras am Wegrand.«
Lucy spürte, wie Chris sie unter dem Tisch bei der Hand nahm.
Die Handys aller drei Vermissten Frauen waren nicht weit von ihrem letzten bekannten Aufenthaltsort entdeckt worden. Die erste Frau, Tana, war an einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Kildare Town zuletzt mit Sicherheit gesehen worden; ihr Handy war von einer Frau in einem Café am Market Square abgegeben worden – sie hatte es im Rinnstein gefunden. Nickis Handy hatte auf einem Gehweg im City Centre gelegen, das Display in tausend Stücke zersprungen, an der Ecke des Pubs, den sie dem Bild einer Überwachungskamera zufolge allein verlassen hatte. Die dritte und letzte Frau, Jennifer Gold, war entführt worden, als sie ihren Hund an einer Landstraße unweit ihres Hauses ausführte. Ihr Handy war in einer Hecke entdeckt worden.
»Lena wurde mit den anderen zuerst nicht in Zusammenhang gebracht«, fuhr Denise fort. »Man nahm an, dass sie aus freien Stücken weggegangen war. Sie hatte sich mit ihren Eltern gestritten, weil sie aus dem Haus der Familie ausziehen und in einem Studentenwohnheim unterkommen wollte. Sie waren der Ansicht, dass es sich um eine Privatangelegenheit handele und es ihr nur umso schwerer fallen würde, wieder nach Hause zu kommen, wenn alles in den Medien ausgebreitet würde. Ich habe es bestimmt schon erwähnt, aber in Vermisstenfällen sind wir sehr auf das angewiesen, was die Familie uns mitteilt.«
»Okay«, sagte Chris mit einem Anflug von Ungeduld.
»Südöstlich des Great Sugarloaf verläuft eine Straße, die Red Lane heißt. Dort ist ein Parkplatz mit einem auffälligen Betontorbogen über der Einfahrt. An den Wochenenden ist er sehr gut von Bergwanderern und dergleichen besucht.« Denise sah sie nacheinander an. »Kennen Sie ihn?«
Lucy kannte ihn nicht, aber sie wusste, dass der Sugarloaf in den Wicklow Mountains lag, einer Gegend, die ansonsten als jedermanns erster Tipp galt in dem Spiel Wo sind sie jetzt? Die Vermisste-Frauen-Edition.
Alle drei waren im Umkreis einer Autostunde um eine Region entführt worden, die sich besser als jede andere im Land dazu eignete, eine Leiche zu verstecken.
Chris drückte Lucy die Hand. Seine Berührung fühlte sich mehr nach Anspannung an als nach Trost.
»Wir sprechen von unbesiedeltem Land«, fuhr Denise fort, »auch wenn es nur wenige Minuten von der N11 entfernt ist. Eine schmale Straße, die sich durch die Landschaft windet. Streckenweise gibt es dort nicht einmal Fahrbahnmarkierungen.« Sie schwieg kurz. »Gestern am späten Abend kam es in der Nähe der Einfahrt zum Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein amerikanischer Tourist in einem Leihwagen fuhr eine Fußgängerin an, die plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Sie war bei Bewusstsein, als die Rettungssanitäter eintrafen, und konnte ein paar Worte mit ihnen sprechen, aber sie war schwer verletzt und liegt nun in einem künstlichen Koma. Die Prognose lautet mehr oder weniger Warten wir ab. Und diese Fußgängerin war Lena.«
Chris schüttelte den Kopf. »Das verstehe ich nicht.«
Doch Lucy hatte große Angst, dass sie es verstand.
»In einer idealen Welt«, sagte Denise, »würde ich Ihnen nichts hiervon mitteilen. Es ist gerade erst geschehen, wir haben viel zu verarbeiten und versuchen noch immer, die grundlegenden Tatsachen festzustellen. Aber der Fahrer« – ein ganz kurzes Augenrollen – »hat seinen Unfall online gepostet, wodurch eine Boulevardzeitung Wind von der Sache bekam, und wir rechnen damit, dass es bis Mittag in allen Nachrichten ist. Die Titelseiten« – sie malte Anführungszeichen mit den Fingern in die Luft – »berichten bereits, dass eine große Enthüllung bevorsteht, obwohl sie nichts Näheres wissen. Sie können keine Informationen haben, weil wir sie auch nicht haben. Nichts, was man eine fundierte Tatsache nennen könnte. Aber was Lena den Sanitätern gesagt hat …«
Lucy war schwindlig und übel. Sie wollte nichts als Antworten, doch jetzt, wo sie der Möglichkeit gegenüberstand, sie tatsächlich zu erhalten, bezweifelte sie plötzlich, ob sie bereit dafür war.
»… ist von beträchtlichem Interesse für unsere Untersuchung des Verschwindens von Nicki und den anderen. Falls es wahr ist. Und genau das herauszufinden, beschäftigt uns gerade. Nach allem, was wir wissen, könnte Lena Angst gehabt haben, in Schwierigkeiten zu sein, und es erfunden haben.«
Was hat sie gesagt?!, schrie Lucy in ihrem Kopf.
»Was hat sie gesagt?«, fragte Chris.
Denise legte die Ellbogen auf den Tisch. »Lena erzählte den Sanitätern, dass sie in der Nacht ihres Verschwindens von einem Mann entführt wurde, der sie in seinen Wagen packte und zu einem Haus brachte, wo sie die vergangenen beiden Wochen über gefangen gehalten wurde. Irgendwie hat sie es geschafft, zu entkommen, und ist davongerannt, bis sie schließlich dem Wagen in den Weg geriet, der sie anfuhr. Und sie sagte …«
Lucy spannte sich an, wappnete sich für den Einschlag.
Unter dem Tisch drückte Chris ihre Hand so fest, dass es schmerzte.
»… dass sie nicht die Einzige gewesen ist«, erklärte Denise. »Sie sagte, dass dort auch andere Frauen festgehalten wurden.«
FUNDSACHE
Angela saß an ihrem Schreibtisch in der Missing Persons Unit, der Dienststelle für vermisste Personen, starrte auf eine Tupperdose voll schlaffer Karottenstifte und versuchte zu ergründen, wie Nacht-Angela nur auf die Idee verfallen konnte, dass Tag-Angela so etwas essen wollte.
Seit Monaten lagen ihre beiden Hälften im Krieg. Nacht-Angela maß sorgsam eine Tasse Haferflocken ab und ließ sie über Nacht in einem Topf einweichen. Sie briet eine Hähnchenbrust und legte sie in ein schickes Ding, das sie im Internet bestellt hatte und das wie eine Bento-Box aussah, dazu ein paar Löffel (gekneteten) Grünkohlsalat, und stellte alles griffbereit in den Kühlschrank. Sie schob ihre Arbeitsschuhe in einen Turnbeutel, legte ihre Sportschuhe und das Laufzeug auf einem Stuhl in ihrem Zimmer bereit – so brauchte sie sich morgens nicht einmal daran zu erinnern, sie anzuziehen –, hängte Fitbit und AirPods an die Ladekabel.
Nacht-Angela befolgte Dinge wie eine Hautpflegeroutine, führte ein Dankbarkeitstagebuch und ging früh zu Bett.