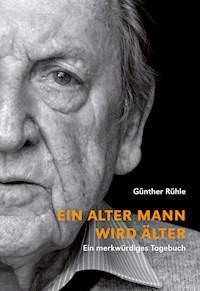16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der erste Band des Standardwerks. Dieses Buch enthält die lebendig geschriebene Geschichte des Theaters in Deutschland von den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts, vom jungen Kaiserreich über die Republik bis zum Ende der Hitler-Diktatur 1945. Es spricht von seinen prägenden Personen, von Dramatikern, Regisseuren und Schauspielern, zeigt die Entwicklung führender Theater. Es behandelt den Wandel der Themen, der Stile, der Arbeitsmethoden, gibt also Bericht von einem großen Aufbruch in die Weltgeltung, aber auch von der Spaltung und Zerstörung dieses bedeutenden Kunstbetriebes und von den Bemühungen um die Rettung seiner Substanz. Das Buch macht Zusammenhänge sichtbar zwischen der künstlerischen Arbeit und der Politik, dem Zeitgeist und den gesellschaftlichen Kräften. Günther Rühle nennt es: »Eine Biographie des Theaters«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2181
Ähnliche
Günther Rühle
Theater in Deutschland
Seine Ereignisse – seine Menschen
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Margret die Mitarbeiterin
Eine Biographie des Theaters
Dieses Buch wagt den Versuch, die Arbeit der deutschen Schauspielbühnen vom Erscheinen Henrik Ibsens bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts darzustellen. Also vom jungen Kaiserreich über die Republik bis zum Ende der Hitlerschen Diktatur. Das ist die Geschichte einer erstaunlichen Entfaltung mit großen geistigen und szenischen Impulsen, einer in die Welt dringenden Wirkung, einer emphatischen Inbesitznahme und einer schmählichen Spaltung und Zerstörung; aber auch eine Geschichte der Bewahrung seiner Energien und Intentionen unter den bedrängendsten Umständen. Es will also die Kräfte erkennen und benennen, die das deutsche Theater zu einem geschlossenen kulturellen System ausbildeten und so entwickelten, dass es am öffentlichen Leben teilnehmen, dessen Probleme darstellen, bewusst machen und Gedanken und Handeln beeinflussen konnte. Abend für Abend zeigt es die Ergebnisse seiner oft mühsamen Arbeit, deren Bedeutung für den Augenblick und für die folgende Zukunft oft nicht gleich erkennbar sind. Inszenierungen sind oft nur Teilstücke weiter reichender Entwicklungen. Sie sollen dargestellt werden. Die Aufmerksamkeit gilt also einzelnen, führenden Theatern und ihren plötzlich greifenden Intentionen wie den prägenden Autoren, Regisseuren und Schauspielern; aber auch dem Wandel der Themen, der Stile, der Arbeitsmethoden, der Zielsetzungen im Theater und deren ästhetischen Bewertungen. Es geht uns auch um die Zusammenhänge zwischen der künstlerischen Arbeit und der Politik, dem Zeitgeist und den gesellschaftlichen Kräften; also auch um die Freiheiten des Theaters, um seine Visionen und seine Schwierigkeiten, seine Abhängigkeiten und auch seine Pressionen und Verirrungen. Theatermachen entspringt spontaner Lust, hat eine mühsame Praxis, will den abendlichen Erfolg, stärkt sich im Beifall, ist aber utopische Arbeit. Diese wird getrieben von der Vorstellung, durch Spiel und Darstellung Handlungen entwickeln zu können, die in ihrer Bildhaftigkeit Erkenntnis vermitteln, sowohl dem einzelnen Zuschauer wie der Gesellschaft insgesamt. Die Utopie besteht in der Hoffnung, die vorgeführten Konflikte überwinden und ein nicht verletzendes Leben gewinnen zu können. So wirkt das Theater in der Zeit und mit der Zeit für die kommende Zeit. Es ist im Nach-, Neben- und Gegeneinander der Bühnen ein Arbeitszusammenhang, als solcher aber in dauerhafter Veränderung und Verwandlung. Das Theater wird gestaltet und getrieben von Menschen, die ihre Ideen und Phantasien, auch ihre Lebenslust im Spiel begreifen und vermitteln wollen und – auf der Suche nach dem privaten Erfolg – öffentliche Bedeutung erlangen. Die Themen und die Spielarten wechseln mit den Generationen oder Gruppierungen, die neu im Theater erscheinen, ihr Werk tun und abtreten. Verwandlung im Theater bringt oft Erneuerung; sie ist vor Regression nicht gefeit. Das Theater ist ein lebender Organismus, der aufblühen und schwach werden kann, der plötzlich Impulse aus der Gesellschaft erhält, verliert und wieder verfällt. Die Arbeit der Theater fließt durch die vielen Jahrzehnte wie ein Strom aus den verschiedensten Energien. Sie kommen nicht nur aus den Künsten, aus der Politik, sondern aus den Lebenskräften und Lebensvisionen vieler einzelner Menschen. Sie alle machen die Biographie dieses Organismus. Diese haben wir zu schreiben versucht. – Hoffend, man werde erkennen, welch ein erlebnisträchtiges Instrument kultureller Reflexion man im Theater in Deutschland besitzt.
Im September 2006
Günther Rühle
I.Im Kaiserreich 1887–1918
Vorstoß ins Neue
Der Aufbruch
Am Morgen des 9. Januar 1887 begab sich der Schriftsteller Theodor Fontane in Berlin aus seiner Wohnung in der Potsdamer Straße ins Residenztheater in der Blumenstraße. Der Kritiker der ›Vossischen Zeitung‹, Paul Schlenther, zuständig für die Privattheater, hatte ihm sein zweites Billett zukommen lassen. Fontane war der große Kollege. Ausgestattet mit dem wachsenden Ansehen des Schriftstellers, hatte er seit dem August 1870 im selben Blatt über die Aufführungen im Königlichen Schauspielhaus zu berichten. Für die einen war Fontane ein erleuchteter kritischer Geist, bei anderen hatte er sich den Ruf eines »Scheusals« erworben. Denn mit dem, was das Königliche Schauspielhaus am Gendarmenmarkt damals bot, war er nicht zufrieden. »Alles scheint aus den Fugen gehn zu wollen; Chaos und erst wenig Ansätze zu Neubildungen«,[1] notierte er im Tagebuch, als wäre das Chaos dort – an des jungen Deutschen Reiches erster Bühne – selbst ein Symptom sich andeutender oder gar notwendiger Veränderungen. Überall blühte der Theaterplunder. Im Königlichen Schauspielhaus gab man an diesem Sonntag ›Der Leibarzt‹, im Deutschen Theater ›Goldfische‹ von Schönthan und Kadelburg, im Wallner-Theater ›Die Sternschnuppe‹ und im Residenztheater selbst abends Sardous ›Georgette‹: zum 52. Mal. An diesem Sonntagmorgen aber gingen Schlenther und Fontane – seit dem Sonnabend voller Unruhe – zu einem verstörenden Schauspiel: ›Gespenster‹ von Henrik Ibsen.
Der Name des norwegischen Dichters war seit langem wie ein Raunen in die Zukunft. Schon vor 25 Jahren hatte dieser Ibsen die norwegische Gesellschaft mit seiner ›Komödie der Liebe‹ aufgeregt, in der ein junger Dichter namens Falk seinen Lebensspruch hinausrief: »Ich oder die Lüge.« Seitdem war der junge Falke Ibsen eine wachsende Kraft, schrieb ein Stück ums andere. In ›Brand‹ rief er sein »Alles oder Nichts!«, im ›Peer Gynt‹ trieb er sein andres Ich hinaus in die Abenteuer der Welt, im ›Bund der Jugend‹ griff er zum ersten Mal in die gegenwärtige Gesellschaft und formulierte das Recht, man selbst zu sein, an einer Vorläuferin der Nora. In den ›Stützen der Gesellschaft‹, die im Jahr 1877 jenen Stücken folgten und ihm die Aufmerksamkeit außerhalb Norwegens zuführten, hieß es dann deutlich und endgültig: »Der Geist der Wahrheit und der Geist der Freiheit – das sind die Stützen der Gesellschaft.« Den Satz sprach eine kraftvolle, starke Frau, Lona Hessel. Dieser Ibsen exemplifizierte mit Vorliebe und Absicht an Frauen die unwahren Zustände in der Gesellschaft und entwarf dramatische Bilder, die die Konventionen der engen norwegischen, aber – wie sich zeigte – auch die in der mitteleuropäischen Gesellschaft durchstießen.
Sieben Jahre nach der Gründung des Reiches war Henrik Ibsen langsam in Deutschland bekannt geworden. Die ›Stützen der Gesellschaft‹ erschienen 1878 gleichzeitig an drei Berliner Bühnen. Für den jungen Paul Schlenther, 24 Jahre alt, wurden sie eine der »größten Kunstoffenbarungen« seines Lebens. Er nannte das Stück »ein eroberndes und erleuchtendes Drama« und erinnerte noch nach Jahren an den Aufruhr in seiner Seele: »Über all dem blinkenden und schillernden Theaterplunder ringsum gingen uns damals die jungen Augen auf. Wir bebten und jauchzten (…) So muß neunzig Jahre früher Schillers ›Kabale und Liebe‹ auf die nicht mehr ganz unreife Jugend gewirkt haben (…) Bis dahin war uns Ibsen ein bloßer Name gewesen. Durch dieses Stück erst lernten wir ihn lieben, fürs Leben lieben.« In »dieser modernen Wirklichkeitsdichtung (…) trat uns (…) die kräftigste Realpoesie entgegen.«[2] Es war das Erlebnis der eben antretenden Generation.
Für sie sprach Henrik Ibsen die Sprache der Wirklichkeit. Er sah in den Zustand der Gesellschaft; er brachte lebenswahre Konflikte und lebensstarke Menschen wie den Konsul Bernick in den ›Stützen der Gesellschaft‹ oder – zwei Jahre später – jene Nora, die ihren Ausbruch aus dem Puppenheim ihrer Ehe mit dem Anspruch der Frau auf ein geachtetes, gleichberechtigtes Leben rechtfertigte. Ihr »Leb wohl« am Schluss war mehr als die Aufkündigung eines unwahr gewordenen Lebensbundes. Es war ein schmerzender Anruf an alle, die in ihren Puppenheimen und Lebenslügen sich eingenistet hatten. Ihr Name, Nora, wurde ein Signal für das kommende Jahrhundert und zum neuen Titel des bis heute lebendigen Stücks.
Gespenster in Berlin
Um ›Nora‹ zu spielen, brauchte man noch Mut. Die erste Aufführung im noch Ibsen-scheuen Berlin verhielt 1880 auf halbem Wege. Die Darstellerin der Nora war ein Liebling des Publikums. Sie wagte nicht den zeichensetzenden Affront der Kündigung einer Ehe und erzwang für sich einen versöhnlichen Schluss. Die Furcht der Hedwig Niemann-Raabe warf ein Schlaglicht auf die Situation.
Aus Konflikten dieser Art war das Ibsensche Drama entstanden als das Drama des gegenwärtigen, zu sich selbst wollenden Menschen. Was hier begann, sollte noch reichen bis in Carl Sternheims zukünftige Komödien. Dieser Schritt ins Neue und Freie hat die Zukunftserspürer von damals für Ibsen eingenommen. Von Georg Brandes und Julius Hoffory, seinen nordischen Verkündern in Deutschland, bis zu seinen deutschen Wortführern, Friedrich Spielhagen, Hermann Bahr und den jungen Kritikern Otto Brahm und Paul Schlenther. Auch der alte Fontane war mit von der Partie.
Seit zehn Jahren[3] war in Deutschland um die Durchsetzung Ibsens gekämpft worden. Der Kritiker Otto Brahm hatte in der ›Vossischen‹, in der ›Frankfurter Zeitung‹[4] Ibsen gerühmt; er hatte die Aufführung der ›Gespenster‹ gefordert. Schon seit 1884 gab es eine deutsche Übersetzung des Stückes. ›Gespenster‹ war zuerst ein Leseerlebnis. Reclam musste nachdrucken. Als in Norwegen die Empörung darüber schon verklungen war, hielt Ibsen es noch immer für unmöglich, dass eine deutsche Bühne das Stück spielen würde. Brahms großer Ibsen-Essay von 1884 endete noch mit der Frage: »Wird kein deutsches Theater den Mut finden, es auf die Szene zu stellen?«[5] Er ist ein Dokument für die Dauer dieses Vorkampfs. Die Annäherung an die ›Gespenster‹ geschah – vier Jahre nach der Uraufführung[6] – nur zögernd und noch fernab der Hauptstadt. Was also geschah an diesem Morgen?
Das Residenztheater, in dem einst auch jene ›Nora‹ aufgeführt worden war, hatte die einmalige Aufführung vorsichtig angekündigt: als »Wohltätigkeits-Matinée«. Der norwegische Dichter war seit einer Woche in der Stadt. Die Aufführung geschah ihm zu Ehren, sie sollte eine Huldigung sein. Sie barg Angst und Schrecknis. Ibsen hatte hier die neuesten Einsichten von der Macht des Milieus und der Vererbung, mit denen die Wissenschaft damals – von Taine bis Darwin – die alten idealistischen Vorstellungen von Freiheit sprengte und mit denen Ibsen schon lange umging, nun ganz in ein »grausiges« dramatisches Bild verwandelt. Zum ersten Mal sah man auf der Bühne in den Zusammenhang libidinöser, unverantwortlicher Lebensführung, syphilitischer Ansteckung und deren Folgen, in den Zerfall einer Lebensgemeinschaft und die Zerstörung eines jungen Menschen. Das Schicksal des Osvald Alving, der – »Mutter, gib mir die Sonne!« – in den Armen seiner betrogenen Mutter Gedächtnis und Leben verliert, war wie das Menetekel kommender Wahrheiten. Name und Schicksal Osvalds brannten sich in die Erinnerung. Den Osvald zu spielen wurde – wie Nora – zum Wunsch vieler in der neuen Generation.
Diesen 9. Januar 1887 nannte Paul Schlenther später »einen denkwürdigen Tag«. Schon nach dem Ersten Akt musste sich Ibsen dem brausenden Beifall stellen, und Julius Hoffory, Ibsens Prophet an der Berliner Universität, ging in der Pause umher und rief, Brötchen kauend und Goethe paraphrasierend: »Von hier und heute fängt eine neue Epoche der Literaturgeschichte an, und ihr dürft sagen, ihr seid dabeigewesen.«[7] Er hatte Recht. »Alle Perücken wackelten, auch die freiesten Geister waren erschreckt durch diese Revolte in der Ästhetik«, und: »Zum erstenmal für uns Heutige war das Theater wieder die große Kulturmacht geworden, die Führerin im Geistesleben, und ihre Gewalt offenbarte sich in strömender Schnelle.« Und Otto Brahm, der Kritiker mit der großen Zukunft, hat in seiner Rezension dieser Aufführung Schlenthers Urteil bestätigt. Er, Verfasser einer viel gerühmten Biographie über Kleist, arbeitend an einer über Schiller, verglich – wie einst der Freund Schlenther – den Tag mit dem, an dem Schillers ›Kabale und Liebe‹ auf der Bühne erschienen war. Ja, unter der Wucht des Eindrucks von Ibsens analytischer und dramatischer Kraft beschworen er und andere Rezensenten sogar – und nicht ohne Grund – die antike Tragödie des ›Ödipus‹.[8]
Inszeniert hatte das erschreckende Stück Anton Anno, der Direktor des Theaters. Seiner Arbeit wurde Ernst, atmosphärische Dichte und Eindruckskraft bestätigt. Emanuel Reicher spielte eindringlich den Pastor Manders; der Dramaturg des Hauses, Franz Wallner, den Osvald, Annos Frau, Charlotte Frohn, die Witwe Alving. Die ungewohnte Wucht des Stücks machte die Wirkung der Darstellung. Ibsens dichterische Kraft wurde auch von denen gerühmt, die das Stück als Zumutung verwarfen, die es als das »lehrreichste Beispiel für die Entartung« ausgaben, »der die dramatische Kunst mit unaufhaltsamer Notwendigkeit verfallen muß, wenn sie fortfährt, im Sinne der Franzosen dem Phantom der nackten Wahrheit nachzujagen und darüber die ewigen Gesetze der Schönheit, ohne die es keine Kunst gibt, leichtmütig zu verachten; wenn sie fortfährt, aus ingrimmiger Lust an der Zerstörung des Ideals und an der grausamen Vertilgung jedes tröstlichen Gedankens in den Schwären herumzuschneiden«.[9] So stand es in der ›Täglichen Rundschau‹ in Berlin. Und auch Paul Schlenthers Ibsen-stolze Rezension durfte in der ›Vossischen Zeitung‹ nicht erscheinen ohne einen massiven Vorbehalt der Redaktion. Deren Anmerkung definierte die jetzt aufgebrochenen, neuen Fronten: »In philosophischen Abhandlungen mag man die schwierigsten, ethischen, sozialen und physiologischen Probleme lösen; für die Kunst, so verschieden ihre Richtungen sind, bleibt ein Gesetz unumstößlich: ein Kunstwerk soll uns Genuß, Freude, Erhebung bereiten, nicht Entsetzen, Qual und, was noch schlimmer ist, hoffnungslose Verzweiflung – auch dann nicht, wenn, was wir dem Ibsenschen Stücke bestreiten, die Handlung auf Wahrheit beruht. Mit solchen Mitteln soziale und ethische Probleme lösen zu wollen, ist eine Verirrung der Kunst, selbst wenn eine so mächtige dramatische Schöpfungskraft ihnen Gestalt gibt, wie die Ibsens.«[10] Deutlicher konnte sich die etablierte, auf ihren Vorstellungen von der Kunst und ihren »Idealen« beharrende Gesellschaft nicht formulieren. Eine Kluft tat sich auf. Es schieden sich die Epochen.
Verstörte Gefühle
Wahrgenommen wurde an diesem Morgen vor allem der Bruch mit allen Konventionen. Die Wörter der Diskussion sagen, was vor sich ging. Der Begriff von »Kunst« wird noch eng verbunden mit der Vorstellung von Schönheit, Erhebung und den klassischen Idealen. Das Wort von Freude und Genuss gesellt sich schon dazu als Inbegriff unbezweifelter Vereinnahmung der Kunst in die Wonnen des Lebens, als seien die Gebilde der Kunst, die hier verteidigt wurden, – vom ›Götz von Berlichingen‹ über ›Die Räuber‹ und ›Kabale und Liebe‹ bis zu Hebbels ›Maria Magdalena‹ – einst zu Freude, Genuss und Erhebung geschrieben worden. Die von Ibsen intendierte neue Wahrheit wird dagegen als Entartung, Verirrung und Zerstörung bekämpft. Ja, es wird sogar auf die fatalen Muster des 1871 besiegten Erbfeinds Frankreich verwiesen – auf die verführerischen Sittenstücke von Vater und Sohn Dumas und die harten Wahrheiten des Émile Zola, auf die der heranreifende Naturalismus sich stützte.
Auch das gehört zur Situation: Das junge Deutsche Reich war gerade sechzehn Jahre alt. Noch lebte es vom Triumph über Frankreich, im Stolz auf den Sieg von Sedan und auf die eigene Reichsbildung. Es genoss die wirtschaftliche Prosperität der ersten Gründerzeit, den sich abzeichnenden technischen Fortschritt und die wirtschaftliche Entfaltung. In den frühen achtziger Jahren bildete und festigte sich das neue Nationalgefühl. Bismarck war noch Herr der Politik, die Zeit war anfällig für hohe Töne und Vorstellungen von großer Vergangenheit und glänzender Zukunft.
Der Autor, der diesen Strömungen Ausdruck auf dem Theater gab, hieß Ernst von Wildenbruch, Enkel des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, Diplomat im Auswärtigen Amt. Mit großem Sinn für szenische Wirkungen erwarb er seit 1880 dem fast abgestorbenen historischen Drama neuen nationalen Stoff und Geltung. Die lange Reihe seiner Dramen von den ›Karolingern‹ über die deutschen Königsstücke bis zu den ›Quitzows‹ hat die nationale Dichtung und das nationale Bewusstsein gestärkt und manchem Nachahmer seiner Erfolge auf die Bühne geholfen. Wildenbruch sammelte noch einmal, was das Jahrhundert an historischer Erinnerung, an dramatischem Geschick, an sentimental-heroischer Empfindsamkeit und Bedürftigkeit hervorgebracht hatte. Es schien, als wolle er – am Ende der Epoche – ein Richard Wagner der Schauspielbühne sein. Effektvoll entwarf er seine historischen Tableaus, »baute« große Szenen. Als er den zentralen Konflikt mittelalterlicher Politik, den Gang des Königs Heinrich IV. nach Canossa zum Papst Gregor VII., um die Lösung vom Bann und die Kaiserkrone zu erreichen, 1896 aufs Theater brachte, waren schon längst die neuen Entwicklungen in Gang. Hier aber dröhnte noch das »Drama« alter Art mit heldenhaften Auftritten, heroischer Rhetorik und Gebärde. So:
GREGOR zu HEINRICH: Beuge dich! HEINRICH: Nein! GREGOR: Du mußt. HEINRICH: Nein! GREGOR(wirft beide Hände empor): Umsonst, was ich gesprochen und gefleht? Verloren die Stunde, die einmal war und nie wiederkehrt? Ah – Verstockter!! HEINRICH: Ah – Betrüger! GREGOR(prallt zurück):Betrüger? HEINRICH: Ja! Dem die Menschen glauben sollen, er sei über Schwäche und Begier – und der du hungerst nach Macht und dich sättigst am leeren Schein! In dessen Seele ich zweimal gesucht und zweimal nichts gefunden habe als das Nichts! GREGOR: Nun sollst Du nicht Kaiser sein. HEINRICH: Nun werde ich Kaiser ohne dich! (Er rafft den Mantel auf, deutet nach dem Fenster) Rot bricht der Tag an – Tausende sind gestorben durch dich, Zehntausende werden sterben um dich – soll ihr Blut kommen über dich? Soll Kampf sein? GREGOR: Kampf von Geschlecht zu Geschlecht, vom Vater wider den Sohn! Kampf soll sein und Fluch auf dich über die Zeit hinaus in Ewigkeit! HEINRICH(rafft den Mantel um die Schultern): Du nicht Wundertäter – Hexenmeister, der die Welt verflucht. (…) du sollst verflucht sein, verflucht und verflucht! (Er stürmt hinaus). GREGOR(breitet die Arme aus): Beten – beten – beten – (Er taumelt und fällt quer über das Ruhebett, so daß sein Kopf herniederhängt.) – Ende der Szene. (4. Akt, 5. Szene)
Das war doch eine andere Welt, die sich auf dem Theater, übereinstimmend mit dem wilhelminischen Geist der Zeit, noch darstellte, machtvoll, mit hohen Worten, bejubelt und staatlich gesegnet. Mit dem Pathos seiner szenischen Erfindungen war Wildenbruch aufgestiegen zum verehrten Dramatiker des neuen Reiches. Er war dem Kaiser, Wilhelm II., Freund, der selbst sich als Künstler verstand und sein »Königliches Schauspielhaus« nach seinen Wünschen dirigierte. »Die Dinge (liegen) in Deutschland jetzt so, daß das ganze Schicksal eines Kunstwerks und eines Künstlers wesentlich beeinflußt werden kann von dem Maß der Teilnahme, das ihm der Kaiser bekundet«, schrieb der junge Kerr schon am Beginn seiner journalistischen Karriere.[11]
Zu seinem zehnten Regierungsjubiläum, am 15. Juni 1898, trat seine Majestät, der Kaiser, vor die Schauspieler seines Königlichen Theaters, sprach von seiner eigenen Erziehung in der »Schule des Idealismus« und folgerte, dass das »Königliche Theater vor allem dazu berufen sei, den Idealismus in unserem Volke zu pflegen« und dass es »ein Werkzeug in der Hand des Monarchen sein sollte«. Es habe »gleich der Schule und der Universität (…), das heranwachsende Geschlecht heranzubilden (…) beizutragen zu Bildung des Geistes und des Charakters und zur Veredelung der sittlichen Anschauung«. Dann wurde er deutlich: »Das Theater ist auch eine meiner Waffen. (…) Es ist die Pflicht eines Monarchen, sich um das Theater zu kümmern (…) eben, weil es eine ungeheure Macht in seiner Hand sein kann.« Dann bat er seine Schauspieler, ihm fernerhin beizustehen, »um dem Geiste des Idealismus zu dienen und den Kampf gegen den Materialismus und das undeutsche Wesen fortzuführen, dem schon leider manche deutsche Bühne verfallen ist. Und so wollen Sie in diesem Kampfe fest bestehen und in treuem Streben ausharren …«[12] Er verteidigte bis zum Ende seiner Regierung, bis 1918, den Idealismus in der Kunst gegen den »Verfall«, der sich mit Ibsens ›Gespenstern‹ scheinbar abzeichnete.
Der damals öffentlich zutage tretende Konflikt, was Kunst sei und sein solle, spiegelte exakt die Positionen, die Ibsen in sein Stück, in den Dialog der Helene Alving mit dem Pastor Manders eingebracht hatte. Sie waren aktuell und grundsätzlich. »Und die Wahrheit?«, fragt Frau Alving, – »Und die Ideale?«, fragt Manders dagegen. – Die Ideale! Das waren hier: die Familie, die Reputation, die Treue, die Liebe und Opferbereitschaft, die Pflicht, der schöne Schein über der Wirklichkeit. Die schlimme Wirklichkeit hinter der Fassade zu benennen war dem einen schon ein Sakrileg, »Frau Alving, da versündigen Sie sich«, sagt Pastor Manders; dem anderen war das klare, ungeschönte Wort ein Weg in die Freiheit. »Ach – Ideale, Ideale!« »Ich muß mich zur Freiheit durcharbeiten«, ruft Helene Alving – eine im Haus gebliebene Nora – gegen den Wust des Vergangenen, der über sie kam. (2. Akt, 1. Szene)
Die Vorstellung der ›Gespenster‹ ging in starkem Beifall und Protest zu Ende. Sie setzte auch Fontane »in höchste Spannung und Erregung«.[13] Noch am Abend schrieb er an Schlenther, der die Rezension für die Zeitung liefern musste, er fühle sich »gedrängt, selbst etwas über dieses merkwürdige Stück«, das er in seinem Tagebuch »ein sehr meisterliches, aber doch ganz schiefgewickeltes«[14] nennt, zu schreiben. Er sei für Ibsens Stück selbst voller Bewunderung, »Abweichung nur im Letzten und Innersten«.[15] Die Abweichung beschrieb er zwei Tage später ausführlich. Er folge nicht den Ibsenschen Thesen, dass, wer heiraten wolle, nach Liebe, nicht nach Geld heiraten und wenn er, zweitens, den Irrtum einer falschen Bindung erkenne, sich scheiden lassen solle. Das heißt, er reagierte nicht direkt auf das Schrecknis des Themas, er sah in Ibsen mehr einen Prediger von Regeln, mit denen die Welt doch nicht zu bessern sei. »Unter allen Umständen bleibt es mein credo, daß, wenn von Uranfang an, statt aus Konvenienz und Vorteils-Erwägung, lediglich aus Liebe geheiratet wäre, der Weltbestand um kein Haarbreit besser sein würde als er ist.«[16] Der Realist Fontane hielt dem Realisten Ibsen einen verkappten Idealismus vor; der sich freilich anders bestimmte als die fassadenhaften »Ideale« der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer bevorzugten Dichter.
Ibsens neuidealistische Position ergab sich aus seinem Versuch, der Gesellschaft Denkbilder zu geben, die auf die Veränderung der Verhältnisse zielten. Von einer »Revolutionierung des Menschengeistes« sprach er. Der Skeptiker Fontane betrachtete den Moralisten Ibsen, ohne die neue Energie zu verkennen, die mit ihm in der dramatischen Kunst spürbar wurde. Eine Energie, die die alten Positionen des heroisch-pathetischen Historienstücks wie die Stücke lustvoller Unterhaltung erschütterte. Das historische Schauspiel, das Versdrama, das noch immer die Bühnen beherrschte, – Formen, in denen auch der frühe Ibsen begann – waren hier verworfen. Die »dichterischen Intentionen der Zukunft« seien andere, sagte er. »Die Kunstformen sterben aus, ebenso wie die ungeheuren Tierformen der Urzeit ausstarben, als ihre Zeit zu Ende war.« Er setzte seine eigenen.
Meininger Beispiele
Das Berliner Szenarium von Anfang 1887 machte den damit öffentlich sichtbar gewordenen Konflikt noch deutlicher. Drei Wochen nach jener Aufführung der ›Gespenster‹ kam abermals die inzwischen von Wien und London bis Moskau bekannte und gerühmte Truppe des Herzogs von Meiningen, die manche – trotz ihres Historismus – doch als das Urensemble des kommenden Theaters betrachten wollten. Die Truppe des verehrten, kunstsinnigen Herzogs hatte ihren europäischen Ruhm erworben durch historisch genau entwickelte Inszenierungen. Man sah große, durch ihre architektonische wie ihre landschaftliche Phantasie imponierende, perspektivisch gemalte, durch Vorsatzstücke auch gegliederte und oft variierte Bühnenräume und die Schauspieler in stimmigen, mit zeichnerischer Akribie entworfenen Kostümen; man sah ein bewegtes Zusammenspiel, das dem einzelnen Schauspieler den üblich gewordenen Starkult verweigerte, die Gruppierungen waren prachtvoll geordnet wie auf historischen Gemälden, der Umgang mit Massenauftritten gab zum ersten Mal den Eindruck eines in einem gemeinsamen Willen zur Kunst geeinten Ensembles. Die beeindruckenden Bilder, der sorgfältige Umgang mit dem dichterischen Text verwiesen auf eine verantwortliche Führung der Regie, die Sprache wurde aus dem bloßen Deklamieren auf ihren Geist hin geöffnet. In der Truppe war das auf den Bühnen üblich gewordene Virtuosentum beseitigt, den schlechten Klassikerbearbeitungen war Gewissenhaftigkeit entgegengestellt. Ihr Ruhmesstück war die Inszenierung von Schillers ›Jungfrau von Orleans‹ mit Amanda Lindner, der heroischen Jungfrau; der Krönungszug darin das außerordentliche Ereignis. Auch Fontane bezeugte: Sie »debütieren glänzend«. Berlin liebte die Meininger. An keinem anderen Ort waren sie seit ihrem glorreichen Debüt 1874 mit ›Julius Cäsar‹ öfter zu Gast. 385 Abende hatten sie seitdem hier gespielt. Der Jubel um die Meiningische ›Jungfrau‹ war auch jetzt wieder der höchste Beweis für die herrschenden hehren Ansprüche an die Kunst. Den ganzen Februar hindurch spielten sie ihre opulente, bildstarke, eindrucksvolle, historisch illustrierte ›Jungfrau von Orleans‹ in Berlin. 55-mal (gegen einmal Ibsen). Ein Theaterwunder für sich. Der Glanz der Epoche.
Merkwürdig spielt die Geschichte: Diese auf eine neue, reiche, gewissenhafte Darbietung der klassischen Stücke angelegte Truppe des Herzogs Georg von Meiningen hatte es in der Hand, selbst den Akzent der neuen Zeit zu setzen. Der Herzog hatte in Meiningen schon Ibsens ›Kronprätendenten‹ aufgeführt, mit Ibsen war er befreundet. Im Dezember 1886 hatte er sogar die erste öffentliche Aufführung der ›Gespenster‹ auf deutschem Boden gewagt, denn die erste Aufführung in Augsburg im voraufgegangenen April hatte nur vor geladenem (geschlossenem) Publikum stattfinden können. Aber die Theatergänger in Meiningen, verschreckt vom bekannten Inhalt des »unsittlichen und unanständigen« Stücks, verweigerten im Voraus den Besuch. Der dort versammelte »erlesene Kreis von Schriftstellern und Künstlern« füllte nicht das Theater; der Hofstaat wurde in die Vorstellung zum Beifall kommandiert, um Ibsen nicht zu enttäuschen. Auf der Bühne gab altfränkisches Mobiliar, der schwarzbronzene Schmerzenskopf des Laokoon und das trübe Licht des Regentages die Atmosphäre des Alvingschen Heims. Kein Ereignis. Der Herzog war der beste Claquer. Sein Bekenntnis zu Ibsen bestätigte seinen offenen Sinn für neue Kräfte in der Kunst, erschien sogar wie eine Legitimation des Neuen aus dem Alten. Ihr erhofftes (öffentliches) Gastspiel mit den ›Gespenstern‹ aber wurde in Berlin nicht erlaubt.
Begriff der Herzog damals schon, dass nach vierzehn Jahren glorreicher, oft triumphierender Arbeit seine Zeit zu Ende ging, obwohl sie doch eine außerordentliche war? 1887, beim neuen Triumph in Berlin, erschien das Meiningische Theater noch das stärkste der Gegenwart. Am Ende dieses Gastspiels ahnte noch niemand, dass es das letzte der Meininger in Berlin sein sollte. 1890 gaben sie auf. Auf eine Schlussrevue ihrer großen Inszenierungen in Berlin verzichtete der Herzog. »Es ist nicht mehr nötig. Was die deutschen Theater lernen sollten, haben sie gelernt«,[17] sagte er. Was er erreicht hatte, wirkte lange nach. Und doch war der Verzicht von 1890 ein zweites Zeichen für die Zeitenwende, die mit den ›Gespenstern‹ begann. Auch das Theater des Herzogs repräsentierte, wie das Wildenbruchs, mehr den Schlussglanz einer Epoche als dass es eine neue eröffnete.
Die Aufführung der ›Gespenster‹ in Berlin von 1887 zeigte noch etwas anderes: Weder die Aufführung in Augsburg noch die in Meiningen hatte die öffentliche Meinung entzündet. Dazu brauchte es die Großstadt. Hier formulierte sich das Künftige. Mochten die Theater im Land noch so viel Vorbereitendes leisten: das neue, aktive Feld wurde Berlin. Hier wurde fortan die maßgebende Meinung gebildet, das Ereignis bestimmt. Schon die Meininger hatten diese Kraft der Großstadt gespürt. Nicht ihr Erscheinen daheim, erst ihr Debüt in Berlin hatte sie, wie Siegfried Jacobsohn bestätigt, im Frühjahr 1874 zum »theatergeschichtlichen Ereignis«[18] gemacht.
Berliner Entwicklungen
Es gab keinen anderen Ort in Deutschland, der sich seit dem Sieg von 1870 und der Reichsgründung 1871 so zu verwandeln begann wie Berlin. Menschen strömten von allen Seiten in die sich schnell industrialisierende Stadt, Arbeiter, Bürger, Wissenschaftler, Studenten; unter ihnen 1876 der junge, aus Hamburg gebürtige Otto Brahm, der früh begriff und es auch niederschrieb, dass es »ein ewiger Schaden« für unsere Dichtung, vor allem für das Drama, gewesen sei, »daß wir keine Kapitale besaßen, keinen Brennpunkt alles nationalen Lebens wie die Spanier, Engländer, Franzosen«.[19] Es kamen aber auch Spekulanten, Abenteurer und Glückssucher. Neue Straßen wurden gebaut, neue Stadtteile entworfen, der Bau der S-Bahn begann, das elektrische Licht kam in die Häuser, die Börse beherrschte das Tagesgespräch, das Verlangen nach Gewinn und Reichtum prägte das Denken. Im neuen Westen der Stadt siedelte eine reiche, neue Gesellschaft, die bald Ton und Geschmack angab; das Tempo ergriff Berlin, die spürbare Offenheit für künftige Entwicklungen machte deren Konflikte öffentlicher als jeder andere Ort. Die Berichte von damals bis hin zu den Berliner Briefen[20] des jungen Alfred Kerr, der 1887 als Student aus Breslau in die Stadt kam und der berühmteste kritische Betrachter ihres Theaters wurde, sprechen von dieser Dynamik. Die preußische Königsstadt verwandelte sich in die Reichshauptstadt und erhob bald den Anspruch, Weltstadt zu werden. Die schönste obendrein.
In keiner anderen Stadt entfaltete sich jetzt eine Theaterszene so wie hier. Die Einführung der Gewerbefreiheit 1869 erlaubte die Gründung neuer, in ihrer Art sehr unterschiedlicher Theater. Die Gewerbefreiheit brach das Monopol des Königlichen Schauspielhauses auf die Klassiker und auf das ernste Drama. Klassiker konnte man bald überall sehen, in schnellen, auch leichtfertig zusammengesetzten Inszenierungen. Die neuen, privat geführten Theater – von denen das 1871 erbaute Residenztheater das langlebigste wurde – konkurrierten scharf miteinander, mussten sich gegeneinander profilieren, versuchten einander zu überbieten. Possen, Schwänke und Operetten begannen die Szene zu dominieren, zu großen, monströsen Revuen lockte der Zirkus Renz. Das war der »Theaterplunder«, von dem Paul Schlenther sprach. Je penetranter er wurde, desto stärker wuchs das Verlangen nach einem ernsthaften, der Kunst verantwortlichen Theater. Es verband sich mit dem Anspruch, den die Stadt als Reichshauptstadt an sich selbst zu stellen begann.
Der Erste, der daraus Konsequenzen zog, war ein Mann, den Alfred Kerr bald den »bewährten Rindfleischlieferanten der deutschen Bühne«[21] nannte. Der ehemalige Kapellmeister hatte, zum Autor gewandelt, dem Volks-, Schwank- und Lachtheater mit ›Mein Leopold‹, ›Hasemanns Töchter‹ und dem ›Doktor Klaus‹ Musterstücke geschrieben. Er war jüdischer Herkunft und hatte – wie viele in dieser Zeit eines öffentlichen, aber gebändigten Antisemitismus – seinen ursprünglichen Namen, Aronsohn, verändert. Er hieß nun Adolph L’Arronge, war erfolgreich, hatte Witz, Ideen und Durchsetzungskraft. Mit dem Geld, das er an seinen Stücken verdiente, hatte er das alte Friedrich-Wilhelm-Städtische Theater gekauft, es neu dekoriert und in ein Haus höheren Anspruchs verwandelt. Er hatte ihm einen Namen gegeben, in dem der alte deutsche Traum von einem Nationaltheater noch mitschwang und auch die Herausforderung benannt war: ›Deutsches Theater zu Berlin‹. Er begriff es als »ein Konkurrenz-Unternehmen gegen das Königliche Schauspielhaus«, das in jenem von Fontane benannten Chaos und Schlendrian dahintrieb, sprach selbst von seiner »Anmaßung«, diese Konkurrenz öffentlich aufzunehmen, rechtfertigte sie aber mit der Bemerkung, die Gründung sei »in Berlin ein Bedürfnis« gewesen.[22] Schon am Ende der ersten Spielzeit nannte Otto Brahm das Haus »die bestgehasste aller Bühnen« in Berlin.[23] Die Inszenierungen dieses Theaters hätten »in ihrer Lebendigkeit und Einheitlichkeit ihrer Stimmung die matten und abgezirkelten Aufführungen der klassischen Werke im Schauspielhaus (…) einfach totgeschlagen«.
L’Arronge hatte an den Erfolgen der Meininger gesehen, was ernsthafte Bemühung um die klassischen Stücke bedeuten konnte. Nicht nur Ruhm, nicht nur geschäftlichen Erfolg, sondern Grundlegung für die Entwicklung des Theaters überhaupt. Programmatisch hatte er Ende September, Anfang Oktober 1883 sein Theater mit Schillers ›Kabale und Liebe‹, Lessings ›Minna von Barnhelm‹ und Goethes ›Iphigenie auf Tauris‹ eröffnet und Jahr um Jahr seiner elf Jahre dauernden Direktion den klassischen Bestand neu erprobt, den Spielplan erweitert, Schillers ›Don Carlos‹ in Ludwig Barnays Regie (Barnay kam aus Meiningen) zwei Abende eingeräumt, dem ›Faust II‹ unter dem Bearbeitungstitel ›Fausts Tod‹ die Bühne geöffnet und ein Ensemble versammelt, das bald mit leuchtenden Namen das Publikum ins Haus zog. Hier fand der junge Josef Kainz seinen ersten Ruhm, als er Ferdinand, Pylades, Don Carlos spielte und bald den Narren im ›Lear‹ und den Romeo und den Prinzen von Homburg; hier reifte die junge Agnes Sorma zur Ophelia und zum Käthchen von Heilbronn, hier war Adele Sandrock die Minna und neben dem Liebling Hedwig Niemann-Raabe waren Theresina Geßner, Else Lehmann, Ludwig Barnay, Otto Sommerstorff, Georg Engels, Arthur Kraußneck und Siegwart Friedmann Mitglieder eines Ensembles von ungewöhnlicher Präsenz und Ausdruckskraft.
L’Arronge war ein eher konservativer Disponent seines Theaters. Ibsens ›Gespenster‹ hatte er zu spielen noch abgelehnt. Vergeblich hatte Otto Brahm ihm vorgehalten, die ›Gespenster‹ aufzuführen sei eine Aufgabe für das Deutsche Theater; sogar die Besetzung hatte er ihm schon genannt: Osvald – Josef Kainz; Regine – Frl. Sorma.[24] L’Arronge wagte es nicht, selbst Kainz – der später als Osvald triumphierte – blieb der Sache fremd. Erst in den letzten Jahren seiner Direktion, als die Bresche geschlagen war, die Zäsur endgültig gesetzt, wandte auch L’Arronge sich den Neuen zu, gab Ibsens ›Stützen der Gesellschaft‹ und (nach der ›Freien Bühne‹) von Hauptmann ›Einsame Menschen‹, ›Kollege Crampton‹ und den ›Biberpelz‹; dann zog er sich zurück und gab sich zufrieden in dem Bewusstsein, »daß das Beispiel des ›Deutschen Theaters‹ viel stärkere und einflussreichere Wirkung auf die Bühnenzustände in Berlin hervorgerufen hat als vordem die Meininger«.[25] Er hatte Recht, und wir werden an den Folgen sehen, warum. Er durfte in dieses Resümee sogar das neue, stattliche Lessing-Theater einbeziehen, das sein Konkurrent im heiteren Stückeschreiben, der lebensfrohe Oscar Blumenthal, am 11. September 1888 mit ›Nathan dem Weisen‹ eröffnete und so bewirkte, dass die beiden erfolgreichsten Spaßmacher innerhalb der Wilhelminischen Kultur, Adolph L’Arronge und Oscar Blumenthal, auch die beiden anspruchs- und wirkungsvollsten neuen deutschen Theater gründeten. Es waren Zukunftshäuser. Zu ihnen kam Ludwig Barnay, der am 16. September mit Schillers ›Demetrius‹ sein Berliner Theater auftat. Beides große Häuser mit je über eintausend Plätzen. Als künftige Konkurrenten des Deutschen Theaters verstärkten sie den Anspruch Berlins auf die führende Rolle im deutschen Theater.
Macht ein anderes Theater
Spätestens seit jener Aufführung der ›Gespenster‹ und der Konfrontation im Jahr 1887 wurden in der Stadt Kräfte aktiv, die ein »anderes Theater« verlangten; eines, in dem sich »Wahrheit« anders definierte. Nicht aus der Geschichte, nicht aus den erhabenen Beispielen der Klassiker, sondern aus den Ängsten und den sozialen Zuständen der Gegenwart. Sie verlangten nach einem Theater, das – frei von den Fesseln der Zensur – die Stücke neuer, junger Autoren spielen und sich durch systematische Arbeit eine neue öffentliche Bedeutung gewinnen sollte. Die Idee, dafür eine von Zensur und Konvention ›Freie Bühne‹ in Deutschland zu schaffen, ist in Gesprächen zwischen zwei Publizisten entstanden, von denen der eine, Theodor Wolff, aus seinen Tagen als Pariser Korrespondent des ›Berliner Tageblatts‹ wohl Erinnerungen an das ›Théâtre Libre‹ des André Antoine mitbrachte, und der andere, Maximilian Harden, als Theaterkritiker wie als politischer Publizist in Berlin eine fast dominierende Stellung behauptete. Für den 5. März 1889 luden sie acht Personen in die Weinstube von Kempinski: die Brüder Heinrich und Julius Hart, die in ihren ›Kritischen Streifzügen‹ für den neuen Naturalismus stritten, die Kritiker Otto Brahm und Paul Schlenther, die der alte Fontane als »die besten Namen der jungen Schule« rühmte, den jungen Verleger Samuel Fischer, Julius Stettenheim, den Satiriker, der als »Wippchen« Berlin erheiterte, den Rechtsanwalt Paul Jonas und den Theateragenten Stockhausen. Vier Wochen später gründeten die zehn den ›Verein Freie Bühne‹, weil nur die Vereinsform von der Zensur befreite Aufführungen, also »geschlossene« Vorstellungen auf dem Theater möglich machte. Sie wählten auf Betreiben von Maximilian Harden[26] Otto Brahm zu ihrem Sprecher und gaben ihm mit der ›Freien Bühne‹ ein Instrument in die Hand, das er bald kräftig nutzte.
Das Echo war stark. Ein Jahr nach der Gründung hatte der Verein tausend Mitglieder, also ein festes Publikum für die einmaligen Vorstellungen. Die Zerwürfnisse im Vorstand, die aus Richtungsgründen zum Ausscheiden Hardens, Wolffs und Stockhausens führten, konnten den Verein nicht erschüttern. Otto Brahm, 33 Jahre alt, hatte konkrete Vorstellungen, Energie, Durchsetzungskraft; die Ausgeschiedenen ersetzte er durch die Schriftsteller und Kritiker Fritz Mauthner, Ludwig Fulda und einen fast noch unbekannten jungen Schriftsteller aus Schlesien, der Bildhauer werden, aber auch einmal den Hamlet spielen wollte. Er saß in den Berliner Theatern, oft verdrossen über die »scheinbar hoffnungslose Barbarei« der Verballhornung der Stücke. Als er Ibsens ›Nora‹ 1884 gelesen hatte, notierte er schon: »Eine helle Fanfare.«[27] Er harrte der Entdeckung.
Dass die ›Freie Bühne‹ unter ihrem neuen Direktor Otto Brahm am 29. September 1889 – mehr als zwei Jahre nach der Aufführung von 1887 – mit einer Aufführung der ›Gespenster‹ eröffnete, war fast selbstverständlich. In Frankfurt, in Danzig und Königsberg durfte das Stück inzwischen öffentlich gezeigt werden. Noch immer nicht in der Reichshauptstadt. So war die einmalige Aufführung im Lessing-Theater (»Sonntag, Mittags 12 Uhr«) abermals mit Spannung geladen. Die Kritiker bestätigten ihr höheren künstlerischen Rang als der von 1887, Fontane rühmte Hans Meerys »treffliche Regie« und die Ausarbeitung der Rollen zu Charakteren. Denn das war die Aufgabe: mit den neuen Stoffen und Impulsen auch die neue Schauspielkunst zu entwickeln, die den larmoyant-sentimentalen, aber routiniert kalkulierten Effekt-Realismus des bürgerlichen Dramas überwand, wie er den von Frankreich herüberschwappenden Stücken der Dumas und Sardou eigen war. Denn das war – neben dem radikalen Angriff, der unmittelbaren Gegenwart auf der Bühne wieder Platz zu schaffen – das zweite Ziel der neuen Bewegung: Die Entdeckung des Menschen. Zum ersten Mal wurden im naturalistischen Theater nicht Rollen verkörpert, sondern Menschen dargestellt.
Natürlich hat das Theater immer von Menschen gehandelt. Aber wo waren je die äußeren und inneren Bedrängnisse der Menschen mit solcher Dringlichkeit und Nähe dargestellt, dass man sie und sich selbst in eine andere Welt wünschte? Dass man spürte, dass die Verhältnisse so nicht bleiben dürften, wenn ein menschenwürdiges, freies Leben möglich werden sollte? In Schillers ›Kabale und Liebe‹ hatte es einst so ein Beispiel gegeben. Aber die Spieltradition des nachklassischen Theaters hatte die darin steckende Klage und Anklage stumpf gemacht, die inzwischen vergangene Zeit hatte die aufstörende Fabel in eine ferne Welt gerückt. Die neue Bewegung erzählte keine alten Geschichten. Sie sagte: Dies ist deine Welt, dies sind deine Zeitgenossen, das ist ihre Situation, und das die Kräfte, die an ihnen zerren, die sie entfernen von dem, was sie sein könnten. So machen sie sich gegenseitig ihr Schicksal. Das war der Schock, der den herrschenden Idealismus endgültig zerbrach und aufräumte mit der schönen, geschönten Erscheinung des Menschen auf der Bühne. Die Veränderung im szenischen Personal begann.
Es begann das Sterben der Heroen und Heroinen, der Könige und Aristokraten, der Pathetiker und der edlen Frauen. Es erschienen nun Menschen in allen ihren von außen und innen geprägten Varianten: als Arrivierte, als Handwerker, als Arbeiter, als Beschädigte, Zukurzgekommene, als Kranke, Betrüger, Schädlinge, Illusionäre, Schwätzer und Trinker, als Arme und Reiche, vom Reichtum Deformierte, als Spekulanten, manche auch im schönen, provokanten Schein der Jugend. Sie wurden vorgeführt inmitten ihrer Konventionen, mit ihren Bindungen und Hoffnungen, in ihrem Milieu, das sie definierte. Die Außenbesichtigung war auch eine Innenbesichtigung von seelischen und ethischen Vorgängen, von Schuld-, Gewissens- und Triebproblemen und den Versuchen, den Weg ins Freie zu finden.
Die Kraft des Erwachens
Man kann sich heute schwer vorstellen, welchen Eindruck die neuen Dichtungen Ibsens auf die damals heranwachsende Jugend, die Siebzehn- bis Neunzehnjährigen machten, die in strengen Konventionen, in Begriffen von Gehorsam und Demut, in abverlangter Kirchlichkeit und einer ganz engen Liebesmoral erzogen waren. Eine von ihnen, die aus einer Husumer Adelsfamilie stammende Franziska von Reventlow hat darüber berichtet. »Dann fand ich eines Tages auf seinem Schreibtisch ›Brand‹ und ›Peer Gynt‹ und nahm es mir herüber. Ganze Tage habe ich darüber zugebracht und konnte weder essen noch schlafen, nur immer wieder lesen, sowie ich allein war. Es kam mir vor, als ob jedes Wort für mich geschrieben wäre, ich wußte mit einemmal, daß es keine unmöglichen Hirngespinste waren, mit denen ich kämpfte, – wenn sich alles in mir sträubte gegen das Leben, das man mir aufzwingen will. Früher empfand ich es immer als eine Art Unrecht gegen meine Eltern, mich so dagegen aufzulehnen und heimliche Sachen zu tun, aber nun ging es mir plötzlich auf, daß jeder ein unveräußerliches Recht an sein Ich und sein eigenes Leben hat. Wissen Sie die Stelle: das Eine darfst du nie verschenken, – dein Selbst, dein Ich, den heilgen Dom – du darfst’s nicht binden – nicht es lenken – nicht hemmen seines Lebens Strom.« Sie datierte den Brief auf den 3. März 1888. Da war sie siebzehn. Sie berichtet, wie sie miteinander über die Stücke, auch über ›Die Frau vom Meer‹ diskutierten, einen Ibsen-Club gründeten, wie sie selbst »Reden über Ibsen und moderne Ideen« hielt und Nietzsches ›Zarathustra‹ ihre Bibel wurde. »Die alte morsche Welt mit ihrer Gesellschaft und ihrem Christentum fiel in Trümmer, und die neue Welt, das waren sie selbst mit ihrer Jugend, ihrer Kraft, mit allem, was sie schaffen und ausrichten wollten. Es war wie ein gärender Frühlingssturm in ihnen, jeder träumte von einem ungeheuren Lebenswerk …«[28] »Mir ist, als ob ich auf einer Pulvertonne lebte, die jeden Augenblick in die Luft fliegen kann«, schrieb die Husumerin im Romanbrief vom August 1888. Der Satz könnte aus Wedekinds Schülertragödie ›Frühlings Erwachen‹ sein. Er begann damals an dem Stück zu schreiben.
Wir werden ähnlichen Impulsen, Bewusstseinsschüben noch öfter begegnen. In diesem Ersten aber fallen schon die neuen, die kommenden Wörter: Jugend, Ich Selbst, Neue Welt. Es sind das die ersten Beispiele eines denkwürdigen Vorgangs. Denkwürdig, dass dramatische Literatur in das Leben junger Menschen eingreifen und ihr Lebensverhalten verändern konnte; und dass diese für das Theater entworfene Literatur schon zu wirken begann, bevor das an allerlei Bedingungen, Beschränkungen und Rücksichten gebundene Theater sie überhaupt aufnahm. ›Brand‹ und ›Peer Gynt‹ sind erst 1898 und 1902 auf dem deutschen Theater erschienen.[29] Aber die Stücke wurden gedruckt; die Zensur mit ihren moralisch-politischen Beschränkungen galt nicht für die Drucklegung, nur für die Aufführungen. Das Erscheinen auf der Bühne war die erwartete, oft hart umkämpfte, oft auf die Geduldprobe gestellte zweite Veröffentlichung, ihre Öffnung ins öffentliche Bewusstsein. Dies wiederum zeigt, wie sehr die damals antretende Generation von Autoren mit dem Theater und auf das Theater hin dachte. Das Theater war (noch immer) das einzige verfügbare Instrument, bewegte und bewegende Bilder zu schaffen. Es zu nutzen als Instrument unseres bildnerischen Denkens, war also auch ein Vorgang von öffentlicher Bedeutung. Die Veröffentlichung eines Dramas im Druck war ein Vorlauf, als solcher auch ein Druckmittel für den Kampf mit der Zensur. Diese schnelle Regeneration des im Gewohnten verkommenen Theaters zu einem Brennpunkt des öffentlichen Lebens war fast die Sensation selbst. Vierzig Jahre hat es von der Kraft dieses Erwachens gelebt.
Die neuen Stücke mit ihrem harten Realismus brauchten eine neue Schauspielkunst. Sie war psychologisch, physiologisch und auch sozial zu begründen. Sie klärte die Details, entwickelte durch Einfühlung in Milieu und Rollen den bildlichen und mimischen Ausdruck für die Vorgänge im Innern der Personen, sie machte deren seelischen Abläufe miterlebbar und öffnete den Blick in die Abgründe der Seele und der Situationen, dass man ergriffen wurde von Verstehen, Mitfühlen und Erschrecken, von Sympathie für die leidenden Menschen.
Dies gehört als Wunder in den Geburtsakt der Moderne, dass eine Reihe bedeutender Schauspieler für die neuen Rollen bereit stand. Emanuel Reicher, der bald von sich sagte, er habe schon lange »diesen Stil in die Schauspielkunst hineinzutragen versucht (…) die schön stilisierten Reden der Menschen absichtlich zerhackt, um sie natürlicher zu machen«,[30] war nur ein Beispiel, Arthur Kraußneck ein anderes. Emerich Robert spielte nun erschütternd den Osvald. »Er veranschaulichte die grausigen Erscheinungen der angeerbten Gehirnkrankheit mit einer unheimlich peinigenden Wahrheit.«[31] So sah ihn Paul Lindau. Marie Schanzer (die Frau des Dirigenten Hans von Bülow) zeichnete die Helene Alving als eine moderne, nervöse Frau, die zerrieben ist von den Unentschiedenheiten und Zumutungen in ihrem Leben. Kraußneck gab den Pastor Manders als einen einfältigen, gottgläubigen und von den alten Idealen eingeschüchterten Mann und die junge Agnes Sorma die Regine. Ihr Stern ging hier auf: »Diese lebenstrotzende Sinnlichkeit, die gebieterisch nach Befriedigung lechzt, konnte nicht überzeugender und bei aller Waghalsigkeit zugleich dezenter zur Anschauung gebracht werden, als in dieser in ihrer Wahrheit erschütternden Darstellung.«[32] So abermals Lindau. Ibsen wurde von Otto Brahm bald als »Ahnherr« der Moderne gerühmt. Noch Alfred Kerr setzte diese Bezeichnung später als Titel über seinen großen Ibsen-Essay.[33] Die ›Freie Bühne‹ war mit dieser Aufführung der ›Gespenster‹ geschaffen; wenn auch in den Fesseln »geschlossener Vorstellungen«. Die Erwartung ging darauf, ob ein deutscher Autor sich fände, die neue Bewegung aufzunehmen.
Der Schock aus Schlesien
Kaum vier Wochen später – am Mittag des 20. Oktober 1889 – ging im neu eröffneten stattlichen Lessing-Theater das erste Stück eines jungen Autors in Szene, der »still und uns allen unbekannt« an jenem Mittag des Jahres 1887 die erste Aufführung der ›Gespenster‹ und die Darstellungskraft Emanuel Reichers miterlebt hatte. Sie waren für ihn wie eine Erweckung. »Die Vorstellung zeigte mir das wiedererstandene Theater. Von da ab fühlte ich meinen Beruf. Unendliche Möglichkeiten tauchten in mir auf, und ich spürte Kraft und Liebe, ihrer einige durch mein Leben zu entwickeln«, notierte er noch zehn Jahre später im Tagebuch.[34]Der junge, blonde, eher zarte Mann im Seminaristenrock sollte die kommende Epoche prägen. Sein Name war Gerhart Hauptmann. Er war von diesem Tag an in aller Munde. Sein Schauspiel ›Vor Sonnenaufgang‹ bestätigte und verschärfte die von Ibsen gesetzte Zäsur und übertrug den Bruch ins deutsche Drama.
Auch Hauptmanns Text war längst bekannt. Schon im September schrieb Fontane, nachdem er das Stück gelesen hatte, an den Buchhändler Paul Ackermann: »Ich war ganz benommen, und ich kann Ihnen nur gratulieren, etwas so hervorragendes edirt zu haben.«[35] Einige Zeitungen brachten schon Besprechungen und Hinweise, Skandal und Protest wurden für die Aufführung angekündigt, die Schauspieler in Drohbriefen aufgefordert, ihre Rollen zu verweigern. Brahm strich – um dem Skandal vorzubeugen – schon etliche »Brutalitätselemente«, wie Fontane sagte.[36] Man sah zum Termin und im überfüllten neuen Haus dennoch eine erstaunliche Aufführung. Brahm interessierte, wie Paul Schlenther bezeugte, weniger die ästhetische und soziale Tendenz des Stückes, »sondern der kühne Wagemut des Dichters, aller Konvention und Schablone gründlich zu entsagen, und der geniale Versuch, ein neues und volles Leben in dramatische Formen zu fassen«.[37]
Was auf die Bühne kam, ging über die harte Realität der ›Gespenster‹ hinaus, wenngleich Hauptmanns Stück das gleiche Thema anzuschlagen schien: den Fluch der Vererbung. Aber hier war alles ausgeweitet, über das Familiäre ins Soziale und Gesellschaftliche. Die schlesische Bauernfamilie war reich geworden, weil man unter ihren Feldern Kohle entdeckt hatte. Auf der Bühne eine Bauernstube, in der die frühere bäuerische Dürftigkeit mit Anzeichen von bürgerlichem Luxus überdeckt war. Sofa, Tisch, Buffet, ein Klavier zeigten die höhere Ambition, das zweite Bild den Hof des Gutes mit Stallungen und Brunnen, alles sehr realistisch gebaut. Die Schauspieler bewegten sich in konkreten Räumen. Alles war auf Natürlichkeit bedacht: die Kostüme wie die Sprache der Figuren, die Färbungen des Dialekts bei den Bauern und die Ambitionen zum Hochdeutsch bei den Gebildeteren unter den Personen. Inmitten der Prosperität des Kaiserreichs sah man ein Stück menschlicher Verelendung, und diese gerade aus den Gründen, denen sich jene Prosperität mit verdankte.
Der grölende Bauer verkam im Suff wie seine trunksüchtige Tochter. Deren Mann, der Ingenieur Hoffmann, machte den Herrn im Haus und ging seinen Vergnügungen nach; ebenso die zweite Frau des Bauern, eine Hofmagd, die nun die Vornehme spielte und es mit ihrem debilen Neffen trieb. Man sah in einen Sumpf von Schnaps und Hurerei, in dem es nur eine Lichtgestalt gab: die junge, bei den Herrnhutern erzogene, auf den Hof zurückgekehrte Helene. Sie begann, den Alfred Loth, der zu sozialen Studien ins Haus kam, – ein Sozialdemokrat, der von einer glücklichen Menschenzukunft schwärmte – als ihren Retter zu sehen und zu lieben. Als er aber von dem Arzt Schimmelpfennig über die Zustände im Haus und die Folgen der Trunksucht aufgeklärt war, floh er das verkommene Milieu, Helene zurücklassend. Die stürzt aus dem Zimmer der gebärenden, trunksüchtigen Schwester, die ein totes Kind zur Welt bringt, ruft nach ihrem geliebten Loth. In ihr Erschrecken über seine Flucht dröhnt das Gelalle des trunkenen Vaters; die Schreie der Magd sind dann die wortlos-hysterische Nachricht vom Selbstmord Helenes.
Das wuchtige, harte, erschreckende und erschütternde soziale Stück schlug dem Optimismus der zweiten Gründerjahre kalt ins Gesicht. In dieser Verknäuelung von Klage, Anklage und bedrängender Wahrheit traf man auf ein Menschengeflecht, wie es bis dahin auf der deutschen Bühne nicht zu sehen war. Figuren, von den neuen Verhältnissen um den Verstand gebracht, andere sie ausnutzend, fliehend, verachtend oder erduldend. Menschenuntergänge, Liebesmöglichkeiten und Hoffnungszusammenbrüche, die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft und die Folgen neukapitalistischer Ausbeutung. Es schreckten nicht nur die geschilderten Zustände, man sah sich im realistischen Spiel der Darsteller in eine Unmittelbarkeit des Miterlebens versetzt, die in ihrem gesteigerten Paroxysmus manchem unerträglich schien. Im Schicksal der Helene vollzog sich zugleich und fast schon symbolhaft der Untergang des Schönen, das bis dahin zu den Idealen des Theaters gehört hatte. Es trug von alters her Helenas Namen.
Die Aufführung wirkte durch die sorgsame Ausarbeitung aller Nebenrollen und im Zentrum durch das intensive Spiel der jungen Else Lehmann. Sie war die Helene, »heftig, herb, leidenschaftlich und zugleich doch weich und schmiegsam und von einer edlen Sehnsucht nach Wahrheit, Frieden und Liebe verzehrt«,[38] das eine mit dem anderen verbindend. So rühmte sie Fontane, und Julius Hart schrieb von der »großen Instinktkünstlerin echt naturalistischen Geblüts« und nannte sie »die ursprünglichste elementargewaltigste Tragödin«.[39] Es war ihr Durchbruch zu einer Hauptkraft des naturalistischen Theaters im künftigen Ensemble Otto Brahms, der sie vom Wallner-Theater geholt und den Schauspielern des Lessing-Theaters zugeordnet hatte. Regie führte abermals der Regisseur des Hauses, Hans Meery, der später in Stuttgart arbeitete. Gustav Kadelburg, dessen Name sich mit den erfolgreichsten Schwänken und der Heiterkeitskultur des Wilhelminischen Theaters verbindet, – er schrieb mit Oscar Blumenthal das Luststück vom ›Weißen Rößl‹ – spielte den Ingenieur Hoffmann.
Schon im Zweiten Akt (auf dem Gutshof) begann es im Publikum zu gären. Sogar die Liebesszene zwischen dem Weltverbesserer Loth und der jungen Helene, die viele der Kritiker rühmten, wurde durch Hohngelächter gestört. Als man im Fünften Akt die Geburtsschreie der Frau Hoffmann hörte, der Arzt im Vordergrund den Weltverbesserer Loth aufklärte und zu der Gebärenden gerufen wurde, brach ein Protest aus, der in die Geschichte des Theaters einging. Dr. Isidor Kastan, Arzt, Schriftsteller und Redakteur des ›Berliner Tageblatts‹, zog aus einem Paket eine Geburtszange, sprang vom Sitz auf und rief zornig, das Instrument schwenkend: »Soll ich helfen kommen, Herr Kollege?« So überliefert die Szene Ernst von Wolzogen, selbst Schriftsteller, bald Erfinder des ›Überbrettel‹, der in der Reihe hinter dem kleinen Kastan saß, den er einen »fanatischen Spektakelmacher« und »Spezialisten für sittliche Entrüstung« im ›Berliner Tageblatt‹ nannte.[40] Es muss auch der Satz gefallen sein: »Sind wir denn in einem Bordell?« So wenigstens steht es in den Gerichtsakten des (vergeblichen) Prozesses, durch den Dr. Kastan aus der ›Freien Bühne‹ ausgeschlossen werden sollte. Die Ohren, die den Satz hörten, gehörten erlauchten Männern: dem schon erwähnten, stadtbekannten »Wippchen« und dem sehr ernsthaften Kritiker und Philosophen Fritz Mauthner, die man schon vorsorglich, sozusagen »als Polizisten«, neben den später auf dem Flur auch noch verprügelten Hitzkopf Kastan gesetzt hatte.
In Kastans Aktion gegen die Zumutung der Szene wie gegen die ganze Veranstaltung steckte ein Protest gegen die naturalistische Richtung, die neue »Rinnsteinkunst« überhaupt, die sich hier Bahn brach. Kastans Geburtszangen-Aktion verwandelte sich unfreiwillig in eine symbolische Handlung. Die Aufführung bestätigte die Geburt einer neuen Epoche auf dem Theater: den Beginn der Moderne. So begriff der Student Alfred Kerr Kastans Aktion. Kerr schrieb, von Hauptmann begeistert, in sein Tagebuch: »Das ist er«; er stand an jenem Mittag hoch oben im Rang und rief von dort »Maul halten!« und dann »Hauptmann!…Hauptmann!…« Und seinen Enthusiasmus von damals fasste er mit den Worten: »Freiheit! Freiheit! Freiheit! Es sollte vorüber sein, bei uns, mit dem Leeren und Spießigen.«[41]
Das Echo in den Zeitungen übertraf noch die Ablehnung der ›Gespenster‹. Im ›Börsen-Courier‹ hieß es, Hauptmanns Drama sei »das Abstoßendste, was je auf einer Bühne erschien, das Abstoßendste, das eine geübte Realisten-Phantasie ersinnen kann«. Der altehrwürdige Kritiker der ›Nationalzeitung‹, Karl Frenzel, nannte das Stück »eine Versündigung gegen Sitte, Gefühl und Geschmack«, Maximilian Harden, Starjournalist, abtrünniger Mitbegründer der ›Freien Bühne‹, sprach von einer »leider ernst gemeinten, ausgezeichneten Parodie«.[42] Und Paul Lindau, Journalist, bekannter Stückeschreiber und einst Direktor des Meininger Hoftheaters, lobte die Liebesszene zwar als Beweis für das Hauptmannsche Talent, aber alles andere galt ihm als »widerwärtig«: »Ja, widerwärtig! Ich finde keinen milderen Ausdruck für das, was ich in diesem dramatischen Versuche als das Produkt der neuen Schule betrachten muß. Was will sie denn eigentlich, diese neue Schule? Wahrheit? (…) Ist nur das Häßliche, das Ekelhafte wahr? nur der Unrat, die Jauche, die Kloake? Ist alles Andere Lug und Trug, feige Beschönigung und jämmerliche Schminke? Da stehen wir eben am Scheidewege.«[43]