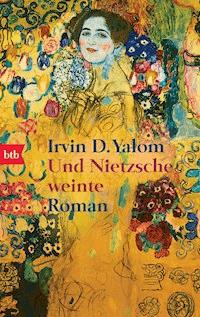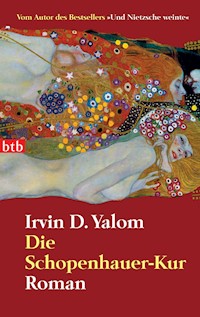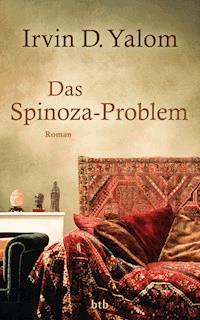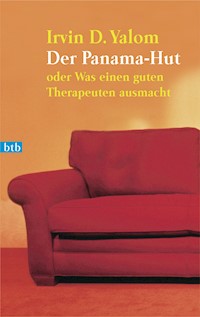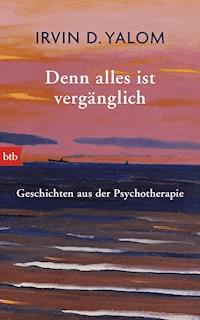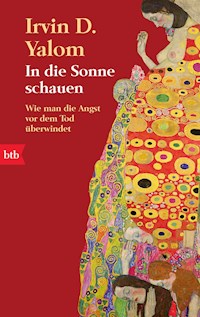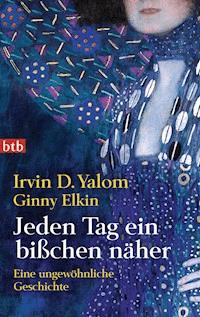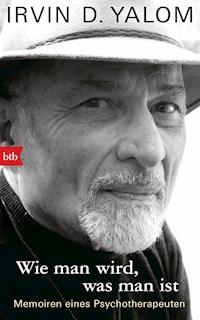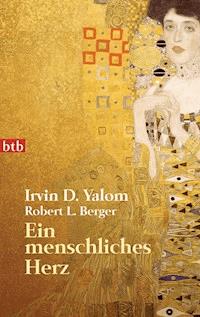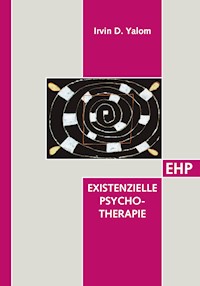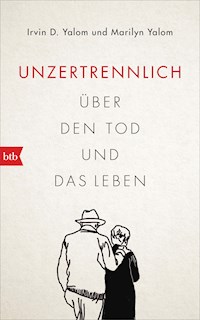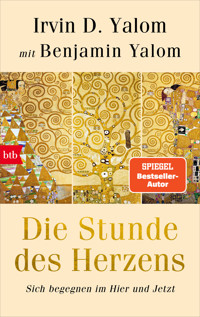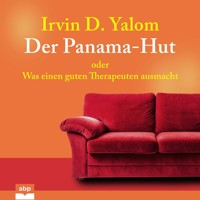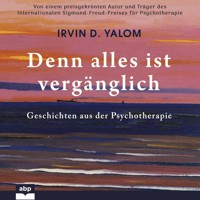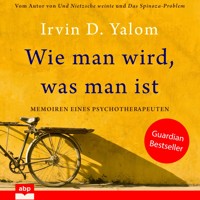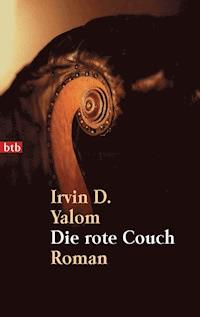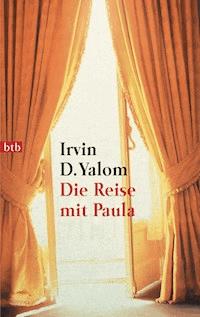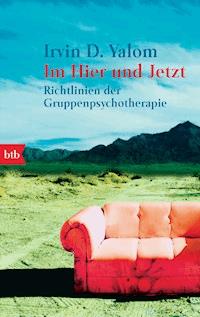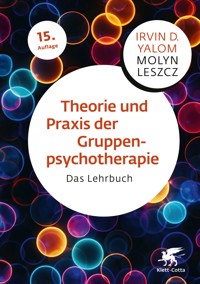
64,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
DAS Standardwerk in überarbeiteter Neuauflage - Über 30.000 verkaufte Exemplare - Komplett überarbeitet mit einem neuen Kapitel zu Online-Gruppentherapie und weiteren innovativen Ansätzen Die Neuausgabe enthält alle signifikanten Innovationen, die sich seit der letzten Revision vor 15 Jahren in Forschung und Praxis der Gruppenpsychotherapie entwickelt haben. In dem Maße, wie neue psychologische Syndrome, Settings und theoretische Ansätze entstanden sind, haben sich auch entsprechende Varianten der Gruppentherapie etabliert. Dem trägt das Buch ebenso Rechnung wie der Tatsache, dass Therapie heute verstärkt mit unterschiedlichen ethnokulturellen Hintergründen bei den Patient:innen umgehen muss. Auch dass Gruppentherapie heute häufig online angeboten wird, schafft neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, für die in dieser Ausgabe Hilfestellungen geboten werden. Nicht mehr so relevante Inhalte wurden herausgenommen, viele neue Themen und Materialien sind dazugekommen: Damit ist das Praxishandbuch wieder hochaktuell. »Wieder einmal haben Yalom und Leszcz einen Volltreffer gelandet. Die Breite und Tiefe der behandelten Forschung ist wirklich beeindruckend. Es ist jedoch der bemerkenswert fesselnde Schreibstil, der diese empirisch fundierten Prinzipien der Gruppenpsychotherapie nahtlos in einen zwischenmenschlichen Rahmen einbettet, der dieses Buch zu einem einzigartigen Klassiker macht. Die lehrreichen und überzeugenden klinischen Beispiele unterstützen angehende Therapeuten, während die zeitgemäßen Gruppeninterventionen den erfahrenen Gruppenleiter dazu einladen, Neuland zu betreten.« Gary Burlingame, Professor und Lehrstuhlinhaber für Psychologie, Brigham Young University
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1627
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Irvin D. YalomMolyn Leszcz
Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie
Das Lehrbuch
15., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Aus dem Amerikanischen von Teresa Junek, Theo Kierdorf und Gudrun Theusner-Stampa
Klett-Cotta
Stimmen zur 15. Auflage
»Dieses Buch ist ein echter Klassiker. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz der Gruppenpsychotherapie in den Gesundheitssystemen verschiedener Länder ist diese Neuauflage eine wirklich unverzichtbare Hilfe für Kliniker und verbindet in hervorragender Weise Forschungsergebnisse und klinisches Wissen. Es ist DAS Buch zur Theorie und Praxis der Gruppentherapie, das inzwischen Generationen von Gruppenpsychotherapeuten unterstützt hat.« Bernhard Strauß, Universitätsklinikum Jena
»Diese neue Ausgabe bietet uns die wertvolle Gelegenheit, von der Weisheit und dem Fachwissen der phänomenalen Partnerschaft von Irvin Yalom und Molyn Leszcz zu profitieren. Dieses Werk behält die Stärken früherer Ausgaben in Bezug auf unschätzbare klinische Erkenntnisse und Fallbeispiele bei, führt aber neues Material ein, das diese Ausgabe bereichert. Als Reaktion auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie haben sie ein Kapitel über Online-Gruppen aufgenommen. Ich freue mich darauf, diese aktualisierte Ausgabe und wertvolle Ressource, die auf neuesten Forschungsergebnissen beruht, mit meinen Studenten und Kollegen zu teilen.« Alexis D. Abernethy, Professorin für Psychologie am Fuller Seminary
»Die Lektüre dieser mit Spannung erwarteten Neuauflage eines echten Klassikers auf diesem Gebiet ist wie eine Rückkehr nach Hause nach einer gewissen Zeit der Abwesenheit: Das beruhigende Gefühl, vertraute, bewährte Begriffe wiederzufinden, vermischt sich mit der Aufregung über neue Entdeckungen und Entwicklungen auf diesem Gebiet. Wie seine Vorgänger spricht auch dieser Band den Gruppentherapeuten, ob Anfänger oder Experte, in einer erfahrungsnahen, klinikerfreundlichen Sprache an und lässt die Gruppenerfahrung im Kopf lebendig werden. Es repräsentiert den aktuellen Stand der Gruppentherapie.« Les R. Greene, Distinguished Life Fellow, American Group Psychotherapy Association
»Wieder einmal haben Yalom und Leszcz einen Volltreffer gelandet. Die Breite und Tiefe der behandelten Forschung ist wirklich beeindruckend. Es ist jedoch der bemerkenswert fesselnde Schreibstil, der diese empirisch fundierten Prinzipien der Gruppenpsychotherapie nahtlos in einen zwischenmenschlichen Rahmen einbettet, der dieses Buch zu einem einzigartigen Klassiker macht. Die lehrreichen und überzeugenden klinischen Beispiele unterstützen angehende Therapeuten, während die zeitgemäßen Gruppeninterventionen den erfahrenen Gruppenleiter dazu einladen, Neuland zu betreten.« Gary Burlingame, Professor und Lehrstuhlinhaber für Psychologie, Brigham Young University
»Die Partnerschaft zwischen Yalom und Leszcz bringt neue Originalität in einen Text, der – wie kein anderer – das Feld geprägt hat, das Yalom vor fünfzig Jahren mitbegründet hat. Die Weiterentwicklung des interpersonellen Modells, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, ist weitreichend und umfassend und verleiht diesem Buch einen neuen Stellenwert für Therapeuten aller Richtungen – ein bleibender Schatz für Praktiker und Lehrende gleichermaßen« John Schlapobersky, Autor von »From the Couch to the Circle«
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Theory and Practice of Group Psychotherapy«,
6th edition, published by Basic Books, an imprint of Perseus Books, a subsidiary of Hachette Book Group
First published by Basic Books 1970/6th edition 2020
© 2020 by Irvin D. Yalom and Molyn Leszcz
All Rights Reserved
Für die deutsche Ausgabe
© 1996/2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Weiß-Freiburg GmbH, Freiburg
unter Verwendung einer Abbildung von amrets/Adobe Stock
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98781-2
E-Book ISBN 978-3-608-12281-7
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20669-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort zur sechsten amerikanischen Ausgabe
Danksagungen
Kapitel 1
Die therapeutischen Faktoren
Hoffnung wecken
Universalität des Leidens
Mitteilen von Informationen
Altruismus
Die korrigierende Rekapitulation des Geschehens in der primären Familiengruppe
Die Entwicklung sozialer Kompetenz
Imitationsverhalten
Kapitel 2
Interpersonelles Lernen
Die Bedeutung interpersoneller Beziehungen
Die korrigierende emotionale Erfahrung
Die Gruppe als sozialer Mikrokosmos
Der soziale Mikrokosmos: Eine dynamische Interaktion
Das Erkennen von Verhaltensmustern im sozialen Mikrokosmos
Existiert der soziale Mikrokosmos tatsächlich?
Übertragung und Einsicht
Zusammenfassender Überblick
Kapitel 3
Die Kohäsionskraft der Gruppe
Die Bedeutung der Gruppenkohäsion
Der Wirkmechanismus
Zusammenfassung
Kapitel 4
Die therapeutischen Faktoren – Ein integrierender Überblick
Der Wert der einzelnen therapeutischen Faktoren aus der Sicht des Klienten
Unterschiede in der Einschätzung therapeutischer Faktoren durch Klienten und Therapeuten
Kräfte, die die Wirkung therapeutischer Faktoren verändern
Kapitel 5
Der Therapeut – Grundlegende Aufgaben
Zusammenstellung und Erhaltung der Gruppe
Der Aufbau einer Gruppenkultur
Wie beeinflusst der Gruppenleiter die Entstehung von Gruppennormen?
Therapeutische Gruppennormen
Kapitel 6
Der Therapeut: Arbeiten im Hier und Jetzt
Definition von Prozess
Die Konzentration auf den Prozess: Die Kraftquelle der Gruppe
Die Aufgaben des Therapeuten im Hier und Jetzt
Techniken der Aktivierung des Hier und Jetzt
Techniken zur Klärung des Prozesses
Wie man Klienten zu einer Prozessorientierung verhilft
Wie man Klienten hilft, klärende Prozesskommentare zu akzeptieren
Der Prozesskommentar: ein theoretischer Überblick
Die Nutzung der Vergangenheit
Kommentare zum Prozess der Gruppe als Ganzes
Kapitel 7
Der Therapeut: Übertragung und Transparenz
Die Übertragung in der Therapiegruppe
Der Psychotherapeut und die Transparenz
Kapitel 8
Klienten auswählen und Gruppen zusammenstellen
Ausschlusskriterien
Aufnahmekriterien
Zusammenfassung: Auswahl der Klienten
Gruppenzusammensetzung
Die Vorhersage des Verhaltens von Klienten in der Gruppe
Zusammenfassung: Vorhersage des Klientenverhaltens
Prinzipien der Gruppenzusammensetzung
Homogenität oder Heterogenität?
Allgemeine klinische Überlegungen
Zusammenfassung: Gruppenzusammensetzung
Kapitel 9
Die Bildung der Gruppe
Äußerer Rahmen und Struktur
Kurzzeittherapie mit Gruppen
Sitzungen vor der Gruppe und Vorbereitung auf die Gruppentherapie
Kapitel 10
Zu Beginn
Die Entstehungsphasen der Gruppe
Der Einfluss der Klienten und anderer Faktoren auf die Entwicklung der Gruppe
Probleme der Gruppenmitgliedschaft
Kapitel 11
Die fortgeschrittene Gruppe
Wie interpersonelles Lernen funktioniert
Die Bildung von Untergruppen
Konflikte in der Therapiegruppe
Selbstoffenbarung
Die Beendigung der Therapie
Kapitel 12
Arbeit mit herausfordernden Gruppenmitgliedern
Der Alleinunterhalter
Der schweigende Klient
Der Langweiler
Der jede Hilfe ablehnende »Jammerer«
Der akut psychotische Klient
Der schizoide Klient
Der charakterlich schwierige Klient
Kapitel 13
Spezielle Behandlungsformen und Techniken
Gleichzeitige Einzel- und Gruppentherapie
Kombinieren einer Gruppentherapie mit einer Zwölf-Schritte-Gruppe
Co-Therapeuten
Träume
Audiovisuelle Technik
Schriftliche Zusammenfassungen
Monitoring der Ergebnisse und des Prozesses der Gruppentherapie
Strukturierte Übungen
Dokumentation der Gruppentherapie
Kapitel 14
Online-Psychotherapiegruppen
Online-Gruppen: Frühe Ergebnisse
Leitlinien für Gruppenpsychotherapeuten
Herausforderungen und Chancen von Online-Gruppen
Kapitel 15
Spezialisierte Therapiegruppen
Die Abwandlung der traditionellen Gruppentherapie für spezielle klinische Situationen: Grundlegende Schritte
Die Therapiegruppe für akut kranke, stationäre Klienten
Gruppen für Klienten mit physischen Krankheiten
Adaptation von KVT und IPT an die Gruppentherapie
Selbsthilfegruppen und Internet-Unterstützungsgruppen
Kapitel 16
Die Ausbildung des Gruppentherapeuten
Das Beobachten erfahrener Kliniker
Supervision
Eine Gruppenerfahrung für Ausbildungskandidaten
Persönliche Psychotherapie
Zusammenfassung
Jenseits der Technik
Anhang
Einige Ziele der Gruppenpsychotherapie
Vertraulichkeit
Was ist in der Gruppe zu tun? Welches Verhalten wird von Ihnen erwartet?
Gruppentherapeuten
Anfängliche Verpflichtung oder Probezeit
Teilnahme und Gruppenkohäsion
Online-Gruppen
Anmerkungen
Anmerkungen zu Kapitel 1
Anmerkungen zu Kapitel 2
Anmerkungen zu Kapitel 3
Anmerkungen zu Kapitel 4
Anmerkungen zu Kapitel 5
Anmerkungen zu Kapitel 6
Anmerkungen zu Kapitel 7
Anmerkungen zu Kapitel 8
Anmerkungen zu Kapitel 9
Anmerkungen zu Kapitel 10
Anmerkungen zu Kapitel 11
Anmerkungen zu Kapitel 12
Anmerkungen zu Kapitel 13
Anmerkungen zu Kapitel 14
Anmerkungen zu Kapitel 15
Anmerkungen zu Kapitel 16
Irv Yalom:Ich möchte dieses Buch Marilyn widmen, meiner geliebten Frau, die nach 65 Jahren Ehe 2019 gestorben ist.
Molyn Leszcz:Für die nächste Generation: Sid, Pete, Lucy und Margot
Vorwort zur sechsten amerikanischen Ausgabe
Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit die fünfte Neuausgabe dieses Fachbuchs veröffentlicht wurde. In dieser sechsten Ausgabe werden wir die signifikanten neuen Innovationen beschreiben, die sich während dieser Zeit in der Gruppentherapie entwickelt haben. Wir freuen uns und sind dankbar, unsere lange Zusammenarbeit fortsetzen zu können, die vor 40 Jahren an der Stanford University begann. Wir sind an unsere gemeinsame Arbeit als erfahrene Co-Therapeuten herangegangen und haben uns beim Verfassen dieser Edition gegenseitig unterstützt und herausgefordert. Größtenteils schreiben wir als »wir«, wobei beide Stimmen miteinander verwoben sind. Bestimmte Stellen, die eine persönliche Erfahrung des einen oder anderen von uns darlegen, kennzeichnen wir, indem wir in die erste Person wechseln und in Klammern angeben, wer von uns die Erzählung übernimmt: IY oder ML.
Unser Ziel ist, unseren Lesern eine Synthese aus aktuellen Erkenntnissen und gesammelten Erfahrungen aus der Praxis der Gruppentherapie zu bieten. Wir beziehen in großem Umfang klinische Darstellungen ein, um diese Konzepte und Prinzipien lebendig zu machen und das Buch praktisch und lehrreich zu gestalten. Es soll für Studierende, Lehrgangsteilnehmer und Praktikerinnen von unmittelbarem Nutzen sein und Supervisoren und Lehrenden als nützliche Ressource dienen.
Seit ihrer Einführung in den 1940er-Jahren hat sich die Gruppentherapie ständig an die Veränderungen in der klinischen Praxis angepasst. In dem Maße, wie neue klinische Syndrome, Settings und theoretische Ansätze aufgekommen sind, haben sich auch entsprechende Varianten der Gruppentherapie entwickelt. Die Vielfalt der Formen ist heute so groß, dass es sinnvoller ist, von »Gruppentherapien« als von »Gruppentherapie« zu sprechen. Für alle Altersgruppen und alle klinischen Bedürfnisse gibt es durchweg überzeugende Belege, dass Gruppentherapie wirksam ist, im Allgemeinen die gleiche Wirkung hat wie Einzeltherapie und weitaus kostengünstiger ist. Dies gilt sowohl für die Behandlung psychischer Erkrankungen wie auch für die Behandlung von Suchterkrankungen und in zunehmendem Maße auch für die Behandlung körperlich Erkrankter.
Die Online-Welt macht den Zugang zu Gruppen viel einfacher. Die geografische Lage ist nicht mehr das Hindernis, das sie einmal war, sofern das Internet zugänglich ist. Neue technologische Plattformen schaffen neue Möglichkeiten und Herausforderungen für Gruppentherapeutinnen und -therapeuten (siehe Kapitel 14). Was ist gleich und was ist anders, wenn sich die Gruppentherapie vom Gruppenraum auf den Gruppenbildschirm verlagert? Dies sind Fragen, mit denen wir uns in diesem Band beschäftigen werden.
Da Klientinnen und Klienten mit unterschiedlichem ethnokulturellen Hintergrund sowohl in Nordamerika als auch in der ganzen Welt Gruppentherapie in Anspruch nehmen, ist es für Therapeuten wichtig, eine multikulturelle Orientierung sowie Sensibilität und Fachwissen in Bezug auf kulturelle Anpassung zu entwickeln. Therapiegruppen sind seit jeher Räume für »schwierige Dialoge« und Diskurse, und Fragen der ethnischen Zugehörigkeit und der Geschlechtsidentität können in einem aufgeschlossenen therapeutischen Gruppenumfeld wirksam behandelt werden (siehe Kapitel 15). Gruppentherapie ist ein wirkungsvolles Hilfsmittel für die Arbeit mit traumatisierten und geflüchteten Menschen.
Paradoxerweise hat jedoch trotz der breiten klinischen Anwendung von Gruppentherapien die Berufsausbildung für Gruppentherapeuten nicht Schritt gehalten. Immer weniger Ausbildungsprogramme – sei es in der Psychologie, der Sozialen Arbeit, der Seelsorge oder der Psychiatrie – bieten die Art von vertiefter Ausbildung und Supervision, die künftige Praktiker benötigen. Allzu oft und in zu vielen Bereichen werden Gruppentherapeuten in die Praxis gedrängt und gebeten, Gruppen von Klienten mit komplexer Geschichte und unterschiedlichen Bedürfnissen zu leiten, ohne dass sie dafür ausreichend ausgebildet sind oder Supervision erhalten. Wirtschaftlicher Druck, Kompetenzstreitigkeiten und die derzeitige Dominanz biologischer Erklärungen und der Pharmakotherapie im Bereich der psychischen Gesundheit haben alle zu dieser Situation beigetragen. Jede Generation glaubt naiverweise, dass sie die wahre Lösung entdeckt hat. Die psychische Gesundheit ist ein Bereich, der wie kein anderer zwischen eifriger Überbewertung und eifriger Abwertung pendelt, und das sogar bei den eigenen Therapeutinnen. Wir sind daher sehr froh, dass die American Psychological Association vor Kurzem die Gruppenpsychotherapie als Spezialgebiet anerkannt hat. Dies wird zu größeren Investitionen in die Aus- und Weiterbildung ermutigen. Wir hoffen, dass die Gruppentherapie damit den Status erhält, den ihre immer weiter verbreitete Praxis rechtfertigt. Wir wissen, dass die Ausbildung transformativ sein kann.
Gruppentherapeutinnen von heute werden auch von der Forderung nach größerer Verantwortlichkeit in der Praxis beeinflusst. Evidenzbasierte Praxis ist ein Standard, an den wir uns alle halten müssen. Viele Jahre lang haben sich Therapeuten gegen diese Hochschätzung von Forschung, Messungen und Daten als Leitlinien für eine wirksame Praxis gewehrt, da sie dies als Eingriff in ihre Arbeit empfanden – als Eingriff, der ihre Autonomie beeinträchtigte und ihre Kreativität hemmte. Die Vorstellung einer evidenzbasierten Praxis als eng gefasste Vorgabe ist jedoch anachronistisch. Wir sind der Auffassung, dass ein effektiverer Ansatz darin besteht, die evidenzbasierte Praxis als ein Set von Leitlinien und Grundsätzen zu betrachten, welche die Effektivität der Therapeuten verbessern. Das gesamte Buch basiert auf den Merkmalen einer evidenzbasierten Gruppentherapie: Aufbau von Gruppen mit starkem Zusammenhalt und guten Beziehungen; echte und sorgfältige Empathie, die gut kommuniziert wird; bewusster Umgang mit Gegenübertragung und Aufrechterhaltung von kultureller Bewusstheit und Sensibilität. Ein reflektierter Umgang mit unserer Arbeit und die bewusste Konzentration auf unsere kontinuierliche berufliche Entwicklung sind Aspekte, die zu evidenzbasierten Gruppentherapien gehören. Das Sammeln von Daten aus unseren laufenden Gruppen gibt uns ein zeitnahes und relevantes Feedback darüber, was tatsächlich von Sitzung zu Sitzung und von Klient zu Klientin geschieht, und trägt ebenfalls dazu bei, evidenzbasiert zu sein (siehe Kapitel 13).
Wir wissen, dass die von Gruppentherapeutinnen verwendeten Ansätze verwirrend vielfältig sind: kognitiv-verhaltenstherapeutische, psychoedukative, interpersonelle, gestalttherapeutische, supportive-expressive, modern-analytische, psychoanalytische, dynamisch-interaktionelle und psychodramatische Ansätze – all diese und viele mehr werden in der Gruppentherapie eingesetzt. Gruppentherapeuten nutzen auch die Fortschritte in unserem Verständnis der menschlichen Bindung und der Neurobiologie zwischenmenschlicher Beziehungen, da wir in unserer Arbeit Psyche, Körper und Gehirn integrieren (siehe Kapitel 2 und 3).
Wie also kann man ein einzelnes Buch schreiben, das alle diese Gruppentherapien behandelt? Die Strategie, die der ersten Ausgabe dieses Buches zugrunde lag, scheint immer noch tragfähig zu sein. Wir versuchen, bei jeder der Gruppentherapien die »Fassade« vom »Kern« zu trennen. Die Fassade besteht aus dem Drumherum, der Form, den Techniken, der Fachsprache und der Aura, die jede der ideologischen Schulen umgibt; der Kern besteht aus jenen Aspekten der Erfahrung, die für den therapeutischen Prozess wesentlich sind, d. h. aus den grundlegenden Mechanismen der Veränderung.
Wenn man die »Fassade« außer Acht lässt und nur die tatsächlichen Mechanismen betrachtet, die bei Klienten eine Veränderung bewirken, wird man feststellen, dass die Veränderungsmechanismen zahlenmäßig begrenzt und in den verschiedenen Gruppen bemerkenswert ähnlich sind. Therapiegruppen mit ähnlichen Zielen, die von außen betrachtet grundverschieden erscheinen, können sich auf identische Veränderungsmechanismen stützen. Diese Veränderungsmechanismen bilden das zentrale Ordnungsprinzip dieses Buches. Wir beginnen mit einer detaillierten Erörterung von elf therapeutischen Faktoren und beschreiben dann einen gruppenpsychotherapeutischen Ansatz, der auf diesen Faktoren beruht (siehe Kapitel 1, 2, 3 und 4).
Aber welche Arten von Gruppen sollen besprochen werden? Die Palette an Gruppentherapien ist mittlerweile so umfangreich, dass es unmöglich ist, jede Art von Gruppe einzeln zu behandeln. Stattdessen konzentrieren wir unsere Ausführungen auf eine prototypische Variante – die ambulante Psychotherapiegruppe – und bieten dann eine Reihe von Grundprinzipien an, die es Therapeuten ermöglicht, dieses grundlegende Gruppenmodell an jede spezielle klinische Situation anzupassen (siehe Kapitel 15).
Unsere prototypische ambulante Psychotherapiegruppe trifft sich mindestens mehrere Monate lang mit den ehrgeizigen Zielen, sowohl die Symptome zu lindern als auch die Persönlichkeit zu verändern. Wir beschreiben diese Gruppe in allen Einzelheiten, von der Gründung bis zum Abschluss. Wir beschreiben, wie die Gruppenmitglieder effektiv ausgewählt und die Gruppe zusammengestellt wird (siehe Kapitel 8) sowie die Vorbereitung (siehe Kapitel 9). Anschließend beschreiben wir die Entwicklung der Gruppe von den Anfängen bis hin zu den fortgeschrittenen Stadien und häufige klinische Herausforderungen (siehe Kapitel 10, 11 und 12).
Warum sollte man sich auf diese besondere Form der Gruppentherapie konzentrieren, wenn die heutige, ökonomisch bestimmte Therapieszene von anderen Arten von Gruppen dominiert wird, die sich für kürzere Zeiträume mit begrenzteren Zielen treffen? Die Antwort ist, dass es die Langzeit-Gruppentherapie schon seit vielen Jahrzehnten gibt und dass sie sowohl durch empirische Forschung als auch durch aufmerksame klinische Beobachtung einen großen Wissensschatz angesammelt hat. Wir sind der Ansicht, dass die prototypische Gruppe, die wir in diesem Buch beschreiben, eine intensive, ehrgeizige Form der Therapie ist, die sowohl Klientinnen als auch Therapeutinnen viel abverlangt. Diese Gruppe bietet Gruppentherapeuten auch einen einzigartigen Blickwinkel, durch den sie etwas über Gruppenprozesse, Gruppendynamik und Gruppenleitung lernen können, was ihnen in ihrer gesamten klinischen Arbeit von Nutzen sein wird. Die für die Leitung einer solchen Gruppe erforderlichen therapeutischen Strategien und Techniken sind anspruchsvoll und komplex (siehe Kapitel 5, 6 und 7). Sobald die Ausbildungsteilnehmer diese jedoch beherrschen und wissen, wie sie sie an spezielle Therapiesituationen anpassen können, werden sie in der Lage sein, eine für jede klinische Population und in jedem Umfeld wirksame Gruppentherapie zu gestalten.
Ausbildungsteilnehmer sollten danach streben, kreative und einfühlsame Therapeuten zu sein, die wissen, wie man die Theorie in die Praxis umsetzt. Dies erfordert einfühlsame Supervisoren mit einem ähnlichen Verständnis (siehe Kapitel 16). Die steigende Nachfrage nach klinischer Betreuung und die Wirksamkeit und Effizienz der Gruppentherapie machen sie zur Behandlungsform der Zukunft. Gruppentherapeuten müssen so gut wie möglich auf diese Entwicklung vorbereitet sein. Und sie müssen in der Lage sein, gut für sich selbst zu sorgen, damit sie andere weiterhin effektiv behandeln und in ihrer Arbeit einen Sinn finden können.
Da die meisten Leserinnen und Leser dieses Buches Therapeuten sind, soll dieser Text unmittelbare therapeutische Relevanz haben. Wir glauben jedoch auch, dass es für gute Therapie unabdingbar ist, mit der Welt der Forschung verbunden zu bleiben. Selbst wenn Therapeutinnen nicht persönlich in der Forschung tätig sind, müssen sie wissen, wie die Forschung anderer zu bewerten ist.
Eine der wichtigsten Grundannahmen dieses Textes ist, dass die zwischenmenschliche Interaktion im Hier und Jetzt für eine wirksame Gruppentherapie entscheidend ist. Die tatsächlich wirksame Therapiegruppe bietet eine Arena, in der Klienten frei mit anderen interagieren können und dann den Mitgliedern helfen, zu erkennen und zu verstehen, was in ihren Interaktionen schiefläuft. Letztlich befähigt die Gruppe unsere Klientinnen dazu, diese maladaptiven Muster zu verändern. Wir sind der Meinung, dass Gruppen, die ausschließlich auf anderen Annahmen beruhen, wie z. B. psychoedukativen oder kognitiv-verhaltenstherapeutischen Prinzipien, nicht die volle therapeutische Wirkung entfalten können. Jede dieser Formen der Gruppentherapie kann durch die Einbeziehung des Bewusstseins für zwischenmenschliche Prozesse effektiver gestaltet werden. In diesem Text erörtern wir eingehend das Ausmaß und die Art des interaktionellen Fokus und seine Fähigkeit, bedeutende charakterliche und zwischenmenschliche Veränderungen herbeizuführen. Der interaktionelle Fokus ist der Motor der Gruppentherapie, und Therapeuten, die in der Lage sind, ihn zu nutzen, sind viel besser für alle Formen der Gruppentherapie gerüstet, selbst wenn das Gruppenmodell die zentrale Bedeutung der Interaktion nicht betont oder anerkennt (siehe Kapitel 15).
Mein (IY) Roman Die Schopenhauer-Kur kann als Begleitband zu diesem Text dienen: Er spielt in einer Therapiegruppe und veranschaulicht viele der Prinzipien des Gruppenprozesses und der Techniken, die im vorliegenden Text vorgestellt werden. Daher verweisen wir in dieser Ausgabe an mehreren Stellen auf Abschnitte aus Die Schopenhauer-Kur, die fiktionalisierte Darstellungen von Therapietechniken bieten.
Zu dicke Bände landen oft in den Regalen für Nachschlagewerke. Um dieses Schicksal zu vermeiden, haben wir darauf verzichtet, diesen Text in die Länge zu ziehen. Die Hinzufügung von viel neuem Material hat uns daher gezwungen, ältere Abschnitte und Zitate zu streichen. Dies war eine schmerzhafte Aufgabe, und die Streichung vieler verworfener Passagen hat nicht nur unsere Finger, sondern auch unsere Herzen gequält. Aber wir hoffen, das Ergebnis ist ein zeitgemäßes und aktuelles Werk, das Ausbildungsteilnehmern und Praktikerinnen in den nächsten fünfzehn Jahren und darüber hinaus dienen wird.
Anm. zur dt. Ausgabe: Diese Übersetzung aus dem Amerikanischen verzichtet aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf das Verwenden von gendergerechter Sprache. Alle männlichen Formen beziehen sich auf alle Geschlechter.
Danksagungen
(Irvin Yalom)
Ich bin der Stanford University dankbar, dass sie mir die akademische Freiheit und die Recherchemöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, die ich für diese Arbeit brauchte. Und ich danke auch einem meisterhaften Mentor, Jerome Frank, der mich in die Gruppentherapie eingeführt hat und mir ein Vorbild an Integrität und Hingabe war. Mehrere Personen haben bei dieser sechsten Überarbeitung mitgeholfen, indem sie Kapitel dieses Bandes gelesen und konstruktiv kritisiert haben: Ruthellen Josselson, Ph. D., Meenakshi Denduluri, M. D., und mein Sohn, Ben Yalom, der mehrere Kapitel meisterhaft redigiert hat. Und schließlich bin ich den Mitgliedern meiner eigenen leiterlosen Therapeutengruppe dankbar, die meinen Glauben an die Kraft und Wirksamkeit einer therapeutischen Gruppe immer wieder bestärken.
(Molyn Leszcz)
Ich danke der psychiatrischen Abteilung der Universität Toronto und dem Mount Sinai Hospital für die Unterstützung bei der Fertigstellung dieses Projekts. Zu den Kollegen aus Toronto, die zu dieser Ausgabe beigetragen und ihre Fertigstellung erleichtert haben, gehören Lesley Wiesenfeld, M. D., Joel Sadavoy, M. D., Danny Silver, M. D., Paula Ravitz, M. D., Jan Malat, M. D., Roisin Byrne, M. D., Smrita Grewal, M. D., Robert Maunder, M. D., und Jon Hunter, M. D. Zu den gruppentherapeutischen Kollegen, deren Beiträge von großem Wert waren, gehören Gary Burlingame, Ph.D., Greg Crosby, MSW, Haim Weinberg, Ph.D., Martyn Whittingham, Ph.D., und Steinar Lorentzen, Ph.D. Liz Konigshaus erledigte die mühsame Aufgabe der Zusammenstellung der vielen Referenzen und Zitate mit enormer Effizienz und unerschütterlicher Liebenswürdigkeit. Marie Maguire leistete wesentliche administrative Hilfe. Meine Kinder Benjamin, Talia und Noah Leszcz und meine Frau Bonny Leszcz unterstützten mich während der gesamten Zeit durch ihr Verständnis und ihre Ermutigung.
Beide sind wir Lisa Kaufman sehr dankbar für ihre sorgfältige und umfassende Bearbeitung unseres Textes.
Kapitel 1
Die therapeutischen Faktoren
Hilft Gruppentherapie Klienten? Natürlich tut sie das. Überzeugende Ergebnisstudien belegen durchgängig und eindeutig, dass Gruppentherapie eine sehr wirksame Form psychotherapeutischer Arbeit ist. Sie steht der Einzeltherapie in ihrer Fähigkeit, Klienten zu befriedigenden Therapieresultaten zu verhelfen, nicht nur nicht nach, sondern ermöglicht auch eine effizientere Nutzung der Ressourcen der psychischen Gesundheitsversorgung.[1] Doch paradoxerweise haben die Ausbildungsprogramme für psychosoziale Fachkräfte die Ausbildung in Gruppentherapie reduziert.1 Dies ist sehr bedenklich: Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gruppentherapien auf einem hohen Qualitätsniveau durchgeführt werden, wenn wir die gewünschte Wirkung erzielen wollen, die unsere Klienten benötigen.[2] In diesem Text werden wir uns auf die Gruppenfaktoren und die Eigenschaften der Gruppenleiter konzentrieren, die zur therapeutischen Wirksamkeit beitragen.
Doch wie hilft Gruppentherapie Klienten? Vielleicht ist das eine naive Frage. Doch wenn wir sie mit einer gewissen Genauigkeit und Sicherheit beantworten könnten, stünde uns ein zentrales Organisationsprinzip zur Verfügung, mit dessen Hilfe wir eine Chance hätten, einige der bedrückendsten und umstrittensten Probleme der Psychotherapie zu lösen. Wenn wir die entscheidenden Aspekte des Veränderungsprozesses kennen, verfügen wir über eine rationale Grundlage für die Entwicklung einer Taktik und Strategie zur Beeinflussung des Gruppengeschehens und zur Maximierung seiner Wirkung bei unterschiedlichen Klienten und in unterschiedlichen Zusammenhängen. Obwohl die Gruppentherapie funktioniert, gibt es große Unterschiede in der Wirksamkeit der Therapeuten.[3] Zu verstehen, wie man die therapeutischen Prozesse am besten umsetzt, ist das Herzstück einer effektiven Gruppentherapiearbeit. Glücklicherweise gibt es viele Hinweise aus der Forschung, die uns weiterhelfen. Erfahrung allein führt nicht zu größerer Wirksamkeit. Was aber dann? Bewusstes Üben, Selbstreflexion, Feedback zur eigenen Praxis und die kluge Nutzung einer empathischen und gut abgestimmten therapeutischen Beziehung.[4]
Wir gehen davon aus, dass die therapeutische Veränderung ein enorm komplexer Prozess ist, der sich durch ein kompliziertes Zusammenspiel menschlicher Erfahrungen vollzieht, die wir als »therapeutische Faktoren« bezeichnen werden. Es ist von großem Vorteil, sich dem Komplexen durch das Einfache anzunähern; dem Gesamtphänomen durch seine grundlegenden Teilprozesse. Deshalb beginnen wir mit einer Beschreibung und Untersuchung dieser elementaren Faktoren.
Nach unserer Auffassung lässt sich das Geschehen in der Gruppentherapie aufgrund natürlicher Gegebenheiten in elf Primärfaktoren unterteilen:
Hoffnung wecken
Universalität des Leidens
Mitteilen von Informationen
Altruismus
Korrigierende Rekapitulation des Geschehens in der primären Familiengruppe
Entwicklung von sozialer Kompetenz
Imitationsverhalten
Interpersonelles Lernen
Gruppenkohäsion
Katharsis
Existenzielle Faktoren
Im weiteren Verlauf dieses ersten Kapitels werden wir die ersten sieben der genannten Faktoren erläutern. Interpersonelles Lernen und Gruppenkohäsion sind so wichtig und komplex, dass wir sie in den nächsten beiden Kapiteln getrennt behandeln werden. Existenzielle Faktoren werden im vierten Kapitel behandelt, weil sie in Zusammenhang mit dem dort vorgestellten Material am besten verständlich werden. Katharsis ist mit anderen therapeutischen Faktoren eng verwoben und wird gleichfalls im vierten Kapitel erläutert.
Die Unterscheidung zwischen den einzelnen Faktoren ist in gewisser Weise willkürlich; und obwohl wir sie einzeln besprechen, sind sie interdependent und kommen weder einzeln vor, noch können sie isoliert wirksam werden. Außerdem repräsentieren sie verschiedene Teile des Veränderungsprozesses: Einige Faktoren (beispielsweise Interpersonelles Lernen) wirken auf der Ebene der Kognition; andere (beispielsweise die Entwicklung von Techniken des mitmenschlichen Umgangs) wirken auf der Ebene der Veränderung von Verhalten; und wieder andere (beispielsweise Katharsis) wirken auf der Ebene der Emotion; und schließlich gibt es Faktoren (beispielsweise den der Gruppenkohäsion), die man vielleicht zutreffender sowohl als therapeutische Kraft als auch als Vorbedingungen für eine Veränderung bezeichnen sollte. Obwohl die gleichen therapeutischen Faktoren in jeder Art von Therapiegruppe wirksam sind, variieren ihr Zusammenspiel und ihr Gewicht je nach Art der Gruppe sehr stark. Außerdem können die verschiedenen Mitglieder ein und derselben Gruppe aufgrund ihrer individuellen Unterschiede aus sehr unterschiedlichen therapeutischen Faktoren Nutzen ziehen.[5]
Obwohl die therapeutischen Faktoren im Grunde willkürliche Konstrukte sind, können sie uns dennoch so etwas wie eine kognitive Landkarte zur Verfügung stellen.[6] Die in diesem Buch beschriebene Zusammenstellung therapeutischer Faktoren ist kein Dogma, und andere Psychotherapeuten und Forscher haben andere, ebenso willkürliche, Zusammenstellungen therapeutischer Faktoren entwickelt. Ein Forscherteam geht davon aus, dass es einen zentralen therapeutischen Faktor gibt: die Hoffnung des Klienten, dass sich seine Fähigkeit, sich emotional auszudrücken und sich seiner Beziehungen bewusst zu sein, in soziales Lernen umsetzen lassen.[7] Kein Erklärungsansatz vermag alles zu erfassen, was Therapie beinhaltet. Da der Therapieprozess in seinem Kern unvorstellbar komplex ist, gibt es eine unüberschaubare Zahl von Möglichkeiten, ihn zu erleben. (Auf alle hier angeschnittenen Fragen werden wir in Kapitel 4 ausführlicher eingehen, einschließlich der Entwicklung von den ursprünglichen 12 therapeutischen Faktoren, die zuerst untersucht wurden, zu den 11 Faktoren, auf die wir jetzt eingehen.)
Das Spektrum der von uns vorgeschlagenen therapeutischen Faktoren sind aus unserer klinischen Erfahrung, aus der Erfahrung anderer Therapeuten, aus den Ansichten von Klienten, die erfolgreich in der Gruppentherapie behandelt wurden, und aus relevanten Ergebnissen systematischer Untersuchungen hervorgegangen. Keine dieser Quellen ist über jeden Zweifel erhaben; weder Gruppenmitglieder noch Gruppenleiter sind völlig objektiv und unsere Forschungsmethoden sind oft in ihrem Geltungsbereich begrenzt.
Gruppentherapeuten liefern uns divergierende und in sich unstimmige Aufzählungen therapeutischer Faktoren, die sich auf die Untersuchung eines breiten Spektrums von Klienten und Gruppen gründen. Therapeuten sind keineswegs unparteiische oder unvoreingenommene Beobachter, denn jeder von ihnen hat viel Zeit und Energie auf das Erlernen eines bestimmten therapeutischen Ansatzes verwendet. Ihre Antworten sind weitgehend von der Schule geprägt, der sie sich zugehörig fühlen – der Loyalitätseffekt.[8] Selbst zwischen Therapeuten der gleichen theoretischen Überzeugung, die »die gleiche Sprache sprechen«, herrscht nicht immer Einigkeit darüber, aus welchen Gründen Klienten Fortschritte machen. Doch das überrascht uns nicht. In der Geschichte der Psychotherapie gibt es eine große Zahl erfolgreicher Heiler, die aus völlig anderen Gründen Erfolg hatten, als sie selbst annahmen. Welcher Therapeut hätte noch keinen Klienten gehabt, der aus völlig rätselhaften Gründen riesige Fortschritte machte?
Eine wichtige Informationsquelle sind die Angaben der Gruppenmitglieder zu den therapeutischen Faktoren, die ihnen selbst als die nützlichsten oder die am wenigsten nützlichen erschienen sind. Die Forscher werfen weiterhin wichtige Fragen zur Untersuchung therapeutischer Faktoren auf: Wirken sich die therapeutischen Faktoren auf alle Gruppenmitglieder auf die gleiche Weise aus? Was beeinflusst die Reaktionen unserer Klienten – vielleicht die Beziehung zum Therapeuten oder zur Gruppe? Wie sieht es mit der Qualität oder Tiefe der Sitzung aus?[9] Darüber hinaus hat die Forschung nachgewiesen, dass die therapeutischen Faktoren, die Gruppenmitglieder für wichtig halten, völlig andere sein können, als ihre Therapeuten oder Beobachter für wichtig halten.[10] Die Reaktionen der Gruppenmitglieder können auch durch eine ganze Reihe anderer Variablen beeinflusst werden: die Art der Gruppe (d. h. ambulant, stationär, Tagesklinik, Kurztherapie)[11], das Alter und die Diagnose des Klienten[12], sein Motivationsgrad, sein Bindungsstil[13], die Ideologie des Gruppenleiters[14] und die Art und Weise, in der die Gruppenmitglieder dasselbe Ereignis auf unterschiedliche Weise erleben und sich gegenseitig beeinflussen.[15]
Trotzdem sind Berichte von Klienten eine ergiebige Informationsquelle, die relativ wenig genutzt wird. Schließlich geht es um ihr Erleben und Erfahren, und je weiter wir uns als Therapeuten davon entfernen, umso fragwürdiger werden unsere Schlussfolgerungen. Natürlich nimmt der Klient bestimmte Aspekte des Veränderungsprozesses nicht wahr, doch wäre es eine gefährliche Fehlentscheidung, deshalb das, was er sagt, völlig zu ignorieren. Schriftlich verfasste Berichte und die Beantwortung von Fragebögen liefern zwar auf unkomplizierte Weise Informationen, doch erfassen sie häufig nicht die Nuancen und die Vielfalt dessen, was der Klient erlebt hat. Klienten aussagekräftige Berichte zu entlocken, ist eine Kunst. Je besser sich der Fragende in das Erleben eines Klienten hineinversetzen kann, umso klarer und bedeutungsvoller wird dessen Bericht darüber, was er in der Therapie erlebt hat.
Abgesehen von der Sichtweise des Therapeuten und den Berichten des Klienten gibt es noch einen dritten wichtigen Aspekt, der zur Einschätzung der relevanten therapeutischen Faktoren beitragen kann: systematische Forschung. Die am weitesten verbreitete Forschungsstrategie besteht darin, die in der Therapie als relevant erkannten Variablen nach Abschluss der Therapie zum tatsächlich erzielten Therapieerfolg in Beziehung zu setzen. Indem man feststellt, welche Variablen in signifikanter Korrelation zum Therapieerfolg stehen, kann man eine rationale Grundlage für die Definition relevanter therapeutischer Faktoren schaffen. Allerdings ist diese Vorgehensweise mit vielen Problemen behaftet: Schon die Erfolgsmessung an sich ist ein methodologischer Morast, und die Variablen auszuwählen und zu messen ist ebenso problematisch.[16]
Um die im vorliegenden Buch erörterten therapeutischen Faktoren herauszukristallisieren, haben wir uns aller genannten Methoden bedient. Trotzdem sehen wir das Ergebnis, zu dem wir auf diese Weise gelangt sind, nicht als »der Weisheit letzten Schluss« an, sondern wir verstehen es als eine Art zeitweiliger Orientierungshilfe, als etwas, das andere überprüfen und vertiefen können.
Hoffnung wecken
Die Forschung hat immer wieder gezeigt, dass Hoffnung zu wecken und zu erhalten in jeder Psychotherapie sehr wichtig ist. Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine hohe Erwartungshaltung des Klienten in Bezug auf Hilfe signifikant mit einem positiven Therapieergebnis korreliert ist.[17] Man denke in diesem Zusammenhang auch an die eindrucksvollen Ergebnisse von Untersuchungen, in denen die Wirksamkeit des Gesundbetens und von Placebo-Behandlung dokumentiert wurde – also von Therapien, deren Wirkung ausschließlich auf Hoffnung und Glauben beruht. Das Vorhandensein von Hoffnung vertieft das Engagement der Klienten für die Arbeit der Gruppe.[18] In einer Psychotherapie ist ein positives Behandlungsergebnis wahrscheinlicher, wenn Klient und Therapeut hinsichtlich der Behandlung ähnliche und positive Erwartungen haben.[19] Erwartungen wirken nicht nur auf die Vorstellung. Brain-Imaging-Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Placebo keineswegs immer völlig unwirksam ist, sondern durchaus unmittelbar physiologisch auf das Gehirn wirken kann.[20]
Gruppentherapeuten können diesen Faktor nutzen, indem sie alles ihnen Mögliche tun, um den Glauben ihrer Klienten an die Wirksamkeit der gruppentherapeutischen Behandlungsmethode zu stärken. Diese Aufgabe beginnt vor der eigentlichen Gruppenarbeit, nämlich während der Einführung in die Gruppentherapie, in deren Verlauf der Therapeut positive Erwartungen verstärkt, negative Vorurteile korrigiert und auf klare und überzeugende Weise erklärt, inwiefern die Gruppe zu heilen vermag. Dies sollte speziell mit einer zugänglichen und kulturell resonanten Erklärung der Schwierigkeiten des Klienten verbunden sein. (Die Vorbereitungsphase vor Beginn der Gruppentherapie wird in Kapitel 10 ausführlich erläutert.)
Die Gruppentherapie nutzt nicht nur die allgemein zustandsverbessernde Wirkung positiver Erwartungen, sondern profitiert auch von einer Quelle der Hoffnung, die nur im Falle einer Gruppentherapie ihre Wirkung entfaltet. In Therapiegruppen gibt es immer Teilnehmer, die sich an unterschiedlichen Punkten des Problembewältigungs-Zusammenbruchs-Kontinuums befinden. Jedes Gruppenmitglied hat starken Kontakt zu anderen, oft mit ähnlichen Problemen kämpfenden Mitgliedern, die aufgrund der Therapie Fortschritte erzielt haben. Ich habe Klienten oft am Ende ihrer Gruppentherapie sagen hören, es sei für sie ungeheuer wichtig gewesen mitzuerleben, wie andere sich positiv entwickelten.
Gruppentherapeuten sollten sich keinesfalls darüber erhaben fühlen, diesen Faktor zu nutzen, indem sie die Aufmerksamkeit der Gruppe immer wieder auf die Fortschritte einzelner Mitglieder richten. Wenn uns beispielsweise Gruppenteilnehmer, die ihre Therapie kürzlich beendet haben, über die weitere Verbesserung ihres Zustands berichten, legen wir stets Wert darauf, dies der Gruppe, mit der wir aktuell zusammenarbeiten, mitzuteilen. Oft übernehmen ältere Gruppenmitglieder diese Funktion, indem sie neu hinzugekommenen und noch skeptischen Mitgliedern aus eigenem Antrieb über derartige Erfolge berichten.
Ein anschauliches Beispiel fand in einer gerontopsychiatrischen Tagesklinik statt:
Betty, eine 86-jährige depressive Frau, die Veränderungen ablehnte, besuchte ihre erste Gruppe. Nichts, was die Gruppenleiter an Vorbereitung oder Ermutigung boten, konnte die bemerkenswerte Wirkung des 88-jährigen Gruppenmitglieds Sarah übertreffen. Sie begrüßte die Neuangekommene auf folgende Weise: »Willkommen in der Gruppe, Betty. Wenn Sie so sind wie ich, dann ist dies der letzte Ort, an dem zu landen Sie jemals gedacht hätten. Und wahrscheinlich sind Sie nur hier, weil Ihre Tochter Sie gezwungen hat zu kommen. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Dies ist ein ganz besonderer Ort. Hierher zu kommen hat mein Leben verändert. Ich stehe kurz vor meinem Abschluss, aber ich nehme so viel mit – ich gehe mit einem Täschchen voller Juwelen, die mir in meinem Leben außerhalb dieses Programms helfen werden. Ich habe erfahren, wie schlimm es ist, einsam zu sein, ich habe gelernt, wie ich um Hilfe bitten und auf Menschen zugehen kann, und ich habe gelernt, dass ich die Zuwendung und Aufmerksamkeit der Menschen verdiene. Glauben Sie mir, das wird auch bei Ihnen so sein, wenn Sie hierher kommen und mitmachen.
Wie die Forschung gezeigt hat, ist es auch von entscheidender Bedeutung, dass die Therapeuten an sich selbst und an die Wirksamkeit ihrer Gruppe glauben, dass die Gruppentherapie in der Lage ist, jedem motivierten Klienten zu helfen, der bereit ist, mindestens sechs Monate lang in der Gruppe mitzuarbeiten. Das Gefühl der eigenen therapeutischen Wirksamkeit muss unbedingt genährt und aufrechterhalten werden (siehe Kapitel 16 für weitere Informationen über die Selbstfürsorge von Therapeuten).[21] In den ersten Sitzungen mit den Klienten teilen wir unsere Überzeugung mit ihnen und versuchen, sie mit unserem Optimismus zu inspirieren.
Viele Selbsthilfegruppen (Gruppen für Eltern, die ein Kind verloren haben, für gewalttätige Männer, für Inzestopfer, für Krebspatienten und ihre Familien, für Menschen mit Depressionen und Bipolaren Störungen und für Patienten nach einer Herzoperation) verlassen sich stark auf die Wirkung des Hoffnung-Weckens.[22] In Zwölf-Schritte-Gruppen wie den Anonymen Alkoholikern, Narcotics Anonymous und Overeaters Anonymous, beginnen die meisten Meetings damit, dass ein Mitglied den anderen Mitgliedern seine Geschichte von »Erfahrung, Stärke und Hoffnung« erzählt. Erfolgreiche Mitglieder erzählen ihre Geschichte vom Absturz und der anschließenden Genesung mithilfe des »Programms« immer wieder, nicht nur, um neuen Mitgliedern Hoffnung zu geben, sondern auch, um sich selbst daran zu erinnern, dass das Leben »immer besser« werden kann, wenn sie weiterhin nüchtern bleiben. Eine der großen Stärken der Anonymen Alkoholiker ist die Tatsache, dass die Gruppen von Mitgliedern und nicht von Fachleuten geleitet werden; die Redner, die Leiter der Meetings und andere leitende Personen sind alle genesende Alkoholiker – eine lebende Inspiration für die anderen.
Einige Programme zur Behandlung von Drogenmissbrauch mobilisieren auch die Hoffnung der Teilnehmer, indem sie genesende Drogenabhängige als Peer-Gruppenleiter einsetzen. Viele Programme wurden von genesenden Süchtigen gegründet und/oder werden von solchen Personen geleitet, die inzwischen professionelle Berater und Therapeuten geworden sind. Der Kontakt mit Menschen, die den gleichen Weg gegangen sind und den Weg zurück gefunden haben, inspiriert die Gruppenmitglieder und steigert ihre Erwartungen. Selbsthilfegruppen für Menschen mit chronischen Krankheiten wie Arthritis und Herzkrankheiten nutzen ebenfalls geschulte Betroffene, um die Mitglieder zu ermutigen, sich aktiv mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen.[23] Die Anregungen, die die Teilnehmer von den Mitbetroffenen erhalten, sind ein wichtiger Teil des Therapieprozesses. Diese Gruppen verbessern die medizinischen Ergebnisse, senken die Gesundheitskosten, fördern das Gefühl der Selbstwirksamkeit des Einzelnen und machen Gruppeninterventionen oft wirksamer als Einzeltherapien.[24]
Universalität des Leidens
Viele Menschen haben zu Beginn einer Gruppentherapie das Gefühl, sie seien in ihrem Elend einzigartig und nur sie allein hätten bestimmte erschreckende oder Abwehr auslösende Probleme, Gedanken, Impulse und Fantasien. Dies gilt mehr oder minder für uns alle, doch haben viele Klienten aufgrund ihrer extrem sozialen Isolation verstärkt das Gefühl, dass ihre spezielle Situation einzigartig sei. Weil sie so große Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen haben, ist es ihnen nicht möglich, echte und tief gehende Nähe zuzulassen. Deshalb merken sie im Alltag nicht, dass andere ähnliche Gefühle haben und Ähnliches erleben wie sie. Und sie sind auch nicht in der Lage, die Gelegenheit zu nutzen, sich anderen Menschen anzuvertrauen und dadurch letztendlich von diesen bestätigt und akzeptiert zu werden.
In Therapiegruppen wirkt die Entkräftung des Gefühls der Einzigartigkeit insbesondere im Anfangsstadium der Arbeit sehr entlastend. Nachdem die Klienten andere Gruppenmitglieder über Probleme haben sprechen hören, die ihren eigenen stark ähneln, fühlen sie sich nach eigenen Äußerungen manchmal stärker in Kontakt mit der Welt und sie beschreiben den Gruppenprozess als ein Erlebnis der »Wiederaufnahme in die menschliche Gesellschaft«. Vereinfacht ausgedrückt kommt dieses Phänomen auch in Redensarten wie »Wir sitzen alle im gleichen Boot« oder auch in dem zynischeren Satz »Not liebt Gesellschaft« zum Ausdruck. Für einige Klienten ist das Gefühl, ein Mensch unter anderen Menschen zu sein, der Beginn der Genesung und ein zentrales Merkmal des heilenden Kontextes, den Gruppentherapeuten schaffen wollen.[25]
Nichts, was Menschen tun oder denken, ist anderen Menschen völlig fremd. Wir haben gehört, wie Gruppenmitglieder Handlungen wie Inzest, Folter, Einbruch, Unterschlagung, Mord, Selbstmordversuche und Fantasien über noch schrecklichere Taten eingestanden haben. Jedes Mal zeigte sich, dass andere Gruppenmitglieder sich den Bekennenden sehr nahe fühlten und dass sie offen zugaben, selbst auch zu solchen Handlungen fähig zu sein. In vielen Fällen wurden die Betreffenden durch das Vertrauen und den Mut des Bekenners sogar dazu angespornt, sich selbst ebenfalls zu offenbaren. Hilfe in Form einer Relativierung der Einzigartigkeit persönlichen Leidens spielt nicht nur in der Gruppentherapie eine Rolle, sondern die implizite oder explizite Thematisierung der Universalität des Leidens hat auch in der Einzeltherapie eine wichtige Funktion, wobei in diesem Zusammenhang die konsensuelle Einschätzung der bestehenden Probleme jedoch schwieriger ist, weil Therapeuten ihren Klienten gegenüber nur sehr wenig über sich selbst und ihre Situation offenbaren.
Während meiner eigenen (IY) sechshundert Stunden umfassenden Einzelanalyse habe ich einmal eindrucksvoll die Wirkung des therapeutischen Faktors Universalität erlebt. Ich war gerade dabei, meine extrem ambivalenten Gefühle meiner Mutter gegenüber zu beschreiben, und es machte mir sehr zu schaffen, dass ich nicht nur starke positive Empfindungen ihr gegenüber hatte, sondern ihr gleichzeitig den Tod wünschte, weil ich dann einen Teil ihres Besitzes erben würde. Mein Analytiker kommentierte dies nur mit der simplen Feststellung: »So sind wir eben.« Diese ungeschminkte Äußerung erleichterte mich nicht nur, sondern ermöglichte mir auch, mich gründlicher mit meiner Ambivalenz auseinanderzusetzen.
Trotz der fraglosen Komplexität und Spezifität menschlicher Probleme sind gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Menschen deutlich zu erkennen und die Mitglieder einer Therapiegruppe merken schnell, in welcher Hinsicht sie den übrigen Gruppenteilnehmern ähneln. Das folgende Beispiel veranschaulicht dies: Seit vielen Jahren bitte ich die Mitglieder von T-Gruppen (Ausbildungsgruppen für Fachkräfte, die keine Klienten sind – z. B. Medizinstudenten, Ärzte in der psychiatrischen Facharztausbildung, Krankenpflegepersonal, Psychiatriehelfer und Peace-Corps-Freiwillige), bei einer »Top-Secret«-Aufgabe mitzuwirken. Die Betreffenden werden aufgefordert, anonym auf einem Zettel ihr größtes Geheimnis zu notieren, das sie in der Gruppe auf keinen Fall preisgeben wollen. Die Geheimnisse, die auf diese Weise zu Papier gebracht werden, ähneln einander in erstaunlichem Maße und einige Themen wiederholen sich ständig. Am häufigsten wird der tiefen Überzeugung Ausdruck gegeben, man sei generell unzulänglich – dem Gefühl, man sei im Grunde völlig unfähig und mogele sich mittels Bluff durch das Leben. Als zweithäufigstes Geheimnis wird ein tiefes Gefühl der Entfremdung von anderen Menschen genannt – das Gefühl, man empfinde entgegen allem äußeren Anschein keine echte Liebe und Zuneigung einem anderen Menschen gegenüber und sei dazu auch gar nicht in der Lage. Am dritthäufigsten werden persönliche Geheimnisse sexueller Art genannt. Diese drei größten Sorgen sind identisch mit den wichtigsten Problembereichen von Menschen, die psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe suchen. Fast ausnahmslos haben unsere Klienten Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und mit ihrer Fähigkeit, zu anderen Menschen in Beziehung zu treten.2
Einige sehr spezielle Gruppen, für deren Mitglieder Geheimhaltung ein besonders wichtiger und isolierend wirkender Faktor war, messen ihrer Ansicht über die Universalität des Leidens besonders großen Wert bei. Dies kann Stigmatisierung und Scham entgegenwirken. Für solche Menschen kann die Gruppentherapie wirkungsvoller sein als eine Einzeltherapie. So machen strukturierte Kurzzeitgruppen für Bulimiker die Selbstoffenbarung zur Pflicht, insbesondere Äußerungen über das eigene Körperbild und ausführliche Berichte über Essrituale und Praktiken zur Beschleunigung der Ausscheidung. Fast ausnahmslos zeigen sich die Mitglieder solcher Gruppen sehr erleichtert, wenn sie merken, dass sie sich nicht als Einzige so verhalten, sondern dass andere die gleichen Dinge erleben wie sie und sich in der gleichen Zwickmühle befinden.[26]
Auch Mitglieder von Gruppen sexuell Missbrauchter profitieren sehr vom Erleben der Universalität ihrer Probleme.[27] Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit dieser Gruppen ist, dass deren Mitglieder oft zum ersten Mal in ihrem Leben anderen Menschen Einzelheiten über den erlebten Missbrauch und über die anschließenden verheerenden Empfindungen mitteilen. In einer aktuellen Studie wurden Gruppen- und Einzelpsychotherapie für sexuell missbrauchte kongolesische Frauen verglichen, die unter Scham, Stigmatisierung und sozialer Isolation litten. Die Gruppentherapie führte zu deutlicheren und dauerhafteren positiven Ergebnissen als die Einzeltherapie.[28]
Mitglieder homogener Gruppen können besonders authentisch miteinander reden, weil ihnen allen bestimmte Erfahrungen gemeinsam sind. Dies ermöglicht eine Authentizität in der Kommunikation, zu der die Therapeuten selbst nicht immer in der Lage sind. So habe ich (ML) zu Beginn meiner Arbeit als Gruppentherapeut einmal eine Gruppe für depressive Männer im Alter zwischen 70 und 80 Jahren geleitet. In einer Sitzung hatte ein 77-jähriger Mann, der kurz vorher seine Frau verloren hatte, erklärt, er denke daran, sich umzubringen. Als wesentlich jüngerer Mann zögerte ich, weil ich fürchtete, was immer ich sagen würde, könnte mich als naiven Grünschnabel erscheinen lassen. Dann meldete sich ein 91-Jähriger zu Wort und beschrieb, wie er nach dem Tod seiner Frau, mit der er 60 Jahre zusammengelebt hatte, völlig verzweifelt gewesen sei und ebenfalls daran gedacht habe, sich umzubringen, dass es ihm jedoch irgendwann gelungen sei, dieses Tief zu überwinden und sich wieder dem Leben zuzuwenden. Diese Äußerung ging dem Leidensgenossen zu Herzen, und er konnte sie nicht so leicht als »naiv« abtun.
Da die heutigen Therapiegruppen unsere Gesellschaft mit ihrer Vielfalt an Geschlecht, sexueller Orientierung und multikultureller Zusammensetzung repräsentieren, muss der Gruppenleiter möglicherweise besonders auf das Gefühl der Universalität in diesen Gruppen achten. Kulturelle Minderheiten in einer von Weißen (bzw. Angehörigen einer bestimmten Nation) dominierten Gruppe fühlen sich aufgrund ihrer kulturbedingt anderen Einstellung gegenüber Selbstoffenbarung, Interaktion und dem Ausdruck von Gefühlen schnell isoliert. Die Diskussion über ethnische Zugehörigkeit, geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung ist eine Herausforderung und erfordert Mut, Vertrauen und Demut. Die Therapeuten müssen der Gruppe helfen, die Auswirkungen von Kultur, Unterdrückung, Marginalisierung und Privilegien auf das Persönlichkeitsgefühl jedes Einzelnen zu verstehen.[29] Wir müssen uns auch mit transkulturellen – d. h. universellen – Reaktionen auf menschliche Situationen und Tragödien befassen.[30] Nur in der Gruppentherapie können offensichtlich kulturell divergierende Individuen eine gemeinsame Basis finden – man denke nur an die starke Identifikation eines jungen, schwulen palästinensischen Mannes mit einer älteren heterosexuellen kommunistischen Frau, die beide marginalisierte Stimmen für soziale Gerechtigkeit sind. Ein Therapeut, der mit einer solchen Gruppe arbeitet, muss somit so viel wie möglich über die Kulturen und Gemeinschaften seiner Teilnehmer sowie über den Grad der Bindung an ihre Ursprungskultur lernen.[31] Interkulturelle Kompetenz ist eng mit therapeutischer Effektivität verknüpft.[32]
Die Universalität des Leidens lässt sich nicht deutlich abgrenzen; sie überschneidet sich mit ihnen. Wenn Klienten erkennen, dass sie anderen Menschen ähneln und dass diese ihre tiefsten Sorgen teilen, profitieren sie auch davon, wenn es bei der Arbeit mit diesen anderen zur Katharsis kommt und sie von den anderen Mitgliedern akzeptiert werden.
Mitteilen von Informationen
Zu dieser Kategorie zählen wir sowohl die didaktische Unterweisung der Therapeuten über seelische Gesundheit, seelische Krankheit und allgemeine Grundlagen der Psychodynamik als auch Ratschläge, Empfehlungen oder direkte Anleitungen, die entweder der Therapeut oder andere Klienten geben.
Didaktische Unterweisung
Die meisten Klienten wissen nach Abschluss einer erfolgreichen interpersonellen Gruppentherapie viel über Empathie, über die Bedeutung von Symptomen, über interpersonelle Dynamik und Gruppendynamik und über den psychotherapeutischen Prozess. Gruppentherapie fördert die emotionale Intelligenz.[33] Wir haben oft erlebt, dass studentische Beobachter von Gruppentherapien über das Wissen der Gruppenmitglieder zu diesen Schlüsselkonzepten staunen. Die meisten Gruppentherapeuten bieten keine explizite didaktische Unterweisung an, abgesehen von den ersten Sitzungen, in denen sie Anleitungen für die Arbeit im Hier und Jetzt und für das interpersonelle Feedback geben. In jüngerer Zeit haben jedoch viele gruppentherapeutische Ansätze die formelle Unterweisung oder Psychoedukation zu einem wichtigen Bestandteil ihres Programms gemacht.
Eine eindrucksvolle historische Vorläuferform der Psychoedukation wird Maxwell Jones zugeschrieben, der in den 1940er-Jahren im Rahmen seiner Arbeit mit großen Gruppen seine Klienten wöchentlich drei Stunden lang über Struktur und Funktion des Zentralnervensystems und dessen Bedeutung für psychiatrische Symptome und Störungen aufklärte.[34] Auch Marsh, der seine Schriften in den 1930er-Jahren publizierte, hielt die Psychoedukation für sehr wichtig, und er organisierte in den Dreißigerjahren für seine Klienten Kurse, in denen er Vorträge hielt, Hausaufgaben stellte und Noten vergab.[35] Viele andere Selbsthilfegruppen legen ebenfalls großen Wert auf die Vermittlung relevanter Informationen. Gruppen wie Wellspring (eine Gruppe für Krebspatienten), Parents Without Partners (Alleinerziehende) und Mended Hearts (Patienten, die am Herzen operiert worden sind) fördern den Informationsaustausch zwischen ihren Mitgliedern und laden oft Fachleute zu Gruppenvorträgen ein.[36] Wichtig ist, in welcher Art von Umgebung das Lernen stattfindet. Die Atmosphäre in all diesen Gruppen ist von partnerschaftlichem Denken und Zusammenarbeit geprägt, also nicht von Vorschriften und Unterordnung bestimmt.
In der zeitgenössischen gruppentherapeutischen Literatur wird eine große Zahl spezieller Gruppen für bestimmte Leiden oder Störungen und für bestimmte Lebenskrisen beschrieben: beispielsweise Gruppen für Patienten mit einer Panikstörung,[37] Übergewicht,[38] Bulimie,[39] Scheidungsproblemen,[40] Herpes,[41] Koronarerkrankungen,[42] für Eltern missbrauchter Kinder,[43] für Täter familiärer Gewalt,[44] Trauernde,[45] Aids-Kranke und HIV-Positive,[46] Menschen mit sexuellen Funktionsstörungen,[47] Vergewaltigungsopfer,[48] für die Anpassung des Selbstbilds nach einer Brustamputation,[49] für Patienten mit chronischen Schmerzen,[50] für Patienten, die eine Organtransplantation erhalten haben,[51] Gruppen für die Rückfallprävention bei Depression,[52] Patienten mit einer Autismus-Spektrum-Störung,[53] Eltern von Kindern mit Autismus, Menschen mit geistigen Behinderungen,[54] solche, die eine genetische oder familiäre Veranlagung haben, an Krebs zu erkranken,[55] und natürlich die explosionsartige Zunahme von Online- und Social-Media-Gruppen, die sich mit einer Vielzahl von Problemen befassen.[56]
Diese Gruppen ermöglichen ihren Mitgliedern nicht nur, einander zu unterstützen, sondern beinhalten gewöhnlich auch eine psychoedukative Komponente, da sie die Mitglieder genau über das Wesen ihrer Krankheit oder ihrer speziellen Lebenssituation informieren und ihnen helfen, sich mit eventuellen falschen Vorstellungen über ihre Krankheit und mit wenig hilfreichen Reaktionsweisen auf diese auseinandersetzen. Beispielsweise beschreiben die Leiter von Gruppen für Klienten mit Panikstörungen die physiologische Ursache von Panikanfällen: dass starker Stress und ein erhöhtes Erregungsniveau die Adrenalinproduktion verstärken, was Hyperventilation, Kurzatmigkeit und Schwindelgefühle hervorrufen kann.
Der Gruppenleiter hebt dann hervor, dass der Klient diese Symptome oft falsch deutet (»Ich sterbe« oder »Ich werde verrückt«), wodurch ein Teufelskreis entsteht. Für die Leiter solcher Gruppen ist es hilfreich zu erläutern, dass Panikattacken nicht gefährlich sind und die Gruppenmitglieder dann dazu anzuleiten, einen leichten Panikanfall auszulösen, und ihnen anschließend beizubringen, Panikattacken zu vermeiden. Sie lehren sie, bestimmte Atemtechniken richtig einzusetzen, und schulen sie in der Technik der progressiven Muskelentspannung. Sie können die gesamte Gruppe auffordern, sich an der Übung zu beteiligen, um das in Panik geratene Mitglied zu unterstützen.[57]
Gruppen sind oft der Rahmen, in dem Methoden der Stressverringerung mithilfe der Achtsamkeitsmeditation vermittelt werden. Durch die Entwicklung einer disziplinierten Fokussierung lernen die Mitglieder, ihre Gedanken und Gefühle klar, akzeptierend und nicht urteilend zu beobachten und so ihren Stress, ihre Angst und ihre Anfälligkeit für Depression zu verringern.[58]
Leiter von Gruppen für Trauernde können die Teilnehmer über den natürlichen Trauerzyklus informieren, um ihnen klarzumachen, dass der Schmerz, den sie durchleben, einer bestimmten Entwicklung folgt und dass ihr Kummer im Laufe dieser Sequenz ganz natürlich und fast zwangsläufig abklingen wird. Beispielsweise helfen die Gruppenleiter ihren Klienten, sich auf den starken Schmerz einzustellen, den sie im ersten Jahr nach dem Trauerfall zu bestimmten Zeitpunkten, etwa bestimmten Feiertagen, Jahrestagen oder Geburtstagen, spüren werden.[59] Psychoedukative Gruppen für Frauen mit primärem Brustkrebs informieren diese über ihre Krankheit, über Behandlungsmöglichkeiten sowie über zukünftige Risiken und geben ihnen Empfehlungen für die Entwicklung einer gesunden Lebensweise, wenn man mit Krebs lebt. Untersuchungen über Gruppen dieser Art haben ergeben, dass die Teilnehmerinnen deutlich und dauerhaft von ihnen profitieren.[60]
Die meisten Gruppenpsychotherapeuten bereiten ihre Klienten in irgendeiner Weise auf die oft beängstigend wirkende Situation des Eintritts in eine Psychotherapiegruppe vor, beispielsweise in Form einer Vorbereitungssitzung, in der wichtige Gründe für eine psychische Dysfunktion geklärt werden und in denen die angehenden Gruppenmitglieder Methoden der Selbsterforschung erlernen.[61] Indem wir den Klienten zu erwartende Ängste voraussagen und ihnen Verständnisgrundlagen liefern, helfen wir ihnen, besser mit dem »Kulturschock« fertig zu werden, der sie beim Beginn der Gruppentherapie möglicherweise erwartet (siehe hierzu Kapitel 10).
Didaktische Anleitung wurde und wird in der Gruppentherapie verschiedenartig verwendet: zur Übermittlung von Informationen, zur Strukturierung der Gruppe, um den Krankheitsprozess zu erklären, und schließlich zur Veränderung dysfunktionaler Denkmuster. Oft dienen solche Erklärungen dazu, einen ersten Zusammenhalt zwischen den Gruppenmitgliedern zu schaffen, der diesen Zweck so lange erfüllt, bis andere therapeutische Faktoren ihre Wirkung entfalten. Erklärungen und Klärungen wirken jedoch teilweise auch an und für sich als therapeutische Faktoren. Ein Phänomen zu erklären ist der erste Schritt auf dem Weg zu seiner Beherrschung. Wenn ein Vulkanausbruch durch einen verstimmten Gott verursacht wird, kann man zumindest hoffen, diesen gnädig zu stimmen. Wissen fördert die Kompetenz, die wiederum die Selbstwirksamkeit fördert, ein wesentlicher Bestandteil jeder wirksamen Therapie.[62]
Immer wieder weisen Therapeuten darauf hin, dass die beste Antwort auf Furcht und Angst in unserer heutigen Welt in der aktiven Bewältigung liegt (z. B. sich auf das Leben einlassen, offen sprechen und sich gegenseitig unterstützen), im Gegensatz zum Rückzug in demoralisierte Vermeidung. Diese Haltung zeugt nicht nur von gesundem Menschenverstand, sondern, wie neuere neurobiologische Forschungen zeigen, aktiviert die Bewältigung wichtige neuronale Schaltkreise im Gehirn, die zur Regulierung der Stressreaktionen des Körpers beitragen.[63]
Ebenso verhält es sich bei Klienten, die sich in einer Psychotherapie befinden: Furcht und Angst, die durch die Unsicherheit über Ursache, Bedeutung und Schwere psychischer Symptome entstehen, können den dysphorischen Zustand als Ganzes so verschlimmern, dass eine sinnvolle Erforschung desselben erheblich erschwert wird. Die didaktische Unterweisung hat, weil sie dem Klienten eine Struktur und eine Erklärung liefert, einen Wert in sich selbst, und sie verdient einen Platz in unserem Repertoire therapeutischer Werkzeuge (siehe Kapitel 5).
Direkter Rat
Anders als die explizite didaktische Instruktion des Therapeuten existiert das Phänomen des direkten Rats vonseiten anderer Gruppenmitglieder ausnahmslos in jeder Therapiegruppe. In dynamischen interaktionsorientierten Gruppen tritt es so regelmäßig im Anfangsstadium der Gruppenarbeit auf, dass man aufgrund dessen schätzen kann, wie lange sich eine Gruppe bereits trifft. Wenn ich eine Gruppe beobachte oder mir eine Bandaufnahme von einer Gruppensitzung anhöre, und die Gruppenteilnehmer sagen mit einer gewissen Regelmäßigkeit: »Ich glaube, Sie sollten …« oder »Sie sollten … tun« oder: »Warum machen Sie nicht …?«, dann kann ich mit einiger Sicherheit behaupten, dass die Gruppe entweder noch sehr jung ist oder dass es sich um eine ältere Gruppe mit gewissen Schwierigkeiten handelt, die entweder ihre Entwicklung behindern oder eine vorübergehende Regression hervorgerufen haben. Mit anderen Worten: Das Erteilen von Ratschlägen kann Widerstand gegen ein stärkeres Engagement anzeigen, wobei die Gruppenmitglieder versuchen, ihre Beziehungen zueinander zu »managen«, statt sich wirklich aufeinander einzulassen. Obwohl zu Beginn von interaktionsorientierten Gruppen sehr häufig Ratschläge gegeben werden, kommt es nur selten vor, dass ein spezieller Rat einem der Klienten tatsächlich hilft. Indirekt jedoch erfüllt das Ratgeben einen Zweck: Nicht der Inhalt des Rats, sondern der Prozess des Ratgebens könnte nützlich sein, weil er gegenseitige Anteilnahme und Interesse am anderen erkennen lässt.
Der Vater eines kleinen Sohnes, der der Gruppe mitteilt, dass sein inneres Gefühl, böse zu sein, die Ursache für die sozialen Ängste seines Kindes ist, erhält vielleicht Vorschläge, welche Ressourcen in der Gemeinde für sein Kind zur Verfügung stehen. Von größerer Bedeutung ist jedoch die Rückmeldung der Gruppenmitglieder über seine offensichtliche Anständigkeit, Fürsorge und Großzügigkeit nicht nur gegenüber seinem Sohn, sondern auch gegenüber anderen Gruppenmitgliedern. Die Mitglieder verinnerlichen die Gruppe: Ein Gruppenmitglied, das vor Kurzem seinen Studienabschluss gemacht hatte, bemerkte, dass er sich die Gruppe regelmäßig ins Gedächtnis rufen würde, um das in der Gruppe Gelernte auf sein Leben außerhalb der Gruppe anzuwenden, und er scherzte darüber, sich WWGS tätowieren zu lassen – »was würde (die) Gruppe sagen«?
Ratgebendes oder ratsuchendes Verhalten ist oft ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Aufklärung der interpersonellen Pathologie. Beispielsweise ist ein Klient, der ständig versucht, anderen Gruppenmitgliedern Ratschläge und Anregungen zu entlocken, nur um sie dann prompt abzulehnen und die Befragten zu frustrieren, Gruppentherapeuten als der »Hilfe ablehnende Klagende« oder als der »Ja-aber-Klient« wohlbekannt.[64] Einige andere Klienten versuchen, sich Aufmerksamkeit und Zuwendung zu sichern, indem sie bezüglich eines Problems um Rat bitten, das entweder unlösbar oder bereits gelöst ist. Wieder andere saugen Ratschläge auf, als sei ihr Durst unstillbar, geben aber selbst Teilnehmern, die ebenfalls Rat und Hilfe benötigen, niemals etwas Entsprechendes. Manche Gruppenmitglieder sind so darauf aus, innerhalb der Gruppe ein hohes Ansehen zu wahren oder eine Fassade kühler Selbstgenügsamkeit aufrechtzuerhalten, dass sie nie direkt um Hilfe bitten. Einige sind so davon besessen, selbst gefällig zu sein, dass sie nie für sich selbst um etwas bitten. Andere überschlagen sich geradezu in ihren Dankbarkeitsbezeugungen; und schließlich gibt es Klienten, die das Geschenk nie als solches anerkennen, sondern es mit nach Hause nehmen wie einen Knochen, an dem sie dann im stillen Kämmerlein nagen. All diese Verhaltensmuster können in der Gruppenarbeit hilfreich aufgegriffen werden.
Andere Arten von strukturierteren Gruppen, bei denen die Interaktion der Mitglieder nicht im Vordergrund steht, nutzen explizit und sehr effektiv direkte Vorschläge und Anleitungen. Beispielsweise werden in verhaltenstherapeutischen Gruppen, in Gruppen, die Patienten nach einer stationären psychiatrischen Behandlung auf das Leben außerhalb der Klinik vorbereiten sollen, in Gruppen, die Lebenskompetenzen oder Kommunikationsfähigkeiten vermitteln und in den AA-Gruppen oft direkte Ratschläge gegeben. Die AA arbeiten mit Anleitungen und Merksprüchen: Beispielsweise werden ihre Mitglieder aufgefordert, nur während der nächsten vierundzwanzig Stunden abstinent zu bleiben – immer nur für einen Tag –, statt darüber nachzudenken, wie sie es schaffen sollen, für ihr ganzes restliches Leben nicht mehr zu trinken. Eine Gruppe für chronisch kranke Klienten aus der Psychiatrie berichtet von ausgezeichneten Ergebnissen mit einem strukturierten Gruppenprogramm, das gezieltes Feedback, die Wiedergabe von Videoaufzeichnungen und Problemlösungsprojekte umfasst.[65] Eine Gruppe für Schizophrenie-Patienten in China berichtete über signifikante positive Auswirkungen, wenn das Programm um Psychoedukation für Patienten und ihre Familien ergänzt wurde.[66] Kriegsveteranen, die unter einer Kombination aus medizinischen und psychiatrischen Erkrankungen leiden, profitieren von ganzheitlichen Edukationsgruppen, die eine bessere Pflege ihrer körperlichen Gesundheit und Fähigkeiten zur Stressbewältigung fördern.[67] In gemeinschaftsbasierten pädagogischen Gruppeninterventionen wird emotionales Bewusstsein gelehrt und die Resilienz gegenüber Widrigkeiten gefördert.[68] Gruppen wurden in Schulsystemen zur Bekämpfung des Alkoholkonsums von Jugendlichen eingesetzt, indem den Schülern der Zusammenhang zwischen emotionaler Verwundbarkeit und ihrem Trinkverhalten aufgezeigt wurde.[69]
Ist bestimmter Rat besser als anderer? Wissenschaftler, die sich mit einer Gruppe beschäftigten, die das Verhalten männlicher Sexualstraftäter positiv zu beeinflussen versuchte, stellten fest, dass in dieser Gruppe häufig Rat gegeben wurde und dass dieser für die einzelnen Gruppenmitglieder unterschiedlich nützlich war. Die am wenigsten wirksame Form der Beratung war ein direkter Vorschlag wie: »Du musst aufhören, auf dein Handy zu schauen«, der leicht als kontrollierend empfunden werden kann; am wirksamsten war eine Reihe von alternativen Vorschlägen, wie ein gewünschtes Ziel erreicht werden kann: »Wenn du dich weniger isoliert fühlen willst, könntest du vielleicht mehr an den Aktivitäten auf der Station teilnehmen oder in den Aufenthaltsraum kommen, anstatt in deinem Zimmer zu bleiben«, ein Vorschlag, der eher als kooperativ empfunden wird.[70] Psychoedukation hinsichtlich der Auswirkung einer Depression auf Familienbeziehungen ist effektiver, wenn die Teilnehmer einer Gruppe direkt untersuchen, wie die Depression ihr eigenes Leben und die Beziehungen in ihrer Familie beeinflusst. Wird die gleiche Information auf abstrakte, intellektuell-distanzierte Weise vermittelt, ist sie wesentlich weniger nützlich.[71]
Altruismus
Eine alte chassidische Geschichte berichtet von einem Rabbi, der mit Gott ein Gespräch über Himmel und Hölle führte. »Ich will dir die Hölle zeigen«, sagte Gott und führte den Rabbi in ein Zimmer, in dem um einen großen runden Tisch eine Gruppe hungernder, verzweifelter Menschen saß. Mitten auf dem Tisch stand eine riesige Schüssel mit Eintopf, mehr als genug für alle. Das Gericht duftete köstlich, und dem Rabbi lief das Wasser im Mund zusammen. Doch niemand aß. Jeder am Tisch hatte einen sehr langstieligen Löffel in der Hand – lang genug, um den Topf zu erreichen und sich einen Löffel von dem Eintopfgericht zu nehmen, aber zu lang, um die Speise zum Mund zu führen. Der Rabbi sah, dass die Versammelten schrecklich litten, und neigte voller Mitleid sein Haupt. »Nun zeige ich dir den Himmel«, sagte Gott, und sie betraten ein anderes Zimmer, genau wie das erste – der gleiche große runde Tisch, die gleiche riesige Schüssel mit Eintopf, die gleichen langstieligen Löffel. Doch hier waren die Anwesenden fröhlich, wohlgenährt, rundlich und ausgelassen. Zunächst begriff der Rabbi nicht und schaute den Herrn an. »Es ist einfach«, sagte Gott, »aber man braucht dazu eine gewisse Fähigkeit. Die Menschen in diesem Raum haben gelernt, einander zu füttern!«3
Nicht nur im imaginären Himmel und in der imaginären Hölle der Geschichte, sondern auch in Therapiegruppen erhalten Klienten etwas, indem sie selbst etwas geben: Es liegt etwas zutiefst Befriedigendes im Akt des Gebens. Am Anfang ihrer Therapie sind psychisch Kranke oft demoralisiert und haben das bedrückende Gefühl, sie hätten anderen nichts Wertvolles zu bieten. Für andere wichtig sein zu können, wirkt belebend auf sie und es stärkt ihr Selbstwertgefühl. Gruppentherapie ist die einzige Therapieform, die den Klienten eine derartige Erfahrung bietet. Ressourcenorientierte Ansätze wie die positive Psychologie von Seligman stellen die Betonung der Pathologie in unserem Fachgebiet infrage und ermutigen dazu, sich auf die Stärken, positiven Eigenschaften, den Lebenssinn, die Dankbarkeit und die gegenseitige Großzügigkeit der Mitglieder zu konzentrieren.[72] Altruistisches Geben und Nehmen fördert auch die Rollenvielfalt und verlangt von den Klienten, zwischen den Rollen des Hilfeempfängers und des Hilfegebers zu wechseln.[73]
Natürlich helfen Klienten sich auch ausnahmslos gegenseitig im gruppentherapeutischen Prozess. Sie unterstützen und beruhigen einander, machen Vorschläge, teilen Einsichten und informieren einander darüber, dass sie ähnliche Probleme haben. Häufig hören sie sich die Äußerungen anderer Teilnehmer viel bereitwilliger an und nehmen sie sich auch eher zu Herzen, als wenn der Therapeut ihnen mehr oder weniger das Gleiche sagt. Für viele Klienten ist und bleibt der Therapeut der bezahlte Fachmann, wohingegen die anderen Gruppenmitglieder für sie die reale Welt verkörpern; von ihnen glauben sie, aufrichtiges Feedback und wirklich spontane Reaktionen erwarten zu können. Bei einem Rückblick auf den Verlauf ihrer Therapie schreiben Gruppenmitglieder das Verdienst für die Besserung ihrer Situation fast immer anderen Gruppenmitgliedern zu. Manchmal verweisen sie ausdrücklich auf die Unterstützung und die Ratschläge, die sie von anderen Teilnehmern erhalten haben, manchmal auf die bloße Anwesenheit als hilfreichen Faktor.
Die im Folgenden beschriebene Interaktion zwischen zwei Gruppenmitgliedern veranschaulicht dies. Derek, ein chronisch ängstlicher und ziemlich isolierter Mann in den Vierzigern, hatte sich kürzlich der Gruppe angeschlossen und die anderen Gruppenmitglieder sehr verärgert, indem er ihre kritischen und besorgten Feedbacks immer wieder in den Wind geschlagen hatte. Irgendwann hatte Kathy, eine 35-jährige Frau, die unter chronischer Depression und Problemen infolge von Substanzmissbrauch litt, ihm eine wichtige Lektion erteilt, was das Erleben der Gruppe betraf. Auch sie hatte die mitfühlenden Äußerungen anderer monatelang abgetan, weil sie das Gefühl gehabt hatte, diese Zuwendung nicht zu verdienen. Nachdem andere Teilnehmer ihr klargemacht hatten, dass ihre Zurückweisung verletzend wirkte, hatte sie sich bewusst dafür entschieden, auf die Äußerungen anderer grundsätzlich aufgeschlossener und dankbarer zu reagieren. Daraufhin hatte sie zu ihrer Überraschung schon bald festgestellt, dass sie sich wesentlich besser fühlte. Sie hatte also nicht nur von der erhaltenen Unterstützung profitiert, sondern auch davon, dass sie die anderen wissen ließ, sie hätten ihr etwas zu bieten, das für sie wertvoll war.
Altruismus wird auch in anderen Heilsystemen als ein ehrwürdiger therapeutischer Faktor angesehen. In primitiven Kulturen erhalten Menschen, die Probleme haben, oft den Auftrag, ein Festmahl vorzubereiten oder der Gemeinschaft irgendeinen Dienst zu erweisen.[74] Altruismus spielt auch bei dem Heilungsprozess eine wichtige Rolle, der an katholischen Wallfahrtsorten wie Lourdes stattfindet, wo die Kranken nicht nur für sich selbst, sondern auch füreinander beten. Wir Menschen brauchen das Gefühl, gebraucht zu werden und nützlich zu sein.