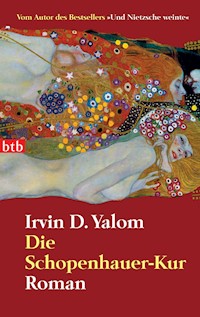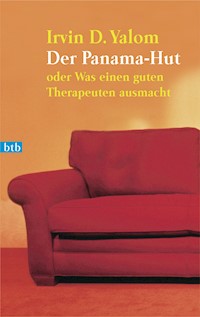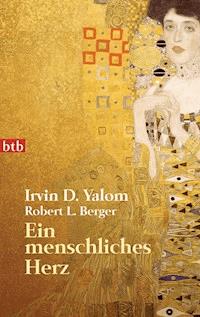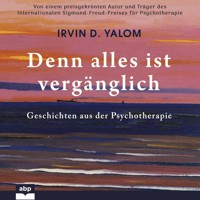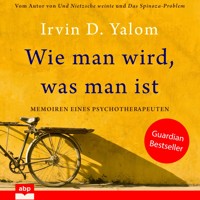11,99 €
Mehr erfahren.
Neue Geschichten vom Kultautor Irvin D. Yalom
Daß Wissenschaft und Phantasie keine Gegensätze bilden müssen, dafür liefert der amerikanische Psychoanalytiker Irvin D. Yalom seit Jahren überzeugende Beweise. Seine Geschichten um psychische Grenzsituationen und deren Bewältigung haben in Deutschland eine riesige Fangemeinde. In seinem neuen Buch erzählt er nicht nur von allzu menschlichen Neurosen seiner "Klienten", sondern läßt seine Leser auch tief ins eigene Innere blicken. So berichtet er vom zwiespältigen Verhältnis zu seiner verstorbenen Mutter, die zeitlebens eine ungebildete Frau war, sich gleichwohl unermüdlich für ihre Familie einsetzte.
"Die Reise mit Paula" wiederum führt zurück in die 70er Jahre, als in Amerika das Thema Sterben "So tabu war wie Pornographie". Yalom ruft eine Art Selbsterfahrungsgruppe Todkranker ins Leben. In deren Zentrum steht Paula, die an Brustkrebs leidet. Ihre Energie und spirituelle Weitsicht beeindrucken Yalom tief und haben bis heute Spuren in seiner Arbeit hinterlassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Irvin D. Yalom
Die Reise mitPaula
Aus dem Amerikanischen von Hans-Joachim Maass
Buch
Dass Wissenschaft und Fantasie keine Gegensätze bilden müssen, dafür liefert der amerikanische Psychoanalytiker Irvin D. Yalom seit Jahren überzeugende Beweise. Seine Geschichten um psychische Grenzsituationen und deren Bewältigung haben in Deutschland eine riesige Fangemeinde. In dem neuen Buch erzählt er nicht nur von allzu menschlichen Neurosen seiner »Klienten«, sondern lässt seine Leser auch tief ins eigene Innere blicken. So beichtet er vom zwiespältigen Verhältnis zu seiner verstorbenen Mutter, die zeitlebens eine ungebildete Frau war, sich gleichwohl unermüdlich für ihre Familie einsetzte. »Die Reise mit Paula« wiederum führt zurück in die 70er Jahre, als in Amerika das Thema Sterben »so tabu war wie Pornografie«. Yalom ruft eine Art Selbsterfahrungsgruppe Todkranker ins Leben. In deren Zentrum steht Paula, die an Brustkrebs leidet. Ihre Energie und spirituelle Weltsicht beeindrucken Yalom tief und haben bis heute Spuren in seiner Arbeit hinterlassen.
Autor
Irvin D. Yalom ist Professor für Psychiatrie an der Stanford University. Seine Bücher »The Theory and Practice of Group Psychiatry« und »Inpatient Group Therapy« sind in den USA zu Klassikern geworden.
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Momma and the Meaning of Life. Tales of Psychotherapy« bei Basic Books, New York
Die Personen und Situationen in den ersten vier Erzählungen sind in der Wirklichkeit verwurzelt, es wurden jedoch die Namen, wesentliche Charakterzüge und gewisse Umstände verändert. Die letzten beiden Erzählungen haben fiktionalen Charakter, das heißt, jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Menschen wäre rein zufällig.
Die Auszüge aus den Gedichten von Robert Frost beziehen sich auf: »Come in« und »Home Burial« aus The Poetry of Robert Frost, herausgegeben von Edward Conney Lathem, © 1942, © 1958 by Robert Frost. © 1970 by Lesley Frost Ballantine. © 1930, 1939, 1969 by Henry Holt & Co., LLC. »Der Hauptfriedhof« aus: Robert Frost »Gesammelte Gedichte«, © Kessler Verlag, Mannheim 1952, in der Übersetzung von Eva Hesse.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
4. Auflage Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2000 Copyright © 1999 by Irvin D. Yalom Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2000 by Wilhelm Goldmann Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Tony Stone Bilderwelten/Sanders Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin RK Herstellung: Augustin Wiesbeck Made in Germany
eISBN 978-3-641-19478-9V001
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de
Für Saul Spiro, Psychiater, Dichter, Künstler.In Dankbarkeit für unsere vierzigjährigeFreundschaft – vierzig Jahre, in denen unsvieles gemeinsam war – das Leben, Bücher,schöpferische Unternehmungslust und eineunerschütterliche Skepsis, ob die ganze Choseüberhaupt einen Sinn hat.
Danksagung
Meinen Dank an alle, die dieses Manuskript gelesen, dazu Vorschläge gemacht oder auf andere Weise entscheidend zu seiner endgültigen Form beigetragen haben: Sara Lippincott, David Spiegel, David Vann, Jo Ann Miller, Murray Bilmes, Ann Arvin, Ben Yalom, Bob Berger, Richard Fumosa und meine Schwester Jean Rose. Meiner Frau Marilyn bin ich auf vielfältigere Weise, als ich sagen kann, zu liebevollem Dank verpflichtet. Dank schulde ich auch meiner Lektorin Phoebe Hoss, die mich wie schon bei so vielen anderen Büchern auch diesmal gnadenlos dazu gedrängt hat, beim Schreiben das Beste aus mir herauszuholen.
Inhaltsverzeichnis
Mama und der Sinn des Lebens
Dämmerung. Vielleicht liege ich im Sterben. An meinem Bett unheimliche Gebilde: Monitore, die meinen Puls überwachen, Sauerstoffgeräte, tropfende Flaschen mit Infusionslösungen, zusammengerollte Plastikschläuche – die Eingeweide des Todes. Ich schließe die Augen und gleite in die Dunkelheit.
Doch dann bin ich mit einem Satz aus dem Bett, renne aus dem Krankenhaus und bin urplötzlich in dem hellen, sonnenbeschienenen Vergnügungspark von Glen Echo, wo ich vor Jahrzehnten viele Sommersonntage verbrachte. Ich höre Karussell-Musik. Ich atme den feuchten, karamellisierten Duft von klebrigem Popcorn und Äpfeln ein. Und ich gehe geradeaus weiter – ohne bei dem Stand mit dem gefrorenen Vanillepudding, der Achterbahn, die sich zwei Mal hinunterstürzt, oder dem Riesenrad innezuhalten –, um mich in der Warteschlange vor der Geisterbahn anzustellen. Nachdem ich meine Eintrittskarte bezahlt habe, warte ich, bis der nächste Wagen mit einem Ruck um die Ecke fährt und scheppernd vor mir hält. Nachdem ich eingestiegen bin und den Sicherungsbügel heruntergezogen habe, um mich sicher und gemütlich hinzusetzen, sehe ich mich ein letztes Mal um – und da, in einer kleinen Gruppe von Zuschauern, sehe ich sie.
Ich winke mit beiden Armen und rufe so laut, dass jeder es hören kann: »Mama! Mama!« In diesem Moment macht der Wagen einen Satz und kracht gegen die Doppeltür, die sich öffnet und den Blick auf einen gähnenden schwarzen Schlund freigibt. Ich lehne mich so weit zurück, wie ich nur kann, und bevor ich von der Dunkelheit verschluckt werde, rufe ich erneut: »Mama! Zufrieden, Mama? Zufrieden mit mir?«
Selbst als ich den Kopf vom Kissen hebe und den Traum abzuschütteln versuche, klumpen sich die Worte in der Kehle zusammen: »Zufrieden, Mama? Mama, zufrieden?«
Aber Mama liegt zwei Meter unter der Erde. Seit zehn Jahren mausetot in einem einfachen Fichtenholzsarg auf einem Friedhof am Anacostia River außerhalb von Washington D.C. Was ist von ihr übrig? Wahrscheinlich nur Knochen. Ohne Zweifel haben die Mikroben jeden Fetzen Fleisch entfernt. Vielleicht sind noch ein paar dünne graue Haarsträhnen übrig – vielleicht kleben noch ein paar glitzernde Knorpelstreifen an den Enden größerer Knochen, des Oberschenkelknochens und des Schienbeins. Und, natürlich, der Ring. Irgendwo im Knochenstaub versteckt muss noch der dünne filigrane silberne Hochzeitsring sein, den mein Vater kurz nach ihrer Ankunft in New York in der Hester Street gekauft hatte, nachdem sie im Zwischendeck von dem eine halbe Welt entfernten russischen Schtetl hergekommen waren.
Ja, lange vorbei. Zehn Jahre. Abgekratzt und verwest. Nichts als Haar, Knorpel, Knochen und ein filigraner silberner Ehering. Und ihr Bild, das in meinen Erinnerungen und Träumen lauert.
Warum winke ich Mama in meinem Traum zu? Ich habe schon vor Jahren mit dem Winken aufgehört. Wie vielen? Vielleicht vor Jahrzehnten schon. Vielleicht war es jener Nachmittag vor mehr als einem halben Jahrhundert, als ich acht war und sie mit mir ins Sylvan ging, das Flohkino, das beim Laden meines Vaters um die Ecke lag. Obwohl es viele leere Plätze gab, ließ sie sich neben einem der Schläger des Viertels hinplumpsen, einem Jungen, der ein Jahr älter war als ich. »Dieser Platz ist besetzt, Lady«, knurrte er.
»Ja, ja! Besetzt!«, gab meine Mutter verächtlich zurück, als sie es sich bequem machte. »Der hält Plätze frei, dieses Großmaul!«, verkündete sie jedem, der in der Nähe saß.
Ich versuchte, mich in dem kastanienbraunen Samtpolster unsichtbar zu machen. Später, in dem abgedunkelten Kino, nahm ich meinen Mut zusammen und drehte langsam den Kopf. Da war er und saß jetzt ein paar Reihen weiter hinten neben seinem Freund. Kein Irrtum möglich, sie funkelten mich böse an und zeigten auf mich. Einer von ihnen schüttelte die Faust und formte mit den Lippen die Worte: »Warte nur!«
Mama hatte damit das Sylvan-Kino für mich ruiniert. Es war jetzt feindliches Territorium. Gesperrt, zumindest bei Tageslicht. Wenn ich bei den Fortsetzungsfilmen am Sonnabend auf dem Laufenden bleiben wollte – Buck Rogers, Batman, The Green Hornet, The Phantom –, durfte ich erst rein, wenn der Film schon angefangen hatte, musste meinen Platz in der letzten Reihe des Kinos im Dunkeln einnehmen, möglichst nahe an einem Notausgang und schnell verschwinden, kurz bevor die Lichter wieder angingen. In meinem Viertel hatte nichts höhere Priorität als das Bemühen, nicht zusammengeschlagen zu werden, denn das war eine größere Katastrophe. Ein Fausthieb – nicht schwer, sich das vorzustellen: Ein Schlag aufs Kinn, und das war’s dann. Faustschläge, Ohrfeigen, Fußtritte, Messerstiche ebenso. Aber zusammengeschlagen zu werden – O mein Gott. Wo endet das? Was bleibt von einem übrig? Man ist aus dem Rennen und trägt für immer das Etikett »Man hat mich zusammengeschlagen« mit sich herum.
Und dass ich Mama zugewinkt habe? Warum sollte ich ihr jetzt wohl zuwinken, wo ich Jahr für Jahr mit ihr in einem Zustand ungebrochener Animosität gelebt habe? Sie war eitel, herrisch, aufdringlich, misstrauisch, boshaft, höchst starrsinnig und abgrundtief unwissend (aber intelligent – sogar ich konnte das sehen). Ich kann mich nicht erinnern, jemals, auch nur einmal, mit ihr einen warmherzigen Moment erlebt zu haben.
Niemals, kein einziges Mal, empfand ich so etwas wie Stolz auf sie oder dachte, wie froh ich bin, dass sie meine Mama ist. Sie hatte eine giftige Zunge und ein boshaftes Wort für jeden – mit Ausnahme meines Vaters und seiner Schwester.
Ich liebte meine Tante Hannah, die Schwester meines Vaters: ihre Sanftheit, ihre unfehlbare Herzenswärme, ihre in geräucherte knusprige Wurstscheiben gewickelten Grillwürstchen, ihren unvergleichlichen Strudel (dessen Rezept für mich auf ewig verloren ist, da ihr Sohn nicht damit herausrücken will – aber das ist eine andere Geschichte). An Sonntagen liebte ich Hannah am meisten. Sonntags war ihr Delikatessenladen in der Nähe der Marinewerft von Washington geschlossen, und da stellte sie den Spielautomaten auf Freispiele und ließ mich stundenlang spielen. Sie erhob nie Einwände, wenn ich kleine Papierstapel unter die Vorderbeine des Automaten schob, um das Rollen der Kugel zu verlangsamen, um so leichter mehr Punkte zu erzielen. Meine grenzenlose Liebe zu Hannah brachte meine Mama immer in Wut und löste boshafte Attacken auf ihre Schwägerin aus. Zu Hannah leierte Mama immer die gleiche Litanei herunter: Hannahs Armut, ihre Abneigung gegen die Arbeit im Laden, ihr unterentwickelter Geschäftssinn, ihr Trottel von Ehemann, ihr Mangel an Stolz und ihre Bereitwilligkeit, jede Art von Almosen anzunehmen.
Mamas Sprechweise war schauerlich, Englisch sprach sie mit einem starken Akzent, und es war mit jiddischen Redensarten gespickt. Sie kam an Elterntagen nie in die Schule und nutzte auch nie die Lehrersprechstunden. Gott sei Dank! Schon beim bloßen Gedanken daran, ich sollte ihr meine Freunde vorstellen, krampfte sich mir alles zusammen. Ich stritt mit Mama, forderte sie heraus, brüllte sie an, ging ihr aus dem Weg, um schließlich als Jugendlicher überhaupt nicht mehr mit ihr zu sprechen.
Das große Rätsel meiner Kindheit war: Wie hält Daddy es mit ihr aus? Ich erinnere mich an wundervolle Augenblicke, wenn er und ich an einem Sonntagmorgen Schach spielten und er fröhlich zu Schallplatten mit russischer oder jüdischer Musik sang. Dabei wiegte er den Kopf im Takt der Musik. Früher oder später wurde die Morgenluft von Mamas Stimme erschüttert, die von oben her kreischte: »Gevalt, Gevalt, genug! Weh ist mir, Schluss mit der Musik, Schluss mit dem Lärm!« Mein Vater stand ohne ein Wort auf, stellte das Grammofon ab und setzte unser Schachspiel schweigend fort. Wie oft betete ich, bitte, Dad, bitte, nur dieses eine Mal, hau ihr eine runter!
Also wozu winken? Und wozu am Ende meines Lebens fragen: »Zufrieden, Mama?« Kann es sein – und die Möglichkeit erschüttert mich –, dass ich mein ganzes Leben mit dieser beklagenswerten Frau als wichtige Zuhörerin verbracht habe? Mein ganzes Leben lang habe ich mich bemüht, meiner Vergangenheit um jeden Preis zu entkommen – dem Schtetl, dem Zwischendeck, dem Getto, dem Gebetsschal, dem Singsang, dem schwarzen Kaftan, dem Lebensmittelladen. Mein Leben lang habe ich mich um Befreiung und Wachstum bemüht. Kann es sein, dass ich weder meiner Vergangenheit noch meiner Mutter entkommen bin?
Diejenigen Freunde, die liebevolle und reizende Mütter hatten, die immer für sie da waren – wie ich sie beneide. Und wie merkwürdig, dass sie sich ihren Müttern nicht verpflichtet fühlen und sie nicht oft anrufen, besuchen, von ihnen träumen oder auch nur an sie denken. Während ich mir meine Mutter jeden Tag mehrmals aus dem Kopf scheuchen muss und selbst jetzt noch, zehn Jahre nach ihrem Tod, oft aus Reflex nach einem Telefon greife, um sie anzurufen.
Oh, intellektuell kann ich das alles nachvollziehen. Ich habe über das Phänomen Vorträge gehalten. Ich erkläre meinen Patienten, dass es vernachlässigten Kindern oft schwer fällt, sich von ihren gestörten Familien zu lösen, während es andererseits Kinder gibt, die sich guten, liebevollen Eltern entfremden, mit denen es weit weniger Konflikte gab. Besteht die Aufgabe guter Eltern letztlich nicht darin, das Kind in die Lage zu versetzen, das Elternhaus zu verlassen und auf eigenen Beinen zu stehen?
Ich verstehe es, aber es gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, dass meine Mutter mich jeden Tag besucht. Ich hasse es, dass sie sich so geschickt in die Zwischenräume meiner Gehirnwindungen hineingeschmuggelt hat, dass ich sie nicht ausrotten kann. Und mehr als alles andere hasse ich, dass ich mich am Ende meines Lebens gezwungen fühle zu fragen:
»Zufrieden, Mama?«
Ich denke an den üppig gepolsterten Sessel in ihrem Altersheim in Washington, D.C. Er versperrte zum Teil den Eingang zu ihrer Wohnung und war von Beistelltischen flankiert, auf denen die von mir geschriebenen Bücher gestapelt lagen, von jedem mindestens eins, manchmal mehrere. Bei mehr als einem Dutzend Büchern und weiteren zwei Dutzend fremdsprachiger Ausgaben gerieten die Bücherstapel gefährlich ins Wanken. Ich stellte mir oft vor, dass nur noch ein mittelprächtiger Erdstoß nötig wäre, um sie bis zur Nase unter den Büchern ihres einzigen Sohnes zu begraben.
Wann immer ich sie besuchte, fand ich sie in diesem Sessel postiert, mit zwei oder drei meiner Bücher auf dem Schoß. Sie wog sie in der Hand, roch daran, streichelte sie – alles, nur lesen tat sie sie nicht. Sie war zu blind. Aber schon bevor ihr Sehvermögen nachließ, hätte sie sie nicht verstehen können: Ihre einzige Schulbildung hatte sie beim Staatsbürgerkundeunterricht genossen, der eine Voraussetzung dafür war, dass sie die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt.
Ich bin Schriftsteller. Und Mama kann nicht lesen. Trotzdem wende ich mich an sie, um ein Urteil über mein Lebenswerk zu erhalten. Das wie beurteilt werden soll? Am Geruch oder dem schieren Gewicht meiner Bücher? An der Gestaltung der Schutzumschläge, die sich anfühlen, als wären sie mit glattem Fett bestrichen oder mit Teflon beschichtet? Von meinen sorgfältigen Recherchen, meinen Inspirationsschüben, meiner anspruchsvollen Suche nach dem korrekten Gedanken, dem flüchtigen, eleganten Satz: Von diesen Dingen hat sie nie etwas gewusst.
Der Sinn des Lebens? Der Sinn meines Lebens. Gerade die auf Mamas Tisch gestapelten und gefährlich schwankenden Bücher enthalten anspruchsvolle Antworten auf solche Fragen. »Wir sind sinnsuchende Geschöpfe« schrieb ich, »die sich der Unannehmlichkeit stellen müssen, in ein Universum geschleudert zu werden, das an sich keinen Sinn hat.« Um dann dem Nihilismus zu entgehen, erklärte ich, müssten wir uns eine zweifache Aufgabe vornehmen. Erstens müssten wir etwas erfinden oder entdecken, was ein Leben bedeute und tragfähig genug sei, ein Leben zu stützen. Als Nächstes müssten wir uns vorstellen, wir hätten dieses dem Leben einen Sinn gebende Vorhaben nicht erfunden, sondern entdeckt – dass es ein unabhängiges Eigenleben hat.
Obwohl ich mir den Anschein gebe, als akzeptierte ich ohne Bewertung die Lösung jedes Menschen, teile ich sie insgeheim in Bronze, Silber und Gold ein. Manche Menschen werden von einer Vision rachsüchtigen Triumphs durchs Leben getrieben; andere, in Verzweiflung gehüllte Menschen, hantiert nur von Frieden, Distanz und Freiheit von Schmerz; wieder andere weihen ihr Leben dem Erfolg, dem Reichtum, der Macht und der Wahrheit; andere suchen nach Möglichkeiten, über sich hinauszuwachsen, und vertiefen sich in eine Sache oder ein anderes Wesen – einen geliebten Menschen oder ein göttliches Wesen; wieder andere finden ihren Sinn in einem dienenden Leben, in Selbstverwirklichung oder in schöpferischem Ausdruck.
Wir brauchen die Kunst, sagte Nietzsche, um nicht an der Wahrheit zu zerbrechen. Daher halte ich die Kreativität für den goldenen Weg und habe mein ganzes Leben, alle meine Erfahrungen, alle meine Vorstellungen in eine Art schwelenden inneren Komposthaufen verwandelt, aus dem ich von Zeit zu Zeit etwas Neues und Schönes zu gestalten versuche.
Doch mein Traum sagt das Gegenteil. Er behauptet, ich hätte mein Leben einem ganz anderen Ziel geweiht – die Anerkennung meiner toten Mama zu gewinnen.
Diese Traum-Anschuldigung hat Macht: Zu viel Macht, um sie zu ignorieren. Und sie ist zu verstörend, um sie zu vergessen. Doch ich habe gelernt, dass Träume weder unergründlich noch unwandelbar sind. Die meiste Zeit meines Lebens bin ich ein Mensch gewesen, der mit Träumen hantiert. Ich habe gelernt, Träume zu zähmen, sie auseinander zu nehmen, sie zusammenzusetzen. Ich weiß, wie man aus Träumen Geheimnisse ausquetscht.
Und so lasse ich den Kopf wieder auf mein Kopfkissen fallen, lasse mich treiben und spule den Traum zurück zu dem Wagen in der Geisterbahn.
Der Wagen hält mit einem Ruck an und lässt mich gegen den Sicherheitsriegel knallen. Einen Augenblick später wechselt der Wagen die Richtung und fährt langsam rückwärts durch die Schwingtür, wieder hinaus in das Sonnenlicht von Glen Echo.
»Mama, Mama!«, rufe ich und winke mit beiden Armen. »Zufrieden?«
Sie hört mich. Ich sehe, wie sie sich ihren Weg durch die Menge bahnt und links und rechts Menschen zur Seite schleudert. »Oyvin, was für eine Frage«, sagt sie, löst den Schutzriegel und zieht mich aus dem Wagen.
Ich sehe sie an. Sie scheint fünfzig oder sechzig zu sein, eine starke und stämmige Frau, und trägt mühelos eine überquellende bestickte Einkaufstasche mit einem Holzgriff. Sie ist reizlos, weiß es aber nicht, und geht mit erhobenem Kinn, als wäre sie schön. Ich bemerke die vertrauten Fleischfalten, die von ihrem Oberarm herabhängen, und die direkt über den Knien straff gezogenen und fest gebundenen Strümpfe. Sie gibt mir einen dicken nassen Kuss. Ich täusche Zuneigung vor.
»Und ob ich das bin. Wer könnte mehr verlangen? All diese Bücher. Du hast mich stolz gemacht. Wenn nur dein Vater es noch sehen könnte.«
»Was meinst du damit, Mama? Woher willst du das wissen? Du kannst nicht lesen, was ich geschrieben habe – mit deinen schlechten Augen, meine ich.«
»Ich weiß, was ich weiß. Sieh dir diese Bücher an.« Sie öffnet die Einkaufstasche, zieht zwei Bücher heraus und beginnt sie zärtlich zu streicheln. »Große Bücher. Schöne Bücher.«
Ihr Herumfingern an meinen Büchern entnervt mich. »Es kommt darauf an, was in den Büchern steht. Vielleicht enthalten sie nur Unsinn.«
»Oyvin, red keine narrishkeit. Schöne Bücher!«
»Trägst du sogar in Glen Echo immerzu diese Tasche mit Büchern mit dir herum, Mama? Du machst ein Heiligtum aus ihnen. Meinst du nicht ...«
»Jeder weiß von dir. Die ganze Welt. Meine Friseuse sagt mir, dass ihre Tochter deine Bücher in der Schule studiert.«
»Deine Friseuse? Soll das der Qualitätstest sein?«
»Jeder. Ich erzähle es jedem. Warum sollte ich nicht?«
»Mama, hast du nichts Besseres zu tun? Wie wär’s, wenn du deinen Sonntag mit deinen Freunden verbringst, mit Hannah, Gertie, Luba, Dorothy, Sam, deinem Bruder Simon? Was willst du überhaupt hier in Glen Echo?«
»Schämst du dich, weil ich hier bin? Du hast dich immer geschämt. Wo sollte ich sonst sein?«
»Ich meine nur, dass wir beide erwachsen sind. Ich bin mehr als sechzig Jahre alt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass jeder von uns seine eigenen privaten Träume hat.«
»Hast dich immer meiner geschämt.«
»Das habe ich nicht gesagt. Du hörst mir nicht zu.«
»Hast mich immer für dumm gehalten. Hast immer geglaubt, ich verstünde nichts.«
»Das habe ich nicht gesagt. Ich habe immer gesagt, dass du nicht alles weißt. Es ist nur die Art und Weise, wie du – wie du …«
»Wie ich was? Na los doch, sprich weiter. Du hast angefangen – sag es – ich weiß, was du sagen willst.«
»Was werde ich sagen?«
»Nein, Oyvin, du sagst es. Wenn ich es dir sage, wirst du es ändern.«
»Es ist die Art, wie du mir nicht zuhörst. Die Art, wie du von Dingen sprichst, von denen du nichts weißt.«
»Dir zuhören? Ich höre dir nicht zu? Sag mir, Oyvin, hörst du mir zu? Weißt du etwas von mir?«
»Du hast Recht, Mama. Keiner von uns ist für den anderen ein guter Zuhörer gewesen.«
»Auf mich trifft das nicht zu, Oyvin, ich habe gut zugehört. Ich habe jeden Abend der Stille gelauscht, wenn ich aus dem Laden nach Hause kam und du es nicht nötig hast, von deinem Arbeitszimmer zu mir nach oben zu kommen. Du sagst nicht mal hallo. Du fragst mich nicht, ob ich einen harten Tag hinter mir habe. Wie sollte ich dir zuhören, wenn du nicht mit mir sprichst?«
»Etwas hat mich davon abgehalten; es war eine solche Mauer zwischen uns.«
»Eine Mauer? Nett, so was zu deiner Mutter zu sagen. Eine Mauer. Habe ich sie gebaut?«
»Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass da eine Mauer war. Ich weiß, dass ich mich von dir zurückgezogen habe. Warum? Woher soll ich das jetzt noch wissen? Das ist fünfzig Jahre her, Mama, aber alles, was du zu mir sagtest, war für mein Gefühl so etwas wie eine Rüge.«
»Wos? Lüge?«
»Ich meine Kritik. Ich musste mich von deiner Kritik fern halten. In jenen Jahren war mir auch so schon unwohl genug in meiner Haut, und noch mehr Kritik brauchte ich nicht.«
»Weswegen hast du dich unwohl gefühlt? Alle diese Jahre – Daddy und ich haben im Laden gearbeitet, damit du studieren kannst. Bis Mitternacht. Und wie oft hast du angerufen, damit ich dir etwas mitbringe? Bleistifte oder Papier. Erinnerst du dich an Al? Er hat im Wein- und Schnapsgeschäft gearbeitet. Der Mann, dem man bei einem Raubüberfall das Gesicht zerschnitten hat?«
»Natürlich erinnere ich mich an Al, Mama. An die Narbe auf der Nase, die von oben nach unten verlief.«
»Nun, Al nahm ab und brüllte quer durch den vollen Laden: ›Es ist der König! Der König ruft an! Soll der König sich doch selber seine Bleistifte kaufen. Der König könnte etwas Bewegung gebrauchen.‹ Al war eifersüchtig; seine Eltern schenkten ihm nichts. Ich habe damals nicht auf das geachtet, was er sagte. Aber Al hatte Recht; ich habe dich wie einen König behandelt. Wann immer du anriefst, ob am Tag oder nachts, ließ ich Daddy mit einem Laden voller Kunden stehen und rannte den Block hinunter zu Menschs Billigladen. Briefmarken brauchtest du auch. Und Notizbücher und Tinte. Und Kugelschreiber. All deine Kleider mit Tinte verschmiert. Wie ein König. Keine Kritik.«
»Ma, wir sprechen jetzt miteinander. Und das ist gut. Wir wollen uns nicht gegenseitig beschuldigen. Wir sollten Verständnis füreinander aufbringen. Sagen wir einfach, dass ich mich kritisiert fühlte. Ich weiß, dass du zu anderen gute Dinge über mich gesagt hast. Du hast mit mir geprahlt. Aber du hast es nie zu mir gesagt. Nicht ins Gesicht.«
»Es war gar nicht so leicht, damals mit dir zu sprechen, Oyvin. Und nicht nur für mich, für jeden. Du wusstest alles. Du hattest alles gelesen. Vielleicht fürchteten sich die Menschen ein wenig vor dir. Ich vielleicht auch. Wer weiß? Aber eins will ich dir sagen, Oyvin, mir ist es schlimmer ergangen als dir. Erstens hast auch du nie etwas Nettes über mich gesagt. Ich hielt das Haus in Ordnung; ich kochte für dich. Zwanzig Jahre lang hast du mein Essen gegessen. Es schmeckte dir, das weiß ich. Woher ich das wusste? Weil die Teller und Töpfe immer leer waren. Aber gesagt hast du es mir nie. Nicht einmal in deinem Leben. Oder? Einmal in deinem Leben?«
Ich schämte mich und konnte nur den Kopf neigen.
»Zweitens wusste ich, dass du hinter meinem Rücken nichts Nettes über mich sagtest – wenigstens hattest du das, Oyvin, denn du wusstest, dass ich hinter deinem Rücken bei anderen mit dir prahlte. Aber ich wusste, dass du dich meiner schämtest. Du hast dich immer meiner geschämt – ob direkt vor mir und hinter meinem Rücken. Du schämtest dich meines Englischs, meines Akzents. Du schämtest dich wegen allem, was ich nicht wusste. Und der Dinge, die ich falsch sagte. Ich hörte, wie du und deine Freunde euch über mich lustig machtet – Julie, Shelly, Jerry. Ich habe alles gehört. Was sagst du dazu?«
Ich senke den Kopf noch mehr. »Dir ist nie was entgangen, Mama.«
»Wie hätte ich etwas von dem wissen sollen, was in deinen Büchern steht? Wenn ich eine Chance gehabt hätte, wenn ich eine Schule hätte besuchen können, was hätte ich mit meinem Kopf machen können, mit meinem Sechel!1 In Russland, im Schtetl, konnte ich nicht zur Schule gehen – nur die Jungen.«
»Ich weiß, Mama, ich weiß. Ich weiß, dass du dich in der Schule genauso gut gemacht hättest wie ich, wenn du die Chance dazu gehabt hättest.«
»Ich bin mit meiner Mutter und meinem Vater von Bord des Schiffes gegangen. Ich war erst zwanzig. Sechs Tage in der Woche musste ich in einer Textilfabrik arbeiten. Zwölf Stunden am Tag. Von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends. Manchmal bis acht. Und zwei Stunden vorher, um fünf Uhr morgens, musste ich meinen Vater zu seinem Zeitungsstand neben dem U-Bahn-Eingang bringen und ihm dabei helfen, die Zeitungen auszupacken. Meine Brüder haben nie geholfen. Simon besuchte Buchhaltungskurse. Hymie fuhr ein Taxi – kam nie nach Hause, schickte nie Geld. Und dann habe ich Daddy geheiratet und bin nach Washington gezogen, und bis ich alt war, habe ich mit ihm zwölf Stunden am Tag im Laden an seiner Seite gearbeitet und das Haus sauber gemacht und auch noch gekocht. Und dann bekam ich Jean, die mir nicht eine Minute Kummer gemacht hat. Und dann bekam ich dich. Und du warst nicht einfach. Und ich habe nie aufgehört zu arbeiten. Du hast mich doch gesehen! Du weißt es doch! Du hast gehört, wie ich treppauf und treppab gelaufen bin. Lüge ich etwa?«
»Ich weiß, Mama.«
»Und in all diesen Jahren habe ich Bubba und Zeyda unterstützt, solange sie lebten. Sie hatten nichts – die paar Pennys, die mein Vater mit dem Zeitungsstand machte. Später haben wir für ihn einen Süßigkeitenladen aufgemacht, aber er konnte nicht arbeiten – die Männer mussten beten. Du erinnerst dich an Zeyda?«
Ich nicke. »Ich erinnere mich schwach, Mama.« Ich musste vier oder fünf gewesen sein … Eine säuerlich riechende Mietskaserne in der Bronx ... Warf Brotkrümel und zusammengeknüllte Stanniolkugeln fünf Stockwerke runter zu den Hühnern auf dem Innenhof … Mein Großvater, ganz in Schwarz und mit hoher schwarzer Jarmulke und mit wildem weißen Bart, der voller Bratensoße war, hatte Arme und Stirn in schwarze Schnüre gewickelt und murmelte Gebete. Wir konnten uns nicht miteinander unterhalten – er sprach nur Jiddisch –, aber er kniff mich hart in die Wange. Alle anderen Bubba, Mama, Tante Lena – arbeiteten, rannten den ganzen Tag treppauf und treppab, um im Laden ein- und auszupacken, um zu kochen, die Hühnchen zu rupfen, die Fische zu schuppen und Staub zu wischen. Aber Zeyda rührte keinen Finger. Saß nur da und las. Wie ein König.
»Jeden Monat«, fährt Mama fort, »fuhr ich mit der Bahn nach New York und brachte ihnen etwas zu essen und Geld. Und als Bubba später im Pflegeheim war, bezahlte ich dafür und besuchte sie alle zwei Wochen – du erinnerst dich, ich hab dich manchmal mitgenommen. Wer sonst in der Familie hat geholfen? Niemand! Dein Onkel Simon tauchte alle paar Monate auf und brachte ihr eine Flasche 7 Up mit, und bei meinem nächsten Besuch hörte ich nur etwas von dem wundervollen 7 Up von Onkel Simon. Selbst als sie schon blind war, lag sie da und hielt nur die leere 7 Up-Flasche in der Hand. Und ich habe nicht nur Bubba geholfen, sondern auch jedem anderen in der Familie – meinen Brüdern Simon und Hymie, meiner Schwester Lena, Tante Hannah, deinem Onkel Abe, diesem Grünschnabel, den ich aus Russland mitbrachte alle, die ganze Familie, haben von diesem schmutzigen kleinen Lebensmittelladen gelebt. Niemand hat mir je geholfen! Und niemand hat mir je gedankt.«
Ich hole sehr tief Luft und bringe die Worte hervor: »Ich danke dir, Mama. Ich danke dir.«
Es ist gar nicht so schwer. Warum habe ich fünfzig Jahre dazu gebraucht? Ich nehme ihren Arm, vielleicht zum ersten Mal. Der fleischige Teil gleich über dem Ellbogen. Er fühlt sich weich und warm an, etwa so wie ihr warmer Kichel-Teig kurz vor dem Backen. »Ich erinnere mich, wie du Jean und mir von Onkel Simons 7 Up erzählt hast. Das muss hart gewesen sein.«
»Hart? Hast du eine Ahnung. Manchmal trank er sein 7 Up mit einem Stück von meinem kichel – du weißt, was für eine Arbeit es ist, kichel zu machen –, und sie spricht von nichts anderem als von dem 7 Up.«
»Es tut gut zu sprechen, Mama. Es ist das erste Mal. Vielleicht habe ich es mir immer gewünscht, und vielleicht ist das der Grund, weshalb du mir nicht aus dem Kopf gehst und ich immer von dir träume. Vielleicht wird es jetzt anders sein.«
»Wie anders?«
»Nun, ich werde mehr ich selbst sein können – eher für die Ziele und Dinge leben können, die mir etwas bedeuten.«
»Willst du mich loswerden?«
»Nein – nun, nicht so, ich meine es nicht böse. Ich wünsche mir das Gleiche für dich. Ich wünsche, dass du dich endlich ausruhen kannst.«
»Ausruhen? Hast du mich je ausruhen sehen? Daddy hat jeden Tag sein Nickerchen gemacht. Hast du das je bei mir erlebt?«
»Was ich meine, ist Folgendes: Du solltest dir im Leben ein eigenes Ziel setzen – nicht dieses«, sage ich und tippe gegen ihre Einkaufstasche. »Nicht meine Bücher! Und ich sollte mein eigenes Ziel haben.«
»Aber ich habe es doch gerade erklärt«, entgegnet sie und nimmt ihre Einkaufstasche in die andere Hand, damit ich nicht an sie herankann. »Dies sind nicht nur deine Bücher. Es sind auch meine!«
Ihr Arm, den ich immer noch umklammert halte, ist plötzlich kalt, und ich lasse ihn los.
»Was meinst du damit«, fährt sie fort, »dass ich ein eigenes Ziel haben sollte? Diese Bücher sind mein Ziel. Ich habe für dich gearbeitet – und für sie. Mein ganzes Leben lang habe ich für diese Bücher gearbeitet – meine Bücher.« Sie greift in ihre Einkaufstasche und zieht zwei weitere hervor. Ich zucke zusammen, da ich befürchte, dass sie sie hochhalten und der kleinen Gruppe von Zuschauern zeigen wird, die sich jetzt um uns versammelt hat.
»Aber du verstehst nicht, Mama. Wir müssen getrennt leben einander nicht gegenseitig Fesseln anlegen. Nur so wird man zu einem eigenständigen Menschen. Das ist genau das, worüber ich in diesen Büchern schreibe. So möchte ich auch meine Kinder haben – alle Kinder. Unbehindert und frei von Fesseln.«
»Vos meinen – frei von Fesseln?«
»Ich meine, dass sie frei und unbehindert leben sollen. Ich kann mich dir nicht verständlich machen, Mama. Lass es mich so ausdrücken: Jeder einzelne Mensch in der Welt ist im Grunde allein. Es ist hart, aber so ist es nun mal, und wir müssen uns damit abfinden. Ich möchte also eigene Gedanken und eigene Träume haben. Und du solltest deine haben. Mama, ich möchte dich aus meinen Träumen raus haben.«
Ihr Gesicht strafft sich streng, und sie tritt einen Schritt von mir zurück. Ich beeile mich hinzuzufügen: »Aber nicht etwa weil ich dich nicht mag, sondern weil ich für uns alle das Beste will – für mich und auch für dich. Du solltest im Leben eigene Träume haben. Das musst du doch verstehen.«
»Oyvin, du glaubst immer noch, ich verstünde gar nichts, und du verstündest alles. Aber ich sehe mir auch das Leben an. Und den Tod. Und ich verstehe etwas vom Tod – mehr als du. Glaub mir. Und ich verstehe etwas vom Alleinsein – mehr als du.«
»Aber Mama, du sollst doch gar nicht allein sein. Du bleibst bei mir. Du verlässt mich nicht. Du wanderst in meinen Gedanken umher. In meinen Träumen.«
»Nein, Sonny.«
»Sonny«: Ich habe diesen Namen seit fünfzig Jahren nicht mehr gehört, hatte vergessen, dass sie und mein Vater mich oft so nannten.
»Es ist nicht so, wie du denkst, Sonny«, fährt sie fort. »Es gibt ein paar Dinge, die du nicht verstehst, einige Dinge, die du durcheinander bringst. Kennst du diesen Traum, in dem ich da in der Menge stehe und dir zusehe, wie du mir im Wagen zuwinkst und mir etwas zurufst, mich fragst, ob ich mit dem zufrieden bin, was du im Leben erreicht hast?«
»Ja, natürlich erinnere ich mich an meinen Traum, Mama. Damit hat ja alles angefangen.«
»Dein Traum? Das will ich dir ja gerade sagen. Das ist der Irrtum, Oyvin – dass du glaubst, ich wäre in deinem Traum. Dieser Traum war nicht dein Traum, Sonny. Es war meiner. Auch Mütter haben manchmal Träume.«
Die Reise mit Paula
Als Medizinstudent wurde ich in der schönen Kunst unterrichtet, hinzusehen, zuzuhören und zu berühren. Ich betrachtete scharlachrote Rachen, geschwollene Trommelfelle und das Aderngeflecht der Netzhaut. Ich lauschte dem zischenden Geräusch des Herzklappenrasselns, gurgelnden Kanälen der Eingeweide, der Kakophonie rasselnder Laute der Atemwege. Ich befühlte die schlüpfrigen Ränder von Milzen und Lebern, die Straffheit von Eierstockzysten, die marmorartige Härte von Prostatakrebs.
Über Patienten lernen – ja, darum ging es beim Medizinstudium. Aber von Patienten lernen – dieser Aspekt meiner höheren Bildung kam erst viel später. Vielleicht begann es mit meinem Professor, John Whitehorn, der oft sagte: »Hören Sie Ihren Patienten zu; lassen Sie sich etwas von Ihnen beibringen. Um weise zu werden, müssen Sie Student bleiben.« Und er meinte damit weit mehr als die banale Wahrheit, dass der gute Zuhörer mehr über den Patienten erfährt. Er meinte ganz buchstäblich, dass wir unseren Patienten erlauben sollten, uns etwas beizubringen.
John Whitehorn war ein förmlicher, linkischer, höflicher Mann, um dessen glitzernden Schädel sich ein mit peinlicher Sorgfalt geschnittener Halbmond grauen Haars legte. Er war seit dreißig Jahren der distinguierte Chefarzt der Psychiatrie an der John-Hopkins-Universität. Er trug eine goldgeränderte Brille, hatte keine überflüssigen Merkmale an sich – keine Falte im Gesicht oder in dem braunen Anzug, den er jeden Tag des Jahres trug (wir vermuteten, dass er zwei oder drei identische Anzüge im Kleiderschrank haben musste). Und überflüssige Ausdrucksmittel gab es bei ihm auch nicht: Wenn er seine Vorlesungen hielt, bewegten sich seine Lippen; alles andere – Hände, Wangen, Augenbrauen – blieben bemerkenswert still.
Im dritten Jahr meiner psychiatrischen Ausbildung, in dem ich im Krankenhaus wohnte, machten fünf Kommilitonen und ich an jedem Donnerstagnachmittag mit Dr. Whitehorn Visite. Zuvor hatten wir in seinem eichengetäfelten Arbeitszimmer gegessen. Die Kost war einfach und immer gleich – Tunfisch-Sandwiches, Aufschnitt und kalte Pastete von Chesapeake Bay-Krabben, anschließend Obstsalat und Tarte mit Pekannüssen – allerdings mit der Eleganz des Südens serviert: Tischdecke aus Leinen, blitzende Silbertabletts, feines Porzellan. Die Unterhaltung beim Essen zog sich ohne jede Hast lange hin. Obwohl jeder von uns Anrufe zu beantworten hatte und Patienten lautstark auf sich aufmerksam machten, ließ sich Dr. Whitehorn durch nichts aus der Ruhe bringen, und letztlich lernte selbst ich, der ungeduldigste der ganzen Gruppe, die Zeit anzuhalten. In diesen zwei Stunden hatten wir die Gelegenheit, unseren Professor alles zu fragen: Ich weiß noch, dass ich ihn nach Dingen fragte wie der Genesis von Paranoia, der Verantwortung eines Arztes gegenüber zu Selbstmord neigenden Patienten, der Unvereinbarkeit von therapeutischem Wandel und Determinismus. Obwohl er ausführlich antwortete, gab er anderen Themen deutlich den Vorzug: etwa der Zielgenauigkeit persischer Bogenschützen, der Qualität griechischen Marmors gegenüber spanischem, die größeren militärischen Schnitzer in der Schlacht von Gettysburg oder der von ihm verbesserten Tabelle des periodischen Systems der Elemente (er hatte zunächst Chemie studiert).
Nach dem Essen begann Dr. Whitehorn in seinem Arbeitszimmer seine vier oder fünf Privatpatienten zu interviewen, während wir schweigend zuhörten. Es war nie möglich, die Länge des Interviews vorherzusagen. Einige dauerten fünfzehn Minuten, aber viele zogen sich zwei oder drei Stunden hin. Am deutlichsten erinnere ich mich an die Sommermonate, das kühle, abgedunkelte Arbeitszimmer; die orange-grün-gestreiften Markisen sperrten den erbarmungslosen Sonnenschein von Baltimore aus. Das Gestänge der Markisen wurde von Lorbeer-Magnolien umrankt, deren wollig weiche Blüten direkt vor dem Fenster baumelten. Vom Eckfenster aus konnte ich gerade noch den Rand des Tennisplatzes für die Krankenhausbediensteten erkennen. Oh, wie ich mich damals danach sehnte zu spielen! Ich war ganz unruhig bei meinen Tagträumen von Assen und Volleys, als die Schatten auf dem Platz unerbittlich länger wurden. Erst als die Abenddämmerung die allerletzten Streifen von Tennis-Zwielicht verschluckt hatten, ließ ich alle Hoffnung fahren und wandte meine volle Aufmerksamkeit Dr. Whitehorns Interviews zu.
Er ging in gemächlichem Tempo vor. Er hatte viel Zeit. Nichts interessierte ihn so sehr wie der Beruf und die Hobbys eines Patienten. In einer Woche ermunterte er einen südamerikanischen Plantagenbesitzer, eine Stunde lang über Kaffeesträucher zu sprechen; in der nächsten war es vielleicht ein Geschichtsprofessor, mit dem er über den Untergang der Spanischen Armada diskutierte. Man hätte gedacht, dass sein vorrangiges Ziel darin bestand, die Beziehung zwischen Standorthöhe und Qualität der Kaffeebohne zu verstehen oder die politischen Motive, die der Entsendung der Spanischen Armada im sechzehnten Jahrhundert zu Grunde lagen. Er wechselte so subtil in persönlichere Bereiche über, dass es mich stets überraschte, wenn ein misstrauischer paranoider Patient plötzlich offen über sich und seine psychotische Welt zu sprechen begann.
Indem er dem Patienten erlaubte, ihn etwas zu lehren, stellte Dr. Whitehorn eher zur Person des Patienten eine Beziehung her als zu dessen Pathologie. Seine Strategie steigerte unfehlbar sowohl die Selbstachtung des Patienten als auch dessen Bereitschaft, etwas von sich preiszugeben.
Ein schlauer Interviewer, könnte man sagen – jedoch wäre »schlau« der falsche Ausdruck. Da war keine Doppelzüngigkeit: Dr. Whitehorn wollte wirklich gelehrt werden. Er war ein Sammler und hatte auf diese Weise im Lauf der Jahre einen Schatz an wirklichen Kuriositäten zusammengetragen. »Sie gewinnen ebenso wie Ihre Patienten«, sagte er etwa, »wenn Sie ihnen erlauben, Ihnen genug über ihr Leben und ihre Interessen beizubringen. Erfahren Sie etwas über ihr Leben; Sie werden das nicht nur erbaulich finden, sondern letztlich werden Sie auch alles über ihre Krankheit erfahren, was Sie wissen müssen.«
Fünfzehn Jahre später, Anfang der siebziger Jahre, war Dr. Whitehorn tot, ich war Professor der Psychiatrie geworden, und eine Frau namens Paula mit Brustkrebs in fortgeschrittenem Stadium trat in mein Leben, um meine Ausbildung fortzusetzen. Obwohl ich es damals nicht wusste und sie es nie zugab, glaube ich, dass sie es sich von Anfang an zur Aufgabe gemacht hatte, meine Mentorin zu sein.
Paula hatte um einen Termin nachgesucht, nachdem sie von einer Sozialarbeiterin in der Onkologischen Klinik erfahren hatte, dass ich mit unheilbar kranken Patienten eine Therapiegruppe gründen wolle. Als sie zum ersten Mal mein Sprechzimmer betrat, nahm mich ihre Erscheinung auf der Stelle gefangen: ihre würdige Haltung, ihr strahlendes Lächeln, das mich bezauberte, ihr dichtes, überaus jungenhaftes und leuchtendes weißes Haar, sowie etwas, was ich nur ein inneres Leuchten nennen kann, das ihren klugen und intensiv blauen Augen zu entströmen schien.
Schon ihre ersten Worte erregten meine Aufmerksamkeit: »Mein Name ist Paula West«, sagte sie. »Ich bin unheilbar an Krebs erkrankt. Aber ich bin keine Krebspatientin.« Und tatsächlich habe ich sie bei meinen Reisen mit ihr durch viele Jahre hindurch nie als eine Patientin angesehen. Sie fuhr fort und schilderte in knappen und präzisen Worten ihre Krankheitsgeschichte: Brustkrebsdiagnose vor fünf Jahren; operative Entfernung dieser Brust; dann Krebs der zweiten Brust, die ebenfalls entfernt worden sei. Danach Chemotherapie mit den gewohnten schrecklichen Begleiterscheinungen: Übelkeit, Brechreiz, totaler Haarausfall. Dann Strahlentherapie mit der erlaubten Höchstdosis. Nichts jedoch habe die Ausbreitung ihres Krebses verlangsamt – in den Schädel, das Rückgrat, die Augenhöhlen. Paulas Krebs verlangte nach Nahrung, und obwohl die Chirurgen ihm Opfer hinwarfen – ihre Brüste, Lymphknoten, Eierstöcke, Nebennierendrüsen –, blieb er gefräßig.
Wenn ich mir Paulas nackten Körper vorstellte, sah ich eine Brust, die mit Narben übersät war, ohne Brüste, Fleisch oder Muskeln, so etwas wie die nackten Spanten einer schiffbrüchigen Galeone und unterhalb ihrer Brust einen Unterleib voller Operationsnarben, all das gestützt von kräftigen, unvorteilhaften, durch Steroide dick gewordene Hüften. Kurz, eine fünfundfünfzig Jahre alte Frau ohne Brüste, Nebennieren, Eierstöcke, Uterus und, dessen bin ich sicher, Libido.
Ich habe immer eine Vorliebe für Frauen mit festen, anmutigen Körpern, vollen Brüsten und einer ohne weiteres erkennbaren Sinnlichkeit gehabt. Doch als ich Paula zum ersten Mal begegnete, geschah etwas Eigenartiges: Ich fand sie schön und verliebte mich in sie.
Wir sahen uns ein paar Monate lang jede Woche, wie wir formlos vereinbart hatten. Ein Beobachter hätte das vielleicht »Psychotherapie« genannt, denn ich trug ihren Namen in meinen Terminkalender ein, und sie saß während der rituellen fünfzig Minuten auf dem Patientenstuhl. Unsere Rollen waren jedoch immer verschwommen. So kam beispielsweise die Frage eines Honorars nie zur Sprache. Ich wusste von Anfang an, dass dies keine reguläre Vereinbarung mit einer Patientin war, und zögerte, in ihrer Gegenwart von Geld zu sprechen – es wäre mir vulgär erschienen. Und nicht nur Geld, sondern auch andere geschmacklose Themen wie Fleischeslust, eheliche Anpassung oder soziale Beziehungen.
Leben, Tod, Spiritualität, Frieden, Transzendenz – das waren die Themen, über die wir diskutierten; dies waren die einzigen Fragen, die Paula am Herzen lagen. Meist sprachen wir über den Tod. Jede Woche trafen wir vier uns und nicht wir zwei in meinem Sprechzimmer – Paula und ich, ihr Tod und meiner. Sie wurde meine Kurtisane des Todes: Sie machte mich mit ihm bekannt, brachte mir bei, wie ich ihn sehen sollte, ja sogar mich mit ihm anzufreunden. Mir ging allmählich auf, dass der Tod eine schlechte Presse gehabt hat. Obwohl man nur wenig Freude an ihm finden kann, ist der Tod dennoch kein monströses Übel, das uns zu irgendeinem unvorstellbar schrecklichen Ort fortschleift. Ich lernte, den Tod zu entmythologisieren und ihn als das zu sehen, was er ist – ein Ereignis, ein Teil des Lebens, das Ende weiterer Möglichkeiten. »Er ist ein neutrales Ereignis«, sagte Paula, »doch wir haben gelernt, es mit Furcht auszustatten.«
Jede Woche betrat Paula mein Sprechzimmer, schenkte mir das breite Lächeln, das ich anbetete, langte in ihre große Strohtasche, entnahm ihr das Tagebuch, das sie sich auf den Schoß legte. Dann teilte sie mir ihre Überlegungen und Träume der vergangenen Woche mit. Ich hörte aufmerksam zu und bemühte mich, angemessen zu reagieren. Wann immer ich Zweifel äußerte, ob ich ihr helfen könne, schien sie verblüfft zu sein; doch dann, nach einer kurzen Pause, lächelte sie, als wollte sie mich aufmuntern, und wandte sich dann wieder ihrem Tagebuch zu.
Gemeinsam durchlebten wir ihre gesamte Begegnung mit dem Krebs: den ersten Schock und den Unglauben, die Verstümmelung ihres Körpers, wie sie die Krankheit allmählich akzeptierte und sich daran gewöhnte zu sagen: »Ich habe Krebs.« Sie schilderte die liebevolle Fürsorge ihres Mannes und die enger Freunde und Freundinnen. Das konnte ich mühelos verstehen: Es fiel schwer, Paula nicht zu lieben. (Natürlich habe ich ihr meine Liebe erst viel später eingestanden, zu einer Zeit, zu der sie mir nicht glaubte.)
Dann schilderte sie die schrecklichen Tage, in denen ihr Krebs erneut ausbrach. Diese Phase sei ihr Leidensweg gewesen, sagte sie, und die Stationen des Kreuzwegs seien die Prüfungen gewesen, die alle Patienten mit wieder ausbrechendem Krebs erlebten: die Räume der Strahlenbehandlung mit einem metallischen Augapfel an der Decke, der an das Jüngste Gericht gemahne, unpersönliches, gehetztes Klinikpersonal, Freunde, die einem nicht mehr richtig in die Augen sehen könnten, unnahbare Ärzte und vor allem die ohrenbetäubende Stille der Geheimhaltung, die sie überall gespürt habe. Sie weinte, als sie mir erzählte, wie sie ihren Chirurgen angerufen habe, mit dem sie seit zwanzig Jahren befreundet gewesen sei, nur um von seiner Krankenschwester zu erfahren, dass es keine weiteren Termine geben werde, weil der Doktor ihr nichts mehr bieten könne. »Was ist bloß mit den Ärzten los? Warum begreifen sie nicht die Bedeutung ihrer schieren Gegenwart?«, fragte sie mich. »Warum können sie nicht erkennen, dass gerade der Augenblick, in dem sie sonst nichts mehr zu bieten haben, der Augenblick ist, in dem man sie am nötigsten hat?«
Das Entsetzen, das es mit sich bringt, wenn man von seiner unheilbaren Krankheit erfährt, so hörte ich jetzt von Paula, wird noch dadurch gesteigert, dass sich andere von einem zurückziehen. Die Isolation des sterbenden Patienten wird durch die alberne Charade derer verschärft, die sich bemühen, das Näherkommen des Todes zu verbergen. Doch der Tod lässt sich nicht verbergen; die Hinweise sind allgegenwärtig: die Schwestern sprechen in gedämpftem Tonfall, die Ärzte sehen sich bei der Visite oft die falschen Körperteile an, die Medizinstudenten betreten das Krankenzimmer auf Zehenspitzen, die Familie lächelt tapfer, und Besucher bemühen sich fröhlich zu sein. Eine krebskranke Patientin erzählte mir einmal, sie habe gewusst, dass der Tod nahe sei, als ihr Arzt, der seine Untersuchung zuvor immer mit einem spielerischen Klaps auf ihren Po beendet habe, seine Untersuchung stattdessen mit einem warmen Händedruck beendete.
Mehr als den Tod fürchtet man die vollkommene Isolation, die ihn begleitet. Wir bemühen uns, zu zweit durchs Leben zu gehen, aber jeder von uns muss allein sterben – niemand kann unseren Tod mit uns oder für uns sterben. Dass die Lebenden den Sterbenden ausweichen, kündigt die endgültige, absolute Verlassenheit an. Paula lehrte mich, wie die Isolation der Sterbenden sich in zwei Richtungen auswirkt. Die Patientin schneidet die Verbindung zu den Lebenden ab, da sie Familienangehörige oder Freunde nicht in ihr Entsetzen hereinziehen will, indem sie ihre Ängste oder makabren Gedanken preisgibt. Und Freunde ziehen sich zurück, da sie sich hilflos und unbeholfen fühlen und nicht wissen, was sie sagen oder tun sollen und überdies davor zurückschrecken, einen zu ausführlichen Vorgeschmack auf ihren eigenen Tod zu erhalten.
Doch Paulas Isolation war jetzt zu Ende. Und wenn ich schon nichts anderes war, so war ich immerhin ständig da. Mochten andere Paula verlassen haben, ich würde es nicht tun. Wie gut, dass sie mich gefunden hatte! Wie hätte ich damals wissen können, dass die Zeit kommen würde, zu der sie mich als ihren Petrus ansehen würde, der sie nicht nur einmal, sondern viele Male verleugnete?
Sie fand keine angemessenen Worte, um die Bitterkeit ihrer Isolation zu beschreiben, eine Zeit, die sie oft als ihren Garten Gethsemane bezeichnete. Einmal brachte sie mir eine von ihrer Tochter gezeichnete Lithographie mit, auf der mehrere stark stilisierte, nur in Umrissen erkennbare Gestalten eine Heilige steinigen, eine einzelne, winzige, kauernde Frau, deren zartgliedrige Arme sie vor dem Steinhagel nicht schützen können. Das Bild hängt immer noch in meinem Sprechzimmer, und immer wenn ich es sehe, denke ich an die Worte Paulas: »Ich bin diese Frau, die diesem Ansturm hilflos ausgeliefert ist.«
Es war ein Priester der Episkopal-Kirche, der Paula dabei half, ihren Weg aus dem Garten Gethsemane zu finden. Da dieser Geistliche den klugen Aphorismus des Antichristen Nietzsche kannte: »Wer ein ›Warum‹ hat, kann jedes ›Wie‹ ertragen«, wie er Paulas Leiden neu formulierte. »Ihr Krebs ist Ihr Kreuz«, sagte er ihr. »Ihr Leiden ist Ihr geistliches Amt.«
Diese Formulierung – jene »göttliche Erleuchtung«, wie Paula es nannte – veränderte alles. Als sie schilderte, wie sie ihren Auftrag akzeptiert und sich entschlossen habe, das Leiden krebskranker Menschen zu lindern, begann ich die Rolle zu verstehen, die mir zugedacht war: Sie war nicht mein Vorhaben, sondern ich war ihres, das Objekt ihres geistlichen Amts. Ich konnte Paula helfen, aber nicht durch Unterstützung, Interpretation oder auch nur Fürsorge oder Treue. Meine Rolle bestand darin, ihr zu erlauben, mich zu erziehen.
Ist es möglich, dass ein Mensch, dessen Tage gezählt sind und dessen Körper von Krebs befallen ist, eine »goldene Zeit« erleben kann? Paula tat es. Sie war es, die mich lehrte, was es einem Menschen erlaubt, das Leben auf reichere und befriedigendere Weise zu erleben, wenn er den Tod aufrichtig annimmt. Ich war skeptisch. Ich hatte den Verdacht, dass ihr Gerede von einer »goldenen Zeit« übertrieben war, eine ihrer typischen religiösen Übertreibungen war. »Golden? Wirklich? Hören Sie, Paula, wie kann an Sterben etwas golden sein?«
»Irv«, tadelte Paula, »das ist die falsche Frage! Versuchen Sie doch zu verstehen, dass nicht das Sterben golden ist, sondern das volle Ausschöpfen des Lebens angesichts des Todes. Denken Sie daran, wie kostbar und erschütternd letzte Male sind: der letzte Frühling, der letzte Flug der Löwenzahnsamen, das letzte Verwelken der Glyzinien.
Die goldene Zeit ist auch«, fuhr Paula fort, »eine Zeit großartiger Befreiung – eine Zeit, in der man die Freiheit hat, zu allen banalen Verpflichtungen nein zu sagen und sich ausschließlich den Dingen zu widmen, die einem am meisten am Herzen liegen – der Gegenwart von Freunden, dem Wechsel der Jahreszeiten, der wogenden Dünung des Meeres.« Elisabeth Kübler-Ross, in der Medizin so etwas wie die Hohepriesterin des Todes, stand sie zutiefst kritisch gegenüber, da diese das goldene Stadium nicht erkenne und einen von Grund auf negativen klinischen Ansatz entwickelt habe. Kübler-Ross’ »Stadien« des Sterbens – Zorn, Verleugnung, Feilschen, Depression, Akzeptanz – erregten immer wieder unfehlbar Paulas Zorn. Sie blieb unbeirrbar bei der Ansicht – und ich bin überzeugt, dass sie Recht hatte –, dass eine derart starre Kategorisierung emotionaler Reaktionen zu einer Entmenschlichung von sowohl Patient als auch Arzt führe.
Paulas goldene Periode war eine Zeit für intensive persönliche Exploration: Sie hatte Träume, in denen sie durch riesige Hallen wanderte und in ihrem Haus neue, unbenutzte Räume entdeckte. Außerdem war sie eine Zeit der Vorbereitung: Sie hatte Träume, in denen sie ihr Haus vom Keller bis zum Dachboden sauber machte und Kommoden und Kleiderschränke neu ordnete. Sie bereitete ihren Mann umsichtig und liebevoll vor. Es gab zum Beispiel Zeiten, in denen sie sich stark genug fühlte, einzukaufen und zu kochen, es aber absichtlich unterließ, um ihn dazu anzuhalten, selbstständiger zu werden. Einmal erzählte sie mir, sie sei sehr stolz auf ihn, weil er zum ersten Mal von »meiner« Pensionierung statt von »unserer« gesprochen habe. In solchen Augenblicken saß ich mit ungläubig aufgerissenen Augen da. Meinte sie das aufrichtig? Gab es eine solche Tugendhaftigkeit wirklich außerhalb der Dickens’schen Welt von Peggotty, Klein Dorrit, Tom Pinch und den Boffins? In psychiatrischen Schriften wird der Persönlichkeitszug der »Güte« nur selten diskutiert, es sei denn, man bezeichnet damit eine Abwehr gegen dunklere Impulse, und zunächst stellte ich Paulas Motive in Frage, als ich die Fassade anscheinender Frömmelei nach Rissen und Fehlern absuchte. Da ich keine fand, kam ich irgendwann zu dem Schluss, dass es keine Fassade war. Ich beendete meine Suche und erlaubte mir, mich in Paulas Gnade zu sonnen.
Eine Vorbereitung auf den Tod sei unverzichtbar und erfordere deutliche Aufmerksamkeit, wie Paula glaubte. Als sie erfuhr, dass ihr Krebs schon im Rückgrat Metastasen gebildet hatte, bereitete sie ihren dreizehnjährigen Sohn auf ihren Tod vor, indem sie ihm einen Abschiedsbrief schrieb, der mich zu Tränen rührte. In ihrem letzten Absatz erinnerte sie ihn daran, dass die Lungen des menschlichen Fetus ebenso wenig atmen wie seine Augen sehen. Somit ist der Embryo auf eine Existenz vorbereitet, die er sich noch nicht vorstellen kann. »Werden wir auch nicht auf eine Existenz jenseits unseres Gesichtskreises vorbereitet«, gab Paula ihrem Sohn zu verstehen, »ja sogar jenseits unserer Träume?«
Religiöser Glaube hat mich schon immer verwirrt. Solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich es für selbstverständlich gehalten, dass Religionssysteme sich entwickeln, um uns Trost zu bieten und unsere Ängste angesichts der conditio humana zu lindern. Als ich zwölf oder dreizehn war und im Lebensmittelladen meines Vaters arbeitete, erzählte ich einem Soldaten von meiner Skepsis gegenüber der Existenz Gottes. Der Mann hatte den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und war gerade von der Front in Europa zurückgekehrt. Seine Antwort bestand darin, dass er mir ein zerknülltes, verblasstes Bild von Jesus und der Jungfrau Maria gab, das er während der Invasion in der Normandie immer bei sich getragen hatte. »Dreh es um«, sagte er. »Lies, was auf der Rückseite steht. Lies es laut.«
»›Im Schützengraben gibt es keine Atheisten‹«, las ich. »Richtig! Im Schützengraben gibt es keine Atheisten«, wiederholte er langsam und fuchtelte dabei bei jedem Wort mit seinem Finger vor meinem Gesicht herum. »Christlicher Gott, jüdischer Gott, chinesischer Gott, welcher Gott auch immer – aber irgendein Gott, bei Gott! Kann ohne nicht leben.«
Dieses zerknüllte Bild, das mir ein wildfremder Mann geschenkt hatte, faszinierte mich. Es hatte die Invasion in der Normandie überlebt und wer weiß wie viele andere Schlachten noch. Vielleicht ist es ein Omen, sagte ich mir; vielleicht hatte die göttliche Vorsehung mich schließlich gefunden. Zwei Jahre lang trug ich dieses Bild in meiner Brieftasche mit mir herum, nahm es immer wieder heraus und betrachtete es nachdenklich. Und dann, eines Tages, fragte ich: »Und? Was ist, wenn es im Schützengraben tatsächlich keine Atheisten gibt? Das kann doch nur die Position des Skeptikers schützen: Natürlich wird der Glaube größer, wenn die Furcht am größten ist. Das ist es ja gerade: Furcht zeugt Glauben; wir brauchen und wollen einen Gott, aber der Wunsch zaubert ihn nicht herbei. Wie glühend, wie rein, verzehrend der Glaube auch sein mag, so sagt dies gleichwohl nicht das Geringste über die Realität von Gottes Existenz aus. Am nächsten Tag entnahm ich in einer Buchhandlung das jetzt machtlose Bild meiner Brieftasche und – ich ging vorsichtig damit um, denn es verdiente Respekt – steckte es zwischen die Blätter eines Buches mit dem Titel Seelenfrieden, wo vielleicht irgendeine andere zur Schlacht gerüstete Seele es fand und besseren Gebrauch davon machte.
Obwohl die Vorstellung, eines Tages zu sterben, mich schon lange mit Angst erfüllte, gab ich der nackten Angst den Vorzug vor irgendeinem Glauben, dessen Hauptreiz gerade in seiner Absurdität lag. Die unumstößliche Erklärung: »Ich glaube, weil es absurd ist«, habe ich schon immer gehasst. Doch als Therapeut behalte ich solche Gefühle für mich: Ich weiß, dass der religiöse Glaube eine starke Trostquelle ist und mische mich nie in Fragen des Glaubens ein, wenn ich keinen besseren Ersatz habe.
Mein Agnostizismus ist nur selten ins Wanken geraten. Oh, beim Morgengebet in der Schule war mir ein paar Mal unwohl beim Anblick all meiner Lehrer und Klassenkameraden, die mit geneigten Köpfen dem Patriarchen über den Wolken etwas zuflüsterten. Sind alle verrückt geworden, nur ich nicht? fragte ich mich. Und dann waren da diese Zeitungsfotos des geliebten Franklin Delano Roosevelt, der jeden Sonntag zur Kirche ging – diese Bilder gaben mir zu denken: Was FDR glaubte, musste sehr ernst genommen werden.
Aber was war mit Paulas Ansichten? Was war mit ihrem Brief an ihren Sohn, ihrem Glauben an unser bevorstehendes Ziel, von dem wir nichts ahnen können? Paulas Metapher hätte Sigmund Freud amüsiert – und in der religiösen Arena bin ich mit ihm immer voll und ganz einer Meinung gewesen. »Pures Wunschdenken, nichts weiter«, hätte er gesagt. »Wir möchten sein, fürchten uns vor dem Nicht-Sein und erfinden angenehme Märchen, in denen alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Das unbekannte Ziel, das uns erwartet, das Fortleben der Seele, Himmel, Unsterblichkeit, Gott, Wiedergeburt alles Illusionen, alles nur Mittel, um die Bitternis der Sterblichkeit zu versüßen.«
Paula reagierte sanft auf meine Skepsis und erinnerte mich behutsam daran, dass ihre religiösen Überzeugungen dem Zweifel unzugänglich seien, obwohl ich sie für unglaubwürdig hielte. Trotz meiner Zweifel gefielen mir Paulas Metaphern, und ich hörte mir ihre Moralpredigten mit mehr Toleranz an, als ich mir je einen anderen Menschen angehört habe. Vielleicht war es einfach nur ein Tauschgeschäft, dass ich eine kleine Ecke meiner Skepsis dagegen eintauschte, dass ich mich etwas enger an Paulas Gnade kuscheln durfte. Gelegentlich hörte ich mich sogar kleine Sätze äußern wie etwa: »Wer weiß?«, »Wo findet man letztlich Gewissheit?«, »Können wir wirklich je etwas wissen?« Ich beneidete ihren Sohn. War ihm überhaupt klar, wie gesegnet er war? Wie sehr sehnte ich mich danach, der Sohn einer solchen Mutter zu sein.
Etwa um diese Zeit wohnte ich der Beisetzung der Mutter eines Freundes bei, bei der der Priester zum Trost der Angehörigen eine Geschichte erzählte. Er schilderte eine Versammlung von Menschen an einem Strand, die traurig zum Abschied winken, als ein Schiff fortsegelt. Das Schiff wird immer kleiner, bis nur noch die Mastspitze sichtbar ist. Als auch sie verschwindet, murmeln die Zuschauer: »Sie ist verschwunden.« Genau im selben Augenblick jedoch sucht eine andere Gruppe von Menschen irgendwo weit weg ebenfalls den Horizont ab. Als sie dort die Mastspitze auftauchen sehen, rufen sie aus: »Da kommt sie!«
»Eine alberne Fabel«, hätte ich in meiner Zeit vor Paula verächtlich bemerkt. Doch jetzt fühlte ich mich weniger herablassend. Als ich mich umsah und die anderen Trauergäste betrachtete, fühlte ich mich für einen kurzen Augenblick eins mit ihnen, verbunden in einer Illusion, dass wir nämlich alle über das Bild des Schiffs strahlten, das sich jetzt den Stränden eines neuen Lebens näherte.
Vor Paula wäre niemand eher bereit gewesen als ich, sich über die durchgeknallte geistige Landschaft Kaliforniens lustig zu machen. Der New-Age-Horizont erstreckte sich in alle Unendlichkeit: Tarot, I Ching, Körperarbeit, Wiedergeburt, Sufi, Zappen, Astrologie, Numerologie, Akupunktur, Scientology, Computersucht, holotrophes Atmen, Therapierung früherer Leben. Früher dachte ich, dass die Menschen schon immer solche bemitleidenswerten Vorstellungen gehabt haben. Sie befriedigen eine tiefe Sehnsucht, und einige Menschen sind zu schwach, um allein durchs Leben zu gehen. Lassen wir ihnen doch ihre Märchen, den armen Kindern! Jetzt drückte ich meine Ansichten etwas sanfter aus. Jetzt kamen mir behutsamere Formulierungen über die Lippen: »Wer weiß das schon?«, »Vielleicht!«, »Das Leben ist komplex, und niemand kann alles wissen.«