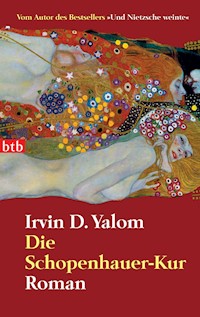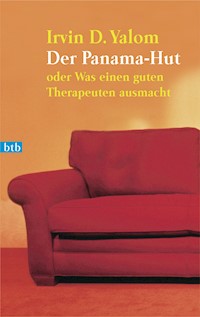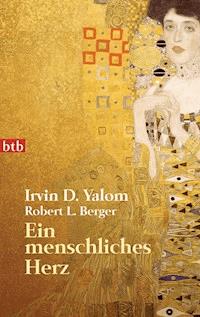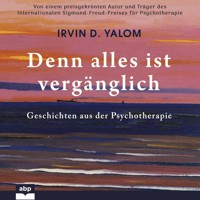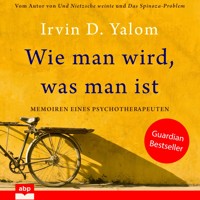4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise in die Welt der Psychoanalyse!
Als Ginny Elkin, eine begabte und problembeladene junge Schriftstellerin, sich zu einer persönlichen Analyse bei dem Psychoanalytiker Irvin D. Yalom entschließt, treffen Therapeut und Patientin eine Übereinkunft: Jeder wird ein Tagebuch führen, in dem er minutiös festhält, wie ihre Arbeit vorankommt. Eine ungewöhnliche Therapie, in deren Verlauf ganz persönlich Fortschritte und Rückschläge geschildert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Irvin D. Yalom und Ginny Elkin
Jeden Tag ein bißchen näher
Eine ungewöhnliche Geschichte
Aus dem Amerikanischen von Lutz-W. Wolff
Buch
Ginny Elkin, eine junge und talentierte, jedoch problembeladene Schriftstellerin, faßt nach monatelanger fruchtloser Gruppentherapie den Entschluß, sich einer persönlichen Analyse bei Dr. Yalom an der Stanford University zu unterziehen. Beide treffen eine Übereinkunft: Sowohl der Arzt als auch seine »Klientin« werden Tagebuch führen und darin detailliert beschreiben, wie ihre »Arbeit« vorankommt. Sie werden die Sitzungen jeweils aus ihrer ganz persönlichen Perspektive schildern – und dabei auch die Fortschritte bzw. Rückschläge, die sich im Laufe einer Therapie fast zwangsläufig ergeben, miteinbeziehen. Das vorliegende Buch ist das Ergebnis dieses bis heute einzigartigen Experiments, bei dem zum erstenmal Therapeut und Therapierte zu Wort kommen.
»Gerade Menschen, die ausgesprochen artikulationsfähig sind, gehören zu den schwierigsten Patienten. Es ist nicht leicht, ihnen zu helfen. In aller Ausführlichkeit verfolgen zu können, wie sich Amerikas bester Psychotherapeut in die Sitzungen mit einem ebenbürtigen Sparringspartner wirft, ist ein besonderes Privileg. Aber ganz abgesehen vom therapeutischen Interesse ist dies eine fesselnde Geschichte. Sie erzählt von Menschen, die sich gegenseitig ihre Stärken und Schwächen eingestehen, und kann in jeder Hinsicht als Literatur verstanden werden – nicht nur als weise und offenherzige Lebensberatung.« Alex Comfort
Autor
Irvin D. Yalom ist Professor für Psychiatrie an der Stanford University und einer der angesehendsten Psychotherapeuten Amerikas. Seine Bücher »The Theory and Practice of Group Psychiatry« und »Inpatient Group Therapy« gelten als Klassiker. Seine literarischen Werke wurden zu Bestsellern und in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Die Originalausgabe erschien 1974 unter dem Titel »Every Day Gets a Little Closer. A Twice-Told Therapy« bei Basic Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
btb Taschenbücher erscheinen im Goldmann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann.
1. Auflage Taschenbuchausgabe Februar 2001 Copyright © 1974 by Basic Books, A Member of the Perseus Books Group Copyright © des Nachworts 2001 by Irvin D. Yalom and Ginny Elkin Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2001 by Wilhelm Goldmann Verlag in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, München Copyright © für die deutsche Übersetzung von Lutz-W. Wolff by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1975 Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Photonica/Wilson Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin TH · Herstellung: Augustin Wiesbeck Made in Germany
eISBN 9783641188504V001
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeberin
Unbestreitbar enthält die psychotherapeutische Literatur bereits zahlreiche Werke, in denen die Geschichte einer erfolgreichen Heilung erzählt wird. Seit der Jahrhundertwende haben sich immer mehr Psychiater dazu entschlossen, außergewöhnliche und besonders anschauliche Krankengeschichten zu publizieren, und auch die Patienten haben nicht angestanden, in wachsender Zahl ihre eigenen retrospektiven Darstellungen zu veröffentlichen. Das Besondere dieses Buches besteht darin, daß hier der Verlauf einer Behandlung gleichzeitig aus der Perspektive des Patienten und der des Arztes verfolgt und dabei das Entstehen einer delikaten und schwierigen Beziehung sichtbar wird, die für beide von großer persönlicher Bedeutung war.
Das Buch ist das Ergebnis eines Experiments, das mein Mann, Dr. Irvin Yalom von der Stanford University, und eine seiner Patientinnen, die im folgenden den Namen Ginny tragen soll, miteinander durchführten. Im Herbst des Jahres 1970 kam mein Mann zu der Überzeugung, daß es nicht ratsam sei, Ginny weiter in einer Therapiegruppe zu behandeln, die er zusammen mit einem Kollegen leitete, denn sie hatte bei dieser Form der Behandlung in anderthalb Jahren buchstäblich keinerlei Fortschritte gemacht. Er schlug daher vor, die Therapie als Einzelbehandlung fortzusetzen. Da zu Ginnys Problemen unter anderem auch eine »Schreibhemmung« zählte (was für eine hoffnungsvolle Schriftstellerin ein sehr ernsthaftes Leiden ist), regte er an, daß sie die Behandlung mit Berichten über den Verlauf der Sitzungen bezahlen sollte, womit auch ihr Schreiben einen deutlichen Antrieb erhalten würde. Gleichzeitig entschloß sich Dr. Yalom, jeweils auch einen eigenen, unabhängigen Bericht über die wöchentlichen Sitzungen zu verfassen. In halbjährlichen Abständen sollten die Berichte ausgetauscht werden, in der Hoffnung, dadurch einen weiteren therapeutischen Effekt zu erzielen. Zwei Jahre lang verzeichneten Patientin und Arzt ihre Erinnerungen an die Stunde, die sie gemeinsam verbracht hatten, wobei sie häufig noch nachträgliche Einfälle, Deutungen, emotionale Eindrücke und Assoziationen hinzufügten, die während der Sitzung nicht zur Sprache gekommen waren.
Obwohl mein Mann nahezu niemals über seine Patienten mit mir spricht, machte er mich doch mit einigen seiner Überlegungen über Ginny vertraut, als er den Plan faßte, sie auf diese Weise zum Schreiben zu ermutigen. Er wußte, daß mich das Vorhaben interessieren würde, denn ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich machte den Vorschlag, die Berichte zu sammeln, bis die Behandlung beendet wäre, und dann zu entscheiden, ob sie ein größeres Publikum verdienten. Insgeheim fragte ich mich, ob die Berichte nicht ein interessantes Stück Literatur werden könnten – mit zwei verschiedenen Hauptfiguren und zwei ausgeprägten literarischen Schreibweisen, zusammen so eine Art Briefroman.
Ich hatte also ein besonderes Interesse, als ich die Manuskripte zwei Jahre später zum erstenmal zu Gesicht bekam. Mein eigener Enthusiasmus, aber auch das Urteil von Lesern, die weniger voreingenommen waren, führten dazu, daß sich die Verfasser mit einer Veröffentlichung einverstanden erklärten. Mit Ausnahme einiger Änderungen, die notwendig waren, um die Anonymität der Patientin zu schützen und die Tonbandnotizen des Arztes lesbar zu machen, folgen die hier gedruckten Texte dem Wortlaut der Originale. Keine zusätzlichen Gedanken oder fiktiven Ereignisse wurden dem dramatischen Ablauf dieser psychotherapeutischen Symbiose hinzugefügt. In den Aufzeichnungen des Arztes wurde kein bedeutsamer Gedanke hinzugegeben oder weggelassen – mit Ausnahme des Inhalts einiger Bänder, die bedauerlicherweise verlegt worden waren und unauffindbar blieben. Abgesehen von minimalen stilistischen Korrekturen sind Ginnys Berichte völlig unverändert geblieben.
Auf Vorschlag einiger Leser, die den Eindruck hatten, das Manuskript sei ohne erläuternde Materialien schwer zu verstehen, und anderer, die sich dafür interessierten, was denn nach der Therapie aus Ginny geworden sei, schrieben Dr. Yalom und Ginny anderthalb Jahre nach ihrer letzten gemeinsamen Sitzung jeder ein Vor- und ein Nachwort. Hier erhält der Leser weitere wichtige Informationen und Erklärungen privater und wissenschaftlicher Natur. Dennoch bin ich der Ansicht, daß der Hauptteil des Textes wie ein Roman gelesen werden kann, als Geschichte zweier Menschen, die sich in der Intimität einer psychotherapeutischen Behandlung begegnet sind und jetzt dem Leser erlauben, sie kennenzulernen, wie sie selbst sich gekannt haben.
Marilyn Yalom 20. Februar 1974
Vorwort von Dr. Yalom
Es gibt mir jedesmal einen Stich, wenn ich in alten Terminkalendern die halbvergessenen Namen von Patienten finde, mit denen ich die zartesten seelischen Erfahrungen gemacht habe. So viele Menschen und gute Momente. Was ist aus ihnen geworden? Die zahlreichen Karteikästen und Berge von Tonbandaufzeichnungen in meinem Archiv erinnern mich oft an einen Friedhof: Menschenleben in klinische Aktendeckel gepreßt, Stimmen, deren Drama für immer stumm auf den elektromagnetischen Bändern gefangen ist. Die Umgebung dieser Zeugnisse erfüllt mich stets mit einem geschärften Bewußtsein für die Vergänglichkeit aller Dinge. Selbst wenn ich gänzlich in der Gegenwart befangen bin, spüre ich, wie das Phantom des Verfalls dort irgendwo lauert – ein Verfall, der die gelebten Erfahrungen letztlich zerstören wird, aber der gerade wegen seiner Unerbittlichkeit auch Schönheit und Intensität verleiht. Das Verlangen, von meiner Bekanntschaft mit Ginny zu erzählen, ist außerordentlich stark; die Möglichkeit, die Zerstörung hinauszuzögern, die Dauer unseres kurzen Zusammenlebens zu verlängern, fasziniert mich. Wieviel besser ist es, wenn ich weiß, daß diese Erfahrung im Bewußtsein des Lesers weiterbestehen wird, anstatt in den verlassenen Lagerhallen ungelesener Krankenberichte und nicht abgehörter Tonbänder gespeichert zu bleiben.
Mit einem Telefongespräch fing es an. Eine dünne Stimme teilte mir mit, daß sie Ginny hieße und gerade in Kalifornien angekommen sei. Einige Monate lang war sie bei einer Kollegin im Osten in Behandlung gewesen, die sie an mich verwiesen hatte. Da ich gerade erst von einem einjährigen Forschungsurlaub aus London zurückgekehrt war, hatte ich noch viel freie Zeit. Wir machten einen Termin für den übernächsten Tag.
Ich holte sie im Wartezimmer ab und führte sie über den Flur in mein Büro. Aber ich konnte offenbar so langsam gehen, wie ich wollte; denn wie die Frau eines Orientalen blieb sie stets einige lautlose Schritte hinter mir. Sie schien sich nicht selbst zu gehören, nichts paßte zusammen – ihre Haare, ihr Lächeln, ihre Stimme, ihr Gang, ihr Pullover, ihre Schuhe, alles war zufällig zusammengewürfelt, und es schien die Gefahr zu bestehen, daß alles – Haare, Gang, Glieder, Jeans und Armeesocken – wieder auseinanderfallen könnte. Was würde dann übrigbleiben? Vielleicht nur das Lächeln. Hübsch war sie jedenfalls nicht, egal, wie man die Teile zusammensetzte! Aber merkwürdig reizvoll. In Minuten hatte sie es geschafft, mir irgendwie zu verstehen zu geben, daß ich alles tun dürfe, daß sie sich gänzlich in meine Hand gäbe. Ich machte mir keine Sorgen deswegen. Damals schien das keine schwere Last zu sein.
Sie begann zu sprechen, und ich erfuhr, daß sie dreiundzwanzig Jahre alt und die Tochter einer ehemaligen Opernsängerin und eines Geschäftsmannes aus Philadelphia war. Sie hatte eine Schwester, die vier Jahre jünger war, und sie besaß schriftstellerische Begabung. Sie war nach Kalifornien gekommen, weil man ihr aufgrund einiger Kurzgeschichten die Teilnahme an einem einjährigen Autorenkursus in einem nahegelegenen College angeboten hatte.
Warum suchte sie Hilfe? Sie sagte, sie müsse die Behandlung fortsetzen, die sie im letzten Jahr begonnen habe. Und dann erzählte sie auf wirre und unzusammenhängende Weise allmählich die Schwierigkeiten, die sie im Leben hatte. Neben den Beschwerden, die sie ausdrücklich erwähnte, stellte ich während des Gesprächs noch verschiedene andere Problembereiche fest.
Zunächst ihr Selbstporträt, das schnell und atemlos erzählt wurde. Es war eine Litanei des Selbsthasses, in der einige treffende Metaphern die Akzente setzten. Sie ist in jeder Beziehung masochistisch. Ihr ganzes bisheriges Leben hindurch hat sie die eigenen Wünsche und Bedürfnisse vernachlässigt. Sie besitzt keine Selbstachtung. Sie hat das Gefühl, ein körperloser Geist zu sein, ein zwitschernder Kanarienvogel, der von Schulter zu Schulter hüpft, während sie mit ihren Freunden die Straße hinuntergeht. Sie bildet sich ein, daß sie nur als ätherisches Irrlicht von Interesse für andere sein könne.
Sie hat kein Selbstwertgefühl. »Ich muß mich auf das Zusammentreffen mit anderen Leuten vorbereiten«, sagt sie. »Ich präge mir ein, was ich sagen werde. Ich habe keine spontanen Empfindungen, das heißt, ich habe schon welche, aber nur in einem kleinen Käfig. Immer wenn ich herausgehe, habe ich Angst und muß mich vorbereiten.« Ihren Ärger nimmt sie nicht wahr und gibt ihm auch keinen Ausdruck. »Ich habe Mitleid mit den Leuten. Ich bin die reinste Verkörperung der Redensart: >Wenn man nichts Nettes über jemanden sagen kann, sagt man lieber gar nichts.‹« Sie kann sich nur an einen einzigen Fall erinnern, wo sie in ihrem erwachsenen Leben wirklich wütend geworden ist: vor einigen Jahren hat sie einmal einen Arbeitskollegen angeschrien, der sie herumkommandierte. Sie zitterte noch Stunden später. Sie hat keine Rechte. Es kommt ihr gar nicht in den Sinn, wütend zu werden. Dauernd fragt sie sich, ob die anderen sie mögen, aber nie, ob sie die anderen mag.
Die Selbstverachtung verzehrt sie. Eine innere Stimme verspottet sie ständig. Immer wenn sie sich für einen Augenblick vergißt und das Leben spontan ergreift, treibt diese lähmende Stimme sie abrupt in den Käfig ihrer Befangenheit zurück. Während des Gesprächs konnte sie sich kein einziges Wort des Stolzes erlauben. Kaum hatte sie den Autorenkurs erwähnt, erinnerte sie mich sofort daran, daß sie nur aufgrund ihrer Faulheit aufgenommen worden sei. Als sie gesprächsweise von dem Kursprogramm hörte, hatte sie sich nur deshalb beworben, weil eine formelle Bewerbung nicht nötig war. Sie brauchte bloß ein paar Geschichten einzuschicken, die sie zwei Jahre vorher geschrieben hatte. Über die vermutlich hohe Qualität der Erzählungen sagte sie natürlich nichts. Ihre literarische Produktion war allmählich geringer geworden, und sie befand sich jetzt im Stadium einer ernsten Schreibhemmung.
Alle Probleme ihres Lebens spiegelten sich in ihren Beziehungen zu Männern. Obwohl sie das dringende Bedürfnis nach einer stabilen Dauerbeziehung hatte, war sie niemals dazu in der Lage gewesen. Mit einundzwanzig war sie aus mädchenhafter Unschuld in sexuelle Beziehungen mit mehreren Männern gestolpert (sie hatte kein Recht, »nein« zu sagen) und klagte nun darüber, daß sie sich ins Schlafzimmer gestürzt habe, ohne das Vorzimmer von Flirt und Petting auch nur zu betreten. Sie mag den physischen Kontakt mit Männern, aber vermag sich sexuell nicht zu lösen. Sie hat Orgasmen beim Masturbieren erlebt, aber die spöttische innere Stimme stellt sicher, daß sie beim Geschlechtsverkehr fast nie einen Orgasmus hat.
Ihren Vater erwähnte Ginny fast nie, aber ihre Mutter schien sehr gegenwärtig. »Ich bin ein blasses Abbild meiner Mutter«, sagte sie. Sie waren sich ungewöhnlich nahe. Ginny erzählte ihrer Mutter alles. Sie erinnert sich, wie sie gemeinsam Ginnys Liebesbriefe gelesen und darüber gelacht haben. Ginny war immer dünn, sie mäkelte am Essen, und während ihrer Teenagerzeit hatte sie sich über ein Jahr lang so regelmäßig vor dem Frühstück erbrechen müssen, daß die Familie sich daran gewöhnt hatte, dieses Erbrechen als Bestandteil ihrer Morgentoilette zu akzeptieren. Sie aß immer viel, aber als sie klein war, konnte sie nur mit Mühe schlucken. »Ich aß eine ganze Mahlzeit, und am Schluß hatte ich alles im Mund. Dann versuchte ich, alles auf einmal herunterzuschlucken.«
Ginny hat schreckliche Alpträume, in denen sie vergewaltigt wird, meistens von einer Frau, aber manchmal auch von einem Mann. Ein häufig wiederkehrender Traum, in dem sie entweder eine riesige Brust ist, an die sich ganze Klumpen von Leuten klammern, oder sie selbst klammert sich an eine riesige Brust. Ungefähr vor drei Jahren begannen ihre Angstträume, bei denen sie nicht unterscheiden konnte, ob sie schlief oder wach war. Sie hat das Gefühl, daß sie durch das Fenster beobachtet und berührt wird; aber wenn ihr diese Berührung Lust zu bereiten beginnt, wandelt sich diese Empfindung in Schmerz, so als ob ihr die Brüste abgerissen würden. In all diesen Träumen gibt es eine weit entfernte Stimme, die sie daran erinnert, daß alles nicht wirklich geschieht.
Am Ende dieser Stunde war ich wegen Ginny ziemlich besorgt. Trotz mancher Stärken – sie hatte einen weichen Charme, Empfindsamkeit, Witz, einen hoch entwickelten Sinn für Komik und eine Begabung für verbale Metaphern – fand ich überall krankhafte Störungen: zuviel primitives Material, Träume, welche die Grenze zwischen Realität und Phantasie verdunkelten, vor allem aber eine merkwürdige Zerstreutheit, ein Verschwimmen der »Ich-Grenzen«. Sie schien sich nicht hinreichend von ihrer Mutter gelöst zu haben, und ihre Probleme beim Essen bedeuteten wohl einen schwachen und hilflosen Befreiungsversuch. Ich erlebte sie als gefangen zwischen den Schrecken kindlicher Abhängigkeit, die eine ständige Selbstentäußerung (d. h. dauernde Stagnation) verlangte, und einer vergeblichen Unabhängigkeit, die ihr aus Mangel an tieferem Selbstgefühl als starr und unerträglich einsam erschien.
Ich versuche mich nur selten an einer ausführlichen Diagnose. Aber ich weiß, daß Ginny wegen ihrer verwischten Ich-Grenzen, wegen ihres Autismus und Traumlebens von den meisten Klinikern als »schizoid« oder zumindest als »Borderline«-Fall1 bezeichnet würde. Ich wußte, daß sie ernsthaft gestört war und daß die Behandlung langwierig und nicht ohne Risiken sein würde, und ich hatte den Eindruck, daß sie schon viel zu vertraut mit ihrem Unbewußten war und daß ich sie eher in die Wirklichkeit als noch tiefer in diese Unterwelt hineinführen müßte. Ich stellte damals gerade in aller Eile eine Therapiegruppe zusammen, die meine Studenten als Teil ihrer Ausbildung besuchen sollten, und weil ich bei Patienten, deren Probleme denen von Ginny ähnlich waren, auch mit Gruppentherapie gute Erfahrungen gemacht hatte, bot ich ihr einen Platz in der Gruppe an. Sie nahm diese Einladung eher zögernd an; der Gedanke, mit anderen zusammen zu sein, gefiel ihr zwar, aber sie hatte Angst, in der Gruppe zum Kind zu werden und ihre intimsten Gedanken nie äußern zu können. Diese Einstellung ist typisch für Patienten, denen die Gruppentherapie neu ist, und so versicherte ich ihr, daß sie ihre Gefühle durchaus werde mitteilen können, wenn sie erst Zutrauen zu der Gruppe entwickelt hätte. Aber wie wir noch sehen werden, bestätigte sich leider ihre eigene Vorhersage über ihr Verhalten nur allzu genau.
Neben den praktischen Überlegungen bei der Suche nach Patienten für die Therapiegruppe hatte ich auch Bedenken hinsichtlich einer individuellen Behandlung für Ginny. Vor allem war ich beunruhigt über die Intensität ihrer Bewunderung für mich, die wie ein vorgefertigter Mantel über meine Schultern geworfen wurde, sobald sie mein Büro betreten hatte. Zum Beispiel der Traum, den sie in der Nacht vor unserer ersten Begegnung gehabt hatte: »Ich litt unter starkem Durchfall, und ein Mann kaufte mir eine Medizin, die den Namen >Rx< auf dem Etikett trug. Ich dachte immer, ich sollte lieber Kaopectate nehmen, weil es billiger ist, aber er wollte mir unbedingt die teuerste Medizin kaufen, die es überhaupt gab.« Ein Teil der positiven Gefühle für mich stammte aus der Empfehlung ihrer früheren Therapeutin, die mich sehr gelobt hatte, ein Teil rührte von meinem akademischen Titel her, der Rest war nicht zu erklären. Aber die Überbewertung war so extrem, daß ich befürchtete, sie würde sich bei einer Einzelbehandlung als Hindernis erweisen. Ich dachte, die Teilnahme an der Gruppentherapie würde Ginny Gelegenheit geben, mich durch die Augen mehrerer anderer zu sehen. Auch die Anwesenheit eines zweiten Therapeuten in der Gruppe würde ihr ein ausgewogeneres Urteil über mich erlauben.
Der erste Monat in der Gruppe bekam Ginny sehr schlecht. Jede Nacht wurde sie von schrecklichen Alpträumen aufgeschreckt. Sie träumte zum Beispiel, daß ihre Zähne aus Glas wären und ihr Mund zu Blut geworden wäre. Ein anderer Traum spiegelte ihr Gefühl, daß sie mich mit der Gruppe teilen müsse: »Ich lag hingestreckt am Strand und wurde zu einem Arzt getragen, der eine Operation an meinem Gehirn vornehmen sollte. Aber die Hände des Arztes wurden von zwei Gruppenmitgliedern so gehalten und geführt, daß er versehentlich in einen Teil des Hirns schnitt, den er gar nicht berühren wollte.« Bei einem anderen Traum gingen wir gemeinsam zu einer Party und rollten im sexuellen Spiel über den Rasen.
Nach einem Monat hatten mein Kollege und ich den Eindruck, daß die wöchentlichen Gruppensitzungen nicht ausreichten, um Ginny zu behandeln, sondern daneben eine Einzelbehandlung notwendig sei. Einerseits, um zu verhindern, daß Ginny noch unausgeglichener würde, und andererseits, um ihr über das schwierige Anfangsstadium der Gruppentherapie hinwegzuhelfen. Sie äußerte den Wunsch, diese Einzelbehandlung bei mir zu erhalten, aber ich war der Ansicht, daß sich nur neue Probleme ergeben würden, wenn ich sie sowohl allein als auch in der Gruppe treffen würde, und überwies sie daher an einen anderen Psychiater bei uns in der Klinik. Sie besuchte ihn ungefähr neun Monate lang zweimal die Woche und hielt daneben auch achtzehn Monate lang an der Gruppentherapie fest. Der Arzt, bei dem sie sich in Einzelbehandlung befand, stellte fest, daß sie von »erschreckenden masochistischen Sexualphantasien und schizophrenen Gedankengängen« heimgesucht werde, »die sich offensichtlich an der Grenze des Normalen bewegten«. Mit seiner Behandlung versuchte er, »ich-stärkend« zu wirken und konzentrierte sich auf Realitätsprüfung und Störungen ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ginny besuchte die Gruppentreffen mit religiöser Inbrunst und verpaßte so gut wie nie eine Sitzung, selbst nachdem sie ein Jahr später nach San Franzisko gezogen war, wodurch sie zu einer mühseligen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gezwungen war. Obwohl sie aus der Gruppe genug Unterstützung erhielt, um an ihr festhalten zu können, machte sie keinerlei echte Fortschritte. Tatsächlich gibt es wohl kaum einen Patienten, der solche Ausdauer bei einer Gruppentherapie gezeigt hätte, die ihm so wenig einbrachte. Es gab Grund zu der Annahme, daß Ginny in erster Linie deshalb in der Gruppe blieb, um den Kontakt mit mir nicht abbrechen zu lassen. Sie klammerte sich an die Überzeugung, daß ich, und möglicherweise nur ich, die Kraft besaß, ihr zu helfen. Die Therapeuten und die Gruppenmitglieder stellten das mehrfach fest; sie bemerkten wiederholt, daß Ginny Angst vor einer Verbesserung ihres Zustandes hätte, weil sie mich dann verlieren würde. Nur wenn sie an ihren hilflosen Zustand fixiert blieb, konnte sie sich meiner Gegenwart sicher sein. Bei ihr geriet nichts in Bewegung. In der Gruppe blieb sie verkrampft, in sich zurückgezogen und war oft auch nicht kommunikativ. Die übrigen Gruppenmitglieder waren interessiert an ihr; wenn sie etwas sagte, war es oft sehr scharfsinnig und hilfreich für andere. Einer der Männer verliebte sich in sie, und andere wetteiferten um ihre Aufmerksamkeit. Aber es kam nie ein Tauwetter, sie war starr vor Angst und konnte ihre Gefühle niemals äußern oder mit den anderen kommunizieren.
Während der achtzehn Monate, in denen Ginny die Gruppe besuchte, hatte ich zwei Ko-Therapeuten, beides Männer, die jeweils etwa neun Monate an den Sitzungen teilnahmen. Ihre Beobachtungen über Ginny entsprechen meinen eigenen ziemlich genau: »Ätherisch … nachdenklich … eine hochmütige, aber befangene Süffisanz gegenüber allen Vorgängen … ihre Energien wurden niemals völlig von der Realität in Anspruch genommen … in der Gruppe eine ›geisterhafte Erscheinung< ... gegenüber Dr. Yalom eine qualvolle Übertragung, die allen Deutungsversuchen widerstand … alles, was sie in der Gruppe tat, wurde abhängig gemacht von seiner Zustimmung oder Ablehnung … ein Wechsel zwischen einer Persönlichkeit, die außerordentlich sensibel auf andere eingehen kann, und jemanden, der einfach gar nicht da ist … ein Geheimnis in der Gruppe … eine Borderline-Schizophrenie, aber sie kam der Grenze zur Psychose nie nahe … schizoid … zuviel Wahrnehmung von Primärprozessen ...«
Während der Zeit der Gruppentherapie suchte Ginny auch nach anderen Methoden, um dem Verlies der Selbstbeobachtung zu entkommen, das sie selbst um sich errichtet hatte. Mehrfach besuchte sie Esalen und andere Zentren für Persönlichkeitswachstum. Die Leiter dieser Umerziehungsprogramme dachten sich ein paar Gewaltkuren aus, um Ginny augenblicklich umzukrempeln: nackt durchgeführte Marathonsitzungen, um ihre Reserve und ihren Hang zum Verbergen zu überwinden. Psychodrama und »psychologisches Karate«, um ihre negative Einstellung und Unterwürfigkeit zu beseitigen, vaginale Stimulation mit Hilfe eines Elektrovibrators, um ihre Orgasmusfähigkeit zu wecken. All das blieb ohne Ergebnis. Sie war eine ausgezeichnete Schauspielerin und konnte vor Publikum leicht eine andere Rolle spielen, aber wenn die Vorstellung vorüber war, fiel sie einfach in die alte Haltung zurück und verließ die Bühne so, wie sie gekommen war.
Als ihr Stipendium am College auslief und ihre Ersparnisse zur Neige gingen, mußte sie Arbeit suchen. Ein Teilzeitjob verursachte unüberwindliche Terminschwierigkeiten, und schließlich machte uns Ginny nach wochenlangen, qualvollen Überlegungen die Mitteilung, daß sie die Gruppe verlassen müsse. Ungefähr zur gleichen Zeit waren mein Ko-Therapeut und ich zu dem Ergebnis gekommen, daß die Wahrscheinlichkeit einer Besserung durch die Gruppe denkbar gering sei. Ich vereinbarte ein Treffen, um mit ihr zu besprechen, wie es weitergehen solle. Es war ganz offensichtlich, daß sie weiterer Behandlung bedurfte; denn obwohl sie die Realität jetzt besser im Griff hatte und die gräßlichen Träume und Tagträume etwas abgeklungen waren, obwohl sie mit einem jungen Mann namens Karl zusammenlebte (von dem wir noch hören werden) und einige Freunde gewonnen hatte, genoß sie das Leben doch nur mit einem Bruchteil ihrer Energien. Ihr innerer Dämon, eine lustverneinende kleine Stimme, quälte sie unbarmherzig; ihr Leben war weiterhin durch Angst- und Schuldgefühle verdüstert. Die Beziehung zu Karl, die engste, die sie jemals erlebt hatte, war eine besondere Ursache qualvoller Leiden. Sie empfand eine tiefe Liebe für ihn, war aber dennoch davon überzeugt, daß seine Gefühle ihr gegenüber so bedingt seien, daß ein einziges dummes Wort oder eine einzige falsche Handlung die Waage zu ihren Ungunsten senken mußte. Der Lustgewinn aus den körperlichen Annehmlichkeiten mit Karl war daher denkbar gering für sie.
Ich überlegte, ob ich Ginny zur individuellen Behandlung an ein öffentliches Krankenhaus in San Franzisko überweisen sollte (sie konnte es sich nicht leisten, Privatpatientin eines Therapeuten zu sein), aber zahlreiche Zweifel beunruhigten mich. Die Wartelisten waren lang, die Therapeuten hatten oft nicht genug Erfahrung. Der entscheidende Faktor aber war die Tatsache, daß Ginnys Glaube an mich insgeheim mit meinen eigenen Rettungsphantasien zusammenwirkte, so daß ich zu der Überzeugung gelangte, nur ich könnte sie vor der Vernichtung bewahren. Außerdem bin ich ziemlich hartnäckig, ich gebe nicht gern auf und mag mir nicht eingestehen, daß ich einem Patienten nicht helfen kann.
Es war daher keine große Überraschung für mich, als ich Ginny vorschlug, die Behandlung bei mir fortzusetzen. Ich wollte allerdings die Spielregeln ändern. Eine ganze Reihe von Therapeuten war nicht in der Lage gewesen, ihr zu helfen, und so suchte ich einen Ansatz, der die Fehler der anderen vermied und bei dem ich zugleich die starke positive Übertragung, die mir Ginny entgegenbrachte, für die Therapie nutzen konnte. Diesen therapeutischen Plan und die zugrunde liegende Theorie habe ich im Nachwort ausführlich beschrieben. Hier will ich nur einen Aspekt hervorheben, eine kühne technische List, aus der die folgenden Texte hervorgegangen sind. Ich bat Ginny, anstelle finanzieller Bezahlung nach jeder Sitzung eine aufrichtige Zusammenfassung zu schreiben, die nicht nur ihre Reaktionen auf das Besprochene, sondern auch eine Beschreibung der unterirdischen Vorgänge während der Stunde enthalten sollte – eine Botschaft aus dem Untergrund mit all den Gedanken und Phantasien, die niemals das Tageslicht der Unterhaltung erreichen. Ich hielt diese Idee, nach meinem Wissen eine Neuerung auf dem Gebiet der psychotherapeutischen Praxis, für ausgesprochen gut; Ginny war damals so unbeweglich, daß jede Technik, die Anstrengung und Bewegung verlangte, zumindest erprobt werden sollte. Ginnys totale Schreibhemmung, die eine wichtige Quelle positiver Selbsteinschätzung völlig blockierte, ließ ein Verfahren, das schriftliche Äußerungen zur Pflicht machte, noch attraktiver erscheinen. (Überdies erforderte dieser Plan auch keinerlei finanzielle Opfer von mir, denn aufgrund meiner festen Anstellung an der Stanford University mußte ich ohnehin alle Nebeneinkünfte aus der therapeutischen Praxis an die Universität abführen.)
Das Interesse, das meine Frau der Literatur und dem Prozeß der Kreativität entgegenbringt, veranlaßte mich, das Vorhaben mit ihr zu besprechen. Auf ihre Anregung hin entschloß ich mich, ebenfalls nach jeder Sitzung eine impressionistische, nicht-medizinische Darstellung zu schreiben. Ich hielt das ebenfalls für eine gute Idee, allerdings aus anderen Gründen als meine Frau. Während sie sich für den literarischen Aspekt der Unternehmung interessierte, reizte mich vor allem eine möglicherweise wirksame Übung in Selbstenthüllung. Ginny konnte sich mir und anderen gegenüber bei einer Begegnung von Angesicht zu Angesicht nicht offenbaren. Sie hielt mich für unfehlbar, allwissend, frei von Problemen und vollständig ausgeglichen. Ich hoffte, daß sie mir – gewissermaßen brieflich – in den Berichten ihre unausgesprochenen Wünsche und Gefühle mitteilen würde. Ich stellte mir vor, wie sie meine eigenen persönlich gefärbten und äußerst fehlbaren Botschaften an sie lesen würde. Die genaue Wirkung dieses Verfahrens konnte ich nicht berechnen, aber ich hatte das Gefühl, daß der Plan eine mächtige Bewegung auslösen würde.
Ich wußte, daß wir beim Schreiben gehemmt sein würden, wenn uns bewußt wäre, daß das Geschriebene vom anderen Partner sogleich gelesen würde; deshalb vereinbarten wir, daß wir die Berichte ein halbes Jahr lang nicht lesen würden. Meine Sekretärin sollte sie für uns aufbewahren. Eine künstliche, konstruierte Situation? Wir würden schon sehen. Ich wußte, daß unsere Beziehung die Arena für Therapie und mögliche Veränderung bilden würde. Ich war der Ansicht, wenn an die Stelle von Briefen eines Tages unmittelbar gesprochene Worte treten und wir eine aufrichtige, menschliche Beziehung herstellen könnten, daß dann alle anderen gewünschten Veränderungen sich von selbst ergeben würden.
Vorwort von Ginny Elkin
In der High-school in New York war ich eine ausgezeichnete Schülerin. Meine Kreativität war nur etwas Nebensächliches angesichts der Tatsache, daß ich meistens völlig benommen war, so als ob eine gewaltige Schüchternheit mir einen Schlag auf den Kopf versetzt hätte. Am Anfang meiner College-Zeit gab ich mir Mühe, auf den akademischen Weiden zu grasen. Aber obwohl ich gelegentlich »großartige« Arbeit leistete, begnügte ich mich doch am liebsten mit der Rolle einer menschlichen Sonnenuhr, indem ich mich irgendwo zusammenrollte und schlief. Jungens gegenüber war ich ängstlich, hatte auch keine. Meine späteren Affären kamen alle eher überraschend. Zu meiner College-Erziehung gehörte ein Aufenthalt in Europa; ich brachte dort einige Zeit zu, um zu arbeiten, zu studieren und schließlich ein dramatisches Resümee zu ziehen, das in Wirklichkeit keinerlei Fortschritt, sondern nur Anekdoten und Freunde verzeichnete. Was man mir als Tapferkeit anrechnete, war in Wirklichkeit nur nervöse Energie und Trägheit. Ich hatte Angst, nach Hause zu kommen.
Nach dem College-Abschluß ging ich nach New York zurück. Ich fand keinen Job, hatte auch gar keine Vorstellung. Meine Fähigkeiten zerschmolzen wie die Uhr von Dali, weil mich alles und nichts reizte. Zufällig bekam ich einen Job, bei dem ich Kinder unterrichten sollte. Aber eigentlich waren das nicht etwa Schüler (es waren sowieso nur acht), sondern verwandte Seelen, und so haben wir ein Jahr lang zusammen gespielt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!