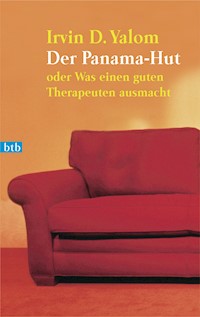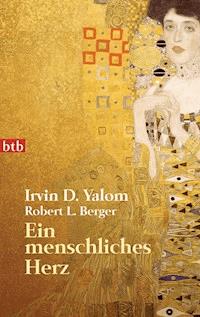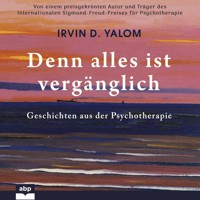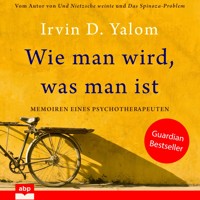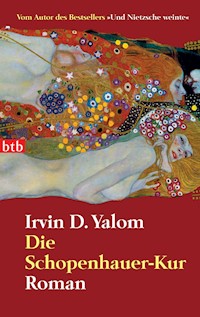
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Vom Autor des Bestsellers „Die rote Couch“.
Julius Hertzfeldt ist 65 und ein renommierter Psychoanalytiker, als er ernsthaft erkrankt. Zeit, sich wichtigen Fragen zu stellen. War sein Wirken wirklich bedeutungsvoll? Er erinnert sich an einen Fall, bei dem er kläglich versagt hat: An Philip Slate, den er einst wegen dessen Sexsucht in Behandlung hatte. Dieser ist immer noch so arrogant und ichbezogen wie früher, dennoch behauptet er, sich mittlerweile selbst geheilt zu haben – und zwar mit Hilfe der Lektüre von Arthur Schopenhauer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Was tun, wenn man gerade eine tödliche Diagnose erhalten hat? Vor diese Frage sieht sich der erfolgreiche Psychoanalytiker Julius Hertzfeldt nach einem scheinbaren Routinecheck bei seinem Hausarzt gestellt. Jahrelang hat der 65jährige anderen dabei geholfen, sich der Endlichkeit von allem zu stellen – jetzt muss er sich mit seiner eigenen auseinandersetzen. War seine Arbeit wirklich bedeutungsvoll? Hat er im Leben seiner Patienten tatsächlich eine Spur hinterlassen? Was ist mit jenen, bei denen er versagt hat? Nun, wo er weiser und reifer ist, könnte er sie da retten? Besonders ein Fall, der Jahrzehnte zurückliegt, macht ihm zu schaffen. Damals hatte er einen Mann wegen dessen Sexsucht behandelt – über drei Jahre lang und absolut erfolglos. Die einzige Möglichkeit, in Kontakt zu einem anderen menschlichen Wesen zu treten, bestand für ihn darin, sich in kurze sexuellen Affären mit zahllosen Frauen zu stürzen. Was ist aus diesem Philip Slate geworden? Als Hertzfeld seinen Patienten von damals tatsächlich wieder findet, macht er eine erstaunliche Entdeckung: Slate behauptet, sich selbst geheilt zu haben, und zwar mit Hilfe der Lektüre von Arthur Schopenhauer …
Autor
Irvin D. Yalom wurde 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den USA und ist vielfach ausgezeichnet. Seine Fachbücher zur Existenziellen Therapie und zur Gruppentherapie gelten als Klassiker. Seine bislang drei Romane wurden international zu Bestsellern und zeigen, dass die Psychoanalyse Stoff für die schönsten und aufregendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur zu erzählen weiß.
Inhaltsverzeichnis
Für meine älteren Kollegen, die mich mit ihrer Freundschaft beehren, die unerbittlichen Einschränkungen und Verluste des Lebens mit mir teilen und mich immer noch mit ihrer Weisheit und ihrer Hingabe an das Geistesleben stärken: Robert Berger, Murray Bilmes, Martel Bryant, Dagfinn Føllesdahl, Joseph Frank, Van Harvey, Julius Kaplan, Herbert Kotz, Morton Lieberman, Walter Sokel, Saul Spiro und Larry Zaroff.
»Jeder Atemzug wehrt den beständig eindringenden Tod ab . . . Ref 1
Zuletzt muß er siegen: denn ihm sind wir schon von Geburt anheimgefallen, und er spielt nur eine Weile mit seiner Beute, bevor er sie verschlingt. Wir setzen indessen unser Leben mit großem Anteil und vieler Sorgfalt fort, so lange als möglich, wie man eine Seifenblase so lange und groß als möglich aufbläst, wiewohl mit der festen Gewissheit, daß sie platzen wird.«
1
Julius kannte die Betrachtungen über Leben und Tod so gut wie jeder andere. Er stimmte mit den Stoikern überein, die da sagten: »Sobald wir geboren werden, fangen wir an zu sterben«, und mit Epikur, der zu dem Schluss kam: »Wo ich bin, ist der Tod nicht, und wo der Tod ist, bin ich nicht. Warum also den Tod fürchten?« Als Arzt und Psychiater hatte er Sterbenden genau diese Trostworte ins Ohr geflüstert.
Obgleich er solch düstere Erwägungen im Falle seiner Patienten für sinnvoll hielt, hatte er nie angenommen, dass sie etwas mit ihm zu tun haben könnten. Das heißt, bis zu jenem schrecklichen Moment vor vier Wochen, an dem sich sein Leben für immer verändert hatte.
Es kam zu diesem Moment im Verlauf einer alljährlichen Routineuntersuchung beim Arzt. Sein Internist – ein alter Freund und Kommilitone aus Studientagen – hatte die Untersuchung gerade beendet und Julius wie immer aufgefordert, sich anzukleiden und zum abschließenden Gespräch in sein Büro zu kommen.
Herb saß an seinem Schreibtisch und blätterte Julius’ Krankenakte durch. »Insgesamt siehst du für einen hässlichen Fünfundsechzigjährigen recht gut aus. Die Prostata ist ein bisschen geschwollen, aber das ist meine auch. Blutwerte, Cholesterin und Fettstoffwechsel sind in Ordnung – dafür sorgen die Medikamente und deine Diät. Hier hast du das Rezept für dein Lipitor, das deinen Cholesterinspiegel im Zusammenspiel mit dem Joggen ausreichend senkt. Du kannst dir also ruhig mal was gönnen: Iss ab und zu ein Ei. Ich verdrücke jeden Sonntag zwei zum Frühstück. Und hier ist das Rezept für dein Synthroid. Ich habe die Dosis ein wenig erhöht. Deine Schilddrüse stellt langsam den Betrieb ein – die gesunden Zellen sterben ab und werden durch fibröses Gewebe ersetzt. Absolut gutartig, wie du weißt. Passiert uns allen; ich nehme selbst Schilddrüsenhormone.
Ja, Julius, keiner unserer Körperteile entgeht dem Schicksal des Alterns. Neben deiner Schilddrüse baut die Knorpelmasse in deinen Knien ab, deine Haarbälge gehen ein, und deine oberen Lendenwirbel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Außerdem verschlechtert sich offenbar der Zustand deiner Haut: deine Epithelzellen verschleißen eben einfach – schau dir die Altersflecken auf deinen Wangen an, diese flachen braunen Erhebungen.« Er hielt einen kleinen Spiegel hoch, damit Julius sich inspizieren konnte. »Das sind bestimmt ein Dutzend mehr als bei der letzten Untersuchung. Wie viel Zeit verbringst du in der Sonne? Trägst du einen breitkrempigen Hut, wie ich es dir empfohlen habe? Ich möchte, dass du deswegen einen Dermatologen aufsuchst. Bob King ist gut. Er hat seine Praxis gleich im Gebäude nebenan. Kennst du ihn?«
Julius nickte.
»Die unansehnlichen kann er mit einem Tropfen flüssigen Stickstoffs abbrennen. Bei mir hat er letzten Monat etliche entfernt. Keine große Sache – dauert fünf, zehn Minuten. Eine Menge Internisten machen das inzwischen selbst. Außerdem sitzt da einer auf deinem Rücken, den er sich mal anschauen soll. Du kannst ihn nicht sehen; er ist direkt unter dem lateralen Teil deines rechten Schulterblatts. Er sieht anders aus als die anderen – ungleichmäßig pigmentiert und nicht scharf begrenzt. Wahrscheinlich nichts, aber wir sollten ihn checken lassen. Okay, Alter?«
»Wahrscheinlich nichts, aber wir sollten ihn checken lassen.« Julius hörte die Anspannung und gezwungene Beiläufigkeit in Herbs Stimme. Doch er ließ sich nicht täuschen; die Worte »ungleichmäßig pigmentiert und nicht scharf begrenzt«, gesprochen von einem Arzt zum anderen, gaben Grund zur Besorgnis. Sie waren der Code für ein potenzielles Melanom, und jetzt, im Rückblick, identifizierte Julius diese Worte, diesen einmaligen Moment, als den Zeitpunkt, an dem sein sorgenfreies Leben endete und der Tod sich in seiner ganzen grässlichen Wirklichkeit materialisierte. Der Tod war gekommen, um zu bleiben, er wich ihm nicht mehr von der Seite, und all die Schrecken, die folgten, waren vorhersehbare Nachwehen.
Bob King war vor Jahren Julius’ Patient gewesen, wie eine beträchtliche Anzahl von Ärzten in San Francisco. Julius herrschte seit dreißig Jahren über die psychiatrische Gemeinde der Stadt. In seiner Position als Professor für Psychiatrie an der University of California hatte er massenweise Studenten ausgebildet und war vor fünf Jahren Präsident der American Psychiatric Association geworden.
Sein Ruf? Ein Arzt für Ärzte, ohne Wenn und Aber. Ein Retter in letzter Minute, ein gerissener Hexenmeister, der willens war, alles zu tun, um seinen Patienten zu helfen. Das war auch der Grund gewesen, weswegen Bob King Julius vor zehn Jahren aufgesucht hatte, um seine seit langem bestehende Abhängigkeit von Vicodin (die von süchtigen Ärzten bevorzugte Droge, weil sie so leicht zugänglich ist) behandeln zu lassen. King steckte damals in ernsthaften Schwierigkeiten. Sein Vicodin-Bedarf hatte sich drastisch erhöht, seine Ehe war in Gefahr, seine Arbeit litt darunter, und er musste sich jeden Abend betäuben, um einschlafen zu können.
Bob hatte es mit einer Therapie versuchen wollen, doch ihm waren alle Türen verschlossen. Jeder Therapeut, den er konsultierte, bestand darauf, er solle an einem Entzugsprogramm für suchtkranke Ärzte teilnehmen, ein Plan, dem Bob sich widersetzte, weil ihm der Gedanke verhasst war, sich in Therapiegruppen vor anderen Ärzten bloßzustellen. Die Therapeuten insistierten. Wenn sie einen praktizierenden Süchtigen ohne das offizielle Entzugsprogramm behandelten, gingen sie das Risiko einer Strafverfolgung durch die Gesundheitsbehörde oder das eines persönlichen Rechtsstreits ein (falls der Patient beispielsweise bei seiner klinischen Arbeit ein falsches Urteil fällte).
Julius war damals die letzte Zuflucht gewesen. Sonst hätte er seine Praxis schließen und Urlaub nehmen müssen, um sich in einer anderen Stadt anonym behandeln zu lassen. Julius ging das Risiko ein und vertraute darauf, dass Bob King den Vicodin-Entzug auch so schaffte. Und obgleich die Therapie schwierig war, wie sie es bei Suchtkranken immer ist, behandelte Julius Bob für die nächsten drei Jahre ohne die Hilfe eines Entzugsprogramms. Es blieb eines der Geheimnisse, die jeder Psychiater hat – ein therapeutischer Erfolg, der auf keinen Fall erörtert oder publiziert werden durfte.
Julius saß in seinem Wagen, nachdem er die Praxis seines Internisten verlassen hatte. Sein Herz hämmerte so heftig, dass das Auto zu erzittern schien. Er holte tief Luft, um seine wachsende Panik in den Griff zu bekommen, dann noch einmal und noch einmal und klappte sein Handy auf, um mit flatternden Händen einen umgehenden Termin bei Bob King zu vereinbaren.
»Das gefällt mir nicht«, sagte Bob am nächsten Vormittag, als er Julius’ Rücken mit einem großen, runden Vergrößerungsglas studierte. »Hier, schauen Sie selbst; mit zwei Spiegeln geht das.«
Bob ließ ihn vor dem Wandspiegel Aufstellung nehmen und hielt einen großen Handspiegel an das Mal. Julius sah den Dermatologen an: blond, rötliches Gesicht, dicke Brillengläser, die auf einer langen, imposanten Nase thronten – er erinnerte sich daran, wie Bob ihm erzählt hatte, dass die anderen Kinder ihn gehänselt und »Gurkennase« gerufen hatten. Er hatte sich in den zehn Jahren nicht sehr verändert. Er wirkte gehetzt, ebenso wie er es in seiner Zeit als Julius’ Patient gewesen war, als er schnaufend und pustend immer ein paar Minuten zu spät gekommen war. Oft war ihm damals der Spruch des weißen Kaninchens aus Alice im Wunderland in den Sinn gekommen: »Jemine! Jemine! Ich komme bestimmt zu spät!«, wenn Bob in sein Sprechzimmer stürzte. Er hatte zugenommen, war aber so klein wie eh und je. Er sah aus wie ein Dermatologe. Wer hat jemals einen hochgewachsenen Dermatologen erblickt? Dann schaute Julius ihm in die Augen – oh, oh, sie schienen besorgt –, die Pupillen waren riesig.
»Hier ist das Viech.« Julius sah im Spiegel, dass Bob mit dem Radiergummi-Ende eines Stifts darauf zeigte. »Dieses flache Mal unter Ihrem rechten Schulterblatt. Sehen Sie es?«
Julius nickte.
Bob hielt ein kleines Lineal daran und fuhr fort: »Es misst fast einen Zentimeter. Sicher erinnern Sie sich an die ABCD-Regel aus Ihrem Dermatologiekurs an der Uni –«
Julius unterbrach ihn. »Ich erinnere mich an nichts aus dem Dermatologiekurs. Betrachten Sie mich als Idioten.«
»Okay. ABCD. A wie Asymmetrie – schauen Sie hier.« Er schob den Stift auf Teile des Flecks. »Er ist nicht vollkommen rund wie die anderen auf Ihrem Rücken – sehen Sie diesen und den hier?« Er deutete auf zwei Pigmentmale, die dicht daneben lagen.
Julius versuchte, seine Spannung abzubauen, indem er tief Luft holte.
»B wie Begrenzung – schauen Sie: Ich weiß, es ist schwer zu erkennen.« Bob zeigte erneut auf den Fleck unter dem Schulterblatt. »Sie sehen in diesem oberen Bereich, wie scharf die Grenze gezogen ist, hier dagegen, zur Mitte hin, ist sie verschwommen, verläuft einfach in die umliegende Haut. C wie Color, Färbung. Hier, auf dieser Seite, wirkt das Mal hellbraun. Wenn ich es vergrößere, sehe ich einen Spritzer Rot, ein bisschen Schwarz, vielleicht sogar Grau. D wie Durchmesser; wie ich schon sagte, ungefähr ein Zentimeter. Das ist nicht ungewöhnlich, aber wir wissen nicht, wie alt es ist, ich meine, wie schnell es wächst. Herb Katz meint, bei der Untersuchung im letzten Jahr war es noch nicht zu sehen. Und schließlich ist bei Vergrößerung deutlich zu erkennen, dass das Zentrum geschwürig ist.«
Während er den Spiegel beiseite legte, sagte er: »Ziehen Sie Ihr Hemd wieder an, Julius.« Nachdem sein Patient es zugeknöpft hatte, setzte King sich auf den kleinen Hocker im Untersuchungszimmer und fing an: »Also, Julius, Sie kennen die Literatur hierüber. Es gibt offensichtlich Anlass zur Sorge.«
»Hören Sie, Bob«, erwiderte Julius. »Ich weiß, dass unsere frühere Beziehung es Ihnen schwer macht, aber bitte fordern Sie mich nicht auf, Ihnen die Arbeit abzunehmen. Gehen Sie nicht davon aus, dass ich irgendetwas über Hautkrankheiten weiß. Denken Sie daran, dass mein Geisteszustand im Moment zwischen Entsetzen und Panik schwankt. Ich möchte, dass Sie die Sache in die Hand nehmen, dass Sie mir gegenüber vollkommen ehrlich sind und sich um mich kümmern. So, wie ich es damals bei Ihnen getan habe. Und, Bob, sehen Sie mich an! Wenn Sie meinem Blick dauernd ausweichen, ängstige ich mich noch zu Tode.«
»Sie haben Recht. Tut mir Leid.« King schaute ihm offen in die Augen. »Sie haben sich verdammt gut um mich gekümmert. Ich werde für Sie dasselbe tun.« Er räusperte sich. »Okay, ich habe den starken Verdacht, dass es ein Melanom ist.«
Als er bemerkte, wie Julius zusammenzuckte, fügte er hinzu: »Trotzdem, die Diagnose allein bedeutet wenig. Die meisten – vergessen Sie das nicht –, die meisten Melanome lassen sich durchaus behandeln, auch wenn manche Miststücke sind. Wir müssen die Sache angehen: Ist es wirklich ein Melanom? Falls ja, wie tief ist es? Hat es schon gestreut? Der erste Schritt ist also eine Biopsie und die Verschickung einer Probe an den Pathologen.
Sobald wir hier fertig sind, ziehe ich einen Chirurgen hinzu, der den Fleck herausschneidet. Ich werde dabei an seiner Seite sein. Als Nächstes kommt die Untersuchung eines Teilstücks durch den Pathologen, und wenn der Befund negativ ist, umso besser, dann war’s das! Ist er positiv, handelt es sich also um ein Melanom, werden wir den verdächtigsten Lymphknoten entfernen oder, falls notwendig, auch mehrere. Ein Krankenhausaufenthalt ist nicht erforderlich – die ganze Prozedur wird ambulant vor sich gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine Hauttransplantation nötig sein wird und Sie höchstens einen Tag pausieren müssen. Allerdings werden Sie an der Stelle des Eingriffs ein paar Tage lang Beschwerden verspüren. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Wir müssen die Biopsie abwarten. Vertrauen Sie mir. Ich habe mit Hunderten solcher Fälle zu tun gehabt. Okay? Meine Mitarbeiterin ruft Sie später an und gibt Ihnen die Details hinsichtlich Zeit und Ort und etwaiger Vorbereitungen durch. Okay?«
Julius nickte. Beide erhoben sich.
»Tut mir Leid«, sagte Bob. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen all das ersparen, aber das kann ich nicht.« Er reichte Julius eine Mappe. »Vielleicht wollen Sie das Zeug hier gar nicht, aber ich gebe es Patienten in Ihrer Situation immer mit. Es hängt von der Persönlichkeit ab: Manche fühlen sich getröstet durch Informationen, andere möchten lieber nicht Bescheid wissen und werfen es schon auf dem Heimweg weg. Hoffentlich kann ich Ihnen nach dem Eingriff etwas Ermutigenderes sagen.«
Doch es sollte nichts Ermutigenderes mehr geben – die nächsten Neuigkeiten waren noch düsterer. Drei Tage nach der Biopsie trafen sie sich wieder. »Wollen Sie es lesen?«, fragte Bob und streckte ihm den endgültigen Befund des Pathologen entgegen. Als er sah, wie Julius den Kopf schüttelte, blätterte Bob den Bericht durch und begann: »Okay, schauen wir mal. Ich muss Ihnen sagen: Es klingt nicht gut. Das Wichtigste: Es ist ein Melanom mit mehreren ... äh ... bemerkenswerten Eigenschaften: Es reicht tief, über vier Millimeter, ist geschwürig, und fünf Lymphknoten sind befallen.«
»Und das bedeutet? Los, Bob, reden Sie nicht drum herum. ›Bemerkenswert, vier Millimeter, geschwürig, fünf Lymphknoten‹? Reden Sie Klartext. Sprechen Sie mit mir, als ob ich ein Laie wäre.«
»Das sind schlechte Nachrichten. Es ist ein ziemlich großes Melanom, und es hat bereits auf die Lymphknoten übergegriffen. Die Gefahr dabei ist eine weitere Streuung, aber das wissen wir erst nach der CT, die ich für morgen um acht vereinbart habe.«
Zwei Tage später setzten sie ihr Gespräch fort. Bob berichtete, dass der CT-Befund negativ war – keinerlei Hinweise auf eine weitere Ausbreitung irgendwo sonst im Körper. Das waren die ersten guten Neuigkeiten. »Aber trotzdem, Julius, es ist ein gefährliches Melanom.«
»Wie gefährlich?« Julius räusperte sich, seine Stimme klang heiser. »Wovon sprechen wir? Wie hoch ist die Überlebensrate?«
»Sie wissen, dass wir diese Frage nur mit statistischen Werten beantworten können. Jeder Mensch ist anders. Aber bei einem geschwürigen Melanom, vier Millimeter tief, und fünf befallenen Lymphknoten zeigt die Statistik eine fünfjährige Überlebensrate von unter fünfundzwanzig Prozent.«
Julius saß etliche Momente mit gesenktem Kopf, klopfendem Herzen und Tränen in den Augen da, ehe er bat: »Weiter. Sie sind aufrichtig. Ich muss wissen, was ich meinen Patienten sagen soll. Wie schaut der Verlauf in meinem Fall aus? Was wird passieren?«
»Es ist unmöglich, das genau vorherzusagen, denn es passiert erst einmal nichts, so lange bis das Melanom nicht an anderer Stelle wieder auftritt. In dem Fall könnte es, besonders, wenn es metastasiert, rasch gehen, dann ist von Wochen oder Monaten die Rede. Was Sie Ihren Patienten sagen sollen – schwer zu sagen, aber es wäre nicht unrealistisch, auf mindestens noch ein Jahr bei guter Gesundheit zu hoffen.«
Julius nickte langsam mit gesenktem Kopf.
»Wo sind Ihre Angehörigen, Julius? Hätten Sie nicht jemanden mitbringen sollen?«
»Ich glaube, Sie haben vom Tod meiner Frau vor zehn Jahren gehört. Mein Sohn ist an der Ostküste und meine Tochter in Santa Barbara. Ich habe ihnen noch nichts gesagt; ich fand es nicht sinnvoll, ihr Leben unnötig durcheinanderzubringen. Im Allgemeinen lecke ich meine Wunden sowieso lieber allein, aber ich bin mir sicher, dass meine Tochter sofort herkommen wird.«
»Julius, es tut mir so Leid, Ihnen dies alles sagen zu müssen. Lassen Sie mich unser Gespräch mit einer positiven Nachricht beenden. Inzwischen wird mit Hochdruck geforscht – es gibt etwa ein Dutzend äußerst rege Labors in diesem Land und in Übersee. Aus unbekannten Gründen hat sich das Auftreten von Melanomen in den letzten Jahren nahezu verdoppelt, es ist deshalb ein intensives Forschungsgebiet. Gut möglich, dass wir kurz vor einem Durchbruch stehen.«
Die nächste Woche verlebte Julius in einer Art Trance. Seine Tochter Evelyn, Professorin für klassische Literatur, sagte ihre Vorlesungen ab und kam sofort, um einige Tage mit ihm zu verbringen. Er führte ausführliche Gespräche mit ihr, seinem Sohn, seiner Schwester, seinem Bruder und mit engen Freunden. Oft wachte er mitten in der Nacht panisch auf, schreiend und nach Luft ringend. Er sagte seine Sitzungen ab, sowohl die mit seinen Einzelpatienten als auch die seiner Therapiegruppe, und sann Stunden darüber nach, wie und was er ihnen erzählen sollte.
Der Spiegel sagte ihm, dass er nicht aussah wie ein Mann, der sein Lebensende erreicht hat. Sein täglicher Fünf-Kilometer-Lauf hatte seinen Körper jung und drahtig erhalten, ohne ein Gramm Fett. Um Augen und Mund waren ein paar Falten. Nicht viele – sein Vater war ohne eine einzige gestorben. Julius hatte grüne Augen; er war immer stolz auf sie gewesen. Einen eindringlichen und aufrichtigen Blick. Augen, denen man vertrauen konnte, Augen, die jedem Blick trotzten. Junge Augen, die Augen des sechzehnjährigen Julius. Der Sterbende und der Sechzehnjährige schauten einander über die Jahrzehnte hinweg an.
Er sah auf seine Lippen. Volle, freundliche Lippen. Lippen, die sogar jetzt in der Zeit der Verzweiflung stets ein warmherziges Lächeln zu zeigen schienen. Er hatte einen dichten Schopf ungebärdiger schwarzer Locken, die nur an den Schläfen grau wurden. Als er noch ein Teenager in der Bronx war, pflegte der alte, weißhaarige, rotgesichtige antisemitische Friseur, dessen winziger Laden zwischen Meyers Süßwarengeschäft und Morris’ Fleischerei lag, sein widerspenstiges Haar zu verfluchen, während er mit einem Stahlkamm daran zerrte und es schnitt und ausdünnte. Mittlerweile waren Meyer, Morris und der Friseur tot, und der kleine sechzehnjährige Julius stand auf der Warteliste des Todes.
Eines Nachmittags versuchte er, ein Gefühl der Kontrolle zu gewinnen, indem er in der Bibliothek der medizinischen Fakultät die Literatur über Melanome las, doch das erwies sich als fruchtlos. Schlimmer als fruchtlos – es machte alles nur noch schlimmer. Je besser Julius die wahrhaft grässliche Natur seiner Krankheit erfasste, desto mehr erschien ihm das Melanom als eine gefräßige Kreatur, die ihre ebenholzschwarzen Fänge tief in sein Fleisch schlug. Wie erschreckend zu erkennen, dass er plötzlich nicht mehr die höchste Lebensform war! Er diente nur noch als Gastgeber, war Nahrung, Speise für einen besser angepassten Organismus, dessen gierige Zellen sich in Schwindel erregendem Tempo teilten, ein Organismus, der einen Blitzkrieg führte und benachbartes Protoplasma annektierte und inzwischen zweifellos Zellschwärme für Kreuzzüge in den Blutkreislauf und die Kolonisierung ferner Organe ausrüstete, vielleicht des wohlschmeckenden, mürben Weidelands seiner Leber oder der schwammigen, grasigen Wiesen seiner Lunge.
Julius legte seine Lektüre beiseite. Über eine Woche war vergangen, und es wurde Zeit, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Die Stunde war gekommen, in der er sich mit dem konfrontieren musste, was eigentlich geschah. Setz dich hin, Julius, befahl er sich. Setz dich hin und meditiere übers Sterben. Er schloss die Augen.
So zeigt sich also, dachte er, der Tod endlich auf der Bühne meines Lebens. Aber was für ein banaler Auftritt – die Vorhänge mit einem Ruck aufgerissen von einem pummeligen Dermatologen mit Gurkennase, ein Vergrößerungsglas in der Hand und gewandet in einen weißen Arztkittel, auf dessen Brusttasche in dunkelblauen Buchstaben sein Name gestickt war.
Und die Schlussszene? Höchstwahrscheinlich ebenso banal. Als Kostüm würde er sein zerknittertes, gestreiftes New-York-Yankees-Nachthemd mit DiMaggios Nummer 5 auf dem Rücken tragen. Die Kulisse? Dasselbe Doppelbett, in dem er seit dreißig Jahren schlief, zerknüllte Kleidungsstücke auf dem Stuhl daneben und auf seinem Nachttisch ein Stapel ungelesener Romane, die nicht wussten, dass ihre Zeit jetzt nie mehr kommen würde. Ein jämmerliches, enttäuschendes Finale. Bestimmt verdiente das glorreiche Abenteuer seines Lebens doch etwas mehr . . . mehr . . . mehr von was?
Ihm kam eine Szene in den Sinn, die er vor ein paar Monaten während eines Hawaii-Urlaubs miterlebt hatte. Beim Wandern war er ganz zufällig auf ein großes buddhistisches Meditationszentrum gestoßen und hatte dort eine junge Frau gesehen, die ein kreisförmiges Labyrinth abschritt, das aus kleinen Lavasteinen bestand. Als sie das Zentrum des Labyrinths erreichte, blieb sie stehen und verweilte reglos in einer ausgiebigen Meditation. Julius’ Reaktionen auf derartige religiöse Rituale waren üblicherweise nicht von Nachsicht getragen, sondern im Allgemeinen irgendwo zwischen Spott und Abscheu angesiedelt.
Aber als er jetzt an die meditierende junge Frau dachte, empfand er mildere Gefühle – eine Welle des Mitleids ergriff ihn, mit ihr und all seinen Mitmenschen, die Opfer jener außergewöhnlichen Laune der Evolution waren, welche Selbstbewusstheit gewährt, jedoch nicht die psychische Ausstattung, die erforderlich ist, um mit dem Schmerz über die Vergänglichkeit der Existenz fertig zu werden. Weshalb die Menschen im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte, der Jahrtausende immer besser darin geworden waren, behelfsmäßige Leugnungen der Endlichkeit zu konstruieren. Würde sich für uns, für irgendeinen von uns, die Suche nach einer höheren Macht, mit der wir verschmelzen und für immer eins sein können, nach von Gott überlieferten Anweisungen, nach einem Zeichen für einen umfassenderen festgelegten Entwurf, nach Ritual und Zeremoniell jemals erledigen?
Und doch, als Julius jetzt seinen Namen auf der Liste des Todes sah, fragte er sich, ob ein wenig Zeremoniell womöglich gar nicht so schlecht wäre. Er schreckte vor seinem eigenen Gedanken zurück, als hätte er sich versengt – so durch und durch gefangen war er in seinem lebenslangen Antagonismus gegen Rituale. Er hatte die Instrumente immer verachtet, mit denen Religionen ihre Anhänger ihrer Vernunft und Freiheit berauben: die zeremoniellen Gewänder, den Weihrauch, die heiligen Bücher, die hypnotisierenden gregorianischen Gesänge, die Gebetsmühlen, Gebetsteppiche, Schals und Käppchen, die Bischofsmützen und -stäbe, die Oblaten und den Messwein, die Sterbesakramente, die zu uralten Liedern auf und ab wippenden Köpfe und sich wiegenden Körper – all das waren für ihn die Utensilien des wirkungsvollsten und ältesten Schwindels in der Geschichte, eines Schwindels, der den Führern Macht verlieh und die Lust der Gemeinde an Unterwerfung befriedigte.
Aber nun, da der Tod neben ihm stand, bemerkte Julius, dass seine Vehemenz an Schärfe verloren hatte. Vielleicht war es lediglich das aufgezwungene Ritual, das ihm missfiel. Vielleicht ließ sich ja ein gutes Wort für ein klein wenig kreatives persönliches Zeremoniell einlegen. Er war gerührt von den Zeitungsberichten über die Feuerwehrleute am Ground Zero in New York, die stehen blieben und die Helme abnahmen, um die Toten zu ehren, während eine Palette nach der anderen mit neu entdeckten Überresten an die Oberfläche befördert wurde. Es war nichts Verkehrtes daran, die Toten zu ehren . . . nein, nicht die Toten, sondern das Leben derer zu ehren, die gestorben waren. Oder war es mehr als ehren, eher etwas wie heilig sprechen? Bedeutete die Geste, das Ritual der Feuerwehrmänner nicht auch Verbundenheit? Die Anerkennung ihrer Beziehung zueinander, ihrer Einheit mit jedem einzelnen Opfer?
Ein paar Tage nach dem schicksalhaften Treffen mit seinem Dermatologen bekam Julius selbst eine Kostprobe von Verbundenheit, als er an der Zusammenkunft seiner Psychotherapeuten-Selbsthilfegruppe teilnahm. Seine Kollegen waren niedergeschmettert, als Julius ihnen von seinem Melanom erzählte. Nachdem sie ihn ermutigt hatten, sich auszusprechen, äußerte jedes Gruppenmitglied seinen Schock und Kummer. Danach fand Julius keine Worte mehr, und das galt auch für die anderen. Ein paar Mal setzte jemand zum Reden an, schwieg dann aber doch lieber, und dann war es, als wäre die Gruppe nonverbal übereingekommen, dass Worte nicht notwendig waren. Die letzten zwanzig Minuten saßen alle schweigend da. So lange Perioden des Schweigens in einer Gruppe sind fast unweigerlich peinlich, doch diese fühlte sich anders an, beinahe tröstlich. Mit Verlegenheit gestand Julius sich ein, dass das Schweigen ihm »heilig« erschien. Später wurde ihm klar, dass die anderen nicht nur Schmerz geäußert, sondern auch ihre Kopfbedeckungen abgenommen, gemeinsam still dagestanden und sein Leben geehrt hatten.
Und vielleicht ehrten sie damit auch ihr eigenes Leben, dachte Julius. Was haben wir denn sonst? Was außer diesem wunderbaren, begnadeten Intervall des Seins und der Selbstbewusstheit? Wenn etwas geehrt und gesegnet werden kann, sollte es das sein – das kostbare Geschenk der bloßen Existenz. Zu verzweifeln, weil das Leben endlich ist oder weil es keinen höheren Zweck oder festen Entwurf hat, ist krasse Undankbarkeit. Sich einen allwissenden Schöpfer zu erträumen und unser Leben endlosen Kniefällen zu widmen, scheint sinnlos. Und außerdem verschwenderisch: Warum all diese Liebe an ein Phantasma vergeuden, wenn doch auf Erden viel zu wenig Liebe ist? Besser war es, sich Spinozas und Einsteins Haltung zu Eigen zu machen: sich einfach zu verneigen, den eleganten Gesetzen und Mysterien der Natur seine Reverenz zu erweisen und sich der Aufgabe des Lebens zu widmen.
Dies waren keine neuen Gedanken für Julius – er hatte immer gewusst, dass alles endlich und jede Selbstbewusstheit vergänglich war. Doch es gab Wissen und Wissen. Und die nähere Gegenwart des Todes beförderte sein Wissen. Nicht etwa, dass er weiser geworden wäre; es war nur so, dass das Wegfallen von Ablenkungen – Ehrgeiz, sexuelle Leidenschaft, Geld, Prestige, Applaus, Popularität – ihm ein unverfälschteres Bild bot. War ein derartiges Loslassen nicht die Wahrheit des Buddha? Vielleicht, aber Julius zog den Weg der Griechen vor: alles in Maßen. Wir verpassen zu viel von dem, was das Leben zu bieten hat, wenn wir nie die Mäntel ausziehen und an seinen Belustigungen teilnehmen. Warum zur Tür hinausstürzen, ehe der Vorhang fällt?
Nach ein paar Tagen, als Julius sich ruhiger und nicht mehr vollkommen von Wogen der Panik überwältigt fühlte, wandten sich seine Gedanken der Zukunft zu. »Ein gutes Jahr wahrscheinlich«, hatte Bob King gesagt, »es wäre nicht unrealistisch, auf mindestens noch ein Jahr bei guter Gesundheit zu hoffen.« Doch wie sollte er dieses Jahr verbringen? Eins beschloss er jedenfalls: dieses eine gute Jahr nicht zu einem schlechten Jahr zu machen, indem er sich darüber grämte, dass es nicht mehr war als ein Jahr.
Eines Nachts, als er nicht schlafen konnte und sich nach etwas Tröstlichem sehnte, durchstöberte er rastlos seine Bibliothek. Auf seinem eigenen Gebiet fand er nichts, das für seine Lebenssituation auch nur im Entferntesten relevant erschien, nichts, das sich darauf bezog, wie man seine restlichen Tage leben oder Sinn in ihnen finden sollte. Aber dann fiel sein Blick auf eine eselsohrige Ausgabe von Nietzsches Also sprach Zarathustra. Dieses Buch kannte Julius gut: Vor Jahrzehnten hatte er es gründlich studiert, als er einen Artikel über den erheblichen, jedoch nicht eingestandenen Einfluss von Nietzsche auf Freud geschrieben hatte. Zarathustra war ein mutiges Buch, dachte Julius, das mehr als jedes andere lehrt, wie sehr man das Leben ehren und feiern muss. Ja, das konnte das Richtige sein. Zu unruhig, um systematisch zu lesen, blätterte er willkürlich die Seiten um und überflog einige Zeilen, die er hervorgehoben hatte.
»Die Vergangnen zu erlösen und alles Es war umzuschaffen in ein So wollte ich es! – das hieße mir erst Erlösung.«
Julius verstand Nietzsches Worte so, dass er sich entscheiden sollte, welches Leben er wählte – er sollte es leben, statt von ihm gelebt zu werden. Anders gesagt, er musste sein Schicksal lieben. Und vor allem war da Zarathustras oft gestellte Frage, ob wir willens wären, das Leben, das wir führen, genauso bis in alle Ewigkeit zu wiederholen. Ein seltsames Gedankenexperiment – dennoch, je mehr er darüber nachdachte, desto mehr Anleitung bot es ihm: Nietzsches Botschaft an uns war, das Leben so zu leben, dass wir bereit wären, es auf dieselbe Weise ewig zu wiederholen.
Er blätterte weiter und hielt bei zwei Sätzen inne, die deutlich in Neonrosa hervorgehoben waren. In einem hieß es, man solle sein Leben ausschöpfen, im anderen: »Stirb zur rechten Zeit.«
Sie trafen ins Schwarze. Lebe dein Leben bis zum Äußersten, und dann und erst dann stirb. Lass kein ungelebtes Leben zurück. Julius verglich Nietzsches Worte oft mit einem Rorschach-Test: Sie ermöglichten ihren Lesern so viele Sichtweisen, dass es von ihrer geistigen Verfassung abhing, was sie damit anfingen. Als er Nietzsche jetzt las, war er in einer sehr veränderten geistigen Verfassung. Die Gegenwart des Todes führte zu einem besseren Verständnis des Gelesenen: Auf jeder Seite sah er Hinweise auf eine pantheistische Verbundenheit, die ihm vorher entgangen waren. Wie sehr Zarathustra auch die Einsamkeit pries, sie sogar glorifizierte, wie sehr er sie auch für erforderlich hielt, um große Gedanken zu gebären, fühlte er sich doch dazu verpflichtet, andere zu lieben und ihnen Auftrieb zu geben, ihnen zu helfen, sich zu vervollkommnen und zu transzendieren, an seiner Reife teilzuhaben. An seiner Reife teilhaben – das traf ins Schwarze.
Nachdem Julius den Zarathustra an seinen Platz zurückgestellt hatte, saß er im Dunkeln da, starrte auf die Lichter der Autos, die die Golden Gate Bridge überquerten, und dachte über Nietzsches Worte nach. Nach ein paar Minuten hatte er es: Er wusste genau, was er tun und wie er sein letztes Jahr verbringen würde. Er würde genauso leben, wie er im vergangenen Jahr gelebt hatte – und im Jahr davor und dem davor. Er liebte es, Therapeut zu sein; er liebte es, eine Verbindung mit anderen zu knüpfen und dazu beizutragen, dass etwas in ihnen zum Leben erwachte. Vielleicht war seine Arbeit eine Sublimierung für den Verlust seiner Frau; vielleicht brauchte er den Applaus, die Bestätigung und Dankbarkeit derer, denen er half. Trotzdem, selbst wenn unklare Motive eine Rolle spielen sollten, war er dankbar für seine Arbeit. Gott segne sie!
Julius trat an die mit Aktenschränken vollgestellte Wand und öffnete eine Schublade, die gefüllt war mit Krankenblättern und Bändern von aufgezeichneten Sitzungen mit Patienten, die er vor langer Zeit behandelt hatte. Er starrte auf die Namen – jede Akte Denkmal für ein ergreifendes menschliches Drama, das sich einst genau in diesem Raum entfaltet hatte. Als er die Krankenblätter durchging, fielen ihm die meisten der dazugehörigen Gesichter sofort ein. Andere waren verblasst, aber ein paar Absätze mit Notizen beschworen auch sie wieder herauf. Nur wenige waren ganz vergessen, ihre Gesichter und Geschichten für immer verloren.
Wie den meisten Therapeuten fiel es Julius schwer, sich von den unablässigen Angriffen abzuschotten, die gegen das Gebiet der Psychotherapie gerichtet waren. Sie kamen aus vielen Richtungen: von der pharmazeutischen Industrie und den Krankenversicherungen, die oberflächliche Studien finanzierten, um die Effektivität von Medikamenten und kürzeren Therapien herauszustreichen, von den Medien, die nie überdrüssig wurden, Therapeuten ins Lächerliche zu ziehen, von Behavioristen, von Motivationsgurus, von den Horden der New-Age-Heiler und Sekten, die um die Herzen und Hirne der Mühseligen und Beladenen wetteiferten. Und natürlich gab es auch Zweifel aus internen Kreisen: Die außerordentlichen molekular-neurobiologischen Entdeckungen, über die mit wachsender Häufigkeit berichtet wurde, veranlassten auch die erfahrensten Therapeuten, die Relevanz ihrer Arbeit zu hinterfragen.
Julius war nicht immun gegen diese Attacken und hatte oft Bedenken, was die Wirksamkeit seiner Therapien betraf, aber ebenso oft beschwichtigte und beruhigte er sich. Natürlich war er ein effektiver Heiler. Natürlich bot er den meisten seiner Patienten, vielleicht sogar allen, etwas Wertvolles.
Dennoch verfolgte ihn der Stachel des Zweifels weiterhin: Hast du deinen Patienten wirklich und wahrhaftig geholfen? Vielleicht hast du einfach nur gelernt, dir die Patienten auszusuchen, denen es auch von selbst besser gegangen wäre.
Nein. Falsch! War er nicht einer, der sich immer wieder großen Herausforderungen gestellt hatte?
Na ja, er hatte seine Grenzen! Wann hatte er sich zum letzten Mal wirklich gefordert – einen eklatanten Borderline-Fall therapiert? Oder einen ernsthaft gestörten Schizophrenen oder einen bipolaren Patienten?
Als er fortfuhr, seine alten Krankenakten durchzugehen, war Julius überrascht darüber, wie viele Informationen er besaß, die das Hinterher einer Psychotherapie betrafen – durch gelegentliche Anschluss- oder Nachsorge-Gespräche, durch zufällige Begegnungen mit Patienten oder durch Nachrichten neuer Patienten, denen er empfohlen worden war. Aber trotzdem, hatte er nachhaltigen Einfluss auf sie gehabt? Vielleicht waren seine Resultate nicht von Dauer. Vielleicht hatten viele seiner erfolgreich behandelten Patienten einen Rückfall erlitten und enthielten ihm diese Tatsache aus reiner Nächstenliebe vor.
Er nahm auch seine Misserfolge zur Kenntnis – Menschen, so hatte er sich stets gesagt, die für seine fortschrittlichen Methoden noch nicht bereit waren. Halt, dachte er dann, sei nicht so streng mit dir, Julius. Woher willst du wissen, dass sie wirklich Misserfolge waren? Permanente Misserfolge? Du hast sie ja nie mehr gesehen. Wir wissen alle, dass es eine Menge Spätzünder gibt.
Sein Blick fiel auf Philip Slates dicke Akte. Du willst einen Misserfolg?, fragte er sich. Das hier war einer. Ein klassischer, grandioser Misserfolg. Philip Slate. Mehr als zwanzig Jahre waren vergangen, doch das Bild von Philip Slate stand ihm noch immer deutlich vor Augen. Sein hellbraunes, glatt zurückgekämmtes Haar, die dünne, elegante Nase, jene hohen Wangenknochen, die Adel suggerierten, und die lebendigen grünen Augen, die ihn an karibische Gewässer erinnerten. Er entsann sich, wie sehr ihm an den Sitzungen mit Philip alles missfallen hatte. Bis auf das eine: das Vergnügen, sein Gesicht zu betrachten.
Philip Slate war sich selbst so sehr entfremdet, dass ihm nie der Gedanke kam, in sich hineinzuschauen; stattdessen glitt er lieber auf der Oberfläche des Lebens dahin und widmete all seine Energie der sexuellen Ausschweifung. Dank seines hübschen Gesichts hatte er keinen Mangel an Freiwilligen. Julius schüttelte den Kopf, als er Philips Akte durchblätterte – drei Jahre Sitzungen, so viel Zuhören und Unterstützung und Anteilnahme, so viele Interpretationen, und alles ohne einen Hauch von Fortschritt. Erstaunlich! Vielleicht war er doch nicht der Therapeut, für den er sich hielt.
Zieh keine voreiligen Schlüsse, sagte er sich. Warum hätte Philip drei Jahre lang kommen sollen, wenn er nichts davon gehabt hätte? Warum hätte er all das Geld aus dem Fenster werfen sollen? Und Philip hasste es weiß Gott, Geld auszugeben. Vielleicht hatten die Sitzungen Philip ja doch verändert. Vielleicht war er ein Spätzünder – einer jener Patienten, die Zeit brauchen, um die Nahrung zu verdauen, die der Therapeut ihnen verabreicht, einer von denen, die sich einige der Leckerbissen des Therapeuten aufbewahren, sie mit nach Hause nehmen wie einen Knochen, an dem sie später ganz allein herumnagen. Julius hatte Patienten kennen gelernt, die so sehr mit ihm konkurrierten, dass sie ihre positive Entwicklung verheimlichten, nur weil sie dem Therapeuten die Befriedigung (und die Macht), ihnen geholfen zu haben, nicht gönnten.
Nun, da ihm Philip Slate in den Sinn gekommen war, ging er Julius nicht mehr aus dem Kopf. Er hatte sich in ihm eingenistet und Wurzeln geschlagen. Ebenso wie das Melanom. Sein Misserfolg bei Philip wurde zu einem Symbol, das all seine therapeutischen Misserfolge verkörperte. Der Fall Philip Slate hatte etwas Besonderes. Was machte ihn so einprägsam? Julius schlug die Akte auf und las seine erste Notiz, die er vor über zweiundzwanzig Jahren geschrieben hatte.
PHILIP SLATE – 11. Dezember 1980
26jähr. lediger weißer Chemiker, der bei DuPont arbeitet – entwickelt neue Pestizide – auffällig gut aussehend, salopp gekleidet, hat aber etwas Adliges an sich, förmlich, sitzt steif da, bewegt sich wenig, keine Äußerung von Gefühlen, ernst, Fehlen jeglichen Humors, kein Lächeln oder Grinsen, streng sachlich, keinerlei soziale Kompetenz. Überwiesen von seinem Internisten Dr. Wood.
HAUPTBESCHWERDE: »Ich werde gegen meinen Willen von sexuellen Impulsen gesteuert.«
Warum jetzt? »Es reicht«-Episode vor einer Woche, die er wie auswendig gelernt beschrieb.
Ich kam zu einem beruflichen Treffen nach Chicago, stieg aus dem Flugzeug, stürzte ans nächste Telefon und klapperte meine Liste von Chicagoer Frauen ab, weil ich für den Abend auf ein sexuelles Abenteuer aus war. Kein Glück! Sie hatten alle schon etwas vor. Natürlich hatten sie was vor: Es war ein Freitagabend. Ich hatte gewusst, dass ich nach Chicago kommen würde; ich hätte sie Tage, sogar Wochen vorher anrufen können. Dann, nachdem ich die letzte Nummer aus meinem Buch gewählt hatte, legte ich den Hörer auf und sagte mir: »Gott sei Dank, jetzt kann ich lesen und danach schön schlafen, was ich eigentlich sowieso tun wollte.«
Patient meint, dieser Satz, dieses Paradox – »was ich eigentlich sowieso tun wollte« – habe ihn die ganze Woche verfolgt und sei der spezifische Grund dafür, dass er eine Therapie beginnen wolle. »Darauf möchte ich mich in der Therapie konzentrieren«, sagt er. »Wenn es das ist, was ich will – lesen und danach schön schlafen –, Dr. Hertzfeld, bitte, warum kann ich es dann nicht tun, warum tue ich es nicht?«
Langsam fielen ihm weitere Einzelheiten aus seiner Arbeit mit Philip Slate ein. Intellektuell hatte Philip ihn fasziniert. Zur Zeit ihrer ersten Begegnung schrieb er gerade an einem Artikel über Psychotherapie und Willen, und Philips Frage – warum kann ich nicht das tun, was ich eigentlich tun will? – war ein spannender Anfang dafür. Und am besten erinnerte er sich an Philips außergewöhnliche Unbeweglichkeit: Selbst nach drei Jahren wirkte er völlig unberührt und unverändert – und war sexuell ebenso getrieben wie eh und je.
Was war aus Philip Slate geworden? Er hatte nichts mehr von ihm gehört, seit er die Therapie vor zwanzig Jahren abrupt abgebrochen hatte. Wieder fragte sich Julius, ob er Philip, ohne es zu ahnen, vielleicht doch geholfen hatte. Plötzlich musste er es wissen; es schien ihm eine Sache auf Leben und Tod. Er griff nach dem Telefon und wählte die Auskunft.
»Wollust im Akt der Kopulation. Das ist es! Das ist das wahre Wesen und der Kern aller Dinge, das Ziel und Zweck alles Daseyns.« Ref 2
2
»Hallo, ist da Philip Slate?«
»Ja, Philip Slate am Apparat.«
»Hier ist Dr. Hertzfeld. Julius Hertzfeld.«
»Julius Hertzfeld?«
»Eine Stimme aus Ihrer Vergangenheit.«
»Der tiefsten Vergangenheit. Aus dem Pleistozän. Julius Hertzfeld. Ich fasse es nicht – wie lange ist es her? . . . mindestens zwanzig Jahre. Und warum dieser Anruf?«
»Also, Philip, ich rufe wegen Ihrer Rechnung an. Ich glaube, Sie haben für unsere letzte Sitzung nicht alles bezahlt.«
»Was? Die letzte Sitzung? Aber ich bin sicher . . .«
»Das sollte ein Witz sein, Philip. Tut mir Leid, manche Dinge verändern sich nie – der Alte ist immer noch zu Scherzen aufgelegt. Hier in aller Kürze, warum ich anrufe. Ich habe gesundheitliche Probleme und ziehe den Ruhestand in Betracht. Im Laufe dieser Überlegung habe ich den unwiderstehlichen Drang entwickelt, mich mit einigen meiner ehemaligen Patienten zu treffen – nur um zu verfolgen, wie sie sich entwickelt haben, um meine eigene Neugier zu befriedigen. Ich erkläre Ihnen das gern ausführlicher, wenn Sie wollen. Also – hier meine Frage an Sie: Wären Sie bereit, sich mit mir zu treffen? Eine Stunde mit mir zu reden? Rückschau auf unsere gemeinsame Therapie zu halten und mir zu berichten, wie es Ihnen ergangen ist? Für mich wäre das interessant und erhellend. Wer weiß – vielleicht ja auch für Sie.«
»Hm . . . eine Stunde. Klar. Wieso nicht? Ich gehe davon aus, dass Sie kein Honorar verlangen?«
»Eher könnten Sie mir eine Rechnung stellen, Philip – schließlich bitte ich Sie um Ihre Zeit. Wie wär’s noch diese Woche? Sagen wir Freitagnachmittag?«
»Freitag? Gut. Das passt. Ich räume Ihnen ab ein Uhr eine Stunde ein. Ich werde keine Bezahlung für meine Dienste verlangen, aber diesmal sollten wir uns in meiner Praxis treffen – sie ist in der Union Street – Nummer 431. Nicht weit von der Franklin. Die genaue Lage finden Sie auf dem Gebäudewegweiser – ich stehe da als Dr. Slate. Ich bin jetzt auch Therapeut.«
Julius fröstelte es, als er den Hörer auflegte. Er wirbelte in seinem Sessel herum und verrenkte sich den Hals, um einen Blick auf die Golden Gate Bridge zu werfen. Nach diesem Anruf musste er etwas Schönes sehen. Und etwas Warmes in seinen Händen spüren. Er füllte seine Meerschaumpfeife mit Balkan Sobranie, zündete ein Streichholz an und sog.
Verdammt, dachte er, dieser warme, erdige Geschmack von Latakiatabak, dieser honigartige, pikante Duft – es gab nichts Besseres auf der Welt. Schwer zu glauben, dass er so viele Jahre darauf verzichtet hatte. Er versank in einen Tagtraum und dachte an den Tag, an dem er aufgehört hatte zu rauchen. Musste gleich nach seinem Besuch beim Zahnarzt gewesen sein, seinem Nachbarn, dem alten Dr. Denboer, der seit zwanzig Jahren tot war. Zwanzig Jahre – wie konnte das sein? Julius sah sein langes holländisches Gesicht und die goldgefasste Brille immer noch ganz deutlich vor sich. Der alte Dr. Denboer, schon zwanzig Jahre unter der Erde. Und er, Julius, immer noch auf ihr. Fürs Erste.
»Die Pustel da an Ihrem Gaumen«, Dr. Denboer schüttelte leicht den Kopf, »sieht Besorgnis erregend aus. Wir brauchen eine Biopsie.« Und obwohl der Befund negativ gewesen war, hatte er Julius damit gehabt, weil dieser in derselben Woche auch zur Beerdigung von Al ging, seinem alten Zigaretten rauchenden Tenniskumpel, der an Lungenkrebs gestorben war. Und es half auch nicht gerade, dass er mitten in der Lektüre von Sigmund Freud. Leben und Sterben war, geschrieben von Max Schur, dem Arzt Freuds – eine plastische Schilderung, wie Freuds durch Zigarren verursachter Krebs allmählich seinen Gaumen, dann seinen Kiefer und schließlich sein Leben vernichtete. Schur hatte Freud versprochen, ihm Sterbehilfe zu leisten, wenn die Zeit käme, und als Freud ihm irgendwann sagte, die Schmerzen seien so stark, dass es sinnlos wäre weiterzumachen, erwies Schur sich als Mann, der sein Wort hielt und ihm eine tödliche Dosis Morphium injizierte. Das war mal ein Arzt. Wo fand man heutzutage einen Dr. Schur?
Über zwanzig Jahre lang keinen Tabak mehr und auch keine Eier, keinen Käse oder sonstige tierische Fette. Gesund und glücklich abstinent. Bis zu dieser gottverdammten Untersuchung. Jetzt war alles erlaubt: Rauchen, Eiscreme, Spareribs, Eier, Käse . . . alles. Wie konnten sie ihm schon schaden? Wie konnte ihm irgendetwas schaden? – In einem Jahr würden die Moleküle von Julius Hertzfeld zerstreut in der Erde liegen und auf ihre nächste Aufgabe warten. Und früher oder später, in wenigen Millionen Jahren, würde das ganze Sonnensystem Schutt und Asche sein.
Als Julius spürte, wie sich der Vorhang der Verzweiflung auf ihn senkte, lenkte er sich rasch damit ab, seine Aufmerksamkeit wieder dem Telefonat mit Philip Slate zuzuwenden. Philip Therapeut? Wie war das möglich? Er hatte Philip als kalt, gleichgültig, ohne Wahrnehmung für andere in Erinnerung, und nach dem Anruf zu urteilen, hatte er sich nicht sehr verändert. Julius zog an seiner Pfeife und schüttelte in wortloser Verwunderung den Kopf, während er Philips Akte aufklappte und fortfuhr, seine diktierte Notiz über ihre erste Sitzung zu lesen.
AKTUELLE KRANKHEIT: – Sexuell getrieben, seit er dreizehn ist – zwanghaftes Masturbieren die ganze Adoleszenz hindurch, das bis heute angehalten hat – gelegentlich vier-, fünfmal am Tag – ständig von Sex besessen, masturbiert, um Frieden zu finden. Verbringt einen großen Teil seines Lebens damit, sich mit Sex herumzuquälen – er sagt: »Die Zeit, die ich darauf verschwendet habe, Frauen zu jagen – ich hätte Doktorate in Philosophie, Mandarin und Astrophysik erwerben können.«
BEZIEHUNGEN: Einzelgänger. Lebt mit seinem Hund in einer kleinen Wohnung. Keine männlichen Freunde. Null. Ebenso wenig Kontakte mit Bekannten aus der Vergangenheit – Highschool, College, Universität. Außerordentlich isoliert. Hatte nie eine langfristige Beziehung mit einer Frau – vermeidet andauernde Beziehungen bewusst – zieht One-Night-Stands vor – trifft sich gelegentlich mit einer Frau einen Monat lang – meistens macht die Frau Schluss – entweder will sie mehr von ihm, oder sie wird wütend, weil sie sich benutzt fühlt oder weil er andere Frauen trifft. Ständiges Verlangen nach Neuem – Lust auf die sexuelle Eroberung – aber nie befriedigt – auf Reisen gabelt er manchmal eine Frau auf, hat Sex, schafft sie sich vom Hals und geht eine Stunde später von seinem Hotelzimmer aus wieder auf die Jagd. Führt Buch über seine Partnerinnen, eine Trefferliste, und hat in den letzten zwölf Monaten Sex mit neunzig verschiedenen Frauen gehabt. Erzählt das alles völlig ungerührt – keine Scham, keine Prahlerei. Fühlt sich unwohl, wenn er einen Abend mal allein ist. Gewöhnlich fungiert Sex für ihn wie Valium. Sobald er Sex gehabt hat, ist ihm den restlichen Abend über friedlich zumute, und er kann in Ruhe lesen. Keine homosexuellen Aktivitäten oder Fantasien.
DER FÜR IHN PERFEKTE ABEND? Geht früh aus, gabelt Frau in Bar auf, schläft mit ihr (vorzugsweise vor dem Essen), entledigt sich der Frau so schnell wie möglich, vorzugsweise ohne ihr ein Essen spendieren zu müssen, aber meistens läuft es doch darauf hinaus. Wichtig, so viel Zeit wie möglich zum Lesen zu haben, ehe er ins Bett geht. Kein Fernsehen, kein Kino, kein soziales Leben, kein Sport. Die einzige Entspannung sind Lesen und klassische Musik. Verschlingt Klassiker, Historisches und Philosophie – keine Romane, nichts Aktuelles. Wollte über Zenon und Aristarchos sprechen, seine gegenwärtigen Interessen.
BISHERIGE GESCHICHTE: Wuchs in Connecticut auf, Einzelkind, obere Mittelschicht. Vater Investmentbanker, der Selbstmord beging, als Philip dreizehn war. Er weiß nichts über die näheren Umstände oder Gründe für den Suizid, hat die vage Vorstellung, dass er durch die ständige Kritik der Mutter ausgelöst wurde. Allgemeine Kindheitsamnesie – hat aus seinen ersten Lebensjahren wenig und von der Beerdigung seines Vaters nichts in Erinnerung. Mutter ging zweite Ehe ein, als er 24 war. In der Schule Einzelgänger, fanatisch ins Lernen vertieft, hatte nie enge Freunde und hat sich, seit er mit 17 auf der Yale anfing, ganz von der Familie gelöst. Telefonischer Kontakt mit der Mutter ein- oder zweimal im Jahr. Hat Stiefvater nie kennen gelernt.
ARBEIT: Erfolgreicher Chemiker – entwickelt neue Pestizide auf Hormonbasis für DuPont. Strikte Trennung von Job und Freizeit, keine Leidenschaft für Beruf, langweilt sich seit neuestem bei der Arbeit. Hält sich über die Forschung auf seinem Gebiet auf dem Laufenden, aber nie in seinen freien Stunden. Hohes Einkommen plus wertvolle Aktienbezugsrechte. Ein Hamsterer: genießt es, seine Vermögenswerte tabellarisch zu erfassen und seine Investitionen zu verwalten, und verbringt jede Mittagspause, in der er die Börsenanalysen studiert, allein.
EINDRUCK: Schizoid, sexuell zwanghaft – sehr distanziert – weigerte sich, mich anzusehen – begegnete meinem Blick kein einziges Mal – kein Anflug eines persönlichen Gefühls zwischen uns – keine Ahnung von zwischenmenschlichen Beziehungen, reagierte auf meine Hier-und-Jetzt-Frage, was sein erster Eindruck von mir sei, mit einer Miene der Verwirrung – als hätte ich Katalan oder Suaheli gesprochen. Wirkte nervös, und ich fühlte mich unwohl in seiner Gegenwart. Absolut kein Humor. Null. Hoch intelligent, drückt sich gut aus, geizt aber mit Worten – Schwerarbeit für mich. Hartnäckig interessiert an den Therapiekosten (die er sich mühelos leisten kann). Bat mich um Reduzierung meines Honorars, was ich ablehnte. Schien unzufrieden, als ich ein paar Minuten später anfing, und zögerte nicht, sich zu erkundigen, ob wir diese Zeit am Ende der Sitzung nachholen würden. Fragte mich zweimal, wie lange genau er im Voraus eine Sitzung absagen müsse, um nicht bezahlen zu müssen.
Julius klappte die Akte zu und dachte: Heute, zweiundzwanzig Jahre danach, ist Philip Therapeut. Kann es auf der ganzen Welt einen ungeeigneteren Menschen für diese Aufgabe geben? Er wirkt ziemlich unverändert: nach wie vor kein Sinn für Humor, nach wie vor hinter Geld her (vielleicht hätte ich den Witz über seine Rechnung nicht machen sollen). Ein Therapeut ohne Humor? Und so kalt. Und diese gereizte Aufforderung, sich in seinem Büro zu treffen. Julius fröstelte es noch einmal.
»Das Leben ist eine mißliche Sache: ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.«
3
Die Union Street war sonnig und festtäglich. Von den voll besetzten Tischen auf dem Bürgersteig vor Prego, Betelnut, Exotic Pizza und Perry’s drang das Klappern von Besteck und das Summen angeregter Gespräche beim Mittagessen. Aquamarinblaue und magentarote, an Parkuhren gebundene Luftballons kündigten einen Wochenendausverkauf an. Doch als Julius auf Philips Büro zuschlenderte, gönnte er den Speisenden oder den im Freien aufgehäuften, aus der Sommersaison übrig gebliebenen Designer-Klamotten keinen Blick. Ebenso wenig verweilte er vor einem seiner Lieblingsschaufenster, weder dem von Marita’s, einem Geschäft mit antiken japanischen Möbeln, noch dem des tibetanischen Ladens oder bei Asian Treasures, wo der farbenprächtig bemalte Dachziegel mit einer fantastischen Kriegerin aus dem 18. Jahrhundert ausgestellt war, an dem er selten vorbeiging, ohne ihn zu bewundern.
Auch das Sterben beschäftigte ihn nicht. Die Rätsel in Bezug auf Philip Slate boten Ablenkung von derart beunruhigenden Gedanken. Zunächst fragte er sich, warum er Philips Bild mit solch unheimlicher Deutlichkeit heraufbeschwören konnte. Wo hatten Philips Gesicht, sein Name, seine Geschichte all die Jahre gelauert? Er musste sich eingestehen, dass die Erinnerung an seine Erlebnisse mit Philip neurochemisch irgendwo in seiner Großhirnrinde gespeichert war. Höchstwahrscheinlich siedelte sie in einem weit verzweigten »Philip«-Netz aus miteinander verknüpften Neuronen, das sich, wenn es von den richtigen Neurotransmittern aktiviert wurde, in Gang setzte und auf eine gespenstische Leinwand in seiner Großhirnrinde ein Bild von Philip projizierte. Er fand es erschreckend, sich vorzustellen, dass er in seinem Gehirn einen mikroskopisch kleinen ferngesteuerten Filmvorführer beherbergte.
Aber noch faszinierender war die Frage, warum er sich entschieden hatte, Philip aufzusuchen. Wieso holte er von all seinen ehemaligen Patienten gerade Philip aus den Tiefen seines Gedächtnisses hervor? War der Grund dafür einfach der, dass seine Therapie so schrecklich erfolglos gewesen war? Das konnte doch nicht alles sein! Schließlich gab es zahlreiche andere Patienten, denen er nicht hatte helfen können. Aber die meisten Gesichter und Namen dieser Fehlschläge waren spurlos verschwunden. Vielleicht lag es daran, dass die nicht erfolgreich Behandelten ihre Therapie zumeist rasch abgebrochen hatten; Philip dagegen war insofern ungewöhnlich, als er weiterhin kam. O Gott, und wie! Drei frustrierende Jahre lang versäumte er nie eine Sitzung. Verspätete sich nie, nicht um eine Minute – er war zu geizig, um einmal bezahlte Zeit zu vergeuden. Und dann eines Tages kam, ohne jede Vorwarnung, die simple und unwiderrufliche Ankündigung am Ende einer Stunde, dass dies seine letzte Sitzung gewesen sei.
Bis zum Schluss hatte Julius Philip nach wie vor für therapierbar gehalten, wobei er eigentlich sowieso bei jedem davon ausging. Wieso war er gescheitert? Philip meinte es ernst mit der Arbeit an seinen Problemen; er war fordernd, geistreich, höchst intelligent. Aber durch und durch unsympathisch. Julius nahm selten einen Patienten an, den er nicht mochte, doch er wusste, dass an seiner Abneigung gegen Philip nichts Persönliches war; keiner mochte ihn. Sein lebenslanger Mangel an Freunden kam nicht von ungefähr.
Obwohl er Philip vielleicht nicht gerade gern hatte, so liebte er doch das intellektuelle Rätsel, das er ihm aufgab. Seine Hauptbeschwerde (»Warum kann ich nicht das tun, was ich eigentlich tun will?«) war ein spannendes Beispiel für Willenslähmung. Die Therapie mochte Philip zwar nicht genützt haben, aber Julius’ Schreiben förderte sie ungemein, und viele Ideen, die bei den Sitzungen zu Tage traten, fanden ihren Weg in seinen gefeierten Artikel »Der Therapeut und der Wille« sowie in sein Buch »Wünschen, Wollen und Handeln«. Es war ihm schon durch den Kopf geschossen, dass er Philip womöglich ausgebeutet hatte. Vielleicht konnte er das ja jetzt mit seinem gesteigerten Gefühl für Verbundenheit wiedergutmachen, vielleicht konnte er ja jetzt bewerkstelligen, woran er zuvor gescheitert war.
Union Street Nummer 431 war ein bescheidenes einstöckiges, mit Stuck verziertes Eckhaus. Im Foyer sah Julius auf dem Gebäudewegweiser Philips Namen: »Dr. Philip Slate, Philosophische Beratung.« Philosophische Beratung? Was zum Teufel war das? Als Nächstes, schnaubte Julius, wird es Friseure geben, die eine Haartherapie anbieten, und Gemüsehändler, die Reklame für Hülsenfruchtberatung machen. Er stieg die Treppe hinauf und drückte die Klingel.
Ein Summer ertönte, während die Tür sich mit einem Klicken öffnete, und Julius betrat ein winziges Wartezimmer mit kahlen Wänden, das nur mit einem wenig einladenden Zweisitzer aus schwarzem Vinyl möbliert war. Ein Stück dahinter, in der Tür zu seinem Büro, stand Philip und bedeutete Julius, ohne sich ihm zu nähern, er möge hereinkommen. Er streckte ihm nicht die Hand entgegen.
Julius verglich Philips Äußeres mit seiner Erinnerung. Kam ziemlich genau hin. Keine wesentliche Veränderung in den letzten zwanzig Jahren bis auf einige sachte Falten um die Augen und ein wenig schlaffe Haut am Hals. Das hellbraune Haar war immer noch glatt nach hinten gekämmt, die grünen Augen waren immer noch ausdrucksstark und immer noch abgewandt. Julius entsann sich, wie selten sich in all ihren gemeinsamen Jahren ihre Blicke begegnet waren. Philip erinnerte ihn an einen jener selbstbewusst autarken Mitschüler, die im Unterricht saßen und sich nie Notizen machten, während er und alle anderen sich mühten, jede Tatsache in ihr Heft zu kritzeln, die in einer Prüfung womöglich abgefragt werden konnte.
Als er Philips Büro betrat, erwog Julius eine Witzelei über die spartanische Einrichtung – ein schäbiger, unaufgeräumter Schreibtisch, zwei unbequem wirkende, nicht zusammenpassende Stühle und eine Wand, die nur mit einem Diplom geschmückt war. Doch er überlegte es sich anders, setzte sich auf den Stuhl, auf den Philip deutete, verzog keine Miene und wartete darauf, dass Philip das Wort ergriff.
»Nun, es ist lange her. Sehr lange.« Philip sprach in förmlichem, professionellem Ton und ließ kein Anzeichen von Nervosität darüber erkennen, dass er das Gespräch eröffnete und damit mit seinem ehemaligen Therapeuten die Rolle tauschte.
»Zwanzig Jahre. Ich habe nachgeschaut.«
»Und warum jetzt, Dr. Hertzfeld?«
»Heißt das, dass wir den Smalltalk hinter uns haben?« Nein, verdammt!, schalt Julius sich. Hör auf damit! Er erinnerte sich an Philips fehlenden Sinn für Humor.
Philip schien ungerührt. »Grundlagen der Gesprächstechnik, Dr. Hertzfeld. Sie kennen das ja. Den Rahmen festlegen. Wir haben bereits den Ort vereinbart, die Zeit – ich biete übrigens eine sechzigminütige Sitzung, nicht die fünfzigminütige Psychostunde – und das Honorar, beziehungsweise in Ihrem Fall, dass keins fällig ist. Der nächste Schritt sind also Zweck und Ziele. Ich versuche, Ihnen zu Diensten zu sein, Dr. Hertzfeld, damit diese Sitzung so effizient wie möglich für Sie ist.«
»In Ordnung, Philip. Das weiß ich zu würdigen. Ihr ›Warum jetzt?‹ ist keine schlechte Frage – ich verwende sie ständig. Rückt die Sitzung ins rechte Licht. Bringt uns direkt zum Kern der Sache. Wie ich Ihnen schon am Telefon erzählt habe, haben gesundheitliche Probleme, erhebliche Probleme, dazu geführt, dass ich zurückblicken, die Dinge einschätzen, meine Arbeit mit Patienten neu bewerten möchte. Vielleicht liegt es an meinem Alter – ich möchte eine Bilanz ziehen. Ich vermute, wenn Sie erst einmal fünfundsechzig sind, werden Sie verstehen, was ich meine.«
»Was diese Bilanz angeht, werde ich Ihnen einfach glauben müssen. Mir ist der Grund dafür, dass Sie mich oder andere Klienten wiedersehen wollen, nicht unmittelbar einsichtig, und ich selbst verspüre keine Neigungen in dieser Richtung. Meine Klienten zahlen mir ein Honorar, und dafür gebe ich ihnen meinen sachkundigen Rat. Dort endet unsere Transaktion. Wenn wir uns trennen, haben sie das Gefühl, etwas für ihr Geld erhalten zu haben, und ich habe das Gefühl, dass ich sie gut bedient habe. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass ich in Zukunft den Wunsch verspüre, sie wiederzusehen. Aber ich stehe Ihnen zu Diensten. Wo fangen wir an?«
Julius hielt sich üblicherweise in Gesprächen selten zurück. Das war eine seiner Stärken – die Leute wussten, dass er offen und ehrlich war. Doch heute zwang er sich zur Zurückhaltung. Er war verblüfft von Philips Schroffheit, aber er war nicht hier, um Philip Ratschläge zu erteilen. Was er wollte, war Philips aufrichtige Version ihrer gemeinsamen Arbeit, und je weniger er über seine seelische Verfassung sagte, desto besser. Wenn Philip von seiner Verzweiflung wusste, von seiner Suche nach Sinn, von seiner Sehnsucht danach, eine nachhaltige, wesentliche Rolle in Philips Leben gespielt zu haben, gab Philip ihm aus einem gewissen Mitgefühl heraus womöglich nur die Bestätigung, die er brauchte. Oder er tat wegen seiner Widerspenstigkeit genau das Gegenteil.
»Also, dann werde ich damit beginnen, Ihnen dafür zu danken, dass Sie so nett sind, mich zu empfangen. Als Erstes möchte ich Folgendes: zunächst Ihre Ansicht über unsere gemeinsame Arbeit hören – wie sie Ihnen geholfen hat und wie nicht –, und zweitens – das ist eine große Zumutung, ich weiß – hätte ich gern eine Zusammenfassung Ihres Lebens seit unserem letzten Treffen. Ich höre immer gern das Ende einer Geschichte.«
Falls Philip von dieser Bitte überrascht war, ließ er sich nichts anmerken. Er saß nur eine Weile schweigend da, mit geschlossenen Augen, die Fingerspitzen seiner Hände aneinander gelegt. Nach einer wohl überlegten Pause setzte er an. »Die Geschichte ist noch nicht zu Ende – mein Leben hat in den letzten Jahren eine solch erstaunliche Wendung genommen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, es fängt eben erst an. Aber ich werde streng chronologisch vorgehen und mit meiner Therapie beginnen. Alles in allem muss ich sagen, dass meine Therapie bei Ihnen ein kompletter Misserfolg war. Ein Zeit raubender und teurer Misserfolg. Ich glaube, ich habe meine Aufgabe als Patient erfüllt. Soweit ich mich entsinne, war ich äußerst kooperativ, arbeitete hart, kam regelmäßig, bezahlte meine Rechnungen, erinnerte mich an Träume, folgte allen Hinweisen, die Sie mir gaben. Stimmen Sie mir zu?«
»Dass Sie ein kooperativer Patient waren? Absolut. Ich würde sogar weiter gehen. Ich würde sagen, Sie waren ein sehr engagierter Patient.«
Philip schaute zur Decke, nickte und fuhr fort: »Soweit ich mich entsinnen kann, kam ich volle drei Jahre zu Ihnen. Und einen Großteil der Zeit zweimal wöchentlich. Das sind eine Menge Stunden – mindestens zweihundert. Rund zwanzigtausend Dollar.«
Julius hätte ihn beinahe unterbrochen. Wenn ein Patient eine derartige Äußerung machte, war seine Reaktion gewöhnlich: »Ein Tropfen auf den heißen Stein.« Und er wies dann immer darauf hin, dass die Punkte, die in der Therapie bearbeitet wurden, im Leben des Patienten seit so langer Zeit ein Problem darstellten, dass man kaum erwarten konnte, sie würden sich schnell erledigen. Oft fügte er noch etwas Persönliches hinzu – dass seine erste Therapie, eine Psychoanalyse während seiner Ausbildung, drei Jahre gedauert und fünfmal pro Woche stattgefunden hatte – insgesamt über siebenhundert Stunden. Doch Philip war nicht mehr sein Patient, und er war nicht hier, um ihn von irgendetwas zu überzeugen. Er war hier, um zuzuhören. Deshalb biss er sich wortlos auf die Lippen.