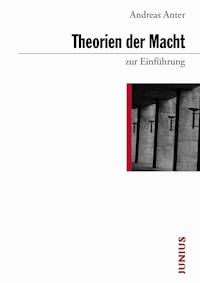
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junius Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: zur Einführung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Frage, warum Menschen sich anderen Menschen unterordnen, ist eine der ältesten Fragen der politischen Theorie und gehört bis heute zu ihren grundlegenden Themen - menschliches Handeln scheint unausweichlich durch Machtbeziehungen geprägt. Gestellt wird die Frage nach der Macht in den Sozialwissenschaften auf denkbar verschiedene Weise: Was ist Macht überhaupt? Hat sie mit der menschlichen Natur zu tun? In welchen Formen tritt die Macht in Erscheinung? Welche Rolle spielt sie in der Politik? Würde Politik ohne Macht überhaupt funktionieren? Ist Machtausübung immer repressiv? Wie wird Macht im modernen Staat kontrolliert? Diese Fragen behandelt der Einführungsband insbesondere anhand der Konzepte von wichtigen modernen Theoretikern der Macht: Max Weber, Hannah Arendt, Michel Foucault, Niklas Luhmann und Heinrich Popitz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Ähnliche
Andreas Anter
Theorien der Macht zur Einführung
Wissenschaftlicher BeiratMichael Hagner, ZürichIna Kerner, BerlinDieter Thomä, St. Gallen
Junius Verlag GmbH
Stresemannstraße 375
22761 Hamburg
www.junius-verlag.de
© 2012 by Junius Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Florian Zietz
Titelbild: Olympiastadion Berlin
E-Book-Ausgabe September 2018
ISBN 978-3-96060-071-8
Basierend auf Printausgabe
ISBN 978-3-88506-062-8
4., unveränderte Auflage 2018
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Hobbes und seine Vorläufer
1.1 Thukydides und das antike Denken
1.2 Niccolò Machiavelli
1.3 Thomas Hobbes
2. Gut und Böse: Macht und menschliche Natur (I)
2.1 Jacob Burckhardt und Friedrich Nietzsche
2.2 John Actons Skepsis und Montesquieus Ideal
2.3 Funktionale Deutungen
3. Max Weber: Macht und Herrschaft
3.1 Macht als soziale Beziehung
3.2 Macht und Herrschaft
3.3 Macht im modernen Staat
4. Heinrich Popitz: Macht und menschliche Natur (II)
4.1 Anthropologie der Macht
4.2 Stufen von Macht zu Herrschaft
4.3 Ordnungssicherheit der Macht
5. Hannah Arendt: Macht und Gewalt
5.1 Die Potentialität der Macht
5.2 Macht vs. Gewalt
5.3 Macht und Politik
6. Michel Foucault: Im Netz der Macht
6.1 Das Subjekt der Macht
6.2 Die Macht und ihr Widerstand
6.3 Pastoralmacht und Gouvernementalität
7. Niklas Luhmann: Macht als Code
7.1 Macht als Kommunikationsmedium
7.2 Macht und Gewalt
7.3 Die Macht und die Kommunikation der Organisation
Schlussbemerkung
Anhang
Anmerkungen
Siglen
Weitere ausgewählte Literatur
Über den Autor
Vorwort zur 3. Auflage
Die anhaltende Nachfrage nach diesem Band macht eine weitere Auflage erforderlich. Während die zweite Auflage weitgehend unverändert blieb, ist die vorliegende dritte Auflage jetzt überarbeitet und aktualisiert. Dabei wurden einige berechtigte Einwände aus der Kritik sowie neu erschienene Literatur berücksichtigt. Dieser Einführungsband kann weder den verzweigten Spezialdiskursen nachgehen, noch will er einen eigenen Ansatz präsentieren. Vielmehr verfolgt er in erster Linie das praktische Ziel, einen kompakten Überblick über die wichtigsten Theorien der Macht zu geben, die längst zum festen Lehr-Repertoire an sozialwissenschaftlichen Fakultäten gehören.
Andreas Anter
Erfurt, im Februar 2017
Vorwort zur 1. Auflage
Die Theorien der Macht gehören seit jeher zu den klassischen Themen in den Sozialwissenschaften. In den letzten Jahren ist allerdings ein auffällig gestiegenes Interesse zu beobachten, das sich in Publikationen ebenso niederschlägt wie in Lehrplänen und Konferenzthemen. In dieser Lage wächst auch das Bedürfnis, die wichtigsten Konzepte auf einen Blick zur Hand zu haben, zumal bisher eine Einführung fehlte. Dieser Band versucht, einen Anfang zu machen. Er ist aus meiner Vorlesung »Macht und Politik« hervorgegangen, die ich zwischen 2007 und 2011 an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig gehalten habe. Der Text wurde für den Druck überarbeitet, gekürzt und bibliographisch ergänzt; der diskursive Charakter so weit wie möglich beibehalten. Dem machttheoretischen Experten wird dieses Buch nur wenig Neues vermitteln. Es wendet sich an jene, die eine kompakte Einführung in das Thema suchen. Der Band stellt die verschiedenen Konzepte der Autoren und Autorinnen vor, bewertet die einzelnen Ansätze und benennt ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.
Die Sympathien des Verfassers liegen insbesondere bei Heinrich Popitz, dessen unorthodoxer soziologischer Ansatz immer mehr Beachtung findet. Die Seminarvorlesung, aus der Popitz’ Phänomene der Macht hervorgingen, hörte ich bei ihm während meines Studiums an der Universität Freiburg. Sie hat auf mich, wie auf die meisten Hörer, einen bleibenden Eindruck gemacht.
Für Hilfe bei der Literaturbeschaffung wie auch bei der Vorbereitung und Unterstützung meiner zugrunde liegenden Vorlesung danke ich Verena Frick und Armin Gliem. Maja Anter und Harald Homann danke ich für die Lektüre ausgewählter Kapitel; Steffen Herrmann danke ich für seine Beharrlichkeit und Umsicht. Ein Aufenthalt als Fellow am Hanse-Wissenschaftskolleg im Wintersemester 2011/12 ermöglichte die Fertigstellung des Manuskripts.
Andreas Anter
Bremen/Leipzig, im Juni 2012
Einleitung
In Haruki Murakamis Roman Naokos Lächeln wird von einem jungen Mann erzählt, der auf seine Umgebung eine ungewöhnliche Wirkung ausübt: »Sein Wesen brachte andere dazu, sich ihm unterzuordnen, und er verfügte über die Fähigkeit, […] anderen routiniert und präzise Anweisungen zu erteilen und sie mit Freundlichkeit dazu zu bringen, diese auszuführen. Diese Aura von Macht umgab ihn wie ein Heiligenschein, so daß jeder in ihm auf den ersten Blick ›ein Ausnahmewesen‹ erkannte.«1
Jeder macht gelegentlich die Erfahrung, dass manche Menschen in der Lage sind, andere dazu zu bewegen, sich ihnen zu fügen. Doch wissen wir in den seltensten Fällen, worauf diese Fähigkeit beruht. Die Frage, warum Menschen sich anderen Menschen unterordnen, gehört zu den klassischen Fragen der Sozialwissenschaften. Soziale Strukturen und politische Institutionen scheinen unausweichlich durch Machtbeziehungen geprägt. Eine Grundfrage der Sozialwissenschaften lautet: Warum?
Bis heute ist diese Frage jedoch nicht beantwortet. Die Phänomene der Macht gehören zwar zu den prominentesten sozialwissenschaftlichen Gegenständen, aber entschlüsselt sind sie nicht einmal ansatzweise. So ist auch die Macht ein weitgehend ungeklärter Begriff. Jeder versteht darunter etwas anderes. Allein die bunte Vielfalt der Definitionen in der modernen Theoriegeschichte, von Hobbes und Kant über Max Weber und Hannah Arendt bis hin zu Luhmann und Popitz, könnte den Eindruck entstehen lassen, hier spreche jeder von einem anderen Phänomen.
Seit einem halben Jahrhundert gehört es daher in der einschlägigen Literatur zum guten Ton, diese Disparität zu monieren. Entsprechend wird in den vielen Darstellungen konstatiert, es gebe weder einen eindeutigen Machtbegriff noch eine maßgebliche Theorie. Konnte der Soziologe Arnold Gehlen schon vor einem halben Jahrhundert nur resignierend sagen, es gebe keine Theorie, »die als maßgeblich gelten könnte«, so wird noch heute die ungeklärte Lage beklagt.2 Zwischen Unklarheit und Popularität scheint es also einen gewissen Zusammenhang zu geben. Je unklarer die Lage, desto größer die Herausforderung. Max Weber machte schon vor mehr als hundert Jahren deutlich, wie sehr die Sozialwissenschaften auf »klare eindeutige Begriffe« angewiesen sind.3 Dies erweist sich auch bei den Theorien der Macht. Die vielen Versuche, die unternommen wurden, haben indes bisher nur wenig Klarheit bringen können.
Diese Einführung erhebt nicht den Anspruch, einen Gordischen Knoten zu durchschlagen; sie will nur dazu beitragen, sich auf dem Gebiet der Machttheorien etwas besser zurechtzufinden. Dabei stehen drei Fragen im Vordergrund: Worum geht es, wenn von Macht die Rede ist? Welche Machttheorien lassen sich unterscheiden, und wo liegen ihre Vorzüge und Schwächen? Und: Inwieweit haben die Phänomene der Macht mit der menschlichen Natur zu tun? Vor allem der letztere Punkt verweist auf eine generelle Frage: Warum sind menschliche Handlungen, soziale Institutionen und politische Prozesse so offensichtlich unausweichlich machtförmig strukturiert? Es scheint, als sei die Macht eine Bedingung der Möglichkeit von Gesellschaft, als gebe es keine Gesellschaft ohne Machtbeziehungen.
Eben diese Vorstellung gehört seit langem zum Bestand der sozialwissenschaftlichen Theorie. Für den Soziologen Heinrich Popitz ist Macht eine Existenzbedingung jeder sozialen oder politischen Ordnung (PdM, S. 64). Ganz ähnlich argumentiert bereits Hannah Arendt (Va, S. 193). Auch der angloamerikanische Soziologie Michael Mann beginnt seine Geschichte der Macht mit der Feststellung, dass Gesellschaften »aus vielfältigen, sich überlagernden und überschneidenden sozialräumlichen Machtgeflechten« bestehen.4 Aus einer systemtheoretischen Perspektive kommt Niklas Luhmann zu dem gleichen Ergebnis: »Es bilden sich keine sozialen Systeme, ohne daß sich Macht bildet.« (MS, S. 474)
Angesichts dieser Befunde kommt es nicht von ungefähr, wenn das Thema in den Sozialwissenschaften so populär ist. Der britische Philosoph Bertrand Russell meinte schon in den 1930er Jahren, »daß der Fundamentalbegriff in der Gesellschaftswissenschaft Macht heißt im gleichen Sinne, in dem die Energie den Fundamentalbegriff in der Physik darstellt«5. Fundamentalbegriffe aber sind meist umstritten. Noch vor einigen Jahrzehnten war der Machtbegriff Gegenstand von heftigen, ideologisch aufgeladenen Kontroversen. Er gehörte zu den »essentially contested concepts«.6 Die Kontroversen haben sich inzwischen weitgehend gelegt, doch nach wie vor gibt es in der Bewertung von Macht und Machtverhältnissen keinen Konsens. Wer zwei verschiedene Konzepte konsultiert, macht in der Regel die Erfahrung, dass das eine mit dem anderen kaum etwas gemein hat. Oft gehen die Theorien schon an der Wurzel auseinander.
Diese Heterogenität beruht nicht zuletzt auf den sehr verschiedenen Erscheinungsweisen der Macht. Die kleinen, fast mikroskopischen Phänomene kennt jeder aus eigener Erfahrung; sie zeigen sich bereits in alltäglichen Entscheidungssituationen. Wer bestimmt, wann was und von wem gemacht wird? Wer in einem Unternehmen arbeitet und von seinem Chef gebeten wird, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, wird diese Bitte in der Regel nicht als Repression empfinden. Dennoch handelt es sich hier zweifellos um eine Art Machtbeziehung. Die Etymologie ist hier vielsagend. Das deutsche Wort »Macht« geht auf das alt- und mittelhochdeutsche »maht« zurück, das wiederum vom altgotischen Verb »magan« kommt, was so viel wie »machen« oder »können« bedeutet.7 Diese Wortherkunft lässt einen wichtigen Aspekt des Phänomens hervortreten: dass jemand etwas »macht« oder etwas »kann«. Wer etwa in der Politik als »Macher« bezeichnet wird, gehört meist zu jenen, die in der Politik etwas zu sagen haben. In der Politik sind die Anordnungen und Entscheidungen ähnlich wie in einem Unternehmen verbindlich, nehmen dabei aber eine kollektiv verbindliche Form an, auch wenn sie im demokratischen Verfassungsstaat nur äußerst selten in Form autoritärer Befehlsgewalt auftreten.
So gibt es kaum eine politische Theorie, die sich nicht mit den Phänomenen der Macht auseinandersetzen würde. Dies beruht zum einen auf der Präsenz der Machtphänomene in der Politik, zum anderen auf der damit verbundenen Aufmerksamkeit der Politikwissenschaft für die Fragen der Macht. Nach einer verbreiteten, nahezu klassischen Auffassung besteht Politik ganz wesentlich aus dem Streben nach Macht. Politische Prozesse sind nach dieser Sichtweise in erster Linie Machtprozesse. Die Komplexität des Machtphänomens steigert sich noch einmal dadurch, dass nicht jeder in gleicher Weise auf eine Machtsituation reagiert. Manche Menschen ordnen sich verhältnismäßig gern unter; andere können es nicht ertragen, sich fügen zu müssen. Entsprechend unterschiedlich fallen die Bewertungen der Macht aus. Die einen scheinen mit der Macht regelrecht verheiratet zu sein und werden nicht müde, ihre Vorzüge zu preisen; den anderen ist jede Form von Macht verhasst. Sie hat, wie der Soziologe Rainer Paris sagt, »sehr verschiedene Formen und Ausprägungen, mit denen sich höchst unterschiedliche Motive, Auswirkungen und Leidensqualitäten verbinden«8.
In einem sehr allgemeinen Sinne kann man Macht als die Fähigkeit verstehen, Einfluss auf seine Umgebung zu nehmen, die Dinge so zu beeinflussen, wie man sie gern hätte. In diesem Sinne argumentiert die bis heute prominenteste Machtdefinition: Max Weber definiert die Macht als die »Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht« (WuG, S. 28). Diese Definition, die seit achtzig Jahren auf die gesamte Machtliteratur eine bannende Wirkung ausübt, wird entsprechend in diesem Band häufiger zur Sprache kommen.
Um sich einen Überblick über die verschiedenen Machtkonzepte zu verschaffen, kann man unterschiedliche Zugänge wählen. Eine verbreitete Möglichkeit ist, die Konzepte nach ihrer jeweiligen Systematik vorzustellen, die einer informativen Darstellung in der Regel zugrunde liegt.9 In der Tat sind Aussagen über die Macht erst aufgrund einer Beobachtung ihrer Wirkungen und Formen möglich. So unterscheidet der italienische Soziologe Gianfranco Poggi drei Formen sozialer Macht: ökonomische, normativ-ideologische und politische Macht,10 während Heinrich Popitz vier »anthropologische Grundformen der Macht« formuliert: Verletzungsmacht, instrumentelle Macht, autoritative Macht und datensetzende Macht.11 Ein duales Modell findet sich demgegenüber bei dem amerikanischen Politikwissenschaftler Joseph S. Nye; er unterscheidet zwischen einer soft power, die ihre Ziele durch Einflussnahme erreicht, und einer hard power, die sich mit Zwangsmitteln durchsetzt.12 Noch prominenter ist das duale Modell seiner Kollegin Hanna F. Pitkin wie auch ihrer Kollegen Keith Dowding und Gerhard Göhler. Sie unterscheiden zwischen zwei Machtarten: power over (die Macht über andere Personen) und power to (die von anderen Personen unabhängige Fähigkeit, irgendetwas zu tun).13 In der Tat kann man die meisten Machtkonzepte einer dieser beiden Seiten zuordnen. Allerdings ist der Ausdruck power over insofern tautologisch, als man Macht nie per se hat, sondern ohnehin immer nur über etwas bzw. über jemanden. Sie ist immer etwas Relationales. Zudem kann sie nur dann wirksam sein, wenn das nötige Potential bereits vorhanden ist; sie existiert erst dann, wenn sie in einer sozialen Beziehung realisiert wird. Daher bietet sich eine alternative Unterscheidung an: zwischen »transitiver Macht«, »die den eigenen Willen auf andere überträgt und auf diese Weise Einfluss nimmt«, und »intransitiver Macht«, »die in sich selbst, in der Gesellschaft erzeugt und aufrechterhalten wird«14.
Die genannten Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die methodischen Zugänge zu den Machtphänomenen sind. Der Nachteil einer Darstellung der verschiedenen Konzepte nach ihrer unterschiedlichen Systematik wäre jedoch eine gewisse Redundanz, da viele Konzepte sich überschneiden. Zudem würde man ihren jeweiligen Entstehungskontexten nicht gerecht werden. Die vorliegende Einführung wählt daher eine ideengeschichtlich orientierte Darstellungsweise. Sie eignet sich am besten für eine kompakte Darstellung der einzelnen Theorien wie auch ihrer Bezüge und Entwicklungslinien.
Heute halten wir die »geschichtliche Bedingtheit« von Begriffen (Otto Brunner) für etwas Selbstverständliches. Wenn Thomas Hobbes von Macht spricht, argumentiert er in einem bestimmten Kontext und meint womöglich etwas anderes, als wenn beispielsweise Niklas Luhmann von Macht redet. Die ideengeschichtliche Methode ist in den deutschsprachigen und angelsächsischen Geisteswissenschaften daher generell sehr verbreitet. Sie fragt danach, welche Machttheorien in den unterschiedlichen Epochen konzipiert wurden und in welchem genealogischen Zusammenhang sie untereinander stehen. Besonders deutlich zeigt sich diese historische Perspektive etwa im Handbuch Geschichtliche Grundbegriffe; der Artikel »Macht« ist dort mit 120 Seiten umfangreicher als manches Buch.15 Ganz ähnlich, wenn auch deutlich kürzer, ist der Artikel »Macht« im Historischen Wörterbuch der Philosophie angelegt.16
Die Frage ist nur: In welcher Weise hat sich das Machtverständnis gewandelt? Zwei charakteristische Entwicklungen treten in den folgenden Kapiteln hervor: zum einen der – wenn auch nicht immer konstante – Versuch, verschiedene Formen der Macht zu unterscheiden, um zu einem differenzierteren Machtverständnis zu kommen; zum anderen das fortgesetzte Bemühen, Macht und Gewalt stärker voneinander abzugrenzen, um ihre unterschiedliche Wirkung, aber auch ihr gegenseitiges Verhältnis präziser zu bestimmen.
1. Hobbes und seine Vorläufer
1.1 Thukydides und das antike Denken
Den Beginn des abendländischen Machtdenkens datiert man gewöhnlich bei Thukydides, dem antiken griechischen Geschichtsschreiber (ca. 460 bis ca. 398 v. Chr.). Seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges, mit der die Geschichtsschreibung überhaupt ihren Anfang nimmt, ist berühmt geworden durch ihre präzisen Beobachtungen und nüchterne Darstellungsweise, in der die beteiligten Kriegsparteien zu Wort kommen; Strategien der Kriegsführung und menschliche Natur, Angriff und Verteidigung, Bündnis und Verrat. Für das Thema Macht ist insbesondere der sogenannte Melier-Dialog wichtig. Die antike Großmacht Athen belagert in ihrem Krieg gegen die Großmacht Sparta das kleine Melos in der Ägäis, um es zur Aufgabe seiner Neutralität zu zwingen. Die Athener begründen ihren Machtanspruch gegenüber den Meliern mit der Drohgebärde des Stärkeren, aber auch mit einer Art anthropologischem Argument. Sie sagen: »wir folgen nur der menschlichen Natur, wenn wir eine Herrschaft, die sich uns anbot, angenommen haben und behalten wollen«; »es ist immer so gewesen, daß der Mindere sich dem Mächtigeren fügen muß«17.
Auch wenn Thukydides an dieser Stelle nur die Stimme einer Kriegspartei wiedergibt, widerspricht sie doch nicht seiner Auffassung über die menschliche Natur. Diese Natur folgt den Gesetzen der Macht. Was der Stärkere diktiert, hat der Schwächere zu befolgen. Dies scheint sich im Schicksal der Melier zu bestätigen: Nachdem sie sich den Forderungen der Athener verweigern, werden sie von den Athenern erobert, die Männer werden getötet, die Frauen und Kinder als Sklaven verkauft. Politik ist für Thukydides ein unerbittlicher Machtkampf, in welchem sich der Stärkere behauptet. Darin ist die Politik ein Spiegel der menschlichen Natur. Wenn es bei ihm eine Anthropologie gibt, dann steht die Macht in ihrem Zentrum. Zur menschlichen Natur gehört bei Thukydides aber auch das Mehr-haben-Wollen, die Pleonexie (πλεονεξια), die sich in der Politik als Mehr-Macht-haben-Wollen niederschlägt. Thukydides hält diesen Trieb für schädlich. Dies kommt in der Dramaturgie seiner Schilderung zum Ausdruck: Nachdem die Athener gegenüber den Meliern noch rigoros vom Recht des Stärkeren Gebrauch gemacht haben, gerät ihre Expedition nach Sizilien zu einer Katastrophe. Der Peloponnesische Krieg, der über drei Jahrzehnte dauerte, endet schließlich mit dem Untergang Athens, der einst imperialen Macht.
Die ideengeschichtliche Bedeutung der Geschichte des Peloponnesischen Krieges liegt nicht zuletzt darin, dass Thukydides das Machtproblem als Erster formuliert, mit einer bis heute anhaltenden Wirkung. In seinem Plädoyer für eine nüchterne und illusionslose Betrachtung der Realität findet er viele spätere Bewunderer. Besonders laut rühmt Friedrich Nietzsche seinen »unbedingten Willen, sich nichts vorzumachen«; er preist Thukydides als »Offenbarung jener starken, strengen, harten Tatsächlichkeit« der älteren Hellenen.18 Thukydides schreibt indes keinen Ratgeber für Machthaber und ist kein antiker Machiavelli. In seinem Plädoyer für eine realistische Sichtweise ist er eher ein Hans J. Morgenthau avant la lettre. Eindringlich schildert er die Grausamkeit des Krieges, der die Natur des Menschen besonders klar hervortreten lässt und sich als »gewalttätiger Lehrer« erweist.19
Das Echo seiner Vorstellung von einer gleichbleibenden menschlichen Natur, die von einem Willen zur Macht regiert wird, hallt indes über Jahrtausende nach und findet sich in den meisten Machttheorien wieder, nicht zuletzt bei Nietzsche. Auch die Vertreter der Realistischen Schule, vor allem der amerikanische Politikwissenschaftler Hans J. Morgenthau, waren erklärte Thukydides-Schüler. Die in der amerikanischen Politik ungemein einflussreiche Schule wandte sich in den 1940er und 1950er Jahren strikt gegen eine idealistische Betrachtung der internationalen Politik und plädierte für eine realistische Sichtweise. Dabei berief sie sich nicht nur auf das anthropologische Argument, dass die menschliche Natur stets nach Macht strebe, sondern auch auf Konzepte klassischer politischer Denker wie Thukydides.20 Die heutigen imperialen Mächte formulieren ihre machtpolitischen Interessen in der Regel allerdings weit euphemistischer als ihre hellenischen Vorgänger.
Der harte, illusionslose Realismus, den Nietzsche an Thukydides so liebt, findet in der antiken Philosophie sein Gegenstück bei Platon (428/27 bis 348/47 v. Chr.). Der Gegensatz könnte kaum größer sein. Während Thukydides sich auf einen realistischen Standpunkt stellt und das Machtstreben, wenn auch nicht die Machthybris, als notwendigen Bestandteil der Politik begreift, will Platon sie auf das Ideal der Gerechtigkeit verpflichten. In den Nomoi bindet er sie an die Herrschaft der Gesetze. In der Politeia kontrastiert er die beiden konträren Konzepte: Während Sokrates auf dem sittlichen Charakter der Macht beharrt, vertritt Thrasymachos die sophistische Ansicht, das Recht sichere nur den Vorteil des Mächtigen; Gerechtigkeit sei ein relativer Begriff; gerecht sei, was dem Mächtigen nützt.21 In dieser Auseinandersetzung sind die Rollen insofern ungleich verteilt, als es Sokrates nicht schwerfällt, die sophistische Haltung zu widerlegen und sich durchzusetzen. Zudem wissen wir über Thrasymachos nur das, was durch Platon überliefert ist; er führt außerhalb des Platonischen Dialogs kaum eine philologische Existenz. Die Konstellation indes ist ideengeschichtlich bedeutsam, da Platons gesamte politische Philosophie als Auseinandersetzung mit dem sophistischen Machtdenken verstanden werden kann. Bereits in seinem Frühwerk, im Gorgias (nach 399 v. Chr.), begegnen wir der Kritik der sophistischen Rhetorik. Für Gorgias wie seinen Schüler Kallikles ist die Rhetorik eine instrumentelle Machtechnik: eine Kunst des Herrschens.22
Einen weiteren Paradigmenwechsel im antiken Machtdenken markiert Paulus’ Römerbrief (ca. 56 n. Chr.), da er die Quelle der Macht transzendent verortet und überdies mit einer Gehorsamsempfehlung verbindet. Er schreibt an die römische Gemeinde: »Jedermann soll den übergeordneten Gewalten untertan sein. Denn es gibt keine Gewalt außer von Gott.« (Röm. 13, 1) Mit dieser politischen Theologie legitimiert er jede politische Machtordnung als gottgewollt. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass Paulus beim Verfassen des Römerbriefs die spezifische Situation der christlichen Gemeinde im römischen Reich vor Augen hat, beschwört er auch für spätere Zeiten ein existenzielles Problem für jene Christen herauf, die sich einer tyrannischen Herrschaft, die gegen Gottes Gebote verstößt, nicht unterwerfen wollen. Folgt man der paulinischen Theologie, dann wäre ihnen jeder Widerstand verwehrt.
Nach dem Siegeszug des Christentums in der Spätantike und seiner universellen Durchsetzung als abendländischer Religion blieb das theologisch-politische Problem der Macht unvermindert aktuell. Es wurde insbesondere im mittelalterlichen Konflikt zwischen Kaiser und Papst virulent. Die beiden rivalisierenden Mächte versuchten ihren jeweils absoluten Machtanspruch auch theologisch zu legitimieren. Marsilius von Padua (ca. 1290 – ca. 1342) stellte sich auf die Seite des Kaisers und legitimierte dessen weltlichen Machtanspruch mit einem theologischen Argument: Da Gott der Ursprung der Macht und diese unteilbar sei, gebe es neben der weltlichen Macht kein Recht auf eine eigenständige, separat legitimierte kirchliche Macht. Eine »geistliche Macht« sei daher eine contradictio in adiecto; sie habe sich der weltlichen Gewalt unterzuordnen.23 Dieser Konflikt wurde indes nicht theologisch gelöst, sondern durch die historisch-politische Entwicklung, in deren Folge sich die weltliche Macht gegenüber der kirchlichen durch militärische Überlegenheit durchsetzte.
1.2 Niccolò Machiavelli
Das theologische Problem der Macht tritt bei Niccolò Machiavelli (1469–1527) ganz aus dem Blickfeld. Der Florentinische Staatssekretär und Schriftsteller, bis heute der schillerndste Denker der Macht, interessiert sich weder für die Frage ihrer theologischen Legitimation noch für ihre philosophische Begründung, sondern allein für ihre Wirkungen. Machiavelli ist gewissermaßen ethisch unmusikalisch. Auch mit begrifflichen Erörterungen der Macht hält er sich nicht auf. Allerdings ist auch bei ihm zu erkennen, dass sein Machtdenken auf bestimmten Annahmen über die menschliche Natur beruht. Er meint, die Menschen begnügten sich nicht mit dem, was sie haben, sondern streben danach, »anderen ihren Willen aufzuzwingen«24. Aus dieser Pleonexie, die bereits bei Thukydides beschrieben wird, resultieren für Machiavelli auch die steten Probleme der Herrschaftssicherung. Hierzu ist wiederum die Macht das entscheidende Mittel: Angriff ist die beste Verteidigung.
Der funktionale Charakter der Macht tritt bei Machiavelli überall hervor. Seine berühmt-berüchtigte Schrift Il Principe, zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht, ist ein Macht-Ratgeber für den Fürsten, der sich darum bemüht, nach seiner Machtübernahme seine Macht dauerhaft zu behaupten.25 Anhand von historischen Beispielen erläutert Machiavelli in lakonischen Worten, welche Regeln der Fürst beherzigen sollte, um einen Machtverlust zu vermeiden. Der kalkulierte und strategische Einsatz von Gewalt ist für Machiavelli ein legitimes, wenn nicht notwendiges Mittel des Herrschers, um seine Machtposition zu sichern. Für Machiavelli, der die Gewalt kühl legitimiert, gibt es nur gut und schlecht angewandte Gewalt. Sie ist gut, wenn sie zur Machtsicherung eingesetzt wird und auf diesen Zweck beschränkt bleibt, also kein Dauerzustand wird (DF, S. 38). Sie ist schlecht, wenn sie dieses Ziel verfehlt.
Für Machiavelli kommt es auf das taktische Geschick des Herrschers an. Er empfiehlt, in einer berühmten Formulierung, dass der Herrscher »alle Gewalttaten, die er nicht umgehen kann, […] alle auf einen Schlag ausführen sollte, damit er nicht jeden Tag von neuem damit zu beginnen braucht […] Gewalttaten muß man alle auf einmal begehen, damit sie weniger empfunden werden und dadurch weniger erbittern. Wohltaten dagegen muß man nach und nach erweisen, damit sie nachhaltiger wirken.« (DF, S. 39) In seinem Principe beschreibt Machiavelli mit nüchternen Worten, wie sich der Herrscher notfalls durch Gewalt und Betrug aus einer misslichen Lage befreien kann. Seine Beschreibungen sind, auch in ihrem Duktus, deutlich vom Bild der altrömischen Diktatur geleitet. Warum aber die Empfehlung zu grausamem Handeln? Der Grund ist ein strategischer. Machiavelli sagt, man könne natürlich auch tugendhaft handeln und sich an Empfehlungen orientieren, wie sie damals in den klassischen Fürstenspiegeln gegeben wurden. Aber für den Herrscher sei es gar nicht ratsam, sich auf Prinzipien festzulegen. Erst recht dürfe er nicht versuchen, »gut« zu sein, denn dann sei er für seine Gegner viel zu berechenbar. Ein Herrscher müsse in der Wahl seiner Mittel immer flexibel bleiben.
Diese Theorie der Macht war in erster Linie ein Vademecum für eine erfolgreiche politische Machtbehauptung, eine »Technik von Machterwerb und Machtbewahrung für beliebig einzusetzende Zwecke«26. Dabei beschränken sich Machiavellis Empfehlungen allerdings auf einen ganz bestimmten Typus politischer Gemeinschaften, nämlich auf Monarchien, die nicht ererbt, sondern neu erworben sind, und zwar durch »glückliche Umstände«.





























