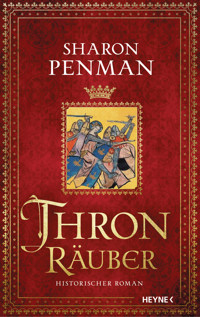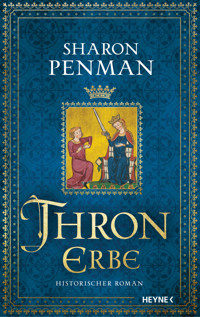
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Plantagenet-Saga
- Sprache: Deutsch
Der zweite Teil des großen Plantagenet-Epos: Akribisch recherchiert und mitreißend erzählt
England, 1147. Die Schlacht um die englische Krone tobt inzwischen seit mehr als einem Jahrzehnt. Weder Kaiserin Maude, die rechtmäßige Erbin König Henrys I., noch Stephen von Blois, ihr Cousin und erbitterter Widersacher, wollen von ihrem Thronanspruch ablassen. Doch als in einer schicksalsträchtigen Nacht Maudes Halbbruder und wichtigster Heerführer einem Fieber erliegt, gewinnt Stephens Feldzug an Fahrt. Die letzte Hoffnung ruht jetzt auf Maudes Sohn, der inzwischen zu einem echten Recken herangewachsen ist – und fest entschlossen scheint, den Thronanspruch seiner Familie ein für allemal durchzusetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 870
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Es ist mehr als eine Schmach für Kaiserin Maude, als sie unverrichteter Dinge nach Anjou zurückkehren muss. Mit dem Tod von Robert von Gloucester hat sie nicht nur ihren Heerführer und einen der wichtigsten Verfechter ihres Thronanspruchs verloren, sondern auch ihren Halbbruder. Ihre verbliebenen Anhänger führen den Feldzug fort, doch die fehlende Präsenz der rechtmäßigen Königin schwächt ihre Position, und Stephen von Blois reißt mehr und mehr Territorium des Inselreichs an sich.
Erst als Maudes Sohn Henry die Bühne betritt, scheint sich das Blatt zu wenden. Über die Jahre ist er zu einem kühnen Strategen herangewachsen: selbstbewusst und souverän, schlagfertig, aber wohlerzogen. Es verstreicht nicht viel Zeit, bis er sich einen festen Platz im Rampenlicht der anglofranzösischen Machtspiele verschafft hat. Als er bei Verhandlungen auf Eleonore von Aquitanien trifft, beschließt Henry, seine Eroberungspläne noch auszuweiten: Er will die englische Krone für seine Familie gewinnen – und die Liebe der französischen Königin für sich.
Sharon Penman
THRONERBE
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Julian Haefs
Die Originalausgabe WHENCHRISTANDHISSAINTSSLEPT (Seite 393-746) erschien erstmals 1995 bei Henry Holt & Co, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 1995 by Sharon Penman
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung © Nele Schütz Design unter Verwendung von Universitätsbibliothek Heidelberg (Codex Manesse Blatt 182r) https://digi.ub.uni-heidelberg.de/touch/cpg848/#page/367; Shutterstock.com (Hein Nouwens, lookus, Devotion, Hein Nouwens)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33744-5V001
www.heyne.de
Für Valerie Ptak LaMont
DramatisPersonae (Historische Figuren)
Henry I. – König von England und Herzog der Normandie, herrschte von 1100 bis 1135, Sohn von Wilhelm dem Eroberer, zu Lebzeiten bekannt als Wilhelm der Bastard
Adeliza – Henrys deutsche Witwe, Gemahlin des Wilhelm d’Aubigny, Graf von Arundel
Maude – Henrys Tochter und Erbin, Witwe des deutschen Kaisers Heinrich und Gemahlin des Geoffrey Plantagenet, Graf von Anjou
Ihre Söhne: Henry, Geoffrey, William
Robert Fitz Roy – Graf von Gloucester, Maudes unehelicher Bruder
Amabel – Gräfin von Gloucester, seine Frau
Rainald Fitz Roy – Graf von Cornwall, Maudes unehelicher Bruder
Ranulf Fitz Roy – Maudes unehelicher Bruder, fiktiv
Stephen – Graf von Mortain und Boulogne, Neffe von Henry I.
Matilda – Erbin von Boulogne, Stephens Gemahlin
Ihre Kinder: Baldwin, Matilda, Eustace, William, Mary
Henry von Blois – Bischof von Winchester, Stephens jüngerer Bruder
Theobald – Graf von Blois und Champagne, Stephens älterer Bruder
Randolph de Germons – Graf von Chester
Maud – Gräfin von Chester, seine Gemahlin sowie Tochter von Robert Fitz Roy
David – König von Schottland, Onkel sowohl von Maude als auch von Matilda
Louis VII. – König von Frankreich
Eleonore – Herzogin von Aquitanien, seine Königin
Constance – Louis’ Schwester, schon als Kind mit Stephens Sohn Eustace verheiratet
Petronilla – Gräfin von Vermandois, Eleonores jüngere Schwester
William de Ypres – flämischer Söldner, unehelicher Sohn des Grafen von Ypern
Brien Fitz Count – Herr von Wallingford, unehelicher Sohn des Herzogs der Bretagne
Miles Fitz Walter – Graf von Hereford
Simon de Senlis – Graf von Northampton
Geoffrey de Mandeville – Graf von Essex
Waleran Beaumont – Graf von Meulan
John Marshal – Herr von Marlborough
Baldwin de Redvers – Graf von Devon
William de Roumare – Graf von Lincoln, Bruder des Grafen von Chester
Rhodri ap Rhys – Ranulfs walisischer Onkel
Rhiannon und Eldri – Ranulfs walisische Vettern
Annora de Bernay – Ranulfs Verlobte
Ancel de Bernay – ihr Bruder und Ranulfs Freund
Gilbert Fitz John – Ranulfs Freund
Vorwort
Ich wage zu behaupten, dass viele von uns nicht die besten Erinnerungen an den Geschichtsunterricht besitzen, ihn bestenfalls als trocken, schlimmstenfalls als irrelevant erlebt haben.
Trotz der Anstrengungen der Lehrkräfte führt eine unselige Allianz aus überholten Lehrplänen, fehlenden Stunden und überfüllten Klassenzimmern oft dazu, dass am Ende nur Fragmente hängen bleiben, einzelne Teile im großen Puzzle der Geschichte, ohne Zusammenhang und ohne Verbindung zu uns und unserem Leben heute: Kriegsschauplätze auf nicht mehr existierenden Landkarten, Gräber im Sand, Namen unter staubigen Ölgemälden oder Gipsköpfen anstatt Menschen, die irgendwann einmal geatmet, gelacht, geliebt und gelitten haben.
Die Wissenschaft zieht sich gerne auf die Sicherheit nackter Zahlen und eindeutig belegbarer Fakten zurück und vermeidet allzu »gefühlige« Deutungen – ein Umstand, den ich bei meiner früheren Arbeit als Archäologin oft bedauert habe. Diese zweifellos berechtigte, aber auch sehr distanzierte und nüchterne Annäherung an die Vergangenheit macht sie gerade für interessierte Laien schwer verdaulich oder ganz und gar unzugänglich.
Dabei wäre es meines Erachtens so wichtig, unsere Geschichte als eine große zusammenhängende und fortlaufende Erzählung der Menschheit und Menschlichkeit zu vermitteln, von der wir ein Teil sind, aus der wir lernen und uns entwickeln und die wir mit jedem Augenblick fortschreiben.
Die 40 000 Jahre alte Steinzeitkarikatur an der Höhlenwand, die römische Grabinschrift, welche die Trauer eines Vaters um sein Kind dokumentiert, die Worte einer mittelalterlichen Dichterin, die die Augen des Geliebten in leuchtenden Metaphern preist – all das sind Ariadnefäden durchs Labyrinth der Vergangenheit, die uns mit den Menschen von damals verbinden. Weil Emotionen wie Humor, Trauer oder Liebe als universelle Sprache über Raum und Zeit hinweg funktionieren.
Und das ist vermutlich auch der Grund, warum historische Romane uns so begeistern. Sie übersetzen Urkunden, Ruinen, Knochen, totes Material in eine Sprache, die wir alle verstehen, in eine Sprache des Mitgefühls. Sie machen Namen zu Menschen, deren Schicksale uns mitreißen und zutiefst berühren.
Sharon Penman beherrscht diese Sprache fließend. Sie versteht es nicht nur, die großen Namen des anglonormannischen Mittelalters aufzuerwecken, für uns nahbar und menschlich zu machen, sondern sie haucht auch den vermeintlichen Randfiguren der Geschichte Leben ein – und zwar auf eine Art, die nicht nur eine papierdünne, einseitig bemalte Kulisse, sondern eine ganze Welt vor unseren Augen entstehen lässt. Ihre Frauenfiguren, allen voran Königserbin Maude, die sie als überaus kluge, ehrgeizige, gleichzeitig aber fehlbare und zweifelnde Herrscherin in den Fokus ihres Romans rückt, sind das beste Beispiel dafür.
Wer sich mit der Historie befasst, wird unweigerlich feststellen, dass die alten Chroniken, aber auch die Geschichtswissenschaften voller patriarchaler Geschlechterklischees stecken und mit mächtigen, ambitionierten und klugen Frauen der Vergangenheit häufig sehr hart ins Gericht gehen (Eleonore von Aquitanien, eine der wenigen Frauen, die es geschafft haben, sich nicht zur Marginalie in den mittelalterlichen Urkunden schrumpfen zu lassen, könnte ein Lied davon singen). Und lassen sich die Verdienste einer Frau nicht unter den Teppich der Geschichte kehren, wird rasch alles ins rechte Licht gerückt, indem man der besagten Dame »einen männlichen Charakter« zuspricht. So entsteht der verzerrte Eindruck, dass Frauen und ihr Wirken in der Vergangenheit eine nebensächliche, wenn nicht unbedeutende Rolle spielen. Leider wird dieses Bild auch in historischen Romanen häufig unreflektiert reproduziert und trägt dazu bei, dass sich Klischees und Fehldeutungen in den Köpfen der Lesenden festsetzen, ja geradezu eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt wird.
Umso größer ist das Verdienst von Sharon Penman, die den Frauen der Geschichte den Platz einräumt, den sie zweifellos verdienen. Nicht, indem sie sie als die »besseren Männer« glorifiziert, sondern sie als gleichbedeutende handlungsstarke Persönlichkeiten mit Hoffnungen und Wünschen, Fehlern und Schwächen zeigt, die ihre Zeit und ihr Umfeld wesentlich beeinflusst und mitgestaltet haben.
Diese Herangehensweise macht Sharon Penman für mich als Autorin zu einem Vorbild und ihre Werke zu einem Must-have im Bücherregal, zumal wenn sie so einfühlsam ins Deutsche übertragen wurden wie in diesem Fall durch Julian Haefs geschehen. Wer sich nicht mit Fragmenten zufriedengeben will, wird bei Sharon Penmans »Thronerbe« ein farbenprächtiges, berührendes und sorgsam zusammengesetztes Puzzle vorfinden, mit dem sie uns gekonnt durch das Labyrinth der Vergangenheit führt und die großen Namen der Geschichte zu neuem Leben erweckt.
Juliane Stadler
»Die Armen starben an Hunger … Nie war ihre Not größer gewesen, nie hatten die Heiden so schlimm gewütet wie viele Christen in diesen Tagen.«
Aus der Peterborough Chronicle
Kapitel I
Juni 1143Sechs Monate nach dem Ende des Ersten Bands
Burg Devizes, England
Der Juni meinte es gut mit Maude; ihr Sohn war abermals zu Besuch in Devizes. Seine Aufenthalte dauerten nie lange genug, immer sehnte sie sich nach mehr, aber Jungen in Henrys Alter gehörten nun einmal nicht mehr an die Seite ihrer Mütter. Nur ein Mann konnte ihm dabei helfen, wohlbehalten zu den fernen Gestaden des Mannesalters zu navigieren. So sahen es zumindest die Gesellschaft und die Kirche. Maude hatte sich widerwillig gefügt und Henry in die Obhut ihres Bruders gegeben, denn Mutterschaft musste hinter Königswürde zurückstehen. Was immer sie tun oder durchleiden oder opfern musste, alles würde sich bezahlt machen – an dem Tag, da man Henry die geraubte Krone aufs Haupt setzte. Daran durfte sie nicht zweifeln.
An diesem schwülen Junisamstag hatten Ranulf und Hugh de Plucknet Henry mit auf die Jagd in den Königsforst von Melksham genommen. Sie kehrten erst mit der Abenddämmerung zurück, schmutzig, schweißverklebt, erschöpft und triumphierend. Es war Henrys erste richtige Jagd gewesen, und er berichtete dermaßen enthusiastisch davon, dass sein Publikum bald begriff, Zeuge der Geburtsstunde einer lebenslangen Passion zu werden. Einer seiner Pfeile hatte dazu beigetragen, einen Hirsch zu erlegen, und mit jeder neuen Erzählung wurden die Enden des Geweihs zahlreicher und ehrfurchtgebietender. Maude hörte geduldig zu, wie er die Jagd für sie noch einmal durchlebte, die Bracken pries, die Verfolgung schilderte und detailliert den Augenblick beschrieb, in dem sie ihre Beute gestellt hatten. Als er aber zu beschreiben anfing, wie ein erfahrener Fährtenleser die Größe eines Hirschs anhand der Form seiner Hinterlassenschaften ermittelte, gebot Maude ihm Einhalt.
»Hirschköttel? Das erklärt, warum du so streng riechst«, sagte sie, und Henry grinste, denn dreckig zu sein, war Teil des Vergnügens. »Los, geh und wasch dich, danach kannst du zurückkommen und mich in die Mysterien des Hirschdungs einweihen«, versprach sie.
Henry fing an, gut gelaunt über sein Bad zu murren, um eine schnellere Säuberung herauszuhandeln, gab aber schließlich klein bei, als Ranulf sich auf Maudes Seite schlug.
»Du brauchst nicht zu baden – solange du beim Abendessen windabwärts von uns sitzt, Harry«, schlug er vor, und Henry grinste schon wieder, denn er war nun alt genug, um über sich selbst zu lachen.
Maude aber drehte sich überrascht zu ihrem Bruder um. »›Harry‹?«, wiederholte sie. »Wo kommt das denn her?«
»Hast du es deiner Mutter noch nicht gesagt, Junge? Er möchte von jetzt an Harry genannt werden.«
Wie Henry befürchtet hatte, zogen sich die Brauen seiner Mutter zu einem missbilligenden Stirnrunzeln zusammen, und er sagte hastig: »Warum nicht, Mama? Ich konnte Henry noch nie leiden – es klingt wie der Name eines Priesters oder … oder wie der Gaul eines Krämers. Es ist einfach kein heldenhafter Name. Harry mag ich viel lieber, und so sprechen die Engländer Henry aus, und wenn ich König der Engländer werden soll, sollte ich ja auch einen englischen Namen haben, außerdem …« An dieser Stelle brach er ab, da ihm zwar nicht die Argumente, wohl aber die Luft ausgegangen war. Ehe er sich sammeln konnte, schüttelte Maude den Kopf.
»Du bist als Henry getauft und wirst Henry bleiben. Spitznamen sind würdelos.«
Ranulf machte den Mund auf, hielt dann aber inne. Henry war weniger vernünftig. Seine Enttäuschung war zu bitter, um sie einfach zu schlucken. Stattdessen wandelte er sie in Wut um und erklärte anklagend: »Das ist ungerecht! Es ist mein Name, nicht deiner!«
»So ist es«, pflichtete Maude ihm kühl bei, »aber es ist auch so, dass du zehn Jahre alt bist. Sobald du erwachsen bist, kannst du dich nennen, wie du willst. Bis dahin musst du dich mit Henry begnügen.«
Der trotzige Blick ihres Sohnes war mittlerweile ein allzu vertrauter Anblick. »Das ist ungerecht«, wiederholte er, diesmal aber nicht als Beschwerde, sondern als Herausforderung, und als Maude keine Anzeichen erkennen ließ, einzulenken, drehte er sich auf dem Absatz um und warf auf dem Weg zur Tür absichtlich einen Stuhl um. Weit kam er nicht. Die Stimme seiner Mutter ließ ihn erstarren.
»Henry, ich dulde so ein rüpelhaftes Benehmen nicht, das weißt du genau. Geh und nimm dein Bad – auf der Stelle!«
Ranulf hatte erstaunt zugesehen, und sobald Henry verschwunden war, gab er zu: »Das ist das erste Mal, dass ich den Jungen so an die Decke habe gehen sehen. Ist das schon mal vorgekommen?«
»Leider ja. Einmal hat er einen Krug zerbrochen, als er seinen Kopf nicht durchsetzen konnte.«
»Soso … hat er also doch seinen Anteil des berüchtigten angevinischen Temperaments geerbt.«
»Temperament lässt sich beherrschen. Geoffrey beherrscht seines. Nein, Ranulf, diese Wutanfälle sind kein Erbe des befleckten Blutes. Henry hat nie zu Wutausbrüchen geneigt – nicht, solange er in meiner Obhut war. In meiner Abwesenheit sind sie wie Unkraut gesprossen und haben Wurzeln geschlagen, sobald er begriffen hat, wie gut sie funktionieren. Wahrscheinlich war das zu erwarten. Geoffrey war mit seinen Söhnen schon immer zu nachsichtig, und während er in der Normandie Krieg geführt hat, gab es kaum jemanden, der zu Henry oder seinen Brüdern zwischendurch einmal ›Nein‹ sagen konnte. Ein weiterer Grund, warum ich zugestimmt habe, Henry in Roberts Obhut zu geben, denn ich weiß, dass Robert Ungehorsam oder absichtlichen Unfug niemals durchgehen lassen würde.«
»In der Tat«, stimmte Ranulf reumütig zu und dachte an seine eigene Lehrzeit unter Roberts Vormundschaft; sein Bruder war noch mehr auf Zucht und Ordnung bedacht als Maude und hatte keinerlei Verständnis für Albernheiten. »Wenn irgendwer dem Jungen den Kopf zurechtrücken kann, dann Robert. Aber wenn du mir meine Einmischung verzeihst, ich finde, mit dem Namen warst du zu hart zu ihm. Was schadet es denn, wenn er sich Harry nennt? Hast du nie deinen Namen ändern wollen? Ich auf jeden Fall!«
»Wirklich?« Maude klang so verblüfft, dass ihm klar wurde, dieser besondere Kindheitswunsch musste gänzlich an ihr vorbeigegangen sein. »Wie wolltest du denn heißen?«, fragte sie neugierig.
Ranulf zögerte. »Das erzähl ich dir nur, wenn du versprichst, nicht zu lachen. Ich war so überwältigt von den Heldentaten im Rolandslied, dass – Maude, du lachst ja doch!«
»Nein, tu ich nicht«, sagte sie, was weder der Wahrheit entsprach noch besonders überzeugend klang. »Roland Fitz Roy … Ich kann mir kaum vorstellen, dass unser Vater das gebilligt hat.«
»Du glaubst ja wohl nicht, dass ich Papa je gefragt habe? Nein, das war, als ich als Page in Stephens Haushalt gedient habe, und wenn ich mich recht entsinne, hat Stephen mich sicher zwei Wochen lang Roland genannt – und zwar, ohne eine Miene zu verziehen –, bis diese Laune vorüber war.«
»Das kann ich mir denken«, sagte Maude spitz und verstummte dann.
Ranulf hoffte, dass sie über seine Worte nachdenken würde. Wenn Geoffrey lernen musste, Henry zu zügeln, musste sie ihrerseits lernen, die Zügel etwas zu lockern. Er wechselte das Thema und erkundigte sich nach Geoffreys letztem Brief. Sie erzählte ihm, ihr Ehemann habe erfolgreich Cherbourg belagert. Die gesamte Normandie südlich und westlich der Seine sei jetzt unter seiner Kontrolle, berichtete sie, wenn auch mit merklich fehlender Begeisterung. Er wusste sehr wohl, warum – sosehr sie das Herzogtum für Henry erobert sehen wollte, musste es sie gewaltig wurmen, dass Geoffrey in der Normandie so spektakuläre Siege einheimste, während ihr englischer Feldzug in Kontroversen feststeckte, von Rückschlägen bestimmt war und sogar gänzlich zu scheitern drohte.
Das Gespräch verlagerte sich von der Normandie hin zu den neuesten Gerüchten vom französischen Hof. Von Eleonore angespornt, war der König in der Champagne einmarschiert, um Graf Theobald dafür zu bestrafen, dass er Partei für Raoul de Péronnes verstoßene Gemahlin ergriffen hatte. Selbst für diese Zeit, in der man an Blutvergießen und zivile Opfer gewöhnt war, hatte das Gemetzel schockierende Ausmaße angenommen. Als das französische Heer in die Stadt Vitry-sur-Marne eingefallen war und die dortige Burg Theobalds belagerte, hatte die verängstigte Bevölkerung Zuflucht in ihrer Kirche gesucht. Als man dann die Stadt brandschatzte, drehte der Wind, und die Flammen erfassten schnell auch die Kirche. Nur die wenigsten konnten diesem Inferno entfliehen – über dreizehnhundert Leichen wurden später in der verkohlten Ruine gefunden. Der junge französische König war ein entsetzter Augenzeuge gewesen, und angeblich wurde sein Schlaf auch jetzt noch, sechs Monate nach dem feurigen Todeskampf in Vitry, von Todesschreien heimgesucht. Allerdings hatte ihn sein geplagtes Gewissen nicht dazu bewegt, seine Truppen aus der Champagne abzuziehen, weshalb der Feldzug unvermindert weiterging.
Ranulf und Maude waren sich einig, dass es sich bei der ganzen Geschichte um eine große Torheit handelte – Krieg zu führen, nur um eine rechtswidrige Liebschaft zu verteidigen. Maude vertraute ihm an, wann immer ihr eigener Seelenfrieden von den Erinnerungen an das schreckliche Leid in Winchester heimgesucht wurde, wisse sie wenigstens, dass sie für eine gerechte Sache gekämpft habe; die Königswürde ihres Sohns war es wert, dafür zu kämpfen und sogar zu sterben.
In diesem Moment betrat Henry das Zimmer. Seine Mutter und sein Onkel verzogen bei seinem Anblick das Gesicht, und ihre Ungnade schmerzte ihn, denn es war ihm sehr wichtig, dass sie ein gutes Bild von ihm hatten. »Du kannst unmöglich so schnell ein Bad genommen haben«, sagte Maude argwöhnisch, und er gab sofort zu, es noch nicht getan zu haben.
»Die Diener erhitzen noch das Badewasser. Aber ich habe mir schon das Gesicht und die Hände und sogar den Hals gewaschen … Siehst du?«, sagte er und zog seine Tunika zur Seite, um einen Flecken frisch geschrubbte Haut zu entblößen. »Mama, ich bin zurückgekommen, um zu sagen, dass mir mein unhöfliches Benehmen leidtut.«
Maudes Gesichtszüge lösten sich. »Dann hast du Vergebung verdient. Aber weißt du, was ich noch mehr schätzen würde als eine Entschuldigung? Das Versprechen, dass es nicht wieder vorkommen wird.«
Henry wand sich. »Ungern, Mama«, sagte er schließlich. »Ich kann mir nicht sicher sein, dass ich das Versprechen halten würde. Und wenn ich es nicht täte, hätte ich doppelte Sünde auf mich geladen – Unhöflichkeit und Unaufrichtigkeit.«
»Sehr gewissenhaft von dir, Henry«, sagte Maude trocken. »Ich würde trotzdem vorschlagen, dass du in Zukunft versuchst, deine Manieren zu bessern. Dass du es wirklich versuchst.«
»Das werde ich, Mama. Ich werde keine Stühle mehr umschmeißen. Und ich werde keine Spitznamen mehr erwähnen und dich nicht noch einmal bitten, mich Harry zu nennen«, sagte er feierlich, gefolgt von einem sehnsüchtigen Seufzen. »Papa wird einwilligen, das muss mir genügen.«
Ranulf verbarg sein Lachen hinter einem Husten, während Maude zwischen Verärgerung und Belustigung schwankte. »Ich mag von Militärtaktik weniger verstehen als deine Herren Onkel, aber das ist eine, die auch ich erkenne – teile und herrsche, nicht wahr?« Henry grinste, weil sie ihn überführt hatte, und sie winkte ihn zu sich. »Du kannst von Glück sagen, dass dein Onkel Ranulf ein gutes Wort für dich eingelegt hat. Aus ihm wäre ein anständiger Anwalt geworden, denn er hat mich davon überzeugt, dass Harry ein passender Name für einen englischen König ist.«
»Danke, Mama! Und dir auch, Onkel Ranulf!« Henry strahlte sie beide an. »Aber du schreibst besser Onkel Robert, dass du das so siehst. Als ich ihn letzte Woche gefragt habe, hat er mich angeschaut, als hätte ich den Verstand verloren.«
Henry blieb keine Zeit, seinen Triumph auszukosten, denn plötzlich brach ein Tumult im Burghof aus, der nach sofortiger Aufklärung verlangte. Er rannte durch die Kammer, kniete sich auf den Fenstersims und beugte sich waghalsig hinaus. »Bewaffnete Reiter«, berichtete er außer Atem, »und zwar viele! Und einer von denen ist dein Freund, Onkel Ranulf – Gilbert Fitz John!«
*
Gilbert brachte eine dringende Einladung für Ranulf und die Ritter aus Maudes Haushalt. »Milady, Ihr wisst ja, dass Stephen versucht hat, die Burg Wareham zurückzugewinnen, sich aber zurückzog, nachdem er gesehen hatte, wie gut sie verteidigt ist. Seither hat er sich nach Wiltshire bewegt, und jetzt steht er vor Wilton.«
Ranulf und Maude wechselten einen Blick, denn Wilton lag nur einundzwanzig Meilen von Devizes entfernt. »Was glaubt Robert, was er im Schilde führt? Einen Angriff auf uns?«
»Möglicherweise. Graf Roberts Spione haben ihn gewarnt, dass Stephen Erlasse verschickt hat, die seine Fürsten und Vasallen nach Wilton beordern. In der Zwischenzeit hat er das Nonnenkloster übernommen und benutzt es als Außenposten, während er eine neue Burg errichten lässt. Damit könnte er Salisbury isolieren, denn die Furt ist bei Wilton, und dann würde er all unsere Besitzungen im Westen bedrohen. Aber er hat einen schwerwiegenden Fehler gemacht, Madame, denn Wilton kann einer Belagerung nicht widerstehen – noch nicht.«
»Robert hat vor, ihn zu überrumpeln?«
Gilbert nickte. »Er hat mich geschickt, um dich zu holen, Ranulf, und außerdem so viele Männer, wie Lady Maude entbehren kann. Er will, dass wir nach Marlborough reiten und John Marshal alarmieren. Er und Lord Miles werden uns dort treffen, und dann fallen wir ohne Vorwarnung über Wilton her.« Gilbert lächelte finster. »So Gott will, wird es ein zweites Lincoln geben.«
*
Wilton lag an der Vereinigung der Flüsse Wylye und Nadder. Die Stadt rühmte sich einer glanzvollen Vergangenheit, denn einst war sie ein Königssitz der Sachsenherrscher gewesen. Sie war noch immer wichtig, denn sie bot einen florierenden Markt, die reiche und berühmte Abtei St. Mary, die regelmäßig Pilgerströme zu ihrem Schrein der heiligen Edith lockte, und das Hospital von St. Giles, das von einer Königin gegründet worden war – von Adeliza, der Witwe des alten Königs.
Stephens Ankunft zerstörte jedoch die Sicherheit und bedrohte den Wohlstand der Bewohner. Der Markt hatte Kundschaft aus allen umliegenden Gemeinden angezogen, und damit war es nun vorbei, da die wenigsten bereit waren, eine von Soldaten besetzte Stadt zu besuchen. Auch die ansässigen Händler litten, und ihre Geschäfte blieben geschlossen. Als Erste waren die Juden aus der Stadt geflohen, die aus allzu bitterer Erfahrung wussten, dass sie in Zeiten des Umbruchs die verletzlichste Bevölkerungsgruppe waren. Einige Bürger – jene mit Töchtern oder jungen Ehefrauen – hatten ihre Familien ins benachbarte Salisbury in Sicherheit geschickt, und die enteigneten Nonnen hatten im nahen Nonnenkloster von Amesbury Zuflucht gefunden. Der Großteil der Bevölkerung aber hatte keinen Ausweg.
Also hielten sie sich so viel wie möglich in ihren Häusern auf, beobachteten die langsame Entstehung von Stephens Burg und beteten, er und seine Männer würden fortreiten und sie in Frieden lassen, sobald das Bauwerk vollendet war. Doch so unerfreulich ihnen ihr Schicksal in diesem Juni auch erscheinen mochte – es sollte noch sehr viel schlimmer kommen.
Der erste Juli startete holprig für Stephen; er musste eine unangenehme Audienz mit der Äbtissin von St. Mary hinter sich bringen, die sich von seinem Charme und seinen Versprechungen in keinster Weise besänftigen ließ. Danach meldete ein Kundschafter, im Norden seien bewaffnete Reiter gesichtet worden. Da die drei nächstgelegenen Burgen in dieser Richtung – Ludgershall, Marlborough und Devizes – alle in Feindeshand waren, schickte Stephen den Grafen von Northampton mit einem Kontingent von Ypres’ Flamen aus, um der Sache nachzugehen und die Feinde, falls nötig, zu stellen. Gerade ließ er sich mit seinem bischöflichen Bruder in der großen Halle der Abtei zum Mittagessen nieder, als ein blutender Jüngling hereinplatzte, auf sie zustolperte und völlig außer Atem seine schlechten Neuigkeiten herauskeuchte. Der Graf von Northampton sei auf Schwierigkeiten gestoßen, denn der gegnerische Trupp war größer als erwartet. Sie hatten sich ein Scharmützel mit dem Feind geliefert und versuchten gegenwärtig, sich zur Stadt zurückzuziehen, brauchten aber dringend Hilfe. An dieser Stelle wurden bereits Stühle zurückgeschoben und Teller beiseitegestellt. In Windeseile war die Halle leer, bis auf den Bischof, seine Geistlichen und seine Diener. Alle anderen Männer waren bereits zur Tür hinaus und brüllten nach ihren Pferden.
Stephen galoppierte aus der Umfriedung der Abtei und führte seine Männer über die East Street auf die Straße nach Norden. Es war ein heißer Tag, die Mittagssonne stand im Zenit. Die Pferde wirbelten erstickende Staubwolken auf. Stephen fühlte den Schweiß die Rippen hinablaufen, und noch ehe die Stadt außer Sichtweite war, pochte sein Kopf schmerzhaft in dem schweren Helm. In solcher Sommerhitze zu kämpfen, war beinahe so zehrend wie ein Winterfeldzug. Normalerweise war er jedoch nicht anfällig für die Unbilden des Wetters, und so fragte er sich unwillkürlich, ob er wohl langsam die Gebrechen des Alters zu spüren bekam, denn er war jetzt siebenundvierzig und seine Jugend lange vorüber.
»Ich werde zu alt für diese ganze Aufregung«, bemerkte er verschmitzt zu William de Ypres. Aber der Flame, der auf Stephen so zeitlos wirkte wie Wiltshires ewige Eichen, schenkte ihm bloß einen Seitenblick und ein abgelenktes Stirnrunzeln, denn all seine Gedanken konzentrierten sich auf die kommende Auseinandersetzung. Nun hörten sie den Lärm des Kampfes weiter vorn, spornten ihre Pferde an und stürmten los.
Sie fanden eine Szenerie voll Chaos und drohendem Unheil vor. Northampton und seine Männer zogen sich zurück, dicht bedrängt von ihren Verfolgern. »Heiliger Christus«, hauchte Stephen, denn er sah sofort, womit er es zu tun hatte. Das war kein Vorstoß in feindliches Gebiet, keine Gruppe von Kundschaftern, die Wiltons Wehrhaftigkeit prüfen sollte. Ihm stand ein komplettes feindliches Heer gegenüber, und ehe er sie entdeckte, wusste er bereits, wessen Banner diese Männer trugen. Es gab nur einen Mann, der mit solch tödlicher Schnelligkeit und Genauigkeit eine so große Truppe zusammenstellen konnte – wie er es schon in Lincoln getan hatte.
Ypres war zum selben schrecklichen Schluss gekommen. »Gott zermalme ihn«, fluchte er, »das ist diese missratene Teufelsbrut von Gloucester!«
Stephen zog eilig sein Schwert. Northamptons Männer hatten sie fast erreicht – und binnen weniger Augenblicke waren sie in die Schlacht verwickelt. Es herrschte derartige Verwirrung, dass Männer aus Versehen die eigenen Kameraden niederstreckten, denn es war keine einfache Aufgabe, in diesem Mahlstrom Freund und Feind zu unterscheiden. Staub verstopfte ihnen die Kehlen und stach in den Augen, und die gleißende Sonne, die sich im Metall der Kettenhemden und Schwerter spiegelte, blendete zusätzlich. Pferde bäumten sich auf und fielen übereinander her, wann immer sie zusammenprallten. Fielen sie, rissen sie ihre Reiter mit zu Boden. Bald war Stephen mit Blut verschmiert. Bis jetzt war es nur fremdes … noch. Aber sie waren überrumpelt worden, befanden sich in der Unterzahl, und auch wenn eine Niederlage noch immer unglaublich schien, war sie doch unabwendbar.
»Majestät, Ihr müsst fliehen, solange Ihr noch könnt!« William Martel hatte sich an Stephens Seite gekämpft. »Ihr dürft nicht zulassen, dass sie Euch gefangen nehmen – nicht schon wieder!«
»Er hat recht!« Obwohl Ypres nah genug stand, um Stephens Arm zu ergreifen, musste er schreien, um sich Gehör zu verschaffen. Er wusste, dass Stephens störrisches Wesen meist zum ungünstigsten Zeitpunkt zum Vorschein kam, und stählte sich bereits für Widerworte, ging hastig die Argumente durch, die er für die überzeugendsten hielt. Er verwarf alle Appelle an gesunden Menschenverstand oder eigene Sicherheit und erinnerte Stephen stattdessen an etwas: »Ihr habt es Eurer Königin versprochen! Kein weiteres Lincoln mehr, das habt Ihr gelobt!«
Stephen erkannte die Wahrheit dieser Worte, aber Flucht war ein ganz und gar fremdartiger Instinkt, denn seine Vorstellung von Ritterlichkeit hatte schon immer sehr viel Edelmut und wenig Realismus beinhaltet. Das Zögern wurde ihm fast zum Verhängnis; ein Schrei des Begreifens hallte zu ihnen herüber. »Jesù, der König! Da, auf dem Rotschimmel!« Die Verzweiflung Ypres’, der kurz davor schien, Stephens Zügel an sich zu reißen, siegte schließlich über dessen Zweifel. Er wendete seinen Destrier und gab den Befehl zum Rückzug.
Während Stephen versuchte, auf dem Ritt nach Wilton die Verfolger ebenso abzuschütteln wie seine Zweifel, warf sich sein Truchsess in die Bresche und kämpfte mit der Nachhut verbissen dafür, seinen König vor der Gefangenschaft zu bewahren, ganz wie Robert es für Maude an der Furt von Le Strete getan hatte. Nur dank William Martels todesmutigem Gefecht waren Stephen und Ypres und die anderen in der Lage, Wilton zu erreichen. Als Robert sich endlich zur Stadt vorgekämpft hatte, war es zu spät. Wilton stand in Flammen, und Stephen war fort.
Robert weigerte sich zunächst, das zu glauben. Auf sein Drängen hin schwärmten seine Männer in die schmalen Straßen und Gassen aus, verschafften sich gewaltsam Zugang zu Wohnhäusern, Geschäften und Kirchen. Sie bündelten ihre Suche in dem requirierten Nonnenkloster und förderten bald einige Flüchtige von der Schlacht zutage. Sie zerrten Schutzsuchende aus den acht Kirchen der Stadt und zogen sich so den Zorn der Pfarrer zu. Dann entdeckten sie in der Abtei Truhen und Kisten voller Beute – Habseligkeiten, die wohl von Stephen und seinen Männern zurückgelassen worden waren. Trotz allem konnten sie Roberts schlimmste Befürchtungen nur bestätigen. Stephen war tatsächlich entkommen.
Im Zunfthaus wurde Robert ängstlich von Wiltons führenden Kaufleuten angesprochen, die versuchen wollten, ihn davon abzuhalten, seine Wut an ihrer Stadt auszulassen. Sie waren sehr erleichtert, zu erfahren, dass er keinerlei derartige Gelüste hegte, auch wenn der Schaden in der Stadt – ob absichtlich verursacht oder nicht – auch so bereits beträchtlich war. Mehrere Häuser standen in Brand, und Roberts Soldaten hatten sich auf der Suche nach Stephen mit sicherem Auge die besten Beutestücke geschnappt.
Die Kaufleute, die begierig waren, sich bei ihrem neuen Eroberer einzuschmeicheln, konnten ihm Augenzeugenberichte von Stephens Flucht anbieten. Er sei in vollem Galopp aus der Stadt geritten und habe nur angehalten, um den Bischof vor der drohenden Gefahr zu warnen. Er, der Flame und der Graf von Northampton seien dann die Straße nach Süden hinuntergejagt, dicht gefolgt vom Bischof und seinem Gefolge. Die Herren hätten ihre Pferde nicht geschont und würden ein solches Tempo nicht lange durchhalten, so prognostizierten sie. Für Robert war das nur ein schwacher Trost, denn er wusste, dass Stephens Bruder keine zehn Meilen entfernt bei Downton eine Burg besaß, wo sie auf frische Reittiere wechseln konnten.
Mechanisch veranlasste er alles Nötige und schickte John Marshal los, um die Verfolgung aufzunehmen, obgleich er wusste, dass es sich um eine leere Geste handelte. Stephen brauchte sich nur von der Hauptstraße fernzuhalten, ehe er einen Bogen machte und ins sichere Winchester ritt. Robert hatte seine Chance gehabt und nichts daraus gemacht. Irgendwann würde er die Niederlage widerwillig abhaken – aber noch nicht jetzt.
Miles trieb Gefangene auf dem Marktplatz zusammen und diskutierte dabei mit zwei empörten Priestern. Beim Anblick von Robert schritt der Mutigere der beiden auf ihn zu und legte Beschwerde gegen den Bruch des Kirchenasyls ein. Ausnahmsweise reagierte Robert nicht wie ein Diplomat, sondern wie ein Jäger, den man um seine Beute gebracht hatte, und wies den Priester zurück, mit einer harschen Erinnerung daran, dass sich nicht alle Kirchen auf das Asylrecht berufen konnten. Der Priester zog sich zurück, aber sein verbales Banner wurde von einem neuen Kontrahenten übernommen, der nicht weniger entschlossen wirkte.
»Herr Graf, auf ein Wort!« Die Stimme klang gebildet, gebieterisch, weiblich und zornig. Eine imposante hochgewachsene Nonne steuerte auf ihn zu, gehüllt in den schwarzen Habit der Benediktinerinnen. Sie näherte sich mit solcher Geschwindigkeit, dass sich ihr weites Gewand und ihre Haube im Wind bauschten und das unpassende Bild eines Schiffs mit vollem Segel wachriefen. Ohne dass man es ihm sagen musste, wusste er, dass es sich nur um die Äbtissin handeln konnte, eine Frau mit einer berechtigten Beschwerde. Trotzdem war er nicht in Stimmung, sie anzuhören, und wandte sich ab, um Ranulf die Aufgabe zu überlassen, sie nach Möglichkeit zu besänftigen.
Er kam jedoch kaum ein paar Schritte weit, ehe er seinen Namen über den Platz schallen hörte, und diesmal klang die Stimme so vertraut, dass er verblüfft herumfuhr. Die zweite Nonne war ihm gar nicht aufgefallen. Während Ranulf gekonnt die Äbtissin abfing, rief ihre Begleiterin abermals: »Robert, warte!«
Und das tat er, denn sie gehörte zur Familie – es war Hawise Fitz Hamon, die jüngere Schwester seiner Frau. »Was tust du hier?«, fragte er energisch. »Wir dachten, alle Nonnen wären ins Konvent von Amesbury gebracht worden.«
»Ich habe die Äbtissin in der Hoffnung begleitet, den König so sehr zu beschämen, dass er uns die Abtei zurückgibt. Wir haben für unsere Mühe aber bloß ein Lächeln und nette Worte bekommen. Und jetzt, da deine Männer überall in der Abtei umherschwärmen wie Bienen in ihrem Stock, fürchte ich mich vor dem, was wir vorfinden, wenn wir zurückkommen. Wir brauchen Hilfe, um die Feuer zu bekämpfen, die du verursacht hast, wenn die Stadt und die Abtei nicht niederbrennen sollen.«
»Wir sind schon dabei«, sagte er.
Sie drehte sich um und sah, dass Ranulf tatsächlich auf die Forderung der Äbtissin einging. Hawise wirkte allerdings noch längst nicht zufrieden, sondern starrte ihren Schwager weiter finster an, die Hände in die Hüften gestemmt, das Kinn vorgestreckt; sie sah dabei Amabel so unheimlich ähnlich, dass er fast glaubte, seine Frau habe sich aus unerfindlichen Gründen als Nonne verkleidet.
»Unsere Abtei wird Jahre brauchen, um sich von diesem Skandal zu erholen«, sagte sie wütend.
Robert erinnerte sie nicht weniger scharf daran, dass das Ungemach der Abtei Stephens Schuld war, denn er war es gewesen, der sie als Stützpunkt genutzt hatte.
»Natürlich ist Stephen schuld«, fauchte sie. »Aber was spielt das jetzt für eine Rolle, wo unsere Stadt in Flammen steht und unsere Abtei geplündert wurde? Schau dich um, Robert, was du und Stephen Wilton angetan habt. Was haben wir verbrochen, um so viel Elend zu verdienen? Glaubst du, der Wagenmacher, dessen Werkstatt niedergebrannt ist, schert sich darum, ob die Krone an Stephen oder an Maude geht? Ich versichere dir, seine einzige Sorge gilt der Frage, wie er jetzt seine Familie ernähren soll, nachdem man sein Geschäft zerstört hat. Frag den Tuchhändler in der Frog Lane, dessen Regale leer geräumt sind, dem auch der letzte Fetzen Stoff geraubt wurde. Frag meine Ordensschwestern, die gezwungen sind, in Amesbury Schutz zu suchen, während auf unserem Kirchhof gemordet wird!«
»Hawise, es reicht! Im Krieg leiden immer auch Unschuldige. Glaubst du, das weiß ich nicht? Sie haben mein Mitgefühl, aber …«
»Mitgefühl ist ein fader Brei und füllt keine leeren Bäuche, Robert. Sag mir nur eins, und zwar ehrlich: Wie viel länger soll dieser verfluchte Krieg noch dauern?«
»Ich hatte gehofft, ihn hier und heute zu beenden – in Wilton«, erwiderte er unglücklich. »Vielleicht kannst du mir aber auch eine Frage beantworten, Schwester Hawise: Sag mir, warum der Allmächtige beschlossen hat, Stephen entkommen zu lassen, damit der Krieg weitergeht.«
Sie musterte ihn nur stumm, ohne eine Antwort zu finden. Er hatte auch nicht mit einer gerechnet.
*
So heiß und trocken der Juli bereits gewesen war, der August präsentierte sich sogar noch sengender und ausgedörrter. Ein Volk, das sich normalerweise nach der Sonne sehnte, hatte nun gründlich genug von ihr, und auf den Feldern ging die Ernte ein. In diesem achten Jahr von Stephens Herrschaft drohte dem gebeutelten, gesetzlosen Land neues Leid – die Furcht vor einer Hungersnot ging um.
*
In Begleitung von Cecily, ihrem Beichtvater Christian und ihrem Stiefsohn, dem Abt Gervais, näherte sich Matilda der Abteikirche von Westminster durch den Klostergarten. Der Zweck ihres Besuchs war einer, der ihr sehr am Herzen lag – das Verteilen von Almosen an die Armen –, trotzdem stellte sie fest, dass sie zunehmend abgelenkt war, denn Eustace und Constance stritten sich schon wieder.
Sie hatten genug Anstand, ihre Stimmen nicht zu erheben, dennoch hörte Matilda mehr, als sie hören wollte. Constances bevorzugte Waffe war Schweigen, ein taktischer Rückzug in eine innere Festung, in die Eustace ihr nicht folgen konnte. An diesem Nachmittag aber ergriff sie das Wort und beharrte stur: »Hab ich nicht!«
»Hast du wohl!«, hielt Eustace mit der Bestimmtheit dagegen, die er in allen Belangen an den Tag legte.
Matilda warf ihnen über die Schulter einen warnenden Blick zu, bemühte sich jedoch nicht, den Grund für ihren Disput zu erfahren, denn sie wusste zu gut, dass sich die beiden meist über Nichtigkeiten entzweiten. Ihre Argumente waren oberflächlich, ihre Unterschiede so gewaltig, dass sie einander bis aufs Blut reizten. Eustace war jetzt dreizehn, Constance ein Jahr älter, und somit näherten sie sich gefährlich dem Tag, vor dem Matilda graute – dem Tag, da sie alt genug waren, als Mann und Frau ein Bett zu teilen. Matilda wusste seit Langem, dass diese Ehe ein großer Fehler gewesen war; sie zu vollziehen, würde den letzten Sargnagel darstellen.
»Eustace!« In Constances Ausruf lag solche Angst, dass Matilda herumfuhr und sich vor dem fürchtete, was sie erblicken würde. Aber ausnahmsweise war nicht Eustace der Grund für die Bestürzung seiner jungen Braut – sie starrte durch den Klostergarten auf die Männer, die gerade ins Sonnenlicht traten, und ihre blonde Schönheit wich einer aschgrauen Blässe. Eustace zog sie schützend hinter sich und schaute herausfordernd drein, denn in diesem einen Punkt waren sich die beiden vollkommen einig – beide hassten Geoffrey de Mandeville.
Mandeville hingegen nahm sie nicht einmal wahr. Er befand sich in einer eindringlichen, wütenden Diskussion mit William de Warenne, die er bei Matildas Anblick jedoch unterbrach, um auf sie zuzumarschieren. »Ich bin froh, dass Ihr hier seid, Madame. Vielleicht könnt Ihr den König zur Vernunft bringen.«
Matildas Antwort war eisig genug, um der drückenden Augusthitze zu trotzen. »Es steht mir nicht zu, den Richtspruch unseres Königs in Zweifel zu ziehen, mein Lord Graf.«
Mandeville teilte nicht jenes aufflammende Temperament, das dem Grafen von Chester schon so viele Brandherde beschert hatte. Doch nur weil er nicht so hitzig war, brannte er dennoch nicht weniger inbrünstig, und Matilda vermutete, dass er seinen Groll wie Zündholz lagerte. Er kniff die dunklen Augen zusammen und entgegnete mit tödlicher Höflichkeit: »Korrigiert mich, falls mein theologisches Wissen Lücken aufweist, Madame, aber mir wurde beigebracht, dass Unfehlbarkeit ein Attribut des Papstes ist, nicht des Königs von England.«
Das Verlangen, etwas Beißendes zu erwidern, war übermächtig, aber Matilda hatte es nie an Selbstbeherrschung gemangelt; sie konnte warten. Jetzt gerade überwog deutlich ihr Bedürfnis, den Grund für seinen Zorn zu erfahren. Zum Glück näherte sich eine verlässlichere Informationsquelle, und Matilda beschleunigte ihre Schritte, um William de Ypres abzufangen und unter vier Augen zu sprechen, mit einer Offenheit, die Königinnen nur selten vergönnt war.
Ypres war kaum weniger aufgebracht als Geoffrey de Mandeville und spannte Matilda nicht lange auf die Folter. »Wir haben endlich von Robert von Gloucester gehört, Gott verdamme ihn. Er hat angeboten, William Martel freizulassen – für die Burg von Sherborne.«
»O nein …«
Er nickte düster. »Ohne Sherborne können wir Gloucesters Kontrolle der westlichen Grafschaften unmöglich anfechten. Diese Festung ist ein zu hoher Preis für einen einzigen Menschen, aber Euer Gemahl, möge Gott ihn schützen, hat vor, ihn zu zahlen, und ich fürchte, dass nicht einmal Ihr in der Lage sein werdet, ihm das auszureden.«
»Ich weiß nicht einmal, ob ich es versuchen sollte«, gab Matilda zu. »Willem, wir schulden Martel so viel! Ohne ihn wäre Stephen zweifellos gefangen genommen worden. Wie können wir uns da einfach von ihm abwenden?«
»Ein König schuldet auch anderen Parteien etwas, Madame – seinen Unterstützern, den Männern, die für ihn gefochten und geblutet haben, und den Untertanen, über die er gebietet. Ich will nicht so tun, als würde mir die englische Bevölkerung etwas bedeuten, aber ich weiß, Euch und dem König bedeutet sie viel, und die Burg von Sherborne aufzugeben, wird den Krieg nur verlängern. Das gibt selbst Stephen zu.«
»Was soll er denn Eurer Meinung nach machen, Willem? Den Mann im Stich lassen, der sich selbst geopfert hat, damit Stephen fliehen konnte? Ihr wisst, dass er das niemals tun würde.«
»Ja, das weiß ich … und Gloucester weiß es auch. Aber warum kann der Kelch immer nur entweder randvoll oder absolut leer sein? Warum sind Halbheiten nie eine Lösung? Bietet ein stattliches Lösegeld für Martel an, und zwar eins, das wir uns leisten können, dann wird Gloucester ihn irgendwann gehen lassen. Ein oder zwei Jahre in Gefangenschaft gegen den Verlust von Sherborne – ich würde sagen, das wäre ein gerechter Tausch.«
»Aber Ihr müsstet diesen Preis nicht bezahlen, Willem. Wenn Ihr es wärt, der im Verlies von Bristol sitzt – könnt Ihr ernsthaft sagen, Ihr würdet nicht wollen, dass Stephen alle Gestirne des Himmels für Eure Freilassung aufbietet?«
»Natürlich würde ich das wollen«, sagte er ungehalten. »Aber ich bin auch nicht der König von England … oder? Madame, mir scheint, wir haben dieses Gespräch schon einmal geführt, vor etwa zwei Jahren in der Burgkapelle von Guildford. Viel hat sich seitdem wohl nicht geändert. Dieser Falke will seine Beute noch immer nicht schlagen.«
*
Matilda fand Stephen in der Kirche. Er stand vor dem Grab des heiligen Bekenners, des vorletzten Sachsenkönigs Edward. Er hatte gerade eine Kerze entzündet, wandte sich beim vertrauten Klang ihrer Schritte aber so rasch um, dass die Flamme flackernd erlosch. Als sie fast nah genug war, um ihn zu berühren, sagte er leise: »Ich muss es tun, Tilda. Ich kann nicht zulassen, dass Will seine Freiheit für meine opfert.«
»Ich weiß.«
»Glaubst du, ich begehe einen Fehler?«
Sie schwieg eine Weile und wog ihre Worte ab. »Als deine Frau würde ich mit Freuden ein Dutzend Sherbornes hergeben, um Will zu befreien. Als deine Königin habe ich meine Zweifel. Es ist eine schwierige Entscheidung, und ich bin froh, dass ich sie nicht treffen muss.«
Da streckte Stephen die Hand nach ihr aus und schlang seine Finger um ihre. »Für mich war es nicht schwierig. Das musst du verstehen. Für mich war es eine leichte Entscheidung, weil es die einzige Entscheidung war.«
»Ich weiß«, sagte sie noch einmal und schmiegte sich eng in seine Umarmung, legte das Kinn an seine Brust und versuchte, diese vollendete Ironie zu begreifen – sie, die so gar keinen Sinn für Ironie besaß –, dass gerade jene Eigenschaften, die sie an Stephen am meisten liebte, diejenigen waren, die seiner Herrschaft den größten Schaden zufügten.
Kapitel II
Oktober 1143
Tower von London
Geoffrey de Mandeville hatte jedes Zeitgefühl verloren und konnte nicht sagen, wie lange er schon als Gefangener in dieser Festung gehalten wurde, die bis vor Kurzem noch ihm gehört hatte. In den seltenen Momenten, in denen seine Wut so weit nachließ, dass er einen klaren Gedanken fassen konnte, schätzte er, dass es schon fast zwei Wochen sein mussten, denn es war in der Woche von Michaeli gewesen, als er in St. Albans angekommen war, um am Rat des Königs teilzunehmen – ohne auch nur im Entferntesten damit zu rechnen, in einen Hinterhalt zu reiten.
Er war noch immer von Unglauben erfüllt, wenn er an den Moment dachte, da sich der König ohne Vorwarnung gegen ihn gestellt und seine Festnahme gefordert hatte. Er hatte sich nicht einmal zur Wehr setzen können, denn Stephen war es gelungen, ihn von seinen Gefolgsleuten zu trennen, ehe er die Falle zuschnappen ließ. Natürlich hatte Stephen jetzt Scherereien mit der Kirche, weil die Festnahme auf dem Gelände der Abtei erfolgt war, was der aufgebrachte Abt als Sakrileg angesehen hatte. Er selbst konnte allerdings kaum Trost aus dieser Tatsache ziehen, denn man hatte ihn in Ketten nach London geschleift, ihn dazu gezwungen, seiner Garnison im Tower den Befehl zu geben, sich zu unterwerfen, und ihn dann in eins seiner eigenen Verliese geworfen. Und jetzt saß er dort allein in der Finsternis und wartete darauf, dass der König über sein Schicksal richtete. Seine Welt lag in Scherben. Er wurde nur noch von seinem Hass genährt.
*
Als man ihn verdreckt und verwahrlost vor sie brachte, wo er wie eine verschreckte Schleiereule im plötzlichen grellen Sonnenlicht blinzelte, war Matilda entsetzt – konnten dieser jämmerliche Wicht von einem Häftling und der hochmütige, elegante Graf von Essex wirklich ein und dieselbe Person sein? Noch mehr als sein tiefer Fall schockierte sie allerdings die Tatsache, wie sehr sie sich daran erfreute. Sie trat neben ihren Gemahl und starrte kalt auf Geoffrey de Mandeville herab, als er vor ihnen auf die Knie gezwungen wurde.
Stephen durchlebte das gleiche ungewohnte Gefühl: Genugtuung beim Betrachten eines leidenden Feindes. »Ihr seht nicht so aus, als hättet Ihr Euren Aufenthalt hier im Tower genossen, mein Lord Graf. Aber gut, ich gehe davon aus, dass meiner Schwiegertochter ihr Aufenthalt ebenso wenig gefallen hat.«
Mandevilles Augen hatten sich allmählich ans Sonnenlicht gewöhnt, und nun blinzelte er vor Verwunderung. »Ist das der Grund für diese ganze Sache – das kleine französische Mädchen? Ihr ist nichts geschehen, dafür habe ich gesorgt. Ich habe ihr lediglich für eine gewisse Zeit meine Gastfreundschaft aufgedrängt – was macht das schon? Es scheint mir doch eine verschwindend geringe Sünde zu sein, verglichen mit manch anderem Verrat, den Ihr vergeben habt, inklusive einiger Taten Eures eigenen Bruders. Ihr würdet ein Kerbholz brauchen, um all die Situationen festzuhalten, in denen er die Seiten gewechselt hat!«
Stephen verzog das Gesicht, Matilda und William Martel ebenfalls. Nur in einem Anwesenden fand dieser Seitenhieb ein dankbares Publikum; ein Lachen wehte vom Fenstersitz herüber, wo William de Ypres sich entspannt fläzte und an einem Buchenstecken schnitzte. Seine Belustigung wirkte echt, aber zugleich blitzte unablässig sein Messer auf und spaltete das Holz in feine Splitter.
»Hättet Ihr nur mich verraten, hätte ich Euch womöglich verziehen«, sagte Stephen. »Aber Ihr habt auch meiner Ehefrau und Constance unrecht getan, und dafür gibt es keine Vergebung.«
Geoffrey de Mandeville sagte nichts, starrte nur Matilda an und wandte dann den Blick ab. Aber so knapp sein Blick auch war, war er doch von eisiger Intensität und großer Bosheit. Bis zu diesem Augenblick hatte Matilda nicht gewusst, wie es sich anfühlte, das Ziel von blankem Hass zu sein.
»Ginge es nach mir, hätte ich Euch hier im Tower eingesperrt gelassen, bis Ihr verrottet. Aber Ihr habt mehr Glück, als Euch zusteht«, sagte Stephen kalt, »denn eine Reihe weiterer Fürsten haben mich um Gnade gebeten. Also habe ich beschlossen, Euch vor die Wahl zu stellen. Falls Ihr kooperiert, kommt Ihr frei.«
Mandeville verlagerte unbehaglich sein Gewicht; Stephen hatte ihm nicht gestattet, sich zu erheben, und seine Wadenmuskeln krampften. »Und was soll mich meine … Kooperation kosten?«
»Den Tower habt Ihr bereits abgetreten. Gebt auch noch Eure Burgen in Pleshey und Saffron Walden auf, und ich schenke Euch die Freiheit.«
Mandeville nahm sich die Zeit, das Angebot zu überdenken, als versuchte er, jemanden – und wenn auch nur sich selbst – davon zu überzeugen, dass es tatsächlich eine Entscheidung zu fällen gab. Als er schließlich nickte, machte Stephen eine Handbewegung, und die Wachen rissen ihn auf die Füße.
»Eine Warnung habe ich für Euch«, sagte Stephen, »und die nehmt Ihr Euch besser zu Herzen. Das ist Eure letzte Chance.«
In der Tür hielt Mandeville inne und wehrte sich gegen die Wachen, die ihn aus dem Saal schieben wollten. »Seid versichert, ich werde es im Kopf behalten«, sagte er zu Stephen.
Sobald Mandeville fort war, nahm Stephen Matildas Hand und führte sie zur nächsten Sitzbank. »Zu schade, dass Henry nicht hier war, um das zu sehen«, sagte er und überraschte sie damit alle, denn den Wunsch nach der Anwesenheit seines Bruders äußerte er nur selten.
Aber der Bischof hatte Geoffrey de Mandevilles Sturz erst ermöglicht, und dafür war Stephen ihm dankbar. In einem ebenso hinterlistigen wie geschickten Manöver hatte Henry arrangiert, dass dem feindlichen Bischof von Ely kirchliche Regelwidrigkeiten zur Last gelegt wurden und er nach Rom reisen musste, um sich zu verteidigen. Sobald der Bischof von Ely nicht mehr in England weilte, hatte Stephen Mandeville nicht länger gebraucht, um in Bischof Nigels Fenlands den Frieden zu sichern, und war endlich in der Lage gewesen, dem Grafen seine gerechte Strafe zukommen zu lassen.
Die Abrechnung war zwar spät erfolgt, dafür aber nicht minder befriedigend gewesen, und Stephen wusste, sein Bruder hätte großen Gefallen daran gefunden. Allerdings war auch Henry auf dem Weg nach Rom, um den neuen Papst Coelestin II. zu überreden, ihn abermals zum päpstlichen Legaten zu ernennen.
Da griff eine noch unerwartetere Stimme Stephens Bedauern auf. »Ich wünschte ebenfalls, der Bischof wäre hier«, sagte William de Ypres. »Ich wette, er würde mir zustimmen, dass Geoffrey de Mandeville nie wieder das Tageslicht hätte erblicken dürfen.«
»Quält Ihr Euch immer noch damit, Will?«
»Das tue ich, Majestät. Ich weiß, Ihr denkt, Ihr hättet ihm die Zähne gezogen, indem Ihr ihm den Tower und seine übrigen Festungen weggenommen habt. Aber eine zahnlose Schlange ist immer noch eine Schlange, und meiner Erfahrung nach sollte man die töten, solange man Gelegenheit dazu hat; man lässt sie nicht davonkriechen, bloß weil alle anderen Schlangen um Gnade flehen.«
Stephen warf dem Flamen einen amüsierten Blick zu. »Ich glaube nicht, dass es meinen Fürsten gefiele, zu hören, wie Ihr sie Schlangen schimpft, Will – trotz ihrer Schuppen und ihrer gespaltenen Zungen.«
»Das war kein Scherz, mein König. Was glaubt Ihr, warum Hugh Bigod und die anderen so erpicht darauf waren, sich für Mandeville einzusetzen? Glaubt Ihr, einen von ihnen würde es kümmern, wenn Ihr ihn höher aufknüpft als Haman? Sie wollen nur verhindern, dass Ihr Mandeville zu streng bestraft, weil sie fürchten, dass es beim nächsten Mal einer von ihnen ist, dessen Doppelspiel ans Licht kommt.«
»Eure Sichtweise der Menschheit ist finster genug, um sogar den Teufel zu beunruhigen«, sagte Stephen spöttisch. »Ich will nicht abstreiten, dass Eure Worte einen wahren Kern haben; selbst Mandevilles Verwandte aus den Häusern de Vere und de Clare scheinen ihn nicht allzu sehr zu mögen. Und ich streite auch nicht ab, dass sie geradezu verunsichert wirkten bei der Aussicht, einer der Ihren könnte wie ein gewöhnlicher Schurke oder Straßenräuber behandelt werden. Aber kein Mann ist je durch den Biss einer zahnlosen Schlange gestorben, Will. Was für Ärger soll er jetzt noch machen? Er kann nicht zu Maude zurückkriechen, nicht nach seinem Verrat bei Winchester. Diese Dame ist deutlich weniger gnädig als ich, das weiß die gesamte Christenheit!«
»Ich kann keiner Eurer Ausführungen widersprechen«, gab Ypres zu. »Ich kann Euch nur das sagen, was ich bei meiner ersten Jagd gelernt habe – wenn man gefährlicher Beute wie etwa einem wilden Eber nachstellt, greift man niemals an, solange man nicht sicher sein kann, dass der erste Schlag tödlich ist.«
»Manchmal reicht es aus, wenn ein Schlag die Beute verkrüppelt, Willem«, warf Matilda ein, und der Flame widersprach ihr nicht. Er war allerdings auch offenkundig nicht überzeugt, und daher schien die Anwesenheit des entehrten Grafen noch in ihren Gedanken zu verharren, als man ihn schon längst auf freien Fuß gesetzt hatte.
*
In jenem Jahr war die Natur unerbittlich. Der trockene, glutheiße Sommer hatte dem Land, das bereits seit vier Jahren unter den Schrecken des Krieges litt, eine Missernte gebracht, und um das Elend der englischen Bevölkerung noch zu verschlimmern, stellte sich früh der Winter ein. Schon im November war das Wetter ungewöhnlich hart: Tag für Tag prasselte eisiger Regen mit Windböen und Graupel nieder. Anfang Dezember hatte der erste Schnee das halbe Land unter sich begraben, und Annora war dankbar, als endlich die Mauern von Lincoln in Sicht kamen, denn dort erwarteten sie eine warme Mahlzeit, ein weiches Bett und die Umarmung ihres Geliebten.
*
Ranulf war schon seit dem Morgengrauen wach, in einen Kokon aus Bettdecken gehüllt und vollkommen glücklich damit, an diesem frostigen Dezembermorgen einfach im Bett zu liegen und die junge Frau zu betrachten, die in seinen Armen schlummerte. Es war ein Leichtes, sich vorzustellen, sie wären eingeschneit und die Welt jenseits dieser Kammer existierte nicht. Ein Leichtes, sich einzureden, dass sie ihre Liebschaft selbst vor der Dienerschaft der Burg verbergen konnten, denn Annoras Bett stand in Mauds Zimmer, und wer außer Maud selbst sollte wissen, wo sie tatsächlich nächtigte? Solange er Annora im Arm hielt, war es auch leicht, an seinen Hoffnungen festzuhalten. Es war sogar fast möglich, Annoras Ehemann zu vergessen, das lebende, atmende Hindernis für ihre Vereinigung – fast.
Irgendwann rekelte sich Annora und schenkte ihm ein schläfriges Lächeln. »Ich liebe es, mit dir aufzuwachen«, murmelte sie und streckte sich, um einen Kuss zu bekommen. »Aber ich hätte es diesmal fast nicht geschafft, weil Gervase sich trotz Mauds Eskorte Sorgen wegen meiner Reise gemacht hat.«
Ranulf rümpfte die Nase; jede Erwähnung ihres Ehemanns, wie knapp oder beiläufig auch immer, verdarb ihm unweigerlich die Laune. »Wegen Geoffrey de Mandevilles Gefangennahme?«, fragte er, und als sie nickte, zog er sie an sich und schob ihnen beiden ein paar Kissen unter die Köpfe.
»Es ist schon seltsam, Annora. Stephen ist am Hof meines Vaters aufgewachsen und hatte jede Gelegenheit, Lektionen über die Königswürde bei einem Meister zu lernen. Was immer er sonst für Fehler hatte, den Nutzen und die Wahrnehmung von Macht hat Papa auf jeden Fall verstanden und in dem Bereich auch so gut wie keine Fehler begangen. Er wusste, wie man Menschen führt. Stephen hingegen … der meint es mit allen gut und taumelt deshalb von einem Patzer zum nächsten.«
»Weil er Mandeville an seinem Hof verhaftet hat, wie auch damals bei den Bischöfen von Ely, Salisbury und Lincoln? Ich gebe zu, das macht ihn zu einem zweifelhaften Gastgeber«, sagte Annora keck, »aber warum ist es für seine Regentschaft so schädlich?«
»Weil die Menschen deswegen denken, dass man ihm nicht trauen kann, weil es ihn schwach wirken lässt und …«
»Aber Ranulf! Niemand – nicht einmal deine Schwester – könnte Stephens Tapferkeit anzweifeln.«
»Das tu ich auch nicht. Ich sage, die Leute halten ihn für einen schwachen König, nicht für einen feigen. Ich sage nicht, dass Mandeville es nicht verdient hat, eingesperrt zu werden, aber die Art und Weise hatte etwas Hinterlistiges. Was vielleicht nebensächlich wäre, würden die Menschen Stephen so sehr respektieren wie meinen Vater. Aber das tun sie nicht, weil sie keine Angst vor ihm haben … und Angst und Respekt sind zwei Hörner derselben Ziege.«
Annora bereute längst, das Thema zur Sprache gebracht zu haben, denn sie hatte kein Interesse daran, zu hören, wie Ranulf Stephens Verfehlungen als König aufzählte; das hörte sie oft genug von ihrem Ehemann, der vom Unvermögen des Königs, diesen Krieg zu beenden, zunehmend enttäuscht war. »Können wir uns nicht über etwas anderes unterhalten als über Politik? Ich würde viel lieber etwas über die Vorkommnisse in Winchester hören, denn«, fügte sie hoffnungsvoll hinzu, »gab es da nicht irgendeinen Skandal?«
Das kürzliche Unglück von Winchester war für alle Gefolgsleute Maudes ein heikles Thema. Aber Ranulf wusste, wie sehr Annora Klatsch und Tratsch liebte, also überwand er sein Unbehagen und erzählte ihr die recht traurige und elende Geschichte von William Pont de l’Arche, von dessen junger, wankelmütiger Frau und dem flämischen Söldner Robert Fitz Hildebrand. Der ehemalige Kastellan der Königsburg von Winchester hatte das Debakel von Wilton ausgenutzt, um seine Festung wiederzugewinnen, und sich dann hilfesuchend an Robert und Maude gewandt. Zu ihrer ewigen Schande hatten sie Hildebrand geschickt, der von William Pont de l’Arche als Verbündeter willkommen geheißen worden war und sich sofort darangemacht hatte, die Frau seines Gastgebers zu verführen. Mit ihrer Duldung hatte er die Garnison der Burg übermannt, den gehörnten Ehemann in sein eigenes Verlies geworfen und ein Geschäft mit dem Bischof und Stephen ausgehandelt. Alles in allem eine traurige Geschichte und ein unseliges Zeugnis dafür, wie dieser Krieg die moralischen Grundfesten des Landes ins Wanken brachte. Annora fand es höchst amüsant.
»Woher weißt du, dass dieser Robert Fitz Hildebrand die Frau des Kastellans verführt hat? Vielleicht war sie es, die ihn verführt hat«, schlug sie schelmisch vor und demonstrierte sogleich, dass es auch ihr nicht an Verführungskunst mangelte. Sie küssten sich und rollten lachend bis an die Bettkante, wo sie sich abermals küssten. Aber dann fuhr Annora kerzengerade auf und stieß einen spitzen Schrei aus. »Eine Ratte! Ranulf, eine Ratte hat mir ins Haar gebissen!«
Als er nachschauen wollte, packte sie ihn am Arm. »Warte – hol erst dein Schwert«, drängte sie ihn und fügte dann entrüstet hinzu: »Ranulf! Warum lachst du?«
»Weil du gleich eine seltene norwegische Ratte kennenlernen wirst«, sagte er.
Sie spähte vorsichtig über die Bettkante und verzog das Gesicht beim Anblick des Hundes, der ernst zu ihr aufschaute.
»Mir war klar, dass sich keine Ratte ins Zimmer traut, solange Lot hier ist. Aus dem ganzen Wurf von Shadow ist er der beste Jäger. Ich hab mal gesehen, wie er ganz allein einen Hirsch erlegt hat«, prahlte Ranulf und streckte die Hand aus, um dem Dyrehund das dichte Fell zu zausen. »Als dein Haar über die Kante hing, hat er wahrscheinlich geglaubt, du willst mit ihm spielen.«
»Dann teil ihm bitte mit, dass ich mit dir spielen will und dieses Spiel nicht für drei Teilnehmer gedacht ist.« Sie verzog abermals das Gesicht; eigentlich mochte sie Hunde, aber der starre Blick dieses Tiers hatte etwas Beunruhigendes. »Wie hast du ihn genannt – Lot? Wo hast du nur so einen befremdlichen Namen her?«
Sofort tat es ihr leid, gefragt zu haben, denn ohne es zu wollen, hatte sie Ranulf eine Gelegenheit beschert, über eine seiner seltsamsten Leidenschaften zu reden – seine Liebe zu Büchern. Das fragliche Werk hieß Geschichte der Könige Britanniens, so erzählte er ihr, und war von einem Augustinermönch namens Geoffrey von Monmouth verfasst worden, der sein Werk Robert gewidmet hatte. Das Buch war das beeindruckendste, was er je gelesen hatte, denn es verfolgte die Geschichte Englands durch die vergangenen Zeitalter zurück. Besonders hatte es ihm die Erzählung über Arthur angetan, den König der Briten, des Volkes, das man heute Waliser nannte. Auch Lots Namen hatte er aus diesem Buch, wie er erzählte – Lot war Arthurs Schwager, der mit dessen Hilfe König von Norwegen geworden war. Konnte es einen besseren Namen für einen norwegischen Dyrehund geben?
Annora stimmte höflich zu, dass Lot in der Tat ein großartiger Einfall gewesen sei, hörte aber nur halb hin, denn Ranulfs Begeisterung für Bücher konnte sie weder teilen noch begreifen. Ihren Brüdern hatte man – gegen deren Willen – Lesen und Schreiben beigebracht, denn ihr Vater hatte einen beinahe mönchischen Respekt für gute Bildung. Als auch sie es hatte lernen wollen, da sie neidisch darauf bedacht gewesen war, ihren Brüdern in allem nachzueifern, hatte er ihren Wunsch wie immer erfüllt, obwohl ihr Priester darauf beharrte, dass Frauen keinen Bedarf an weltlichem Wissen hätten. Tatsächlich verlor sie bald das Interesse und hätte es nicht durchgehalten, wäre Ranulf nicht zur rechten Zeit in ihr Leben getreten – Ranulf, der ernstlich stolz darauf war, die Schreibfeder wie ein gewöhnlicher Sekretär schwingen zu können. Mittlerweile war Annora natürlich dankbar für ihre Bildung, so überschaubar sie auch sein mochte, denn ihre rudimentären Fähigkeiten hatten es ihr erlaubt, Ranulf zu schreiben und seine Briefe zu lesen. Als er sich nun aber immer weiter über den unschätzbaren Wert dieses Werks aus der Feder des Geoffrey von Monmouth ausließ, mit all seinen seltsamen Namen – Brutus, Arthur, Merlin, Lot –, wurde ihr Blick trüb, und ihr Kiefer schmerzte vor unterdrücktem Gähnen.
Sie wollte nicht, dass Ranulf merkte, wie er sie langweilte, und leitete schließlich Ablenkungsmaßnahmen ein, die sich als so erfolgreich erwiesen, dass sie auch bald Lots Aufmerksamkeit erregten. Von Verwirrung und Beschützerinstinkt getrieben, kam der große Hund auf die Beine und legte den Kopf schief, sichtlich verwundert über die seltsamen Geräusche, die aus dem Bett drangen. Er trottete erst davon, als er sich davon überzeugt hatte, dass dieses ganze wilde Gestrampel seinen Meister offenbar nicht in Gefahr brachte.
*
Am nächsten Tag endete Ranulfs und Annoras idyllischer Aufenthalt in der Burg von Lincoln dank der unerwarteten Ankunft von Mauds Gemahl sehr abrupt. Bald legte sich ihre Sorge allerdings, denn es war eindeutig, dass Chester sich nicht entsinnen konnte, Annora je zuvor gesehen zu haben. Ranulf kannte er natürlich und begrüßte den jüngeren Mann mit einem bissigen »Ihr schon wieder? Ein Glück, dass Ihr Mauds Onkel seid, sonst würde ich mich langsam wundern, warum Ihr hier dauernd herumzulungern scheint.« Aber die Beleidigung war nur halb ernst gemeint; er hatte Wichtigeres im Sinn, als Ranulf aufzuziehen. »Weise die Diener an, alles einzupacken, was du brauchst«, sagte er zu seiner Frau. »Ich nehme dich mit zurück nach Cheshire und will gleich morgen los.«
Ranulf und Annora waren bestürzt, Maud verärgert. »Warum?«, fragte sie, und Chester schaute finster drein.
»Es sollte reichen, dass ich es dir sage.« Doch seine Beschwerde wirkte oberflächlich, vielmehr schien er verdächtig guter Laune zu sein. Maud beäugte ihn argwöhnisch, denn sie wusste von früheren Anlässen, dass er meistens so froh gestimmt war, wenn er über anderer Leute Missgeschick nachsann. Und tatsächlich – seine schwarzen Augen funkelten in der verdrehten Freude, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. »Wie bei den alten Ägyptern ist eine Plage über uns gekommen«, verkündete er dramatisch. »Geoffrey de Mandeville hat rebelliert.«
Seine Enthüllung löste genau das Chaos aus, das er bezweckt hatte, und sofort musste er jede Menge Fragen abwehren, die schneller als Pfeile angeschossen kamen. »Wenn ihr aufhört, alle auf einmal zu reden, sag ich euch, was ich weiß«, protestierte er. »Mandeville hat Bischof Nigels Abwesenheit ausgenutzt, um die Isle of Ely zu erobern und die Burg Aldreth einzunehmen. Dann ist er nach Ramsey vorgerückt, hat die Mönche vertrieben und ihre Abtei besetzt.«
»Glaubst du wirklich, er würde sich trauen, Lincoln zu belagern, Randolph?«, fragte Maud skeptisch. Er schüttelte den Kopf.