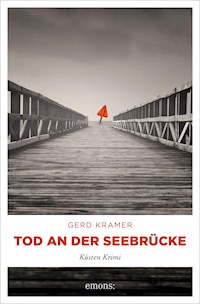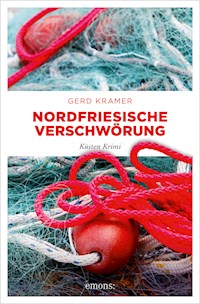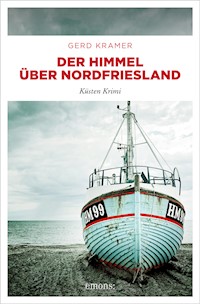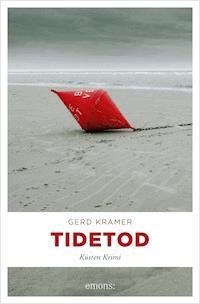
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Flottmann und Hilgersen
- Sprache: Deutsch
Ein hochsensibler Musiker und ein rheinländischer Kommissar ermitteln an der Küste und treffen auf einen Täter, der tödliche Fallen stellt. Ein Serienmörder entführt seine Opfer, um ein perfides Spiel zu spielen: Nur durch mutiges und kluges Handeln können sie dem Tod entkommen. Die Husumer Kommissare Flottmann und Hilgersen stehen vor einem Rätsel. Was ist das Motiv des Täters, und wie lässt sich der Wahnsinn stoppen? Kann Musiker Leon Gerber mit seinem hochsensiblen Gehör auch in diesem Fall wertvolle Hinweise liefern? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Kramer wurde 1950 in der Theodor-Storm-Stadt Husum geboren und ist dort aufgewachsen. Nach seinem Physikstudium in Kiel arbeitete er als Akustiker und Software-Entwickler im Rheinland. 1987 gründete er eine eigene Firma, in der er noch heute tätig ist. Einen Teil des Jahres verbringt er in seiner Heimatstadt, die ihm den Stoff für seine Romane liefert.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: kallejipp/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-396-7
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Heut bin ich über Rungholt gefahren,Die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren.Noch schlagen die Wellen da wild und empört,Wie damals, als sie die Marschen zerstört.Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte,Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte:Trutz, Blanke Hans.
Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden,Liegen die friesischen Inseln im Frieden.Und Zeugen weltenvernichtender Wut,Taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut.Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten,Der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten.Trutz, Blanke Hans.
1
»Charly! Aufstehen!«, rief die Mutter und pochte an die Zimmertür. Wieso nannte sie ihn Charly? Das taten nur seine Freunde und Klassenkameraden. Manchmal auch seine ältere Schwester. Er mochte den Spitznamen, der sich amerikanisch und irgendwie verwegen anhörte. Aber er wollte nicht in die Schule. Heute nicht. Er war so unendlich müde. »Charly!«
Ein Ruck ging durch seinen Körper, als er aufwachte. Ein Traum aus der Kindheit, nichts weiter. Er öffnete die Augen. Wieso war es so dunkel? Stockdunkel. Mouches volantes, fliegende Mücken, huschten im Takt der Augenbewegung durch sein Blickfeld. Aber kein Lichtstrahl erreichte die Netzhaut. Und wieso hörte das Klopfen nicht auf, obwohl er wach war? Dazu dieses permanente Plätschern.
Sein Rücken schmerzte. Es war bitterkalt. Die Luft schmeckte salzig und roch nach Meer. Der harte Untergrund, auf dem er lag, schwankte. Keine Frage, seine Sinne spielten verrückt. Nichts passte zusammen. War er immer noch in einem absurden Traum gefangen?
Er führte die Hand zu den Augen. Etwas Glattes hatte sich fest über seine Lider gelegt. Es gelang ihm, ein Stück abzulösen. Endlich wurde es ein wenig hell. Erste Konturen waren zu erkennen: dunkle Regenwolken, die über den Himmel jagten, bedrohlich, als würden sie ein Unheil ankündigen. Hektisch zog er am Klebeband. Mit dem Daumennagel durchtrennte er es und riss es sich vom Kopf. Ein kurzer Schmerz signalisierte, dass er ein Büschel Haare mit erfasst hatte. Er stützte sich mit den Ellbogen ab und richtete seinen Oberkörper auf. Sein Atem stockte. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, und der Verstand weigerte sich, zur Kenntnis zu nehmen, was die Augen mitteilten.
Was er sah, konnte nicht sein. Es ergab einfach keinen Sinn. Er lag in einem Boot, auf dem offenen Meer. Das war unlogisch. Ein verdammter Irrtum! Er schloss für einen Moment die Augen und hoffte, dass die Halluzination verschwunden wäre, sobald er die Lider wieder öffnete. Aber die Realität ließ sich nicht auf diese Weise überlisten.
Er rappelte sich auf und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wandung. Was war passiert? Was hatte ihn in diese Lage gebracht? Nein. Die Frage war falsch gestellt. Wer hatte ihn betäubt, entführt, ihm die Augen verbunden und ihn mitten auf dem Meer ausgesetzt? Und warum? Das musste ein übler Scherz sein, ein ganz mieser Streich, den sich jemand für ihn ausgedacht hatte. Das war die einzige Erklärung. Oder trachtete ihm jemand nach dem Leben? Hatte ihn jemand auf dem Meer ausgesetzt, damit er hier elendig verrecken sollte?
Er kramte seine letzten Erinnerungsfetzen zusammen: Auf dem Parkplatz hatte ein Auto direkt neben seinem gehalten. Der Fahrer war ausgestiegen, hatte an die Scheibe geklopft und ihn irgendetwas gefragt. Das Gesicht hatte er nicht sehen können, nur eine bedrohliche Bewegung, eine Hand, die durch das offene Fenster griff. An dieser Stelle riss der Film.
Was auch immer geschehen war, es galt jetzt, einen klaren Kopf zu bewahren, die Lage zu analysieren und überlegt zu handeln. Er war vollständig auf sich allein gestellt. Die eisige Kälte machte ihm zu schaffen und behinderte ihn beim Nachdenken. Wo befand er sich? Rechter Hand konnte er ein Ufer im Nebeldunst erkennen. Auch auf der linken Seite glaubte er, Festland zu sehen. Das war beruhigend. Sein Blick wanderte in alle Richtungen über die Wasseroberfläche. Nirgendwo ein Schiff. Aber jemand musste das Boot hierhergeschleppt haben.
Es war zwar alt und marode, würde jedoch den Wellen standhalten. Die See war bewegt, aber wenn kein Sturm aufkam, hatte er nicht zu befürchten, dass der Kahn sank. Die Sitzbank war ausgebaut worden, und die Ruder fehlten. Mit bloßen Händen würde er kaum gegen die Strömung ankämpfen können.
Sein Blick fiel auf einen Rettungsring. Spontan ordnete er den Gegenstand als nützlich und beruhigend ein. Doch sofort machte sich ein ungutes Gefühl breit. Es wurde noch verstärkt durch eine leere Blechdose, die den Verdacht nährte, dass alles für einen bestimmten Zweck arrangiert worden war. Eine Kette hing über der Bordkante. Vermutlich befand sich an deren Ende ein Anker, denn entgegen seinem ersten Eindruck bewegte sich das Boot nicht vom Fleck. Wenn er den Anker liftete und sich treiben ließ, bestand vielleicht eine Chance, an Land zu gelangen – falls Wind und Strömung passten. Letzteres ließ sich bis zu einem gewissen Grad abschätzen. Auf keinen Fall durfte er überstürzt handeln.
Der Nebel hatte sich ein wenig verzogen. Er versuchte sich erneut zu orientieren. Seine Augen fixierten einen bestimmten Punkt in der Ferne. Ein Silo war zu erkennen und eine Mühle. Das war die Skyline der Halbinsel Nordstrand! Er war sich ganz sicher. Sein Herz machte einen Freudensprung. Er war nur etwa einen Kilometer vom rettenden Ufer entfernt. Konnte er so weit schwimmen? Vielleicht. Mit dem Schwimmring müsste er es schaffen. Nein. Seine Zuversicht schwand. Das Wasser war zu kalt. So unterkühlt, wie er bereits jetzt war, würde er keine zehn Minuten überleben.
Es bestand eine, wenn auch geringe, Chance, dass ihn jemand vom Ufer aus bemerkte. Vielleicht ein Tourist, der das Meer mit einem Fernglas beobachtete. Aber um diese Jahreszeit und bei der schlechten Sicht war das eher unwahrscheinlich. Außerdem würde derjenige vermutlich nicht erkennen, dass er in Gefahr schwebte.
Es gab eine weitere einfache Möglichkeit, sich aus der misslichen Lage zu befreien. In einigen Stunden musste Niedrigwasser sein. Das Watt zwischen Nordstrand und dem Festland fiel weitgehend trocken, und er würde ganz bequem durch den Schlick zum rettenden Ufer laufen können. Aber der Heverstrom! Der war mindestens fünfhundert Meter breit, an vielen Stellen sogar mehr als einen Kilometer. Und der führte stets Wasser. Wenn er sich mitten auf dem Wattenstrom befand, hatte er verloren. Allein wegen der Strömung hätte er kaum eine Chance, ihn zu durchschwimmen. Richtung und Stärke waren allerdings tideabhängig.
Ihm kam der Verdacht, dass ihm jemand eine Denkaufgabe gestellt hatte. Ein boshafter Scherzbold, der ihn beobachtete und sich amüsierte. Vielleicht war im Boot eine Kamera versteckt. Er verwarf den abwegigen Gedanken.
Etwa sechseinhalb Stunden lagen zwischen Hoch- und Niedrigwasser. Das wusste er. Aber wann war Hochwasser? Wenn das Wasser noch auflief, könnte es unter Umständen erst in acht Stunden oder noch später wieder flach genug sein. Er trug nur einen dünnen Pullover über dem Oberhemd und eine Jeans. Konnte er so lange bei der Kälte durchhalten? Ja, konnte er. Kein Problem. Aber angenehm würde es nicht werden.
Die Szene war so unwirklich, dass seine Planung ständig von der Frage nach dem Warum unterbrochen wurde. Was, verdammt noch mal, hatte das Ganze zu bedeuten, und wer steckte hinter diesem makabren Anschlag auf sein Leben? Der Rettungsring war eine plumpe Falle. Der sollte ihn verleiten, sich ins kalte Wasser zu stürzen, was den sicheren Tod bedeutete. Und die Blechdose? Ganz sicher lag sie nicht zufällig dort, sondern gehörte zum Arrangement und hatte irgendeine Bedeutung.
Sein Blick fiel erneut auf die Ankerkette. Erst jetzt bemerkte er, dass sie in einem blauen Kasten endete. Dort musste sie befestigt sein. Wenn die Strömung günstig war, wollte er versuchen, den Anker zu lichten und sich treiben zu lassen. Ein wenig würde er das Boot mit den Händen oder besser mit dem Rettungsring steuern können. Er brauchte etwas Schwimmfähiges, um die Strömungsrichtung feststellen zu können. Ein Geldschein würde es tun. Ein Griff zur Gesäßtasche. Das Portemonnaie mit Ausweis, Führerschein und Kreditkarten fehlte. Das Schwein hatte ihn beklaut. Welch ein Hohn!
Er fand ein Papiertaschentuch, eine Tankquittung und eine Rechnung des Restaurants, in dem er vor ein paar Tagen gespeist hatte. Die Schnipsel, die er ins Wasser warf, drifteten eindeutig in Richtung Festland. Es schien so, als wenn das Wasser noch stiege. Sobald der Höchststand erreicht war, würde sich die Strömungsrichtung umkehren. Wenn seine Überlegungen richtig waren, musste er jetzt handeln – oder auf Ebbe warten. Welche Entscheidung war richtig?
Er stand auf. Es war schwierig, auf dem schwankenden Untergrund das Gleichgewicht zu wahren. In gebückter Haltung tastete er sich an der Bordkante entlang. Dann kniete er nieder und zog an der Kette, bis er auf einen Widerstand stieß. Mit aller Kraft versuchte er, den Anker anzuheben. Doch das Gewicht zerrte umso mehr an seinen Armen, je weiter er vorankam. Ihm erschien es, als würde sich der Zug stufenweise vergrößern. Es war aussichtslos. Fast hätte er das Boot zum Kentern gebracht. Er ließ die Glieder durch seine Hände zurück ins Meer gleiten.
Dann umfasste er die Kette in der Nähe des Kastens, der aus dickem Stahl bestand. Vielleicht ließ sie sich aus der Verankerung reißen. Ein kräftiger Ruck, und das laute Geräusch aufeinanderschlagender Metalle erklang. Aber da war noch ein Geräusch. Es ließ das Blut in seinen Adern gefrieren. Er starrte auf den blauen Behälter. Was er sah, durfte einfach nicht wahr sein. Aus der Öffnung, durch die die Ankerkette führte, sprudelte Wasser. Auch aus den Seiten des Metallkastens quoll es hervor.
Abdichten!, schoss es ihm durch den Kopf. Aber womit? Mit Kleidungsstücken! Er riss Stücke aus seinem Oberhemd, ohne den Pullover auszuziehen. Damit versuchte er, die Löcher zu stopfen. Das gelang nur unvollständig. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich der Stoff vollgesogen. Insbesondere dort, wo die Kette austrat, floss das todbringende Nass fast ungehindert heraus.
Die Blechdose! Damit musste er das Wasser abschöpfen. Er rutschte auf den Knien über den Boden und griff nach der Dose. Die scharfe Kante schnitt ihm ins Fleisch. Blut tropfte aus der Wunde in das Gefäß. Er stieß einen Schrei aus. Was für ein mieses Spiel trieb man mit ihm? Während er schöpfte und das Wasser wütend über die Bordkante schleuderte, hielt er Ausschau nach seinem Gegner. Doch weit und breit nur Wasserwüste.
Er stülpte sich den Rettungsring über. Aber nach einiger Zeit störte dieser beim Wasserschöpfen, und er legte ihn wieder ab. Etwa alle zwei Sekunden musste er eine Dose ins Meer kippen. Wenn er das Gefäß verlor, war es vorbei. Mit bloßen Händen schaffte er den Durchsatz nicht. Aber wie lange würde er das Pensum durchhalten? Bereits jetzt schmerzten die Muskeln, und er musste die Hand alle paar Minuten wechseln. Wenn es ihm gelänge, den blauen Kasten zu öffnen, könnte er vielleicht das Loch darunter abdichten. Hätte er doch nur nicht an der Kette gezogen. Damit hatte er die Katastrophe ausgelöst, sozusagen den Stöpsel aus der Wanne gezogen. Genau das hatte sein Widersacher vorausgesehen. Es war eine eingeplante Falle, genauso wie der Rettungsring. Ein Teufel konnte nicht hinterlistiger sein.
Alles Schreien und Fluchen half nicht. Für einen Moment legte er die Blechdose aus der Hand und untersuchte den Kasten. Der war mit stabilen Schrauben am Boden befestigt. Ohne Werkzeug waren sie nicht zu lösen.
Er war überzeugt, dass der Entführer alles akribisch geplant hatte, und er war sich inzwischen sicher, dass er beobachtet wurde. Wenn auf dem Boot eine Kamera versteckt war, musste er sie finden. Das Schwein sollte sich nicht auch noch an seiner Verzweiflung aufgeilen. Solche Minispione konnten extrem klein sein, vielleicht nicht größer als ein Knopf. Er überlegte, wo die Linse den besten Überblick liefern würde. Am Bug, vielleicht auch am Heck. Er musste nicht lange suchen, um das runde, zentimetergroße Loch im Vorderteil des Bootes zu finden. Ein Sekunden anhaltendes Triumphgefühl durchfuhr ihn, als er es entdeckte. Obwohl sich seine Lage dadurch nicht verbesserte, motivierte ihn das Erfolgserlebnis. Er war seinem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert. Es gab die Möglichkeit, sich zu wehren. Mit einem Fetzen des Papiertaschentuchs verstopfte er die Öffnung. Wenn er schon sterben musste, sollte sich sein Mörder nicht an seinem Todeskampf ergötzen.
Das Wasser war inzwischen knöcheltief angestiegen, und er musste die Schöpfgeschwindigkeit erhöhen. Trotzdem ermüdete es ihn vielleicht weniger, wenn er nach jeder Minute eine kurze Pause einlegte. Zwar musste er anschließend das Arbeitstempo erhöhen, aber das Gefäß würde sich schneller füllen lassen, und seine Arme könnte er für kurze Zeit entlasten. Er probierte verschiedene Varianten aus und entschied sich für zwei Minuten Schöpfen und fünfzehn Sekunden Ausruhen.
Mit der Anstrengung wuchs seine Wut auf den, der ihm das antat. War er ein Zufallsopfer, oder hatte es jemand auf ihn abgesehen? Derjenige musste ihn abgrundtief hassen. Sosehr er auch nachdachte, ihm fiel niemand ein, der dafür in Frage kam.
Er zog den Ärmel des Pullovers über die Hand. So spürte er die scharfe Kante der Dose kaum noch. Die Armbanduhr zeigte, dass drei Stunden vergangen waren, seit das Wasser begonnen hatte, unaufhörlich ins Boot zu sickern. Hätte er nicht die Rettung vor Augen, hätte er vermutlich bereits aufgegeben. Aber er war sich sicher, dass der Wasserspiegel bereits wieder sank. Er musste also noch maximal sechs Stunden durchhalten, nur doppelt so lange, wie er bereits geschafft hatte. Wäre er in der Lage, sich ein Lot zu bauen, so hätte er die Wassertiefe messen können. Aber er hatte nicht einmal einen verdammten Bindfaden dabei. Vielleicht ließe sich aus dem Pullover so etwas basteln, indem er die Wolle aufriffelte und eine Münze an den Faden band. Sobald er im Wasser stehen konnte und es ihm nicht weiter als bis zu den Oberschenkeln ging, würde er die Kälte aushalten. Dann konnte er sich ausruhen und warten, bis das Watt freilag, oder langsam Richtung Ufer aufbrechen. Aber er hatte keine Zeit, um das Lot anzufertigen. Er musste schöpfen, immer weiter schöpfen.
Er zählte jeden Vorgang. Das half. Sechshundert war sein nächstes Ziel – siebenhundert – achthundert – neunhundert – tausend. Die Tausend war etwas Besonderes. Sie musste belohnt werden. Er gönnte sich eine ganze Minute Ruhepause. Und wieder musste er an den denken, der ihn in diese todbringende Lage gebracht hatte.
»Du verdammtes Schwein!«, schrie er. Dann griff er wieder zur Blechdose.
Aus den Augenwinkeln hatte er etwas gesehen, das sich bewegte. Abrupt schnellte er empor. Fast hätte er das Gleichgewicht verloren. Nicht weit von ihm entfernt war ein Modellflugzeug vom Wasser aufgestiegen, eines dieser Fluggeräte mit mehreren Propellern. Eine Drohne. Das Ding war die ganze Zeit über da gewesen. Jetzt flog es etwa zehn Meter in die Höhe, blieb dort eine Minute stehen, um anschließend wieder auf den Schwimmkufen zu landen. Ohne Frage war es mit einer Kamera bestückt. Am liebsten hätte er mit dem nutzlosen Rettungsring nach der Drohne geworfen. Aber sie war zu weit weg, und er durfte seine Energie nicht vergeuden.
Nun stand er bis zu den Knöcheln im Wasser. Wie besessen tauchte er die Dose ein, um aus der Bewegung heraus den Inhalt weit vom Boot fortzuschleudern. Das kostete Kraft, aber es half gegen die Wut, die er nicht mehr bändigen konnte.
2
Der Mann am Monitor lehnte sich zurück. Beide Kameras lieferten zufriedenstellende Bilder. Bis hierhin funktionierte sein Plan perfekt. Er hatte wochenlang daran gefeilt, genau ausgerechnet, mit welcher Geschwindigkeit das Wasser eindringen würde, wie viel man mit einer Dose schöpfen konnte und wie lange ein sportlicher und gesunder Mensch durchhalten würde. Das hatte er in einem praktischen Versuch überprüft, indem er mit der gleichen Methode den Inhalt einer Badewanne in Eimer umfüllte.
Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser anstieg, in den Griff zu bekommen, war schwieriger gewesen. Sie hing nicht nur vom Querschnitt der Öffnung, sondern auch vom Gewicht des Probanden ab. Eine genaue Berechnung war nicht möglich. Wenn er sich zuungunsten des Delinquenten verschätzt hatte, musste der sich eben etwas mehr anstrengen.
Eine weitere Unsicherheit stellte das Betäubungsmittel dar. Um die richtige Dosierung herauszufinden, hatte er zahlreiche Selbstversuche durchgeführt. Zwar schwankten die Ergebnisse, aber letztendlich kam es auf eine halbe Stunde mehr oder weniger nicht an. Hauptsache, das Mittel wirkte lange genug, um das Boot zu positionieren, die Verankerung mit den schweren Stahlplatten anzubringen und mit dem Schlauchboot zurück ans Ufer zu rudern.
Die technischen Dinge zu realisieren, den Mechanismus für den Wassereinbruch und die Kameraübertragung, hatte ihm Spaß bereitet. Während der Arbeiten hatte er das Szenario immer wieder in Gedanken durchgespielt. Das hatte ihn angespornt und seine Erregung bis an die Schmerzgrenze gesteigert.
Aber jetzt würde er das Ganze in der Realität erleben. Das Bild auf dem Monitor zeigte den gesamten Bootsraum. Der Proband lag noch immer am Boden, aber er bewegte sich bereits. Endlich richtete er sich auf.
Die Kamera zoomte auf das Gesicht. Kein Schauspieler hätte die Mimik simulieren können. Die Verwirrung, gefolgt von Angst und Panik, und schließlich die Ratlosigkeit ließen sich nicht authentisch nachspielen. Er glaubte, jeden Gedanken des Probanden lesen und dessen nächste Handlung voraussagen zu können. Nein, nicht alles war kalkulierbar. An bestimmten Punkten musste der Delinquent Entscheidungen treffen. Wählte er die falsche Alternative, hatte das unweigerlich seinen Tod zur Folge. Er musste nachdenken und klug handeln.
Machte es einen Unterschied, ob ein fremdes oder das eigene Leben bedroht war? Strengte man sich mehr an, wenn man selbst betroffen war? War das eigene Leben wertvoller als das eines Fremden, als das eines unschuldigen Kindes? Quälende Fragen, auf die es eine Antwort geben musste.
Der Monitor wurde dunkel. Der Delinquent hatte die Kameralinse entdeckt. Auch dieser Fall war eingeplant. Der Gegenspieler war nicht dumm und konnte offenbar auch in Extremsituationen überlegt handeln, jetzt, da er selbst in Gefahr schwebte.
Mit einem Tastendruck schaltete er auf die Drohnenkamera um. Das Bild wackelte trotz der Stabilisatoren. Auch Ausschnitt und Vergrößerung waren nicht optimal. Aber er konnte den schwimmenden Quadrocopter jederzeit starten und über Funk die gewünschte Position und Perspektive realisieren. Sogar eine Reihe von vordefinierten Koordinaten stand zur Verfügung, die per Funktionstaste abgerufen werden konnten. Es hatte viel Zeit gekostet, sich in die komplexe Thematik der Technik und Steuerung einzuarbeiten. Was er brauchte, gab es nicht von der Stange. Auch die Reichweite der Funkübertragung war zu gering gewesen. Das Problem hatte er mit einer Zwischenstation und einem Verstärker gelöst, die in einem gut getarnten Versteck auf dem Festland untergebracht waren. Nach Beendigung des Projekts wollte er sie abbauen. Die Ausrüstungsgegenstände, die sich auf dem Boot befanden, konnten dort verbleiben. Er hatte streng darauf geachtet, nur übliche Handelsware zu verwenden, damit keine Rückschlüsse auf ihn möglich waren. Etwaige Fingerabdrücke oder DNA-Spuren, die nicht vollständig zu vermeiden waren, würde das Salzwasser vernichten.
Das Styropor an den Standfüßen, das die Landung des Copters auf dem Wasser ermöglichte, veränderte dessen Flugeigenschaften. Dazu kam das Abdriften mit dem auf- und ablaufenden Wasser. Fast wäre er an den vielfältigen Problemen gescheitert. Aber das Projekt war jede Mühe wert. Es gab ihm den Sinn des Lebens zurück, der ihm vor einiger Zeit vollständig verloren gegangen war.
Den Anker konnte selbst der stärkste Mensch nicht lichten. Das Gesamtgewicht der Stahlplatten war zu hoch. Vom Bootsboden aus hatten sich die Platten einzeln über Bord werfen lassen. Auch der Transport vom Auto bis zum Liegeplatz war mit einer Sackkarre kein Problem gewesen. Aber jetzt lagen sie so tief im Wasser und waren so eng miteinander verbunden, dass sie sich nicht stückweise herausziehen ließen. Das hatten die Berechnungen und Tests ergeben. Außerdem waren sie vermutlich tief in den Schlick eingesunken.
Der Delinquent zog, wie erwartet, am anderen Ende der Kette. Eine unüberlegte und falsche Entscheidung! Jetzt würde er sich anstrengen müssen, um das Wasser in Schach zu halten. Vielleicht bis zur völligen Erschöpfung. Aber ihm blieb immer noch eine faire Chance zu überleben.
3
Bettina Grünenbach sah auf die Uhr. Der Termin bei der Bank hatte länger gedauert, als sie einkalkuliert hatte. Spätestens in einer halben Stunde musste sie Denise ablösen, die auf ihre Tochter aufpasste. Immerhin war das Beratungsgespräch erfolgreich verlaufen. Die Konditionen für das neue Hypothekendarlehen waren gut, und sie musste nur eine geringfügige Vorfälligkeitsentschädigung für die Ablösung ihres alten Kredits zahlen.
Sie eilte die Asmussenstraße entlang, in der sie ihr Fahrzeug abgestellt hatte. Tauwetter hatte eingesetzt, und ein kräftiger Wind trieb den Nieselregen vor sich her. Den Enten im Schlossgraben schien das Wetter nichts auszumachen. Auch die Französische Bulldogge, die einen alten Mann hinter sich herzog, hatte offenbar kein Problem damit.
Bettina musste nur noch die Straße überqueren. Dort stand ihr Auto in einer Parkbucht. Sie blieb auf dem Bürgersteig stehen und suchte in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel, als sie einen Motor aufheulen hörte. In etwa fünfzig Metern Entfernung sah sie einen Geländewagen, dessen Scheinwerfer mehrmals aufblendeten. Der Fahrer war hinter den getönten Scheiben nicht zu erkennen.
Ein ungutes Gefühl breitete sich in ihrer Magengegend aus. Sie musste an verschiedene Ereignisse der letzten Wochen denken. Zwar war jedes einzelne für sich nicht besonders beunruhigend gewesen, aber die Summe aller merkwürdigen Vorfälle bereitete ihr Unbehagen. Mit dem Schlüssel in der Hand machte sie einen Schritt auf die Fahrbahn, schreckte jedoch sofort zurück, als der fremde Wagen mit durchdrehenden Reifen anfuhr. Mit hoher Geschwindigkeit raste er auf sie zu. Starr vor Schreck war sie unfähig zu reagieren. Sie spürte den Luftzug und den Schwall aus Wasser und Schneematsch, der gegen ihren Körper und ihr Gesicht prallte. Reflexartig schloss sie die Lider. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie den Geländewagen davonfahren. Für einen Moment war sie erleichtert. Dann schaute sie an sich herab. Ihre Angst verwandelte sich blitzschnell in Wut und verleitete sie zu einem lauten Fluch.
»Ich hab alles beobachtet.« Der Mann mit der Bulldogge kam auf Bettina zu. Er gab dem Hund ein paar Meter Leine, damit der am Verkehrsschild schnüffeln konnte. »Das war Absicht, sage ich Ihnen. Um ein Haar hätte er Sie erwischt. Sie sollten ihn anzeigen.«
»Haben Sie das Kennzeichen gesehen?«
»Äh. Nein. Der war so schnell wieder weg. Trotzdem sollten Sie zur Polizei gehen.«
»Danke. Vielleicht mach ich das.«
Bettina nickte ihm freundlich zu und ging zu ihrem Auto.
Kaum hatte sie die Haustür geöffnet, stürmte Nathalie ihr entgegen. »Mama, ich hab beim Memory gewonnen. Dreimal, und Denise hat nur einmal ganz knapp gewonnen.«
»Wow. Großartig.« Bettina nutzte den Schwung ihrer Tochter, hob sie hoch und vollführte mit ihr eine vollständige Drehung.
»Du bist ja ganz nass«, sagte Nathalie, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte. »Und schmutzig.«
»Was ist passiert?«, fragte Denise, nachdem Nathalie in ihr Zimmer gelaufen war, wo es offenbar etwas Wichtiges zu tun gab.
»Ein Auto hat mir Dreck entgegengeschleudert. Es kam mir so vor, als hätte der Fahrer das mit Absicht gemacht.«
»Hast du erkannt, wer es war?«
»Nein, irgendjemand mit einem schwarzen Geländewagen. Ich werde mich gleich erst einmal umziehen. Gab es bei euch etwas Besonderes?«
»Außer, dass Nathalie mich ständig beim Memory besiegt, gibt es nichts zu berichten.« Denise Schuster lachte. »Allerdings hat das Telefon wieder ein paarmal geklingelt, und niemand war dran. Ich finde das unheimlich.«
Bettina nickte. »Das geht schon seit einigen Wochen so. Ich überlege, ob ich den Festnetzanschluss für einige Zeit stilllege. Mein Handy hab ich immer dabei, und bisher hat der ominöse Anrufer noch nicht unter der Mobilfunknummer angerufen. Also, falls du mich nicht erreichst, weißt du Bescheid.«
»Okay. Nathalie ist wirklich ein Engel. Es macht Spaß zu sehen, wie sie sich entwickelt. Bis Montag dann. Die Post hab ich auf den Esszimmertisch gelegt.«
»Danke.«
Nathalie hatte Denise bereits am ersten Tag ins Herz geschlossen. Manchmal erwischte sich Bettina Grünenbach dabei, dass sie eifersüchtig auf die Kinderfrau war, die mit ihren einundzwanzig Jahren einen unbefangenen Zugang zu dem Kind hatte. Die beiden lachten und spielten zusammen, fast wie es Gleichaltrige taten. In einigen Monaten würde sie sich für den Vormittag eine neue Betreuung suchen müssen. Denise hatte ihre Ausbildung als Bankkauffrau abgeschlossen und plante, Betriebswirtschaft zu studieren. Bettina hoffte, rechtzeitig eine neue, ähnlich zuverlässige Betreuung für Nathalie zu finden.
Bettina warf einen Blick ins Zimmer ihrer Tochter. Nathalie saß auf dem Boden und versuchte, einen Ponyhof aus hundert Puzzleteilen zusammenzusetzen. Vermutlich würde das Projekt noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.
Bettina ging ins Esszimmer und blätterte die Post durch: ein Schreiben von der Stadtverwaltung über die zu entrichtende Grundsteuer, Prospekte mit Sonderangeboten, die Fernsehzeitschrift und ein Umschlag ohne Absender. Da die Anschrift von Hand geschrieben war, weckte der Brief sofort ihr Interesse. Sie riss den Umschlag auf und entnahm ein Blatt, auf dem in großen, gedruckten Buchstaben stand: »13 Tage«. Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Sollte das ein Scherz sein? Nein, das war kein Scherz. Obwohl sie keine Ahnung hatte, was die Nachricht zu bedeuten hatte, stellte sich sofort ein beklemmendes Gefühl ein. Dreizehn Tage. Absolut nichts verband sie mit der Zeile. Aber irgendwie wirkte der Text bedrohlich. Sie zerriss das Papier und entsorgte es, aber die Schriftzeichen brannten sich in ihr Gedächtnis ein und verfolgten sie den ganzen Tag. Anstatt dass sie verblassten, gewannen sie an Gewicht, verbanden sich unwillkürlich mit Ereignissen der letzten Tage und Wochen, mit den Anrufen des Unbekannten, dem Fahrer des schwarzen Autos, der das Haus zu beobachten schien, dem Fremden, der sich in der Klinik nach ihr erkundigt hatte, und der heutigen Attacke des Geländewagens.
Einen Augenblick überlegte sie, ob sie die Polizei rufen sollte. Aber was hätte sie der erzählen sollen? Und was konnten die Beamten schon unternehmen? Vielleicht war ja auch alles ganz harmlos, und sie hatte es mit einem Spinner zu tun, der Spaß daran fand, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Dreizehn Tage. Irgendeine Bedeutung musste das haben.
Bettina liebte ihre Arbeit in der Klinik. Mit den Kollegen verstand sie sich gut, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Auch der Tagesablauf funktionierte dank Denise einigermaßen. Natürlich war es in der Zeit, als Maik sich um Nathalie gekümmert hatte, einfacher gewesen. Damals schien das Familienglück in greifbarer Nähe zu sein. Heute wusste sie, dass sie die Probleme nicht gesehen hatte, vielleicht auch nicht hatte sehen wollen. Jetzt hatte er eine Neue. Sie nahm sich sicher mehr Zeit für ihn und umsorgte ihn.
Vielleicht wäre alles anders gelaufen, wenn Nathalie sein eigenes Kind gewesen wäre. Dabei hatten die beiden sich gut verstanden. Aber die Vaterrolle mit den zugehörigen Pflichten hatte er letztendlich nicht annehmen wollen. Das wäre in Ordnung gewesen, wenn er doch nur darüber geredet hätte.
Dann war ihm diese Veronika über den Weg gelaufen, attraktiv, unternehmungslustig – und leider dazu noch sexy. Eigenschaften, die Bettina auch sich zuschrieb, die zumindest noch im Verborgenen schlummerten. Stress und Alltag hatten sie verdrängt. Aber irgendwann würden sie wieder hervorkommen. Und vielleicht würde sie dann auch einen neuen Partner finden.
Dreizehn Tage. Bettina holte die Papierfetzen aus dem Abfalleimer und legte sie in die Küchenschublade zu den Rezepten, für den Fall, dass der Zettel noch Bedeutung erlangen sollte.
Sie hörte ihre Tochter rufen. Nathalie brauchte Hilfe bei ihrem Puzzle.
Als am Abend das Telefon klingelte, erschrak Bettina. Die anonymen Anrufe hatten Spuren hinterlassen. Einen Moment überlegte sie, ob sie das Klingeln ignorieren sollte, nahm aber das Gespräch dann doch an. Sie war froh, dass es Laura Sonntag war.
»Hier ist Laura. Störe ich?«
»Nein, ganz und gar nicht. Nathalie schläft bereits.«
»Sag mal, könnte Sophia am Samstag bei euch übernachten? Das wäre prima.«
»Kommenden Samstag? Ja, kein Problem. Da hab ich keinen Dienst in der Klinik. Nathalie wird sich freuen. Bring Sophia vorbei, wann du willst.«
»So gegen sechzehn Uhr?«
»Klar. Während die beiden miteinander spielen, schaffe ich es vielleicht, endlich mal ein Buch zu Ende zu lesen.« Bettina lachte.
»Toll. Ich möchte nämlich mit meinem Nachbarn ein Konzert besuchen. Es ist wichtig für mich.«
»Der Musiker?«
»Ja. Er wird dort zusammen mit einer Band auftreten.«
»Sophia ist immer willkommen.«
»Danke, Bettina. Bis Samstag.«
»Bis dann, Laura.«
Bettina Grünenbach war beim Fernsehen im Sessel eingeschlafen. Das passierte ihr nicht oft. Manchmal, wenn sie einen anstrengenden Tag gehabt hatte, geriet sie in einen kurzen Dämmerzustand. Aber an diesem Abend verpasste sie das Ende eines gar nicht einmal so schlechten Kriminalfilms. Nun wusste sie nicht, wer der Mörder war. Aber irgendwann gab es eine Wiederholung. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche.
Sie schaltete den Fernseher mit der Fernbedienung aus und löschte die fast vollständig heruntergebrannte Kerze auf dem Couchtisch. Trotzdem blieb es erstaunlich hell im Wohnzimmer. Das Licht schien von draußen herein. Der Vollmond erleuchtete die Terrasse und den schneebedeckten Rasen. Der Ahornbaum am Ende des Gartens warf gespenstische Schatten, die sich im Wind bewegten. Doch da war noch etwas. Für den Bruchteil einer Sekunde huschte etwas am Fenster vorbei. Vielleicht ebenfalls nur der Schattenwurf eines Strauchs. Doch sie hatte die Konturen eines Menschen wahrgenommen. Sicher war sie sich nicht. Auch hörte sie keine verdächtigen Geräusche. Ein Schauder lief ihr über den Rücken, und Gänsehaut breitete sich über ihre Arme aus.
Sie ging zum Fenster. Von dort konnte sie das gesamte Grundstück des Reihenhauses überblicken. Sie musste sich geirrt haben. Draußen war nichts. Vielleicht hatten sie die Anrufe und der Brief mehr verunsichert, als sie sich eingestehen wollte.
Sie prüfte, ob alle Außentüren und Fenster verschlossen waren, und drehte den Schlüssel der Eingangstür zweimal herum. Dann sah sie noch einmal nach Nathalie, die ihren Stoffelefanten Benji fest im Arm hielt und vermutlich von den Ereignissen des Tages träumte.
Bettina ließ die Tür einen Spalt offen und ging in ihr Zimmer, das sich direkt neben dem ihrer Tochter befand. Ein mulmiges Gefühl blieb, bis sie einschlief.
4
Sie sollte leiden, so wie er gelitten hatte, fühlen, was er hatte aushalten müssen. Aber auch ihr wollte er eine Chance geben. Würde sie überhaupt kapieren, worum es ging? Wenn sie auch nur das geringste Maß an Verantwortungsbewusstsein besaß, das man von einer Ärztin erwarten konnte, musste sie sich ihr Fehlverhalten eingestehen. Auch nach all den Jahren müsste sie ein schlechtes Gewissen haben.
Er würde sie zum Nachdenken zwingen. Sie einfach zu töten wäre sinnlos. Nach dem Tod war alles vorbei. Man hatte keine Möglichkeit mehr, etwas einzusehen und zu bereuen. Zumindest ein paar Stunden musste er allen Delinquenten gewähren, um über sich nachzudenken. Dr. Bettina Grünenbach wollte er viel Zeit dafür geben.
Bei dem, was er vorhatte, waren besondere Vorsicht und Vorbereitung geboten. Fehler konnte er sich nicht leisten. Irgendwann würde man auf ihn kommen. Damit rechnete er. Aber noch war es zu früh. Vielleicht schaffte er es, das gesamte Vorhaben zu realisieren. Dann konnte er beruhigt abtreten.
Helena stellte ein Problem dar. Sie stand ihm zur Seite, hatte seine Trauer und Verzweiflung ertragen. Als sie sich kennenlernten, dachte er, er hätte den Tiefpunkt überwunden. Aber das war ein Irrtum gewesen. Es schien bergauf zu gehen, bis zum nächsten Absturz, der noch heftiger war als die vorhergehenden. Nur sein Plan konnte ihn wieder aufrichten. Bereits die Vorbereitungen für das nächste Projekt linderten die Schmerzen, und nach gelungener Durchführung würde er sich wieder etwas besser fühlen. Wenn alles überstanden war, würde er vollständige Ruhe finden, so oder so.
Sollte er überleben, vielleicht sogar unentdeckt bleiben, wollte er ein neues Leben beginnen, irgendwo in der Ferne, weit weg von hier. Dort, wo keine Erinnerungen an Orten, Personen und Gegenständen hafteten. Neu und ohne Vorbelastung musste die neue Heimat sein. Wenn alles gut ging, würde er vielleicht sogar Helena mitnehmen.
Sie hielt zu ihm und half ihm. Zu ihrem eigenen Schutz durfte sie nicht alles wissen. Sie war nicht stabil genug. Er schloss nicht einmal aus, dass sie ihn verraten würde, wenn sie alles erfuhr. Das musste er in jedem Fall verhindern.
Er selbst war überzeugt, dass er nach getaner Arbeit mit allem abschließen konnte. Sie würde das nicht schaffen. Aber das neue Leben sollte möglichst frei von düsteren Erinnerungen sein. Nichts sollte zwischen ihnen stehen. Vielleicht würde er es irgendwann sogar schaffen, sie zu lieben. So etwas konnte wachsen. Nicht so, wie er Jennifer geliebt hatte, aber genug, um mit ihr das Leben zu teilen.
Auch das Kind war ein Problem. Er hatte Helena versprechen müssen, dass der Kleinen nichts passierte. Wenn er sich nicht daran halten konnte, würde sie es aus der Presse erfahren. Ein totes Kind rief die gesamte Meute auf den Plan. Doch so weit würde es nicht kommen. Die Ärztin tat, was er verlangte. Da war er sich sicher – fast sicher.
Er musste einen klaren Kopf behalten. Das war nicht einfach. Die Tabletten, die der Quacksalber ihm verschrieben hatte, minderten die Depressionen, aber sie vernebelten sein Gehirn. In der jetzigen Phase seines Vorhabens durfte er sie nicht einnehmen. Alkohol trank er nur noch selten. Ab und zu gönnte er sich ein Glas Wein oder eine Flasche Bier. Erstaunlicherweise fiel es ihm gar nicht schwer maßzuhalten. Der Rausch, den er bei der Planung und Durchführung seiner Projekte empfand, war um ein Vielfaches stärker als der, den eine Flasche Whisky hergab. Außerdem hatte das Trinken keinen Sinn, löste keine Probleme, anders als der Kampf gegen Ungerechtigkeiten und gegen das Vergessen. Er hatte einen langen Weg gehen müssen, bis ihm das klar geworden war.
Ohne Helena hätte er nicht die Kraft gehabt, sich aus dem Sumpf zu ziehen und die Initiative zu ergreifen. Bevor er sie kennenlernte, hatte er in den Tag hineingelebt und sich nur mit sich selbst beschäftigt. Die Trauer hatte sich in seiner Seele festgefressen. Auch der Psychiater hatte nicht erkannt, dass er ein Ventil brauchte, dass er aktiv werden musste, um sich vom Dauerschmerz zu befreien.
Er selbst hätte viel früher auf die Lösung kommen müssen. Als Kind hatte er Strategien entwickelt, um sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren. Nach jeder Gemeinheit von Spiel- oder Klassenkameraden hatte er tagelang über Vergeltung nachgedacht. Aus heutiger Sicht ging es ihm allerdings auch damals weniger um Rache als um die Befriedigung, die eintrat, wenn er sich revanchiert hatte. Dann war die Sache abgeschlossen, ausgeglichen. Der Ärger war verschwunden, als hätten sich zwei gegensätzliche Ladungen kompensiert. Dank guter Vorbereitung war er selten erwischt worden. Aber meist hatten die Betroffenen geahnt, wer hinter dem Gegenangriff steckte, ohne es beweisen zu können. Das war dann sein größter Triumph gewesen. Seine Methode zwang sie, über ihre Taten nachzudenken, sie vielleicht sogar zu bereuen. Mit der Zeit hatte ihm seine Gegenwehr einen gewissen Respekt verschafft. Trotzdem war er ein Außenseiter geblieben.
Damals war es um Kinkerlitzchen gegangen. Jetzt ging es ums Ganze, um Leben oder Tod. Umso wichtiger waren die Vorbereitungen. So weit wie möglich durfte nichts dem Zufall überlassen bleiben. Das war er nicht nur sich, sondern auch den Delinquenten schuldig. Jeder von ihnen sollte seine Chance erhalten und eine Gelegenheit, über sich nachzudenken.
5
Das Wetter spielte in den letzten Tagen verrückt. Schneefall und Regen lösten sich mehrfach ab. Die Temperaturen pendelten ständig um den Nullpunkt herum und sorgten für gefährliches Glatteis. Heute waren frostige Minusgrade mit Neuschnee an der Reihe. Ohne Winterreifen hätte Leon Gerber mit seinem alten Daimler keine Chance, das Ziel zu erreichen. Er war drauf und dran gewesen, seine Teilnahme abzusagen. Aber das konnte er Laura nicht antun. Sie hatte mit dem Bandleader der »Acoustic Food« und dem Veranstalter des Konzerts, Johnny Altmeier, gesprochen und Gerbers Auftritt klargemacht. Für die Band hatte Gerber vor einigen Monaten eine Gitarrenspur für deren CD eingespielt. Die Aufnahme hatte er in seinem eigenen Tonstudio durchgeführt. Persönlich kannte er die vier nicht, aber er mochte ihre Musik, eine Mischung aus Country, Folk und Blues, ausschließlich mit akustischen Instrumenten gespielt. Auch das Konzert war als »unplugged« angekündigt.
Laura hatte ihn lange überreden müssen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sein letzter Auftritt lag über fünf Jahre zurück und war ein ziemlicher Reinfall gewesen. Nach einer halben Stunde war er von der Bühne abgetreten. Nichts hatte gestimmt, mehrmals hatte er sein Spiel unterbrechen müssen, um seine Gitarre nachzustimmen, ein Fingernagel war eingerissen und hatte hässliche Obertöne erzeugt, dazu ein lautes Publikum und eine miserable Raumakustik. Dabei wusste er, dass er selbst das Problem war. Sein verbissener Hang zur Perfektion stand ihm im Wege. Er schaffte es einfach nicht, seinen Anspruch an sich herunterzuschrauben. »Du hast das Tick-Syndrom«, hatte sein verstorbener Freund Michael ihm einmal gesagt. Manchmal half es, wenn Gerber sich an die Worte erinnerte. Ob es heute half, wusste er nicht. Laura hatte ihn überzeugt, einfach ins kalte Wasser zu springen. Sonst würde er den »Tick« niemals loswerden.
Immerhin musste er diesmal nur zehn Minuten durchhalten, für zwei eigene Lieder. Den Rest des Abends würde die Band bestreiten. Trotzdem war er aufgeregt.
Die Veranstaltung fand in einer alten Scheune im kleinen Ort Struckum statt, nicht weit entfernt von der Windmühle Fortuna, in der der bekannte Liedermacher Hannes Wader lange Zeit gelebt hatte.
Gegen achtzehn Uhr klingelte Laura an Gerbers Tür. Eine kurze Umarmung und ein flüchtiger Kuss.
»Bist du startklar?« Sie trat ein, blieb aber im Flur stehen. Ihre Schuhe hinterließen feuchte Abdrücke auf den Fliesen. Mit der Hand rubbelte sie den Schnee aus ihren Haaren.
»Komm rein.«
»Lieber nicht. Ich müsste sonst Mantel und Schuhe ausziehen.«
»Okay. Ich hole nur meine Gitarre.«
Gerber holte das Instrument aus dem Studio und zog seine Jacke über.
»Ich weiß nicht, ob mein Wagen bei dem Wetter anspringt«, sagte er auf dem Weg zur Garage.
»Keine Ausrede! Meiner ist zwar in der Werkstatt, aber es gibt ja auch noch Taxis.«
»Jedenfalls solltest du deinen Mantel anbehalten.«
»Ich weiß. Die Heizung.« Sie lachte. »Vielleicht solltest du dir mal ein neues Auto leisten.«
»Mein guter alter Daimler tut es ja noch. Jedenfalls im Sommer.« Er öffnete die Heckklappe und verstaute den Gitarrenkoffer.
Irgendwann würde er endlich eine Fernbedienung für das Garagentor einbauen. Das hatte er sich bereits vor langer Zeit vorgenommen. So musste er nach dem Herausfahren aussteigen und das Tor von Hand schließen.
»Hast du dich vorbereitet?«, fragte Laura während der Fahrt. »Ich meine mental.«
»Ich hab deinen Vorschlag umgesetzt.«
»Welchen?«
»Ich hab die Gitarre ein wenig verstimmt und fast eine halbe Stunde gespielt.«
»Wow! Das ist ein Fortschritt, Leon.« Ihre Stimme drückte eine Mischung aus Bewunderung und Ironie aus. »Und? Wie war es?«
»Es tat weh. Sehr weh.« Er grinste, obwohl ihn die Therapie tatsächlich große Überwindung gekostet hatte.
»Und du spielst heute Abend einfach weiter. Klar? Egal, was passiert. Sogar, wenn dir eine Saite reißt. Versprochen?«
Er antwortete nicht.
»Versprochen?«
»Ja, ja.« Zu diesem Zeitpunkt ahnte er nicht, dass er sein Versprechen brechen würde.
Mehrmals geriet der Benz ins Schlingern. Erst als sie die freigeräumte Osterhusumer Straße erreichten, konnte Gerber beschleunigen. Es hatte zwar aufgehört zu schneien, aber stellenweise spiegelten sich die Lichter der entgegenkommenden Autos gefährlich auf dem Asphalt. Er konzentrierte sich auf das Fahren und vermied, sich gedanklich mit dem bevorstehenden Auftritt zu beschäftigen.
Struckum war wie ausgestorben. Die Einwohner saßen zu dieser Zeit und bei diesem Wetter vermutlich am Kachelofen und tranken ihren Tee. Fremde und Touristen verirrten sich im Winter selten in die Gegend. Von der B 5 bog er in Richtung Cecilienkoog ab. Nach etwa einem Kilometer hatten sie ihr Ziel erreicht. Die Scheune gehörte zu einem Bauernhof, der nicht mehr bewirtschaftet wurde. Gerber kannte den Veranstaltungsort von Bildern, war jedoch noch nie dort gewesen.
Er parkte den Wagen vor dem Backsteingebäude, das von farbigen Scheinwerfern angestrahlt wurde. Ein Mann in blauem Overall und Pudelmütze versuchte, mit Hilfe einer langen Stange Eiszapfen vom Dachüberstand abzuschlagen. Nur wenige Autos befanden sich auf dem Innenhof, der mit Kopfsteinpflaster ausgelegt war. Laura und Gerber stiegen aus. Der Schnee knirschte unter ihren Schuhen. Gerber hatte das Geräusch ganz sicher in seiner Geräuschedatenbank. Er konnte sich noch an die Aufnahme erinnern, die er vor drei Jahren gemacht hatte. Es hatte ähnlich hoher Schnee gelegen wie an diesem Abend. Aber die Schritte klangen damals anders als heute. Sicher hingen die Geräusche von der Konsistenz des Schnees ab, vom Schuhwerk, dem Untergrund und natürlich von der Umgebung. Warum musste er jetzt darüber nachdenken? Als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Vielleicht hatte er wirklich einen Tick, wie Michael behauptet hatte. Töne jeglicher Art zogen ihn in den Bann. Er konnte sich nicht dagegen wehren. Dazu kam, dass er während des Hörens Bilder wahrnahm, geometrische Figuren und Farben. Sie unterschieden sich je nach Art und Lautstärke der Geräusche. Synästhesie nannte man das Phänomen, das je nach seiner psychischen Verfassung bei ihm mal schwächer, mal stärker auftrat. Als Kind hatte er es für normal gehalten, hatte gedacht, dass alle so empfanden. Erst später war ihm klar geworden, dass er auch in der Hinsicht anders war als die meisten Menschen. Die Tritte im Schnee waren von weißen und grauen Dreiecken begleitet, die sich durchdrangen.
»Mir wird kalt«, sagte Laura und weckte ihn aus seinen Gedanken.
Gerber öffnete die Heckklappe und nahm den Gitarrenkoffer heraus.
Vor dem Hallentor stand ein weißer Transporter mit der Aufschrift »Acoustic Food«. Ein etwas übergewichtiger Typ mit langen Haaren und Vollbart sah Gerber mit der Gitarre in der Hand und kam auf ihn zu.
»Leon, nehme ich an. Ich bin Erich.« Er klopfte Gerber auf den Rücken, als begrüßte er einen alten Freund.
»Ich bin Laura. Wir haben miteinander telefoniert.«
»Hi, Laura.«
Sie nickte.
»Kommt rein in die gute Stube. Der Laden wird einigermaßen voll werden heute Abend. Jedenfalls hat Johnny das versprochen. Ich hoffe nicht, dass unsere Fans im Schnee stecken bleiben. Notfalls spielen wir ohne Publikum.« Er lachte mit tiefer Stimme.
Wäre auch nicht schlimm, dachte Gerber und lächelte.
Laura und er gingen am Tourbus vorbei in die Scheune. Eine angenehme Wärme kam ihnen entgegen, die von Infrarotstrahlern an der Decke herrührte. Die offene Dachbalkenkonstruktion und das Inventar, das vorwiegend aus Holzbänken, Stühlen und Strohballen bestand, wirkten rustikal und verbreiteten eine gemütliche Atmosphäre. Dazu eine Theke und die aus Brettern gezimmerte Bühne. Eine zierliche Frau in kessem Outfit, kurzem Lederrock und weißem Top mit der Aufschrift »Bad Girl« sprang von der Bühne und kam auf sie zu. Der Pferdeschwanz wippte bei jedem Schritt.
»Schön, dass ihr hier seid. Freibier gibt’s an der Bar. Ich bin Mirja, Gesang und Mundharmonika. Freddy und George sind die anderen beiden coolen Typen dort.« Sie zeigte mit dem Daumen über die Schulter, ohne sich umzudrehen.
»Leon und Laura«, sagte Laura. »Ich hab eure Musik auf YouTube gehört. Gefällt mir sehr.«
»Danke. Unsere neue CD kommt gut an. Besonders das Stück, bei dem Leon den Gitarrenpart gespielt hat, ›Love Me Crazy‹. Das wird der dritte Titel sein. Spielst du die Akustikgitarre? George hätte sicher nichts dagegen.« Sie sah Gerber an und legte den Kopf ein wenig schief.
»Nein. Lieber nicht.«
»Okay.« Mirja zog das Wort lang und schaute Gerber tief in die Augen. Er setzte den Gitarrenkoffer ab, um ihrem Blick auszuweichen.
»Dann bist du kurz vor der ersten Pause dran. Hier ist die Setlist.« Sie überreichte ihm einen zusammengefalteten Zettel, den sie in der linken Hand gehalten hatte. Dann verschwand sie mit katzenartigen Bewegungen wieder Richtung Bühne.
»Hat sie dich jetzt gerade angebaggert, oder was war das?«
»Unsinn.«
»Gefällt sie dir?«
Auf diese Frage gab es keine richtige Antwort. Das wusste Gerber. Sagte er Nein, würde sie ihm nicht glauben. Ein Ja wäre auch nicht klug gewesen. Also schwieg er.
Gerbers innere Unruhe stieg mit der Anzahl der Besucher, die nach und nach eintrafen. Sie lachten, unterhielten sich laut und rückten Stühle und Bänke. Er saß mit Laura seitlich der Bühne. Wäre sie nicht dabei gewesen, wäre er vermutlich ausgerissen.
Sie ergriff seine Hand. »Versuch, locker zu bleiben, Leon. Am besten stellst du dir vor, du wärst alleine hier.«
Wenn das so einfach wäre, dachte er. Dazu hätte er Augen und Ohren verschließen müssen. Nicht sein Auftritt war das Problem, sondern die vielen Menschen und der Lärm, den sie verbreiteten. Ihm wurde immer klarer, dass er für solche Liveveranstaltungen nicht geeignet war. Da halfen keine Tricks, keine Abhärtung, keine Konfrontationstherapie. Aber heute musste er durchhalten, und sei es nur Laura zuliebe.
Für einen kurzen Soundcheck betrat er die Bühne und folgte den Anweisungen des Tontechnikers, der auf einem Podest am anderen Ende der Halle thronte. Als dieser zufrieden den Daumen hob, hätte Gerber gern noch eine weitere Optimierung des Sounds versucht, zwang sich aber, darauf zu verzichten. Eigentlich wollte er nur noch, dass alles vorbei war.
Als die Band zu spielen begann, ließ seine Anspannung etwas nach, stieg für einen Moment jedoch wieder unerträglich an, als Mirja ihn mit übertriebenen Worten ankündigte. Doch die Panik verschwand schlagartig mit den ersten Akkorden. Nur ein kurzes Nachstimmen der Gitarre, dann versank er in sein eigenes Spiel. Das Publikum schien plötzlich verschwunden zu sein. Es meldete sich mit Beifall zurück, als der letzte Ton des Instrumentalstücks verklungen war. Die Besucher klatschten laut und anhaltend. Der Lärm machte ihm nichts aus, er konnte sogar die Anerkennung genießen. Vielleicht hatten die Therapieversuche doch etwas bewirkt.