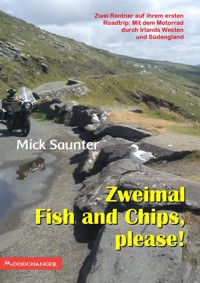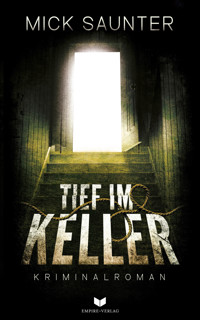
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Empire-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Major Konstantin Manner vom LKA Salzburg träumt seit Kurzem merkwürdige Dinge, die für ihn keinen Sinn ergeben. Als er zu einem Leichenfund am Untersberg gerufen wird, kann er noch nicht ahnen, wie nah ihm dieser Fall gehen wird– und dass er mit seinen Träumen zusammenhängt. Als klar wird, dass eine Verbindung zwischen dem Toten und dem Verschwinden zweier junger Männer einer Behinderteneinrichtung besteht und ein merkwürdiges SM-Video auftaucht, kommen er und sein Team auf die richtige Spur – und entdecken etwas Unvorstellbares, das seit Langem im Geheimen operiert. Nicht in seinen schlimmsten Fantasien hätte er sich vorstellen können, welche Dimensionen dieser zunächst einfach erscheinende Fall annehmen würde.
„Tief im Keller“ entfaltet sich behutsam, verwirrend; und lässt zu Anfang nicht erkennen, wohin der Protagonist unterwegs ist. Aber von Seite zu Seite und mit jedem neuen Charakter wird klarer, in welche Abgründe der menschlichen Seele die Geschichte führt – um am Ende nicht nur die schreckliche Wahrheit zu erzählen, sondern auch zu zeigen: Kein Keller ist tief genug, eine Schuld zu verstecken, die ans Licht will.
Komplett überarbeitete Neuausgabe von Manner sieht rot.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tief im Keller
Mick Saunter, 1957 in Wuppertal geboren, flog mit sechzehn vom Gymnasium, wurde Eisenwarenkaufmann, war Funker beim Bund, fuhr Lkw, verkaufte Versicherungen und arbeitete in einer Autowerkstatt. Lernte das Tischler-Handwerk und holte den Schulabschluss nach, gründete eine Familie, studierte Holztechnik, und plante über viele Jahre Läden in ganz Deutschland. In der Lebensmitte lernte er durch Zufall (den es gar nicht gibt: Nichts geschieht zufällig, sondern alles hat immer einen Sinn.) eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung kennen. Das veränderte in seinem Leben alles: Er begann mit geistig und psychisch behinderten Menschen zu arbeiten, leitete die Arbeitstherapie in einer Suchthilfeklinik und lebte als Heimleiter gemeinsam mit Menschen, die ständige Betreuung brauchen. Lernte, wie unendlich wichtig es ist, das Leben mit dem zu verbringen, was man wirklich will – und fing mit fast sechzig an zu schreiben.
Mick Saunter
Tief im
Keller
Kriminalroman
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
März 2021© 2020 Empire-Verlag
Empire-Verlag OG, Lofer 335, 5090 Lofer
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch
teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Lektorat: Dr. Clemens Krausgruber und Dr. Eva Willi-Krausgruber
Covergestaltung: Chris Gilcher für Buchcoverdesign.de
https://buchcoverdesign.de
Coverabbildungen: Adobe Stock ID 136483089,
Adobe Stock ID 110052760 und freepik.com
„Es muss 2008 oder 2009 gewesen sein, ich arbeitete damals in einem Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Eines Tages verschwand ein Bewohner, ein fröhlicher junger Mann Mitte zwanzig.
Von einem auf den anderen Tag war er weg: ohne Vorankündigung, ohne Hinweis, ohne erkennbaren Grund. Er wurde überall gesucht, die Polizei wurde eingeschaltet und nach ein paar Tagen wurde die Fahndung auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt – doch ohne Erfolg: Niemand wusste, wo er war, keiner hatte ihn gesehen. Ich weiß nicht, ob er jemals wieder aufgetaucht ist.“
Mick Saunter, im November 2020
Die Hauptpersonen
Konstantin Manner
Major der Salzburger Kriminalpolizei. Träumt merkwürdiges Zeugs, isst zu viel, und: muss sich entscheiden
Christian Möckel
Oberleutnant im LKA Salzburg, immer auf der Suche
Dr. Eva Mummenbrauer
Kriminalanwärterin – hat den Durchblick, ist neu und neugierig
Mag. Brammen
Manners Chef. Kann super Sarkasmus, und überrascht immer wieder
Sabine Schmitz
Kommt aus Köln, macht guten Kaffee, und sucht einen richtigen Mann
Tina
Ist eine richtige Schnitte
Mona Martínez
Gibt sich ganz hin
Fernando Klein
Nimmt, was er kriegen kann
Sebastian
Hat einfach Pech gehabt
Paul
Wird rücksichtslos ausgenommen
Dennis
Zum Glück ist er am liebsten in der Gärtnerei
Susi Kju
Weiß sich zu wehren; aber nicht immer
Maximilian
Kommt aus der Vergangenheit zurück
Hans aus der Trafik
Manners Kumpel. Überhaupt kein Fußballfan, hat aber pipifeine Beziehungen
Das Monster
Ist eigentlich ein ganz Netter
Der Tiroler
Tut nett – ist’s aber nicht
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt.
Prolog
1. Mai 1945, gegen 23 Uhr
Flugplatz Schaan, Liechtenstein
„Sind Sie allein? Wo ist Gerhard?“
Der Motor der silbernen Messerschmitt Bf 108 machte solch einen Höllenlärm, dass er sogar das Tosen des Sturms übertönte. Der Pilot ließ den Motor warmlaufen und steigerte dabei die Drehzahl kontinuierlich. Trotzdem verstand der Mann, der durch den strömenden Regen vom Rand des Flugfeldes angerannt kam, die Frage des neben dem Flugzeug auf ihn Wartenden genau. Fluchend versuchte er, mit einer Hand seinen Hut auf dem Kopf zu halten, bevor der Wind ihn fortwehen konnte. Vom nahezu waagerecht kommenden Starkregen war sein Trenchcoat bereits völlig durchnässt, als er versuchte, neben der dröhnenden und vibrierenden Maschine wenigstens etwas Schutz vor dem Wetter zu finden. Die große, schwarze Limousine, mit der er gekommen war, schoss mit durchdrehenden Rädern und verdunkelten Scheinwerfern davon.
„Nix! Aus! Er hat es nicht geschafft!“, brüllte er. „Wir müssen ohne ihn los!“
„Was? Wieso denn das?“
Der andere, er hatte eine Baskenmütze fest auf seinen Kopf gezogen und trug einen langen, schwarzen Ledermantel, packte ihn am Arm. Der Pilot steigerte die Drehzahl und damit die Lautstärke des Motors erneut, und sie mussten dagegen anschreien, um sich zu verständigen.
„Er war auf dem Weg zu seinem Haus, um die Unterlagen
zu holen. Ist vom Heimatschutz erwischt worden – und die haben ihn den Franzosen ausgeliefert!“
Der Mann im Ledermantel wich zurück, sah ihn ungläubig und wütend an. Unwillig schüttelte er den Kopf.
„Verdammt! Wie konnte das passieren? Ist er nicht rechtzeitig los?“
Die letzten Worte gingen im aufbrüllenden Motorlärm unter. Sie blickten zur Kanzel: Der Pilot kurbelte wie wild mit dem rechten Arm, als Zeichen, dass sie sich beeilen sollten.
„Los, los, wir müssen weg, keine Zeit für Erklärungen – rein!“, rief der Angekommene. Sie stiegen auf die Tragfläche, er warf seine Reisetasche in die Kabine, und sie kletterten hinterher. Als sie die Türe hinter sich schlossen, blieb der meiste Lärm draußen. Der starke Motor brüllte erneut auf, wurde auf Startleistung gebracht, die viersitzige Maschine beschleunigte und hob nach bemerkenswert kurzer Zeit ab. Kaum hatten sie den Boden verlassen, zog der Pilot das Fahrwerk ein, sah auf die Instrumente und richtete das Flugzeug ruckartig auf einen Kurs Richtung Südwesten. Die Berge kamen rasend schnell näher.
„Er war bis zuletzt in der Ordensburg, hat alles vernichtet, was auf uns hinweisen könnte. Aber als er über den Berg wollte, nach Haus, da haben sie ihn schon erwartet, und das war’s dann: Noch vor der Grenze hat ihn der Widerstand geschnappt!“ Er nahm seinen Hut ab, und klopfte das Wasser von der Krempe auf den Kabinenboden.
Der andere nahm seine Mütze ab, zog den Mantel aus, und legte ihn über die Lehne des freien Sitzes neben dem Piloten. Mit beiden Händen strich er sich die Haare nach hinten.
„Scheiße. Wir hätten ihn drüben so dringend gebraucht. Scheiße, sag ich! Das ist so ein Rückschlag für die Sache! Verdammt noch mal!“
Der Pilot flog so tief wie möglich, was bei dem Wetter und der Dunkelheit ein äußerst riskantes Unterfangen war. Aber sie hatten keine andere Möglichkeit unentdeckt zu bleiben. Dass ganz Europa und die Welt sich an diesem Tag mit anderen Dingen beschäftigten musste, half ihnen zwar – aber trotzdem: Es blieb nur eine kleine Chance für sie, und sie mussten jede Deckung nutzen.
„Und die Unterlagen? Meinen Sie, die sind verloren?“
Der Gefragte grinste sardonisch. „Ich war ja mal bei ihm, in seinem Haus, und hab mir alles angesehen. Ich bin mir ganz sicher: Das müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn da jemand den Zugang fände!“
Der andere schaute skeptisch. „Na, hoffentlich.“ Aufseufzend lehnte er sich zurück. „Nun gut. Die Spinne wird schon einen Weg finden, ihn wieder herauszubekommen, wenn erst mal wieder etwas Normalität herrscht; ich denke, wir können uns dabei ganz auf Otto verlassen. Und dann sehen wir weiter.“
Er sah aus dem Fenster. Der Regen hatte nachgelassen, und die Berggipfel, die sie überflogen, waren gefährlich nah und detailliert zu erkennen. Er tippte den Piloten an.
„Wie lang werden wir brauchen?“
Der sah auf die Instrumente.
„Es sind noch etwa 1.400 Kilometer bis Dénia. Wir müssen einmal tanken, ich denke kurz hinter den Pyrenäen. Vielleicht auch erst in La Sénia. Wenn alles klappt, so etwa sechs, sieben Stunden.“
Er sah auf seine Armbanduhr, rechnete kurz nach, nickte. Dann sollten sie das Schiff ja noch erreichen.
„Gut.“
Er klopfte dem Gefragten auf die Schulter und machte es sich so gut es ging in seinem Sitz bequem.
„Also, auf in eine neue Zeit. Diesmal werden wir besser aufpassen und uns nicht wieder von einem Verrückten alles verderben lassen.“
Er zog einen Flachmann aus der Jackentasche, schraubte ihn auf, goss etwas von einer dunkel-bernsteinfarbenen Flüssigkeit in den Schraubverschluss und reichte ihn dem anderen. Dann hob er die Flasche:
„Salud! Auf uns! Wir werden erwartet!“
„Jeder von uns sieht das in anderen Menschen, was er selbst im Herzen trägt.“
Ralph Waldo Emerson
„Leise! Ganz leise!“
„ACH WAS, LEISE! LAUF!“
Er wimmert vor sich hin.
„Pssst! Sei leise!“
„BLÖDSINN! HÖR AUF ZU JAMMERN, DU LÄCHERLICHE FIGUR! LOS JETZT!“
„Ich will ja!“
„DANN HEUL HIER NICHT SO RUM, VERDAMMT NOCH MAL! LAUF DOCH! HAU ENDLICH AB, DU HAUFEN SCHEISSE!“
„Hör auf, ihn zu beschimpfen! Du siehst doch, wie es ihm geht!“
„WAS? DU NIMMST DIE MEMME AUCH NOCH IN SCHUTZ?“
„Hör nicht auf ihn. Es wird alles gut – bestimmt! Gib nicht auf!“
Zitternd fängt er an zu weinen.
„JETZT SEH SICH EINER DIE HEULSUSE AN! DU WASCHLAPPEN!“
„Sei nicht so grob mit ihm!“
„WAS WILLST DENN DU VON MIR? ANSTATT ZU SEHEN, DASS ER WEG KOMMT, STEHT ER HIER IM WALD UND PISST SICH AN. ER IST DOCH SELBST SCHULD! ODER ETWA NICHT?“
„Aber er hat Angst! Siehst du das nicht?“
Diese Stimmen. Diese verdammten Stimmen. Er will sie nicht mehr hören! Als ob er nicht selbst wüsste, was er getan hat. Beim Gedanken daran schluchzt er verzweifelt laut auf.
„Still! Wenn du zu laut bist, weiß es, wo es dich findet. Hörst du? Du!“
„HA! ES WIRD IHN SOGAR GANZ SICHER FINDEN, WENN ER NICHT ENDLICH ABHAUT! WAS? DU? DU SCHAFFST ES EH NICHT!“
Er versucht, einen klaren Gedanken zu fassen, trotz ihrer Vorwürfe, trotz ihrer Streitereien.
„ICH SCHAFF DAS SCHON!“, ruft er entschlossen.
„Schhht! Leise! Bitte, sei um Himmels willen leise!“
„ACH WAS, LEISE – SCHEISSDRECK! LAUF ENDLICH, DU NICHTSNUTZIGE MISSGEBURT! HAU AB! RENN UM DEIN LEBEN!“
Er presst die Hände auf die „Ohren, schüttelt wild, zornig und voller Wut den Kopf – jetzt ist es genug, er will sie nicht mehr hören, er will gar nichts mehr hören! Sie sollen aufhören!
„HÖÖÖRT AUUUF!“
Stille.
Vorsichtig nimmt er die Hände runter, horcht.
Sind sie doch noch da? Nein – sie sind weg. Endlich! Triumphierend sieht er sich um – doch jetzt, wo er so plötzlich allein ist, erscheint ihm der dunkle Wald auf einmal viel schwärzer und bedrohlicher als zuvor. Ein überwältigendes Gefühl von Verlorensein überkommt ihn. So sehr, wie er sie gerade noch verflucht hat, wünscht er sie sich zurück.
Er hört wieder den Lärm, der ihn schon die ganze Zeit den Berg hinauftreibt: Ein rhythmisches, blechernes Scheppern dringt durch den Wald. Sein Herz klopft wie rasend in der Brust, als eine unheimliche Stimme seinen Namen ruft. Sie ist weit entfernt, aber sie scheint immer näher zu kommen. Wird lauter, immer bedrohlicher, immer …
Plötzlich – ist es wieder still. Warum ist es auf einmal so still?
Ist es schon da?
Sie haben Recht: Er mussweiter!
Er läuft – ein paar Schritte, tapsig, unbeholfen, versucht, so leise zu sein, wie er nur kann. Bleibt stehen. Lauscht. Rührt sich was? Nein, nichts.
Er schnauft leise durch die Nase, einmal, zweimal. Saugt die kalte Bergluft tief in sich hinein, fühlt, wie sie seine brennende Lunge ausfüllt, und stößt sie heftig wieder aus. Die Feuchtigkeit in seinem Atem kondensiert in der Kälte sofort: Bei jedem seiner Atemzüge weht eine kleine Wolke aus seinem Mund. Er schaut ihr hinterher, bis sie zergeht.
Dann läuft er weiter, den verschneiten Weg hinauf – an dunklen Felsen vorbei, die wie mit uralten, steinernen Gesichtern fragend auf ihn herabschauen.
Er hört Geräusche, von der weit entfernt liegenden Straße. In der Ferne erklingt ein Tuten: das Signal vom Zug nach Berchtesgaden. Er kennt es gut, es ist vertraut … ist Sicherheit. Ist Heimat. Aber jetzt, denkt er, jetzt ist es wie das Horn eines Jägers. Als würde zur Treibjagd auf ihn geblasen.
Er läuft. Weiter… nur weiter! Immer wieder dreht er sich um – seine Augen sind panisch weit aufgerissen: Er ist sicher, jeden Moment muss es hinter der Wegbiegung hervorkommen. Ganz bestimmt. Wird ihn entdecken, wird schneller werden – die sichere Beute vor Augen. Er kann ihm nicht entkommen, bestimmt nicht. Er weiß es einfach. Er weiß es!
Angst schnürt ihm die Kehle zu. Furchtbare Angst. Angst, die alle Energie aus ihm heraussaugt. Wie eine heiße, glühende Masse sitzt sie auf ihm. Er sieht ihren Lichtschein, fühlt, wie sie auf ihm hockt, auf seinen Schultern – im Spiegel hat er sie oft gesehen: eine riesige, rote, von innen leuchtende, verzerrt und böse grinsende Fratze. Von zahllosen, züngelnden, schwarzroten Flammen umgeben, die nach ihm tasten, ihn umschlingen – und durch seinen Mund, seine Nase, seine Ohren in ihn dringen. Die sich tief in ihn hinein brennen, tiefer und tiefer – trotz seiner Gegenwehr, seines Umsichschlagens.
Alles weiß sie über ihn, alles. Und auch, was er getan hat.
Er hat immer und immer wieder versucht, sie loszuwerden; aber jedes Mal vergeblich. Obwohl er durch die Glastür seines Zimmers sprang – in der verzweifelten Hoffnung, dass die Glassplitter sie zerschneiden. Obwohl er seinen Kopf wieder und wieder an die Wand seines Zimmers schlug – in dem Versuch, sie damit zu zerschmettern. Die trotz seiner wütenden und verzweifelten Gegenwehr sich weiter und weiter bis zu seiner Seele wühlt – und an ihr nagt. Sie frisst.
Niemand ist da, der ihn halten kann, in seiner Angst, seiner Verzweiflung. Niemand, der beruhigend auf ihn einredet, niemand, an den er sich anlehnen, festhalten kann: so lange, bis die Fratze wieder verschwindet.
Diesmal ist er allein mit ihr.
Es ist so gekommen, wie er schon immer gewusst hat, dass es eines Tages geschehen würde: dass seine Angst ihn endgültig einholt und besiegt. Er hat es einfach immer schon gewusst!
„HAB ICH DIR JA GESAGT, DU NULL! DU SCHAFFST ES NICHT!“
„Nein – du schaffst das! Bestimmt! Du musst nur …“
Wütend schreit er auf. „Weg! Verschwindet endlich! Weg! Weg! BLEIBT WEG!“
Wieder Stille.
Er läuft den Waldweg entlang, den Berg hinauf. Bei jedem seiner unbeholfenen Schritte stiebt eine glitzernde Fontäne aus Schneekristallen auf. Immer wieder stolpert er, über vereiste Steine und unter der Schneedecke versteckte Wurzeln. Er taumelt, rutscht auf dem glatten, vereisten Holz aus.
Seine Kraft lässt nach – es ist nur noch ein Weiterstolpern, ein irgendwie Weiterkommen. In seiner Brust brennt es wie Feuer, Seitenstiche quälen ihn, rauben ihm alle Energie.
Er blickt zurück, zur Abbiegung: nichts.
Er atmet auf. Vielleicht … oder doch? Ist da nicht was?
Da: Zwischen den schwarzen Silhouetten der Bäume bewegt sich ein ganz schwacher, rötlicher Lichtschein.
Und dann hört er es wieder, wie aus dem Abgrund der Hölle: als ob tausend Finger mit ihren Nägeln über eine unfassbar große Tafel kratzen; wie tausend schrille, sich überschlagende Stimmen, die alle nach ihm rufen.
Es ist ganz nah, ganz … es ist da!
Er muss weg, weg! Nur weg von hier, irgendwie, stolpert, fängt sich, dreht sich im Aufrichten um – und sieht mit eisigem Entsetzen das rote Glühen hinter den schwarzen Silhouetten der Bäume hervorkommen.
Und dann – ist es wirklich da!
Es ist riesig, bestimmt zwei Köpfe größer als er. Das Mondlicht wird vom Schnee reflektiert, und so kann er das schreckliche Gesicht sehen: Es ist ganz fahl, fast weiß. Ein breites Maul ist zu erkennen, leicht geöffnet und wie zu einem grausamen Grinsen verzerrt. Es läuft aufrecht, bewegt die Vorderpfoten wie ein Mensch die Arme. Von Kopf bis Fuß ist es mit einem langen, zotteligen Fell bedeckt, und an den Pfoten meint er, lange Klauen zu erkennen. Zwei kurze, aufwärts gekrümmte Hörner stehen vom Kopf ab, die riesigen Augen leuchten hell, in einem höllischen Rot. Die schreckliche Stimme, die er die ganze Zeit hört, die seinen Namen ruft, ihn lockt, ihm verspricht, ist jetzt ganz nah. Er sieht die Töne aus dem Maul fließen – wie eine nach Nahrung suchende, züngelnde Flamme.
Ein entsetzter Schrei entfährt ihm, seine Hand fährt hoch, bedeckt seinen Mund – doch das Wesen hat ihn gehört. Abrupt bleibt es stehen und sieht ihn an: Ein wilder Blick aus den schrecklichen Augen trifft ihn, lässt ihn erstarren. Sein Atem setzt aus, sein Herz scheint ihm aus der Brust zu springen. Es ist wie in einem wahr gewordenen Albtraum aus seiner Kindheit! Das Ding steht leicht vornübergebeugt, bewegt den Oberkörper pendelnd hin und her, den Blick dabei unablässig und fixierend auf ihn gerichtet. Kurz starren sie sich an: Dann kreischt das Wesen wieder ohrenbetäubend auf, das Geräusch bohrt sich tief in seine Ohren.
Mit einem verzweifelten Aufschrei wirft er sich herum, stürzt blindlings in den Wald. Zuerst scheint es leichter zu gehen: Unter den dicht stehenden Tannen liegt weniger Schnee, er findet besseren Halt als auf dem vereisten Weg. Aber er muss sich durch harte, vertrocknete Zweige kämpfen, schafft es kaum hindurch. Sie schlagen in sein Gesicht, zerkratzen seine Haut, stechen nach seinen Augen, nach seinem Mund. Er reißt seine Hände hoch, versucht, sich zu schützen, schiebt die Äste zur Seite, drängt weiter, immer wieder muss er ausweichen, zu dicht ist das Unterholz. Aber in seiner Panik achtet er nicht darauf, spürt die Verletzungen nicht, kämpft sich durch, stolpert, fällt, fängt sich wieder – das wie wild schreiende Ungeheuer hinter sich. Nur weiter, weiter!
Plötzlich öffnet sich der Wald: Der Weg! Er läuft talwärts, bekommt endlich wieder Luft. Sein Herz schlägt heftig, ein Rauschen erfüllt seinen Kopf, und schwer fühlt er es in sich pochen. Er muss stehenbleiben, schwer schnaufend stützt er seine aufgerissenen, blutenden Hände auf die Knie. Zitternd schießen ihm Tränen in die Augen: Er weint, haltlos, verzweifelt, immer mehr. Aber er gibt kaum einen Laut von sich, nur ein Wimmern entweicht seinen zusammengepressten Lippen. Ich muss ruhig sein, schießt es ihm durch den Kopf, ich darf nicht so laut sein! Vielleicht hat es nicht gesehen, wo ich in den Wald gelaufen bin, vielleicht hat es ja auch aufgegeben, mich zu verfolgen! Bei diesem Gedanken schöpft er Hoffnung, hört auf zu weinen, wischt sich vorsichtig und unbeholfen übers Gesicht. Er lauscht: Es ist still! Ist es weg?
Langsam richtet er sich auf, dreht sich vorsichtig um – und fährt zusammen: Das Untier ist vielleicht zehn Meter oberhalb von ihm auf dem Weg stehen geblieben. Starr schaut es ihn aus leuchtenden Augen an. Es hält den Kopf vornüber geneigt, seine Hörner zeigen in seine Richtung, es atmet schwer, schnaubend, mit einem leicht zitternden, kehligen Knurren, wie ein Stier.
Dann beugt es sich vor, so, als ob es sich zum Angriff bereitmacht. Der riesige Körper spannt sich – da fasst er sich und stürzt davon, ins Dickicht, durch das krachende Unterholz. Hinter sich hört er das Bersten der Äste, als es näher und näher kommt. Er glaubt schon, den heißen Atem in seinem Nacken zu spüren, während er weiterläuft – ohne darauf zu achten, wie sein Gesicht und seine Hände von den spitzen, splitternden Zweigen regelrecht zerfetzt werden. Nichts ist mehr da als seine unermessliche Angst! Der Wald lichtet sich, eine Brandschneise. Er springt, verschätzt sich mit der Entfernung, landet unsicher auf dem rechten Fuß, knickt um: Ein heftiger, schneidender Schmerz in seinem Knöchel durchfährt ihn, er schreit auf, hüpft kurz auf dem linken Bein, läuft humpelnd weiter – und hört, wie es aus dem Unterholz hervorbricht.
Fast besinnungslos vor Panik läuft er zurück in den Wald: Das Unterholz ist hier lichter, er fasst neue Hoffnung – da taucht plötzlich ein kleiner Hügel vor ihm auf. Er nimmt Anlauf, macht einen großen Schritt, springt hinauf – und stoppt hektisch mit den Armen rudernd: Ein Abgrund von vielleicht drei bis vier Metern tut sich auf, hinunter auf einen schmalen Felsabsatz; und gleich dahinter geht es weiter steil bergab.
„Halt! Warte – zurück! Zurück!“
„SPRING SCHON, DU FEIGLING! LOS DOCH!“
Verzweifelt versucht er, ins Gleichgewicht zu kommen, aber vergebens: Er fällt, kracht schwer mit dem Rücken auf den Felsvorsprung, die Lunge wird zusammengepresst. Vergeblich schnappt er hilflos nach Luft, hat das Gefühl zu ersticken. Quälend langsam kommt der Atem wieder zurück, ächzend versucht er, sich aufzurichten – da verliert er den Halt, kommt ins Rutschen, schlittert den Hang hinunter, überschlägt sich, rollt bergab, immer schneller, immer haltloser, schreit gellend vor Schmerz und Angst, kreischt, brüllt, streckt seine Arme aus, versucht, irgendwo einen Halt zu finden, greift in den Schnee, in den gefrorenen Boden, seine Fingernägel brechen, werden gespalten, reißen ab – aber es geht zu steil hinunter, zu schnell ist sein Sturz. Immer hilfloser rutscht er, dreht sich um sich selbst, schlägt über Wurzeln, über Steine, prallt gegen Bäume, wird herumgeschleudert, fällt und fällt. Sein rechter Arm und ein paar seiner Rippen brechen krachend, als er in voller Wucht auf einen großen Baumstumpf knallt, zurückprallt und weiter stürzt. Eine abgebrochene Rippe durchbohrt im Weiterfallen einen Lungenflügel, Blut schießt ihm in den Mund, füllt ihn mit einem widerlichen, metallischen Geschmack.
Der Wald endet abrupt – eine Lichtung öffnet sich, auf der große Felsen beieinanderstehen. Er fliegt regelrecht auf einen der Findlinge zu, schwer kracht er dagegen. Sein Gesicht knallt mit voller Wucht auf das Gestein, Knochen brechen, Haut platzt auf wie eine zu straff gefüllte Papiertüte, Blut spritzt hervor, der Kopf wird zurückgeschleudert, ein Halswirbel bricht mit einem lauten, entsetzlichen Knacken – dann bleibt er vor dem Felsen auf dem Rücken liegen.
Trotz der furchtbaren Verletzungen ist noch Leben in ihm, verzweifelt ringt er nach Atem, versucht, Luft in seine zerstörte Lunge zu bekommen; aber es dringt nur schaumiges Blut in seinen Mund. Er spürt keinerlei Schmerzen; aber eine eisige Kälte beginnt sich in ihm breitzumachen. Blut rinnt ihm in die Augen, blendet ihn. Das Kreischen ist jetzt so laut, dass es alle anderen Sinne erschlägt: Wie eine schwarze Woge wälzt es sich auf ihn zu, fließt über ihn, erstickt ihn. Er versucht, etwas zu sehen – und erkennt das Ungeheuer, das ihn eingeholt hat. Es kniet sich neben ihn, eine riesige, klauenbewehrte Pfote senkt sich langsam auf sein Gesicht. Er spürt, dass hinter der Kralle warme, weiche Haut ist, die ihm sanft die Wange streichelt. Ungläubig schaut er in die leuchtenden, roten Augen – und erkennt die Wahrheit.
Plötzlich verschwimmen die Konturen der riesigen Gestalt und eine leuchtende Aura umgibt sie. Ihr Lichtschein ist erst ganz schwach und schimmert in den verschiedenen Farben des Spektrums. Dann aber wird es schnell immer intensiver, immer heller – bis schließlich ein strahlendes Leuchten alles überdeckt und wunderbare Wärme ihn durchflutet.
„HAHA! DU NARR! DU EINFÄLTIGER, DUMMER NARR! WARUM HAST DU DAS AUCH GEMACHT!“
„Ruhig, ganz ruhig, es wird alles gut.
Du hast keine Schuld, hörst du.
Alles ist jetzt gut.
Lass es los.
Geh.“
Dann verstummen sie.
Er will ihnen antworten, seine Lippen bewegen sich, aber kein Laut verlässt seinen Mund. Seine Augen suchen unruhig die des anderen – dann bricht sein Blick. Mit einem leisen Seufzen verlässt das Leben seinen Körper. Am Himmel sind Wolken aufgezogen, hinter denen der Mond immer wieder verschwindet. Ein heller Lichtstrahl scheint auf die leblose Gestalt, lässt die erstarrten Augen noch einmal kurz aufleuchten – dann verlöschen sie endgültig.
Der gehörnte Kopf senkt sich, das Monstrum stöhnt auf vor Enttäuschung. Dann erhebt es sich, schüttelt sich, und blickt sichernd in alle Richtungen. Dreht sich um, und geht mit langsamen Schritten durch den knirschenden Schnee Richtung Wald. Das dichte Fell an seinen Pfoten verwischt seine Spuren im Schnee, und es bleiben nur undeutliche Abdrücke zurück. Der Mond ist nun ganz hinter dichten Wolken verschwunden, und Dunkelheit legt sich wie ein weiches, stilles Tuch über den Berg. Es beginnt wieder zu schneien: Zuerst erreichen nur wenige zarte, federleichte Flocken das zerstörte Gesicht, und die Schneekristalle schmelzen auf den erstarrten, blicklosen Augen. Werden zu Wasser, das sich mit den Tränen und dem noch warmen Blut vermischt. Dann wird der Schneefall dichter, und als sich das Monster am Waldrand noch einmal umblickt, verbirgt bereits ein dichtes Schneetreiben die Sicht auf das, was gerade noch ein Mensch gewesen ist.
Kapitel eins
Das unbekannte Land
Samstag, 11. Dezember
1.
Das Meer, auf dem er in einem kleinen, weiß und blau gestrichenen Ruderboot unterwegs war, schimmerte in einem tiefen Türkisblau.
Das Boot war kaum länger als er selbst und eigentlich viel zu klein für ihn: Es bot gerade so viel Platz, dass er einigermaßen bequem aufrecht sitzen konnte. Die See war etwas kabbelig, kleine Wellen kreuzten sich, und das Licht der fast den Horizont berührenden Sonne brach sich in ihren Spitzen. Die Lichtreflexe stachen und kitzelten seine Augen, riefen in ihm ein altes Gefühl von Sommer und Freiheit hervor.
Gut fühlte er sich, ausgesprochen gut sogar. Völlig entspannt und gelassen ruderte er langsam Richtung Ufer, wo ein reges Strandleben herrschte: Er sah Menschen jederlei Alters in leichter, heller Sommerkleidung am Strand sitzen oder am Meeressaum flanieren, spielende Kinder liefen durcheinander, man hörte Lachen, Gesang und Musik. Neben einer Strandbude flatterte an einem Fahnenmast die weiß-blaue Nationalflagge, an den Ästen der hinter dem Strand stehenden Kiefern hingen überall kleine Lichterketten: Sie setzten farbige Lichtpunkte, die aus der Entfernung wie hunderte Glühwürmchen wirkten und der warmen, beginnenden Mittsommernacht eine besondere Stimmung gaben. Alles war voller fröhlicher Aktivität und Leichtigkeit, und die Erwartung von etwas Besonderem lag in der Luft.
Die Leute unterhielten sich in einer Sprache, deren Klang ihm vertraut schien, die er aber nicht verstand. Trotzdem freute er sich darauf, gleich bei ihnen zu sein: Noch ein, zwei Minuten, dachte er, dann würde er den Strand erreichen.
Plötzlich, ohne dass er eine Veränderung wahrgenommen hatte, verdunkelte sich der Himmel: Große, tiefgraue Wolken waren aufgezogen, türmten sich schnell höher und höher. Ein starker, böiger Wind kam auf, packte das Boot von vorne, drehte es herum, und trieb es vom Ufer weg. Er ruderte gegen, um es wieder in die richtige Richtung zu bringen; aber der Wind war stärker und schob es immer wieder aufs offene Meer. Schnell wurde ein Sturm daraus, der das Wasser zu hohen Wellen zusammenschob und vor sich hertrieb. Der schlagartig einsetzende starke Seegang schüttelte ihn in seiner Nussschale heftig auf und ab.
Heiße Angst überlief ihn, dass er die anderen nicht mehr erreichen würde. Seine Ruderschläge wurden hektisch, fahrig – immer öfter verfehlten sie das Wasser, die Ruderblätter peitschten mehr über als durch das Meer.
Gischt sprühte über die Bordwand, in seine Augen. Wellen schlugen ins Boot, schnell begann es sich zu füllen. Ich muss schöpfen, dachte er panisch, und um die Hände dafür frei zu haben, ließ er die Ruder los; da rutschten sie aus den Dollen und glitten ins Meer. Ehe er nach ihnen greifen konnte, trieben sie in großer Geschwindigkeit vom Boot weg: So, als ob sie, wie von einer unsichtbaren Kraft gezogen, immer schneller würden.
Verzweifelt sah er ihnen hinterher.
Die Sonne war jetzt ganz hinter den Wolken verschwunden, die über den Himmel rasten. Das vorher tiefblaue Wasser hatte nun eine dunkle, flaschengrüne Farbe angenommen, die Wellenberge wurden immer höher, mächtiger und die Täler zwischen ihnen immer tiefer und weiter.
Mit hoher Geschwindigkeit schoss das Boot hinunter in ein gewaltiges Wellental; aber so sehr ihn die Situation auch beängstigte, so wild, ungezähmt und schön war es auch, durch das brodelnde Wasser bergab zu schießen. Blitzartig kamen ihm Bilder in den Sinn, wie er als Kind im Winter auf seinem Schlitten den Rodelhügel am Untersberg hinuntergerast war; und das aufregende Gefühl von Abenteuer und Freiheit durchfuhr für einen Moment seinen Körper.
Unwillkürlich jauchzte er vor Begeisterung über die wilde Fahrt laut auf, mit weit aufgerissenen Augen und wehenden Haaren sauste er hinab ins Wellental, tauchte tief ein – dann wurde er wieder hoch hinauf auf den nächsten Wellenberg gehoben. Das winzige Boot schoss empor, durch die weiß schäumende Gischt der brechenden Krone hindurch, und flog einen Moment, der sich wie in Zeitlupe dehnte und dehnte, über dem Wasser durch die Luft. Er klammerte sich an den Bordwänden fest, um nicht hinausgeschleudert zu werden; aber er spürte keine Angst – das Gefühl des Fliegens schien ihm so vertraut, als ob es schon immer ein ganz normaler Teil seines Lebens gewesen wäre.
Das Ufer war noch ganz nah: Während er flog, sah er hinüber zu den bunten Holzhäusern, den Lichtern, dem Wald hinter dem Strand; sogar die Menschen sah er. Scheinbar hatten sie von seiner gefährlichen Situation und dem Sturm nichts mitbekommen und feierten weiter fröhlich die sommerliche Nacht.
Etwas zog seinen Blick magisch an, er wusste nicht warum: Unter den vielen Menschen fiel ihm eine Gestalt besonders auf. Sie war klein, stand ganz still und schien ihn direkt anzusehen. Das salzige Wasser brannte in seinen Augen, er konnte nicht erkennen, ob es eine Frau, ein Mann oder ein Kind war: Er sah das Gesicht nur verschwommen – so, als sähe man durch ein beschlagenes Glas. Aber sie sah ihn an, das spürte er deutlich.
Er war gemeint.
Auf einmal verschob sich die Perspektive, alles wurde seltsam verzogen und in sich gedehnt. Wie in einem surrealen Bild von Dalí veränderten sich die Dinge, verloren ihre festen Konturen, wurden weich, flüssig, schienen sich zu vermischen und flossen nach hinten von ihm weg – immer schneller werdend, auf einen imaginären Punkt zu. Dann entfernte sich auch das Ufer in rasender Geschwindigkeit, wie in einem rückwärts und zu schnell ablaufendem Film.
Abrupt fiel das Boot hinunter in das tobende Meer. Eine riesige, turmhohe Welle stürzte über ihm zusammen, die gewaltigen Wassermassen wirbelten ihn umher, zogen, drückten, rissen ihn in die Tiefe. Verzweifelt versuchte er mit fahrigen, hektischen Schwimmbewegungen, zurück an die Oberfläche, an die rettende, lebensspendende Luft zu kommen. Wie wild ruderte er mit Armen und Beinen – aber es war, als ob etwas an ihm zog: Gerade so, als ob ihn ein Wirbel aus der dunklen, bodenlosen Tiefe ansog, ihn verschluckte.
Weiter und weiter hinab sank er, um ihn herum wurde es dunkler, bedrohlicher. Er spürte, dass der Druck auf seine Brust zunahm, sie zusammenpresste. Er verschluckte sich, als salziges Wasser in seine Lunge geriet; und als er würgend versuchte, es auszuhusten, sah er, dass Blut aus seinem Mund strömte.
Meine Lunge ist zerrissen, dachte er erschrocken, blieb dabei aber eigentümlicherweise ganz ruhig; so, als hätte er es irgendwie schon erwartet.
Während er weiter in die Endlosigkeit sank, wurde im immer schwächer werdenden Licht aus dem Rot seines Blutes ein tiefes Schwarz, das ihn mehr und mehr einhüllte. Seine Bewegungen wurden langsamer, sein Herz hämmerte wie rasend in seiner Brust, und als ein unglaubliches Rauschen seinen Kopf erfüllte, wurde ihm schlagartig klar, dass er ertrank.
Eine seltsame Ruhe überkam ihn.
Das Klopfen in seiner Brust ließ nach, wurde weniger, ruhiger. Er schaute noch einmal nach oben, zum Licht: Da war ihm, als ob er wieder diese Gestalt sähe – die, die er vorhin nicht erkennen konnte; und die jetzt durch die aufgepeitschte Wasseroberfläche zu ihm herunter winkte.
Sein schon fast erloschener Lebenswille entflammte neu, mit aller Kraft kämpfte er vehement gegen den Sog aus der Tiefe – da wachte er auf.
Die Bettdecke hatte sich um seinen Kopf gewickelt, und er war kurz davor zu ersticken – zumindest fühlte es sich genauso an. In wilder Panik wühlte er sich heraus, setzte sich ruckartig auf, und rang nach Luft. Völlig verwirrt sah er sich um: Er saß in seinem Bett, das fest und sicher in seinem Schlafzimmer stand. Kein winziges Boot, kein Sturm, kein Meer.
Erleichtert sank er zurück in sein Kissen: Gott sei Dank – er hatte nur geträumt!
Als er sich nach ein paar Minuten beruhigt hatte, schüttelte er den Kopf. Wieso träumte er so was? Soweit er sich erinnerte, war er noch nie Rudern; und was war das für ein Begriff, als er die Riemen verlor – Dollen? Woher wusste er, was Dollen sind? Nachdenklich rieb er sich über die Stirn. Die Narbe, die er sich irgendwann in der Kindheit zugezogen hatte, juckte.
Wo war das überhaupt gewesen, und in welcher Sprache hatten die Menschen am Strand gesprochen? War das Finnisch? Und dann das Blut im Wasser, als er träumte zu ersticken. Das Meer, das sich erst rot und dann schwarz färbte. Völlig verrückt!
Er dachte an das Gefühl des Fliegens im Traum und dass er sich dabei seltsamerweise an seinen alten Schlitten erinnerte. Er hatte es so geliebt, mit ihm die Hügel hinaufzusteigen und dann in rasender Fahrt hinunterzufahren; früher als junger Bub. So lange hatte er schon nicht mehr an ihn gedacht. Ob er wohl noch immer bei seinen Eltern im Keller an der Wand hing?
Langsam setzte er sich wieder auf, drehte den Kopf hin und her, auf und ab; verschränkte die Finger ineinander, und dehnte sie genüsslich mit ausgestreckten Armen.
In seiner Lunge brannte es, er musste heftig husten: Schleim löste sich, kam die Luftröhre hoch und füllte seinen Mund. Hastig griff er nach einem Papiertaschentuch, spie hinein. Mit einem unguten Gefühl faltete er es auseinander: Aber es war nur klarer, zäher Schleim. Kein Blut darin.
Für einen kurzen, beängstigenden Moment hatte er gedacht, dass vielleicht doch …
Entschlossen schüttelte er den Gedanken ab.
So ein verdammter Scheiß-Traum!
Er schaute auf sein Smartphone, das auf dem Stuhl neben seinem Bett lag, der ihm als Nachttisch diente: Es war kurz nach acht. Genau die richtige Zeit zum Aufstehen, dachte er. Ausgiebig duschen, reichlich Kaffee – und dann diesen besonderen Tag genießen!
Mit einem energischen Ruck schlug Manner die Decke beiseite und stand auf.
2.
Für die zweite Dezemberwoche war es schon ziemlich kalt geworden im Salzburger Land: Auch tagsüber hatten die Temperaturen fast durchgängig die Frostgrenze von null Grad nur geringfügig überschritten. Drei Tage hatte es immer wieder geschneit, und eine üppige, durchgehende Schneeschicht bedeckte bald das Land. Danach stellte sich eine Hochdrucklage ein, mit strahlenden Sonnentagen und klaren, eiskalten Nächten. Durch den ausgiebigen Sonnenschein am Tag waren die obersten Schichten leicht angetaut, und in den frostigen Nächten wieder gefroren. Große Eiskristalle waren auf dem Schnee entstanden, die nun im Schein der an einem blitzblauen Winterhimmel strahlenden Sonne wie Abermillionen Diamanten das Licht reflektieren. Sie erschufen ein märchenhaftes Zauberreich, und für romantische Naturen war es gerade so, als seien Sterne vom Himmel gefallen.
So war es auch heute Morgen am Untersberg, dem von Sagen und Mythen umwobenen Berg zwischen Berchtesgadener Land und Salzburg; genau das richtige Wetter für eine Winterwanderung.
Es war kurz nach 10 Uhr, als sich in der Nähe vom Parkplatz beim Fuchsbach an der B 20 zwischen Bayerisch-Gmain und Bischofswiesen eine kleine Gruppe von Menschen um einen etwa 50-jährigen, kleinen, stämmigen Mann in Lederhose, grüner Bergjacke und dicken Wanderschuhen versammelte. Unter seiner dunkelroten Strickmütze schaute am Hinterkopf ein langer, weißer Zopf hervor, und am linken Ohr trug er einen Ohrring mit einem schmalen, hauchdünnen Holztäfelchen, darauf ein chinesisches Schriftzeichen. Er hatte sich auf einen niedrigen Baumstumpf gestellt, seine Hände in einer umfassenden Willkommensgeste ausgebreitet und lächelte die Teilnehmer fröhlich an.
Er nannte sich Qi, was wie „Tschi“ ausgesprochen wurde, vom chinesischen Wort für Energie und Atem. Seit vielen Jahren war das Leben im Wald und am Berg, besonders am Untersberg, zu seinem Lebensinhalt geworden; und nach und nach war es ihm gelungen, daraus eine Existenz aufzubauen. So veranstaltete er unter anderem geführte Wanderungen an wenig bekannte Plätze und Energieorte, wo es etwas anderes zu erleben gab, als es die gängige Wissenschaft lehrte. Ein esoterischer Spinner, ein „Schmarrenbeni“ eben, für die einen – aber nicht für die, die sich heute hier zusammengefunden hatten.
„So, hallo, griaß eichmiteinand. Sche, dass ihr kemma seids!“ Die leisen Gespräche unter den Wartenden verstummten. „Wir woll’n heut ein bisserl was vom Untersberg erfahren. Ihr wisst ja schon, dass dies hier ein ganz besonderer Ort ist, zu dem wir nun wandern wollen: ein Kraftort. Das Herzchakra Europas, wie der Dalai Lama sagt. Ich hab euch bei unserem ersten Treffen schon davon erzählt, und ihr habts ja schon viel dazu gelesen – jetzt wollen wir’s mal in der Natur direkt erleben, ob da was dran ist. Ich kann euch sagen: Wenn ihr euer Herz öffnet, wirklich öffnet, für neue Erfahrungen; wenn ihr euch frei macht von Überkommenem, frei von übernommenen Vorurteilen – dann werdets vielleicht etwas erleben, was ihr so nur hier, nur an dieser Stelle, auf unserem Planeten finden könnt.“
Er machte eine kleine Pause und senkte seine Hände, die seine Ansprache lebhaft begleitet hatten. Er schaute seine Zuhörer der Reihe nach an, bei jedem Einzelnen von ihnen ein paar Sekunden intensiv in seinem Blick verweilend. Sein Publikum bestand aus sieben Frauen und zwei Männern, und bis auf zwei Frauen von schätzungsweise Mitte zwanzig, die offenbar zusammengehörten, waren alle im mittleren bis leicht vorgerückten Alter. Sie hatten dem Redner aufmerksam zugehört, und auf ihren Gesichtern war durchweg so etwas wie gespannte Erwartung zu sehen.
„Also, wir werden sehen, was heut so passiert, was wir erleben werden; vielleicht treffen wir ja auf ein paar Untersbergmandl oder finden die eiserne Pforte am Hallthurm. Habts ihr alle was zu trinken und zu essen dabei? Seids warm genug angezogen? Seids alle fröhlichen Herzens? Fein. Dann: auf geht’s! Ich geh voraus: Zunächst laufen wir ein Stückerl den Waldweg hinauf, Richtung Bruchshäusl. Von da aus gehen wir zum Vierkaser, und dann schau’n wir mal weiter. Und bittschön, seids stad, soweit ihr’s könnt – umso mehr werdets erleben!“
„Wat soll‘n wir sein?“
Der Fragende war ein großer, sportlicher und breitschultriger, dunkelblonder Mann mit norddeutsch klingendem Dialekt und einem fröhlichen Blick aus strahlendblauen Augen, der offensichtlich mit den hier gebräuchlichen Ausdrücken noch nicht so ganz vertraut war.
Qi lächelte, als sich ein paar der Frauen nach dem Mann umdrehten und ihn interessiert genauer musterten.
„Ruhig, still sollst sein. Stad heißt ruhig – hast noch nie von der ‚staden Zeit’ gehört?“
„Ah!“ Der fragende Ausdruck im Gesicht verschwand.
„Jo, kloar! Hab ich nur noch nie drüber nachgedacht. So wat aber auch!“ Ein entwaffnendes Lächeln strahlte über sein Gesicht, und ein paar der Frauen merkten sich insgeheim vor, an welcher Position sie in der Gruppe auf der Wanderung gehen wollten.
„Gut. Dann also aufi!“
Qi drehte sich um und schlug einen Weg in den verschneiten Wald hinein ein. Die Gruppe schloss sich ihm an, einige redeten noch eine Weile mit gesenkter Stimme miteinander. Es gab noch ein paar kleine, fast unmerkliche Rangeleien unter den Damen bis klar war, wer den Platz neben dem Blonden ergatterte, nach und nach trat Ruhe ein. Bald hörte man nur noch die Schritte im Schnee.
Nachdem sie etwa eine dreiviertel Stunde bergauf gestapft waren, erklang plötzlich die Stimme einer der jungen Frauen.
„Ich weiß, das ist jetzt ziemlich blöd – aber ich muss mal pieseln! Mein Kaffee von vorhin drückt, ich hätt’ wohl doch besser nur eine Tasse trinken sollen.“ Etwas verlegen schaute sie in die Gesichter der Gruppe.
„Hey – wennst halt musst, dann is des so.“
„Jau“, hörte man die Stimme vom Mann aus dem Norden, „watmutt, dat mutt!“ Er grinste übers ganze Gesicht.
Sie verschwand im Gebüsch.
„Pass auf die Waldgeister auf!“, rief ihre Freundin feixend hinterher.
„Können wir eine rauchen?“, fragte eine Frau mit rot gefärbten, wilden Locken.
„Klar, warum nicht. Aber nehmt bitte eure Tschick mit – wir lassen nichts im Wald zurück!“, sagte Qi mit Nachdruck.
„Außer Pipi“, warf jemand ein, und alles lachte schallend.
Sie wollte nicht direkt am Weg pinkeln, wo sie jeder hören konnte; war ein Stück ins Unterholz gegangen, um eine günstige Stelle zu finden, als sich plötzlich vor ihr der Wald öffnete, und sie auf eine sonnendurchflutete Lichtung trat. Ungläubig sah sie sich um: Es war einfach nur märchenhaft und wie verzaubert, überall glitzerte und strahlte es um die Wette. Die Zweige der umstehenden Bäume waren weiß überzogen, auf den Ästen der Tannen lag reichlich Schnee, und auf ein paar verstreut liegenden Felsen lagen weiße, dicke Schneemützen, sodass manche aussahen, als seien sie geduckt hockende, dicke Zwerge. An einem bildete ein Vorsprung eine regelrechte Nase und ein Eiszapfen hing daran.
„Nein, also wirklich!“, sagte sie zu sich und vergaß völlig, warum sie eigentlich hierhergekommen war. „So eine Winterpracht! Wenn es doch bis Weihnacht so bliebe.“
Entfernt hörte sie das undeutliche Gemurmel und Gelächter der Gruppe, und jetzt fiel ihr wieder der Grund ein, weshalb sie hier war. Rasch lief sie zum nächsten Felsen, schaute sicherheitshalber noch mal, ob auch wirklich niemand da sei. Dann zog sie ihre Hose runter, hockte sich hin und ließ der Natur ihren Lauf.
„Nnnh …“, entfuhr ihr ein Seufzer der Erleichterung. Dann richtete sie sich wieder auf, zog die Hose hoch, richtete ihren Pullover und zog den Reißverschluss ihrer Jacke zu. Dabei schaute sie sich noch einmal um: Es sah wirklich alles so unglaublich zauberhaft aus, dass es kaum zu fassen war. Qi hatte recht gehabt, hier war es wirklich ganz besonders.
Gerade wollte sie sich umdrehen, um zurück zu den anderen zu gehen, da segelte ein großer Rabe an ihr vorbei, und landete hinter einem besonders mächtigen, dunklen Felsbrocken, der ein paar Meter von ihr entfernt auf der Lichtung am Waldrand lag. Sie hörte ein Krächzen und das Flattern von Flügelschlagen – es klang kurz so, als ob da noch weitere Vögel wären, die miteinander stritten.
Vorsichtig ging sie ihm nach, versuchte, so wenige Geräusche wie nur möglich zu machen, was im tiefen, verharschten Schnee gar nicht so einfach war. Doch die Raben waren offenbar so beschäftigt, dass sie nicht darauf reagierten. Als sie den Felsen erreichte, hörte sie ein leises, merkwürdiges Geräusch – so, als ob etwas Weiches zerriss. Vorsichtig streckte sie ihren Kopf vor, um an dem Stein vorbeizuschauen: Ja, da waren tatsächlich noch mehr der großen Vögel, vielleicht fünf oder sechs, und flatterten um etwas am Boden Liegendes herum. Pickten darauf ein, zogen und zerrten mit ihren Schnäbeln an etwas. Wieder diese leisen, reißenden Geräusche.
Ohne weiter zu überlegen, trat sie vor: Die Raben krächzten wütend, hüpften und flatterten umher, flogen auf, Richtung Wald. Neugierig trat sie näher: Der Schnee vor ihr war auf einer Fläche von vielleicht einem knappen Quadratmeter rot gefärbt. Sicher ein verendetes Tier, ging es ihr durch den Kopf, als sie sich bückte – und prallte erschrocken zurück: Unter dem Schnee erkannte sie die Konturen eines menschlichen Körpers. Die Raben hatten den Schnee vom Kopf gekratzt und daran herumgehackt. Ein grausam zerstörtes, augenloses Gesicht starrte sie an. Aus den Augenhöhlen, der Nase, dem Mund lief Blut, und im Schnee lagen Hautfetzen.
Entsetzt schlug sie eine Hand vor den Mund, stolperte rückwärts, fiel der Länge nach hin. Hastig rappelte sie sich wieder hoch und rannte, so schnell sie konnte zurück, ihren Fußspuren nach; erreichte den Waldrand, und hörte schon die Stimmen der anderen.
„He! Hallo! Hier! Ich hab was gefunden!“, rief sie atemlos, noch bevor sie den Weg erreicht hatte.
„Ah, da ist ja unsere Quellnymphe wieder!“, rief die rothaarige Frau, lachte und verschluckte sich dabei am Rauch ihrer Zigarette. Hustend warf sie den Glimmstängel auf den Boden, besann sich aber eines Besseren; drückte die Glut im Schnee aus und steckte ihn dann in ihre Jackentasche.
„Na“, empfing sie ihre Freundin, „biste erleichtert?“
„Da hinten liegt einer!“ Sie zitterte am ganzen Körper, und Tränen schossen ihr in die Augen.
Qi drückte sich durch die Wartenden.
„Wo liegt einer?“, fragte er.
„Dahinten – bei den Felsen!“ Ihre Augen waren weit aufgerissen, und er sah den Schrecken darin, den sie erlebt haben musste
„Bist sicher?“
„Ja, verdammt! Alles ist voller Blut, und …“, sie verstummte, vom Grauen geschüttelt. „Sie haben daran gefressen!“
„Wer hat daran gefressen?“
Sie war völlig aufgelöst, blass, zitterte, und das Entsetzen stand ihr ins Gesicht geschrieben.
„Die Raben! Die Raben haben am Gesicht gefressen!“
Alle starrten sie entgeistert an.
„Was hast du denn da am Handschuh?“
„Was? Wo?“
Sie hob ihre Hände, drehte sie hin und her – und tatsächlich, an der Unterseite der linken Hand, da, wo sie sich im Fallen abgestützt hatte, klebte etwas Rotes mit etwas Grauweißem darin. Entsetzt schüttelte sie ihre Hand, um den Handschuh loszuwerden, kreischte verzweifelt, zappelte panisch herum – bis er im hohen Bogen davonflog. Ihre Freundin nahm sie in den Arm, versuchte, sie zu beruhigen.
„Okay.“ Qi richtete sich mit einem angespannten Gesichtsausdruck auf. „Wir gehen mal nachschauen. Magst mir zeigen, wo das war?“
Sie schüttelte heftig den Kopf.
„Du brauchst ja nur meinen Spuren im Schnee zu folgen. Bitte – ich will da nicht wieder hin!“ Die Angst stand ihr im Gesicht. Das Nordlicht schob sich neben ihn.
„Komm, ich geh mit – vielleicht ist es ja was ganz anderes!“
„Gut. Ihr anderen wartet hier bitte; und kümmerts euch ein bisserl um sie!“
Als sie den Felsen erreichten, erkannte Qi sofort, dass dort tatsächlich etwas lag, das hier nicht sein sollte: Es war wirklich ein Mensch, bis auf den Kopf völlig von Schnee bedeckt; und darum herum waren die Spuren der Vögel zu erkennen, die dort herumgehüpft waren. Der Schnee war rot vom Blut, und das, was einmal ein menschliches Gesicht gewesen war, war völlig verwüstet, kaum noch als ein solches zu erkennen. Er war sich noch nicht einmal sicher, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Während seiner Zeit beim Roten Kreuz hatte er immer wieder mit schrecklich zugerichteten Unfallopfern zu tun gehabt. Aber das hier, mitten in der stillen, friedlichen Natur einen Leichnam zu finden, der wie ein verendetes Wildtier angefressen wurde, war dann noch einmal etwas anderes.
Er sah den erschrockenen Gesichtsausdruck des Blonden. Um seinen Mund zuckte es, er war leichenfahl. „Mann. So eine Scheiße.“
„Ja.“
„Jetzt wissen wir es. Wir müssen die Polizei rufen. Hast du ein Handy dabei? Machst du das?“
Das Nordlicht starrte ihn noch einen Augenblick entsetzt an, riss sich dann aber zusammen.
„Okay.“ Er knöpfte die Brusttasche seiner Jacke auf, holte ein Smartphone heraus und schaute auf das Display. „Ich bin im österreichischen Netz!“
„Ja, logo, wir sind ja hier auch schon die ganze Zeit in Österreich; die Grenze verläuft hier direkt am Bach, unten an der Straße.“ Er überlegte.
„Wie machen wir’s denn jetzt? Deutsche oder österreichische Bullerei?“
„Ist das denn wichtig?“, fragte Nordlicht, „die werden uns schon sagen, wat Ambach is!“
Qi schaute auf.
„Was was ist?“
„Wat Ambach is! Ach so – was zu tun ist. Nur so’n Ausdruck.“
„Also gut – rufst halt 112 an, wer’nmerscho seng, wo mer landen.“
Nordlicht drückte die Tasten, hielt sich das Gerät ans Ohr. Als sich jemand meldete, hielt er das Mikrofon kurz zu und flüsterte „Die Ösis!“. Dann meldete er sich, schilderte, was geschehen war.
„Wo wir sind, wollen sie wissen“, fragte er. Qi stand auf, nahm das Handy an sich. Er schilderte genau, wo sie waren, hörte aufmerksam zu.
„Okay, machen wir. Und danke! Servus!“ Dann gab er das Handy zurück.
„Tja“, sagte er, „wir sollen hier warten. Also am Weg. Und so wenig wie irgend möglich durcheinanderbringen. Am besten in den eigenen Fußspuren zurück!“
Die Gruppe wartete schon, die Menschen scharten sich aufgeregt um die beiden. Als sie erfuhren, dass dort tatsächlich eine Leiche im Schnee lag, verstummten alle. Die junge Frau, die den Fund gemacht hatte, begann wieder leise zu schluchzen; ihre Freundin nahm sie in den Arm, sprach tröstend auf sie ein.
„Also, wir müssen hier auf die Polizei warten; ich denk sie brauchen ungefähr eine Viertelstunde bis zum Parkplatz, dann noch eine halbe Stunde hier rauf. Ich bitt’ euch, versucht euch irgendwie abzulenken und warm zu halten. Aber schaut, dass ihr keine möglichen Spuren zertrampelt oder so, sie haben uns extra darauf hingewiesen. Und: Ihr könnt euch ja denken, dass mir das alles sehr leidtut – eigentlich wollten wir ja auf eine andere Art und Weise etwas Außergewöhnliches erleben!“
Alle nickten zustimmend und versuchten, irgendwo ein Plätzchen zum Hinsetzen zu finden.
Die Frau mit den wilden roten Locken zog ihre Zigarettenschachtel hervor und schaute kurz auf die fettgedruckte, drohende Aufschrift: „Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu“.
„Ha!“, dachte sie, „am Ende stellt sich noch heraus, dass der im Wald am Rauchen gestorben ist!“.
Sie zog ihr Feuerzeug raus, nahm eine Zigarette aus der Packung und zündete sie sich mit einem grimmigen Gesichtsausdruck an.
3.
Es war bereits nach 13 Uhr, als Manner, zurückgekehrt von seinem morgendlichen Einkauf, es sich mit der Samstagsausgabe der Salzburger Nachrichten an seinem Küchentisch gemütlich machte. Vor sich hatte er eine Tasse Sencha-Grüntee: Den schickte ihm immer wieder einmal eine japanische Freundin aus Freiburg, und sie bekam ihn ihrerseits von ihrer Mutter, direkt aus Japan. Die war nämlich der Meinung, dass es in ganz Deutschland – eigentlich in ganz Europa – keinen guten Grüntee gäbe. Und wirklich: Wenn er ihn so zubereitete, wie Sonoko es ihm damals beigebracht hatte, – dann war es ein unvergleichlicher Hochgenuss. Im Büro reichte es immer nur für einen Verlängerten aus dem Automaten: einen „Dreckigen“, wie er ihn nannte, und seiner Meinung nach der schlechteste Kaffee von ganz Salzburg; oder für irgendeinen Teebeutel im heißen Wasser. Aber, wenn er frei hatte: Dann hatte er es sich angewöhnt, sich für das, was ihm wichtig war, wirklich Zeit zu nehmen.
Das hatte er in seinem Leben erstmals in der Reha gelernt, nach seinem Zusammenbruch: wie wichtig es ist, sich für etwas Zeit zu nehmen, das einem guttut. Auf sich selbst aufmerksam zu sein und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen – ohne immer gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Er durfte das!
So war auch sein Plan für den heutigen Abend ein Teil der neuen Erfahrung, sich selbst etwas zu gönnen – und nichts und niemand würde ihn davon abhalten: Im Fernsehen würde das Spiel Manchester United gegen Schalke 04 in der Champions League übertragen. Darauf freute er sich schon die ganze Woche! Er war sich sicher, dass ManU die Schalker im Stadion von Old Trafford aber so etwas von demontieren würden, dass die Blau-Weißen sich vor lauter Wut und Enttäuschung über ihr Versagen gegenseitig ihre Trikots von den verschwitzten Leibern reißen und noch im Stadion vor johlenden englischen und wehklagenden deutschen Fans verbrennen würden. Er grinste. Das wär’s doch mal!
Um nur ja nichts davon zu verpassen, hatte er sich extra dieses Wochenende frei genommen, die Kollegen würden mit dem vorweihnachtlichen Kram schon klarkommen. Es würde schon nicht ausgerechnet heut’ jemand umgebracht oder eine Bank ausgeraubt werden. War abends früh genug ins Bett, um wirklich ausgeschlafen zu sein – und dann dieser Traum!
Nach dem Aufstehen hatte er sich mit zwei Bechern starken Milchkaffees von dem immer noch nachklingenden und äußerst unangenehmen Gefühl des Erstickens erholt, frühstückte eine vom gestrigen Abendbrot übriggebliebene labbrige Scheibe Toast mit Bergkäse, der von den darauf liegenden Gurkenscheiben regelrecht aufgeweicht war und kümmerte sich kurz um das Allernotwendigste in seiner Wohnung.
Dann war er in aller Ruhe losgezogen, um sich die Grundversorgung für den Abend vorm Fernseher zu besorgen: Beim Metzger hatte er zwei Paar Würstel gekauft, beim Bäcker eine Tüte voll frischer Semmeln, dazu noch im Supermarkt ein Sechser-Tragerl TrumerPils und ein paar Knabbereien geholt. Anschließend war er noch in seine Lieblingstrafik gegangen, hatte sich die Zeitung gekauft und mit Hans, dem fast zwei Meter großen Besitzer und alten Motorradkumpel, einen kleinen Plausch über die chaotischen Straßenzustände in der Stadt gehalten. Über das Spiel heute Abend verlor er kein Wort, denn vom Fußball verstand Hans – schon weit in den Sechzigern, mit einem scheinbar ohne Hals übergangslos auf dem riesigen Körper aufsitzendem Kopf, auf dessen spiegelblank polierter Glatze das Licht der Ladenbeleuchtung glänzende Effekte hervorrief; und mit einer Geduld gesegnet, die ebenso umfangreich war wie sein gewaltiger Bauch, der in den wohl größten Hawaiihemden steckte, die Manner jemals gesehen hatte – leider nichts.
Ging es um Motorräder: Jederzeit, darüber konnten Manner und er nach wie vor stundenlang fachkundig ratschen und philosophieren. Jedoch über Fußball – nix.
Aber als guter Kaufmann hatte Hans es sich angewöhnt, mit seinen fußballnarrischen Kunden so zu tun, als würde er verstehen, worum es ging: Nur wenige wussten von dieser kleinen Schwäche, und Manner war einer davon. Er genoss es, zuzuhören – und vor allem zuzuschauen – wenn wieder einmal so ein Mensch, der sich für einen ausgesprochenen Fußball-Fachmann hielt, den armen Hans mit irgendwelchen Details über diesen und jenen unglaublichen Fehler vom Spieler XY und von einem Volldepp von Schiedsrichter namens Oarschloch vollquatschte. Der sich dann seinerseits mit seiner ganzen Körpermasse auf einem seiner muskulösen und überaus farben- und abwechslungsreich tätowierten Arme ganz interessiert an seine Theke lehnte, sich mit zusammengekniffenen Augenbrauen und halboffenem Mund mit Äußerungen wie „Ah!“, „So?“ und „Na, ned wirklich!“ am Gespräch beteiligte – bis der Kunde dann nach einer Weile zufrieden mit seinem Einkauf abzog. Hin und wieder konnte man in dem Gesicht des einen oder anderen so etwas wie einen fragenden, stutzenden Ausdruck erkennen, wenn Hans an der falschen Stelle eine unpassende Äußerung eingeworfen hatte. Aber meist machte er seine Sache ganz gut. Es war wirklich sehenswert und eigentlich eine durchaus honorable komödiantische Leistung, wie Manner fand.
Hans und er kannten sich schon eine Ewigkeit, waren vor langer Zeit beide Mitglieder in einem Salzburger MC, einem Motorradclub, gewesen – in der Zeit bevor er sich zu einer Polizeilaufbahn entschloss. Damals waren sie Motorrad-Brüder, und auch danach über die Zeit weiterhin gute Freunde geblieben. Aber während Hans immer noch Biker war und mit seiner alten Harley-Davidson Shovelhead namens „Putzi“ – so benannt nach einer seiner Lieblingstanten – nach wie vor Touren unternahm, stand Manners „Eisenschwein“ genannte Yamaha seit vielen Jahren eingemottet in der Garage.
In Hans‘ Trafik hatte er auch schon das eine oder andere Mal etwas erstanden, was normalerweise nicht zum Standardsortiment gehörte:Hans hatte immer noch gute Kontakte zu den Leuten von damals, die auch „ungewöhnliche“ Dinge technischer Art beschaffen konnten; was die nicht immer einfache Arbeit als Polizist im LKA erleichtern konnte. Inoffiziell natürlich.
Es war auch schon vorgekommen, dass er sich ein paar von Hans‘ selbstgebackenen Kräuterkeksen mit nach Hause nahm, die der für gute Freunde unter der Ladentheke parat hielt: Sie waren gut, wenn sich die depressiven Gedanken in ihm breitmachten. In der Vergangenheit speziell an einsamen Wochenenden, an denen er nichts Rechtes mit sich anzufangen wusste; und an denen der schwarze Schatten nur auf eine Schwäche von ihm wartete, um aus seinem Abgrund emporzukriechen, und seine gierigen Finger nach ihm auszustrecken. Aber das war zum Glück Geschichte.
Heute gönnte er sich zur Feier des Fußball-Tages noch ein 5er-Schachterl Villiger-Virginia-Zigarillos, die Hans extra für ihn immer bestellte. Viel rauchte er nicht mehr, aber so ganz wollte und konnte er nicht davon lassen. Vielleicht irgendwann mal, dachte er immer wieder. Vielleicht, wenn er doch noch einmal mit einer Frau zusammenzöge – seine Gedanken schweiften ab – zu Tina. Vielleicht!
Er warf noch einen kurzen Blick auf die Auslage der Motorradzeitschriften, entschied sich aber, dass die Wochenend-Zeitung genügte.
„Also, Hänschen, bis bald – baba!“
„Pfiat di, Konny, viel Freud‘ heut‘ Abend!“
Wieder zu Hause hatte er sich dann aus einem guten Esslöffel Dijonsenf, zwei Eigelb, Öl, etwas Zitrone, etwas Essig, gutem – das war ganz wichtig! – aromatischem Meersalz, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und einer Prise Rohrzucker schnell eine Mayonnaise gerührt. Seit seiner Kindheit war er ganz versessen auf Würstel mit Mayo – nur selbst gemacht und aus guten Zutaten musste sie sein!
Wenn dann das Spiel anfangen würde, dann säße er bereits gut vorbereitet in seinem alten Sessel, die heißen Frankfurter, die Schale mit der Sauce und den Semmelkorb auf dem Tischchen neben sich, und eine gut gekühlte Flasche Trumer in der Hand. Und dann – Fußballabend!
Ja, dachte er, während er in der Zeitung blätterte, seinen Sencha schlürfte und dabei in seiner etwas altmodischen und unpraktischen, aber, wie er fand, sehr gemütlichen Küche herumblickte: So eine eigene Wohnung, nur für sich, hatte eben manchmal auch etwas für sich. Im Radio hatte er Jazz-FM, einen Internetsender, eingestellt, in dem gerade der erste Teil von Keith Jarretts Köln-Konzert gespielt wurde. Manner lehnte sich befriedigt zurück und schloss die Augen; lauschte den entspannten Klängen, die er sich in seinem Leben schon viele dutzende Male angehört hatte. Er seufzte behaglich: So war es doch wirklich gut, sein Leben.
Und wenn er sich jetzt schon ein Zigarillo genehmigte? Wieso eigentlich nicht – niemand außer er selbst konnte ihn daran hindern! Er schob den alten Küchentisch ein Stück vor, sprang voll Elan auf und hatte schon fast sein Wohnzimmer erreicht, wo die noch geschlossene rote Packung für heute Abend bereitlag – da klingelte im Flur, auf dem kleinen alten Tischchen mit dem Wurzelholzfurnier, sein Diensthandy.
„Verdammt!“ Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Er schaute auf das Display: Chris rief an.
Mist, dachte er – hoffentlich will er nur was fragen. Sofort spürte er wieder seinen altbekannten Druck im Magen: dort, wo der Knoten saß.
„Habe die Ehre“, meldete er sich. „Na, Kollege, willst mich für morgen zum Frühstück einladen?“ Sonntagmorgens trafen sich Manner und seine engen Kollegen hin und wieder zum Frühstück in der Altstadt im Escobar. Das machten sie schon seit einigen Jahren, waren gern gesehene Stammgäste geworden und hatten mittlerweile ihren Stammtisch. Hin und wieder kam Manners Freundin Tina mit – die „Manner-Schnitte“, wie sein Kollege, Oberleutnant Christian Möckel, bei jeder sich bietenden Gelegenheit breit grinsend betonte, wenn das Gespräch auf sie kam. Er konnte es eigentlich nicht mehr hören – auch, wenn das Wortspiel mit der weltberühmten Haselnuss-Kakaocreme-Waffel aus Wien eigentlich als nettes Kompliment entstanden war: Als Christian Tina das erste Mal zu Gesicht bekam, war ihm nach einem anerkennenden leisen Pfiff die Bemerkung „Na, das ist ja mal eine Schnitte!“ entfahren; und gleich danach, mit einem Blick auf ihn, rief er grinsend und laut: „Ha! Eine Manner-Schnitte!“
„Servus, Herr Major“, hörte er Christians Stimme; und er hörte sich gar nicht fröhlich oder locker an.
Auweh, dachte er, das wird jetzt was geben.
„Leider nein, mein Lieber, kein Frühstück – es hat einen Toten gegeben. Und so wie’s ausschaut möglicherweise mit Gewalteinwirkung. Der Erkennungsdienst ist schon vor Ort, und Dr. Fuhrmann ist auch schon unterwegs.“
Manner stöhnte laut und enttäuscht ins Handy.
„Komm – wennst Glück hast, bist zum Spiel wieder daheim!“ Chris hatte also nicht vergessen, wie sehr er sich auf heut Abend gefreut hatte.
„Also, kommst erst her oder sollen wir uns am Fundort treffen?“
„Wo müssen wir denn hin?“
„Zum Untersberg, eine Einfahrt kurz hinter dem Parkplatz am Fuchsbach, kurz vor Hallthurm.“
„Ist der Fundort auf unserer Seite? Oder auf der deutschen?“
Christian lachte leise.
„Die Hoffnung muss ich dir nehmen: eindeutig bei uns.“
Manner brauchte nicht lange zu überlegen: Wenn er mit seinem eigenen Wagen fuhr, sparte er definitiv Zeit. Würde er bei dem vorweihnachtlichen Verkehr in der Stadt erst zum LKA in der Alpenstraße und dann von dort nach Hallthurm fahren, dauerte es bestimmt eine halbe Stunde mehr wenn nicht noch länger, als wenn er von seiner Wohnung in Grödig direkt zum Fundort fahren würde. Außerdem war er dann auch schneller wieder zu Hause: ManU gegen Schalke! Das durfte er nicht verpassen!
„Ich fahr selbst“, sagte er, „wo genau muss ich hin?“
„In der Auffahrt zum Weg steht ein Kollege von der Inspektion Anif, der zeigt dir, wo du rauf musst. Nimm ein Licht mit, wird ja schon recht früh dunkel.“
„Okay, dann seh‘n wir uns dort. Ich beeil mich!“
„Alles klar, bis nachher.“
Er schaute auf den Anzeigebalken des Handyakkus: noch etwa ein Drittel voll. Wird schon reichen, dachte er. Aus dem Küchenradio hörte er, wie Keith Jarrett sein Klavierspiel mit orgiastischen Lauten wie „Ahhh!“ und „Ohhh!“ begleitete. Mit einem Gefühl zwischen Verärgerung und Resignation legte er das Handy zurück auf das Tischchen.
So ein Scheiß, jetzt wird’s doch nicht so gemütlich, wie ich’s mir so fest vorgenommen hatte, und du bistauch noch selbst schuld, dachte er mit einem müden Gefühl und schaute dabei auf sein leicht verzerrtes Spiegelbild im Glas der Wohnzimmertüre. Irgendwann war ihm mal, als er dort stehend, telefonierend und sich selbst betrachtend, bei so einer Gelegenheit eingefallen, in wie vielen Kriminalromanen die Autoren sich solche Momente ausdachten, um ihren Protagonisten zu beschreiben. Er sah sich schief an, wobei seine blauen Augen einen leicht spöttisch bis verzweifeltresignierenden Ausdruck hatten: Hatten die denn keine besseren Ideen?