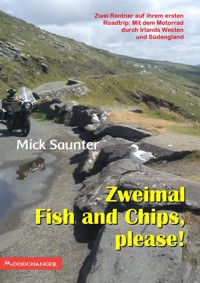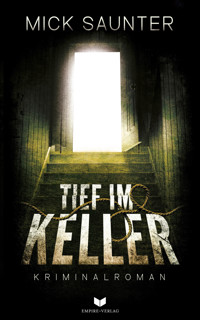Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mick ist Anfang Vierzig, und steht mitten im Leben: Mit einer prima Familie, einem Job, der ihn fordert und eigentlich Spaß macht, Hobbys, Freunde - alles völlig normal. Doch in dem unpassendsten Moment, gerade, als er sich selbstständig gemacht hat, tritt auf einmal, völlig überraschend und unangemeldet, eine bislang unbekannte Besucherin in sein Leben: Der dunkle Schatten einer schweren Depression. Nach einer fast zwanzig Jahre dauernden Odyssee voller Fragen, Therapien, Klinik-Aufenthalten, Zweifeln und Hoffnungen erkennt er endlich was er tun muß, um wieder ein normales Leben führen zu können - und alles ändert sich zum Guten. Ein unerwarteter Besuch ist der Bericht über eine Suche nach dem Warum – und die mit großer Offenheit erzählte Biografie eines eigentlich ziemlich durchschnittlichen Lebens, dass plötzlich und scheinbar grundlos aus den Fugen gerät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein unerwarteter Besuch
Mick Saunter, 1957 in Wuppertal geboren, hat seit seiner Jugend mindestens zwei Leidenschaften: Motorräder und Bücher. Zum Fahren von Motorrädern braucht es den entsprechenden Führerschein – das war relativ schnell erledigt. Zum Schreiben von Büchern braucht es aber mehr: Wissen über das Leben. Das zu sammeln dauerte etwas länger: Er flog mit sechzehn vom Gymnasium, wurde Eisenwarenkaufmann, war Funker beim Bund, fuhr Lkw, verkaufte Versicherungen, und arbeitete in der Autowerkstatt seines Vaters. Lernte das Tischler-Handwerk und holte den Schulabschluss nach, gründete eine Familie, studierte Holztechnik, und plante über viele Jahre Läden in ganz Deutschland.
In der Lebensmitte lernte er durch Zufall (den es gar nicht gibt: Nichts geschieht zufällig, sondern hat immer einen Sinn) eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung kennen. Das veränderte in seinem Leben alles: Er begann mit geistig und psychisch behinderten Menschen zu arbeiten, leitete die Arbeitstherapie in einer Suchthilfeklinik, führte ein Haus für junge Menschen mit Handicap, und lebte in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit Menschen, die aufgrund ihrer Behinderungen ständige Betreuung brauchen.
Man sollte meinen, dass das jetzt an Lebenserfahrung genügte. Aber erst nach einer schweren Depression erkannte er, dass es jetzt aber wirklich an der Zeit war nur noch das zu tun, was er schon sein ganzes Leben lang wollte - und fing mit fast Sechzig an zu schreiben.
Mick Saunter
Ein unerwarteter Besuch
oder
Was glaubst Du eigentlich, wer Du bist
2. Auflage Juli 2024
© 2024 Mick Saunter, Wuppertal
www.saunter.de
Für meine Töchter
Vorwort
Ich wünsche Ihnen, dass das Thema meines Buches für Sie nur etwas ist, das Sie interessiert, und über das Sie sich informieren wollen. Und dass Sie hoffentlich niemals an einer Depression erkranken.
Sollte es aber doch mal dazu kommen, oder Sie sind bereits erkrankt, und die Depression lässt Sie kaum atmen: Nagelt Sie förmlich an den Stuhl, ans Bett. Macht aus jeder kleinen Anforderung an Sie eine unlösbare und nicht zu bewältigende Aufgabe. Lässt Sie sich fühlen als der totale Versager, der es noch nicht mal schafft, sich wenigstens ein Bisschen zusammen zu reißen; und Sie haben das Gefühl, dass Sie ihr Leben nie mehr in den Griff bekommen – dann möchte ich Ihnen Mut machen!
Auch, wenn es sich für Sie in einer depressiven Phase nicht so anfühlt, als dass sich Ihre Situation jemals wieder verbessern könnte: Ihr durch die Depression verzerrtes Gefühl lässt Sie dies alles fühlen. Sie macht Ihnen nur vor, dass es niemals enden wird – es ist nicht so! Sie sind nach wie vor Sie selbst, Sie sind nicht die Depression! Sie haben eine Erkrankung, die behandelbar ist, wie die meisten Erkrankungen – das ist ganz wichtig zu erkennen! Und genau so wenig Sie die Depression sind, und nicht immer in diesem Zustand bleiben müssen, ist auch dieses Gefühl nur vorübergehend ein Teil von Ihnen. Es wird Ihnen wieder besser gehen, haben Sie Vertrauen.
Eine Depression ist eine schwere, ernstzunehmende Erkrankung, die gut behandelt werden kann. Und die in Ihrem Interesse – unbedingt hauptsächlich in Ihrem! – bald behandelt werden sollte. Dabei kann es durchaus sein, dass Ihre Depression oder Ihr Burnout nur ein kurzes Gastspiel in Ihrem Leben gibt. Dass Sie gut therapiert werden – von dem für Sie passenden Arzt oder Ärztin – und in ein paar Wochen oder Monaten ist alles vorbei. Das ist gar nicht so selten. Wenn es aber nicht so ist, dann ist mein Rat: Nehmen Sie es an!
Akzeptieren Sie, dass Sie jetzt in einer Phase Ihres Lebens sind, in der es an der Zeit ist, über Ihre bisherige Existenz auf Erden nachzudenken: Was Sie mitgebracht haben. Was Sie daraus gemacht haben. Was davon eigentlich von anderen gekommen ist. Was Sie nur übernommen haben. Und was davon wirklich Ihres ist!
Akzeptieren Sie, dass es an der Zeit ist, alles aus einer neuen Position zu betrachten, und: Das endlich wahrzunehmen, was Sie bisher versäumt haben anzuschauen. Akzeptieren Sie es, alles andere hat erst mal gar keinen Sinn: Es ist ab jetzt Ihr Ding, Ihr neuer Begleiter – ob Sie es wollen oder nicht. Egal, wie unbequem es jetzt ist. Wie unpassend auch immer, gerade jetzt.
Und verstehen Sie vor allem, dass Ihnen niemand sagen kann, wie lange es bei Ihnen dauern wird. Es sind eben nicht einfach nur Kopfschmerzen, die mit ein paar Tabletten wieder verschwinden.
Was es vielleicht auch für Sie so unfassbar macht ist, dass es scheinbar ganz ohne Grund gekommen ist, und ohne jeden erkennbaren Anlass. Wie aus heiterem Himmel. Aber: Das stimmt nicht! Es gibt einen Grund, einen Anlass, seien Sie sicher. Aus Gründen, die nur Ihre Seele kennt, haben Sie diesen Anlass bisher gut versteckt, gut unterdrückt. Denn nichts anderes bedeutet es, eine Depression zu haben – etwas zu unterdrücken. Das mussten Sie bisher – damit Sie die vergangene Zeit überleben konnten. Diese Zeit, in der Sie nicht Sie sein durften, Ihre Seele nicht ganz und gar frei war. Bisher hat das mal mehr, mal weniger gut geklappt – oder ? Jetzt aber, zu einer ganz bestimmten Zeit Ihres Lebens, ist es zu viel geworden: Es will und muss heraus aus seinem Versteck! Sie haben zum Schluss einfach nicht mehr die Kraft gehabt, es weiter zu verstecken. Herunter zu drücken. Zusätzlich zu all dem, was Ihr Leben eh schon an Last, an Verpflichtung, an Verantwortung von Ihnen abverlangt, haben Sie bisher die ungeheure Energie aufbringen müssen, auch noch das zu unterdrücken, was einen entscheidenden Anteil an ihrem Selbst haben will, haben muss. Haben darf! Aber, eben bisher noch keinen Raum in Ihrem Leben hat einnehmen können: Weil Sie ihm keine Möglichkeit dazu gegeben haben. Geben konnten.
Es gab einen Grund, warum Sie das gemacht haben, warum Sie es unbewusst unterdrückt haben: Weil Sie nicht anders überleben konnten. Es war Ihre Überlebensstrategie. Jetzt geht das nicht mehr!
Nehmen Sie es an – und Ihr Leben wird ein Anderes werden.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Sie im Laufe Ihrer nun beginnenden Reise zu dem Menschen werden, der Sie eigentlich schon immer waren. Eigentlich schon immer hätten sein können: Sie selbst!
Es ist weiter sehr wahrscheinlich, dass der Prozess, in dem Sie hoffentlich bald mit einem guten, zu Ihnen passenden Therapeuten eintreten werden, Ihnen ganz oft furchtbar weh tun wird. Deshalb gewöhnen Sie sich schon mal an den Gedanken, dass Sie möglicherweise bald vor einem Ihnen einigermaßen fremden Menschen sitzen, und weinen werden. Keine Angst: Das gehört dazu. Es darf endlich sein! Es sind die Tränen aus Ihrer Vergangenheit, die Sie bisher noch nicht haben weinen können. Lassen Sie ihnen freien Lauf – es tut wirklich gut! (Spätestens dann werden Sie erkennen, wozu die Packung Papiertaschentücher eigentlich ist, die immer auf dem Tischchen vor Ihnen steht: Sie war nämlich nicht für den Schnupfen ihres Therapeuten bestimmt!)
Sie werden in Ihrer Therapie vielleicht Zusammenhänge in Ihrer Vergangenheit erkennen, die Sie nie zuvor auch nur erahnen konnten. Es wird Ihnen manchmal vorkommen, als ob Ihnen jemand Scheuklappen abnimmt, die ihnen Ihren Blick auf die Wahrheit, auf Ihre Wahrheit verstellt haben. Ich bin mir sicher: Sie werden es manchmal nicht fassen können: Dass Sie das nicht schon früher erkannt haben! Machen Sie sich darüber keine Gedanken, keine Selbstvorwürfe – Sie konnten bisher nicht anders.
Mit einem kleinen bisschen Glück werden Sie irgendwann den Moment erleben, in dem es in Ihrem Kopf leise „Klick“ macht. Oder ein lautes „Krach!“ Sie in Ihren Grundfesten erzittern lässt: Weil die eisernen Bänder, die Sie zum Schutz um Ihr Herz gebunden hatten, zerspringen. Und die ab jetzt nie mehr gebraucht werden!
Sie werden auf Ihrer Reise lernen, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen mit anderen Augen zu sehen. Manche kennen Sie schon von früher, manche werden neu in Ihr Leben treten. Dabei sind solche, die Ihnen gut tun – leider aber auch ganz bestimmt welche, die ganz und gar nicht gut für Sie sind. Die keinerlei Verständnis haben für das, was Sie durchmachen, und dass Sie nun ein anderer werden, und den sie so nicht haben wollen. Auch das gehört dazu, und es ist gut so. Schließen Sie die, die Ihnen nicht gut tun, so weit wie möglich aus Ihrem Leben aus, und öffnen Sie sich für die, die Ihnen zuhören. Die Ihnen beistehen, wenn wieder mal alles grau für Sie ist. Die einfach nur für Sie da sind, die keine Anforderungen an Sie haben, oder irgendwelche Gegenleistungen erwarten. Denen es wichtig ist, dass Sie sich endlich befreien, und Sie selbst werden. Die anderen saugen nur die Lebensenergie aus Ihnen; und die brauchen Sie ab jetzt ganz für sich selbst, für Ihr Leben. Also, weg mit denen – je eher desto besser.
Seien Sie offen für Alles, was ab nun in ihr Leben tritt, und nehmen Sie es an.
Ich wünsche Ihnen, dass bei Ihnen alles leichter, weniger schmerzhaft und viel schneller geht als bei mir. Von ganzem Herzen. Aber, falls nicht: Verstehen Sie, dass es sich lohnt durchzuhalten und weiterzumachen. Dass es um Sie geht – es geht um ihr Leben!
Haben Sie Geduld: Sie haben ihr Leben lang, vielleicht über Jahrzehnte, etwas Wichtiges in sich unterdrückt. So was hinterlässt tiefe Spuren, prägt sich tief ein – das kann man nicht mal eben und in ein paar Tagen oder Wochen ändern, und erwarten, dass es so schnell wieder verschwindet, als wenn eine Welle die Fußabdrücke im Sand wegspült. Und schon gar nicht, in dem man ein einfach nur paar Pillen schluckt. Jetzt etwas für Sie bisher so Elementares zu ändern braucht seine Zeit. Je eher sie das akzeptieren, umso leichter wird es danach werden.
Erst müssen Sie erkennen, was gewesen ist. Dann kommt die Zeit, sich für einen neuen Weg zu entscheiden – und ihn schließlich ohne Bangen zu beschreiten. Geben Sie sich alle Zeit der Welt, die Sie dazu brauchen! Nehmen Sie sie sich, egal wie sehr die Umstände, die sogenannten Sachzwänge auch dagegen sprechen. Es ist elementar wichtig! Spüren Sie, wie mit der Zeit Ihr Urvertrauen langsam wieder zu Ihnen zurück kommt: Das Vertrauen darin, dass alles gut wird, dass Sie im Hier und Jetzt leben können, ohne sich ständig über die Zukunft zu sorgen oder die Vergangenheit zu betrauern. Das tiefe und unerschütterliche Vertrauen, das Sie schon einmal hatten. Das wir alle mal hatten – damals, als wir auf diese Welt kamen.
Erfahren Sie wie es ist: Das Sie es endlich, endlich, endlich wieder fühlen – dass Sie jederzeit so sein dürfen. So, wie Sie tatsächlich sind. So, wie Sie von Anfang an für diese Welt vorgesehen wurden, sind Sie richtig. Und fühlen Sie, was es bedeutet: Ihr Leben zu leben.
Ich wünsche Ihnen, Dir, Euch dabei von Herzen alles Gute.
Der Aufbruch
„Menschen sterben nicht wenn man sie ins Grab legt,
sondern wenn sie ihre Träume aufgeben.“
Aus „Das weiße Segel“, von Sergio Bambaren
4. September 2014
Bad Tölz
Vor etwa sechs Wochen haben meine Depressionen und die panikartigen Angstattacken eine Dimension erreicht, die mich zweifeln lässt, ob ich noch lange tatsächlich so weiter machen kann: So weiter zu leben wie bisher. Immer öfter stellt sich mir die Frage, ob ich, in der Hoffnung darauf, dass es irgendwann wieder wirklich besser wird, es noch länger durchhalten kann. Das, was seit Jahren meine Lebensenergien mehr und mehr auffrisst: Trotz meiner so hartnäckigen, seelischen Qualen die Kraft aufzubringen nicht aufzugeben, und immer wieder aufzustehen. Egal, wie hoffnungslos es aussieht.
Immer öfter frage ich mich, ob es nicht irgendwann doch so weit kommt, dass ich endgültig liegen bleibe – weil einfach keine Kraft mehr dafür in mir ist, wieder aufzustehen. Alle bisher vergeblichen Versuche der vergangenen Jahre, einen wirklichen Weg aus meiner immer wieder auftauchenden Dunkelheit, meiner Leblosigkeit zu finden, stets in der Hoffnung und im Vertrauen darauf, dass die Ärzte und Psychologen schon erkennen würden, was sie denn mit mir am besten anstellen sollten, führten mich letztendlich doch nur wieder ins Dunkle zurück - an den Ort völliger Einsamkeit, Kraft- und Hilflosigkeit. Übrig blieb jedes Mal die letzte, unbeantwortete Frage: Warum ?
Das muss ich heraus bekommen - ich weiß jetzt, dass es für mich nur diesen einen Weg zurück ins Leben gibt: Ich muss den wirklichen, den eigentlichen Grund für diesen verdammten Scheiß finden, in dem ich seit fast vierzehn Jahren feststecke. Deshalb habe ich mir diesen Ort, diese Klinik gesucht. Hier kann, hier will ich mich ganz auf mich besinnen, ganz bei mir sein. Hier kann ich alle Kraft dafür aufbringen, den Weg durch meine persönliche Hölle bis zum Ende durchzuhalten: Hinunter, immer weiter hinunter – wenn es sein muss, bis zum Boden der neun Kreise. Wo ich hoffentlich die Erkenntnis finde, warum ich so geworden bin wie ich bin, und den Ausgang hinauf finde.
Wie sehr war hatte sich mein Leben in den vergangenen Jahren verändert. Wie unglaublich hatte ich unter all dem gelitten, was eine Erkrankung wie eine Depression mit einem macht – und ebenso mit denen, die mit mir und an mir litten.
Vielleicht, kam es mir irgendwann in den Sinn, und ich habe wirklich keine Ahnung, wann und wodurch ausgelöst das passierte, hatte es ja mit dem Spruch zu tun, den ich in meiner Kindheit immer wieder zu hören bekam; von allen möglichen Leuten, er war Teil jener Zeit. Eine der Regeln, die man damals immer wieder vorgebetet bekam, und die bedeutete, dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen solle: „Was glaubst du eigentlich, wer du bist!“.
Wahrscheinlich hörte ich ihn so lange, bis ich mir selbst nicht mehr sicher war: Wer ich eigentlich bin. Oder besser: Was.
Was glaube ich denn nun eigentlich, was ich bin?
Und wie hatte es überhaupt soweit kommen können, so zu denken?
Teil I
Hinunter
„Die Depression ist gleich einer Dame in Schwarz.
Tritt sie auf, so weise sie nicht weg, sondern
bitte sie als Gast zu Tisch und höre,
was sie zu sagen hat.“
Carl Gustav Jung
Die Ankündigung
„In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn
und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank.“
Sigmund Freud
2001
Ich sitze am Steuer meines Autos, und heule wie ein kleines Kind.
Die A 3 von Köln Richtung Frankfurt ist einigermaßen stark befahren, so wie meistens an einem Montagvormittag. Es regnet. Nicht wirklich viel, aber genug um durch den ständig hin und her wedelnden Scheibenwischer genervt zu sein. Die Gischt der überholenden Autos spritzt hin und wieder gegen die Scheiben, dann stelle ich kurz den Wischer eine Stufe schneller um wieder klarer sehen zu können. Wenn das doch im Leben immer so gehen könnte: Man betätigt einen Hebel, und sieht danach wieder klar.
Viele Autos sind als Geschäftswagen zu erkennen, und in den meisten sitzt nur der Fahrer: Montägliche Aufbruchstimmung, alle Mann ran an den Feind – ab ins Hamsterrad. All die Arbeitstiere, die Montag morgens zum Beginn einer neuen Arbeitswoche den Wochenplan, die Tourenpläne und die Termine mit den Kollegen ihrer Teams zusammengestellt hatten oder von ihren Vorgesetzten erhielten, packten ihre Unterlagen zusammen. Tranken vielleicht noch schnell einen Kaffee bei einer Kollegin oder in der Kantine, erzählten etwas von ihrem Wochenende. Lachten pflichtschuldig über zotige Bemerkungen ihrer Chefs, versuchten selbst ein paar Witze. Je nach Temperament verfluchten sie auf der Toilette den beschissenen Wochen–Anfang, oder seufzten resigniert über ihre Wahllosigkeit. Rauchten noch hastig und ohne echten Genuss eine Zigarette, und machten dann schleunigst, dass sie ins Auto kamen, um nicht noch mehr aufgehalst zu bekommen. Nur runter vom Parkplatz. Und auch, weil sie auf die Straße wollten: Für eine kleine Weile vielleicht so etwas Ähnliches wie Freiheit zu spüren – wenigstens, solange sie unterwegs waren. Oder einfach nur, weil sie wussten dass gerade montags auf der Autobahn besonders viel los sein würde, je später sie los kamen. Bei den meisten war das alles Gewohnheit, Routine: Weil es ihr täglich Brot war unterwegs zu sein, und sie sich nichts Anderes vorstellen konnten. Nichts anderes wirklich vorstellen wollten. So wie ich auch: Das Wochenende hatte ich wieder einmal mit viel Arbeit verbracht. Natürlich wollte ich eigentlich viel lieber mit meinen Kindern und meiner Frau etwas unternehmen, zwei freie Tage genießen. Aber, es war mir einfach nicht gelungen, die Arbeit so einzuteilen, dass ich wirklich einmal frei sein würde für das, was im Leben wirklich wichtig ist. Wieder einmal.
Damals, als ich mich nach vielem Hin– und Herüberlegen, Konzept–Ausarbeitungen, unzähligen Gesprächen mit Frau, Freunden und Bank endlich selbstständig machte, war mein fester Entschluss mein Arbeitstempo zukünftig mehr selbst zu bestimmen. Nur: Irgendwie klappte das nie! Und so hatte ich mir wieder einmal terminlich etwas von irgendwelchen Kunden so aufdrängen lassen, dass das vergangene Wochenende nur wenig freie Zeit für mich und meine Familie bot. Statt dessen saß ich stundenlang an meinem Schreibtisch, starrte auf Grundrisspläne, Stücklisten und Notizen, zeichnete im Computer meine Vorschläge zu irgendwelchen Ladeneinrichtungen und trank wieder einmal viel zu viel Kaffee, um mich irgendwie aufzuputschen. Vielleicht auch nur, um mich mit meiner Koffeinsucht von meinem Versagen abzulenken.
Das Rauchen hatte ich mir damals schon lange abgewöhnt. Es fehlt mir auch heute noch, nach über dreißig Jahren Abstinenz.
Und jetzt sitze ich im Auto, bin irgendwo auf der A 3 Richtung Süden, so zwischen Montabaur und Limburg. Unterwegs zu dem Kunden, weshalb ich wieder ein Wochenende durchgearbeitet habe, höre dabei Reinhard Mey – und heule.
Ich bin kurz vor der Ausfahrt zur Raststelle Medebach: Dort gibt es eine architektonisch ansprechend gehaltene Autobahnkapelle; und wäre dort nicht der allgegenwärtige Autobahnlärm, könnte es wirklich ein Ort der Kontemplation sein. Ich war dort schon einige Male, habe mich dort in den Andachtsraum gesetzt und versucht etwas zu fühlen. Heute fahre ich weiter – so, wie es mir gerade geht!
Ich weine nicht einfach, es ist nicht so, dass mir einfach nur
die Tränen kommen – ich heule. Laut.
Kann mich nicht bremsen, und es wird immer mehr.
Ich heule Rotz und Wasser, kann nicht damit aufhören.
Und eigentlich weiß ich nicht mal, warum.
The lucky man
„Ich bin wie nasses Stroh, die besten Zündhölzer
wollen nicht recht helfen – es brennt nicht.“
Theodor Fontane
Reinhard Mey hatte gerade von den Erlebnissen in einem Restaurant in den USA gesungen, an einem letzten Urlaubstag, zusammen mit seiner Familie (der Song ist auf seinem Album „Flaschenpost“ von 1998). Am Nachbartisch hatte ein älteres Ehepaar gesessen und ihn, seine Frau und seine drei erwachsenen Kinder beobachtet. Er war zunächst ein klein wenig amüsiert über das so stereotype, amerikanische Aussehen der beiden älteren Menschen, ihre Kleidung, ihre Frisuren.
Dann, nachdem sie gezahlt und an seinem Tisch vorbeigingen, beugte der Mann sich zu ihm herunter, lächelte und sagte: „What a lucky man you are!“.
Und Mey sang davon, wie er auf einmal seine Familie genauer ansah, die Situation erfasste in der sie sich befanden – er, seine beiden Söhne, seine Tochter und seine Frau. Was er doch für ein Glück im Leben gehabt hatte, so eine Familie zu bekommen. Und dass er darüber nachsann, dass es manchmal eines Fremden bedarf um einem mal wieder aufzuzeigen: Was für ein glücklicher Mann man doch ist!
What a lucky man you are – war ich das auch?
War ich glücklich, dass ich das machen konnte, von dem ich bis vor kurzem gedacht hatte dass es mich ausfüllen würde?
War ich glücklich, dass ich eine Familie hatte, so wie ich es mir ausgesucht hatte, mir als junger Erwachsener wirklich ganz intensivst gewünscht hatte?
War ich glücklich, dass alles trotz der ganz normalen, unendlich vielen und in immer wieder neuen Variationen wiederkehrenden Probleme eines Lebens doch irgendwie so gekommen war, wie ich es mir früher erträumt hatte?
Nein, ich war ganz und gar nicht glücklich: Ich war jetzt verdammt nochmal scheiß unglücklich! Und das Schlimmste daran war, dass ich noch nicht einmal sagen konnte warum. Ich wusste nur: Seit einiger Zeit zweifelte ich immer öfter an mir, und ganz besonders im Beruflichen. Fühlte, dass das, was ich machte, nicht mehr das Richtige war. Und das war nun eigentlich völlig verrückt, denn: Das, was ich machte, machte mir eigentlich Spaß!
Ich war Ladenplaner, erarbeitete die Einrichtungs-Konzepte und Gestaltungen für Ladengeschäfte. Hauptsächlich zu dieser Zeit Gartencenter und Baumärkte, für Europas größten Einkaufsverband für Werkzeuge und Eisenwaren. Ich habe das nicht studiert, bin kein Designer oder Innenarchitekt: Ursprünglich Schreiner, hatte ich mit vier Semestern Techniker–Schule meinen Holztechniker dran gehängt. Nach meinem Abschluss landete ich in einem Ladenbauunternehmen, das für Modelabels, Juweliere und Uhrmacher Ladengeschäfte plante und einrichtete. Das war für mich zunächst rasend interessant, eine Welt, die ich noch nicht kannte: Designer, Werbeagenturen, Show und Glitzer. In Düsseldorf richteten wir sogar für Armani einen Showroom ein.
Wow – für Armani! Den Armani! Und ich war dabei!
Mein damaliger Chef war eine richtige Type: Charismatisch, überzeugend, konnte sich verkaufen. Er war zwar ein ganz miserabler Kaufmann, und ohne seinen Geschäftsführer lief nichts. Aber sich und sein Knowhow verkaufen – Ideen umsetzen, Geschäfte an Land ziehen: Das konnte er! Und, er war immer bereit ein Risiko einzugehen, wenn er das Gefühl hatte, dass es richtig sei.
Da war zum Beispiel die Geschichte mit den Marmorsäulen aus Portugal: Die Firma hatte ein Ladenkonzept entwickelt für eine große Juwelierkette; dazu gehörte natürlich auch eine ansprechende Gestaltung der Ladenfront und des Ladeneingangs, und dieser sollte von zwei halbrunden Säulen aus portugiesischen rosa Marmor eingefasst werden. Wenige Tage vor der Eröffnung waren diese immer noch nicht geliefert, ja noch nicht einmal auf den Weg gebracht worden. Was tun? Dieser Laden war das Vorzeigeobjekt, hier sollte und musste die Firma zeigen was sie zu leisten im Stande war – es hingen jede Menge Anschlussaufträge dran! Gar keine Frage für ihn: Privatflugzeug gechartert, zum Lieferanten geflogen, und die beiden Säulen persönlich abgeholt. Und somit den Laden rechtzeitig und komplett übergeben. Gekostet hat diese Hauruck–Aktion damals 50.000,– DM, und sein Konto war danach leergeräumt. Aber dafür gab es dann auch den Auftrag als Generalunternehmer für viele, viele weitere Läden. Ich gebe zu: So was hat mich schon immer beeindruckt. Denn, auch wenn ich bisher niemals in die Lage gekommen bin, so was tun zu müssen: Genau so etwas ist es, was auch mir als Erstes einfallen würde; schon immer, und auch heute noch – einfach was machen, was für andere eigentlich undenkbar wäre!
Aber irgendwann merkte ich: Mode, Schmuck und Schickimicki waren doch nicht so meine Welt. Ich war schon immer mehr für das Handfeste, war im Kern eben doch nur ein Handwerker, der sich etwas hoch gearbeitet hatte. Und deshalb griff ich sofort zu, als ich von der Stelle im Einkaufsverband erfuhr. Als ich dazu kam, war der Aufbruch in den neuen Länder in vollem Gange – und diese Aufgabe fand ich nun ziemlich klasse: Viel unterwegs, raus aus dem Büro und Neues kennen lernen. Neue Aufgaben, die neuen Bundesländer und immer wieder andere Anforderungen. Menschen kennen lernen, die eine andere Sozialisation erfahren hatten als ich.
Organisieren, Probleme lösen, überzeugen: Das war meins, davon hatte ich geträumt. Unterwegs sein, gebraucht werden, Anerkennung erhalten – bestätigt werden! Deshalb war ich nach meiner Gesellenzeit noch mal zur Schule, zur Technikerschule gegangen: Ich wollte einfach mehr!
Es gab viel zu tun damals, fünfzig, sechzig Stunden Arbeit in der Woche waren normal. Aber das war für mich kein Problem: Früh ins Büro und spät wieder raus. Jetzt gab es Besprechungen im zwölften Stock, ausländische Delegationen erleben, ab und zu auch mal in teuren Hotels übernachten. Ja sogar zu Terminen fliegen war jetzt drin. Das also war es, hatte ich eine ganze Weile meines Lebens gedacht. Das war es, was mir durch meine Erziehung, meine Vorbilder mit aufgegeben worden war: Karriere machen! Ich war auf dem Weg dahin, wo ich hin wollte – weiter nach oben auf der sozialen Leiter. Mehr sein als nur ein Schreiner, der die Dinge, die sich andere überlegen, ausführt. Ich wollte eben einfach immer noch eine Stufe weiter!
O.k. – das hatte ich ja nun erreicht. Ich war zu diesem Ereignis auf der Autobahn dreiundvierzig Jahre alt, bisher einigermaßen gesund geblieben, und hatte eine eigene Familie. Seit siebzehn Jahren war ich verheiratet, hatte zwei prima 1A Töchter bekommen. Es war doch eigentlich so, wie ich es mir immer gewünscht hatte, alles war irgendwie so gekommen wie ich es mir lange Zeit zuvor vorgestellt hatte: Als ich irgendwann mal anfing darüber nachzudenken, was ich denn wohl gern für ein Leben führen wollte.
Und warum also, zum Henker, bin ich so unglücklich?
Die Diagnose
„Um die Wahrheit zu entdecken bedarf es zweier Menschen:
Eines, der sie ausspricht, und des anderen der zuhört."
Aus „Der Prophet“, von Khalil Gibran
Alles begann damit, dass ich nicht mehr schlafen konnte.
Nicht, dass ich nicht einschlief: Das klappte meistens. Aber nach ein bis zwei Stunden wachte ich auf, und konnte nicht mehr einschlafen. Meine Gedanken begannen zu kreisen, oft in einer Art Endlosschleife: Um Arbeit, Familie, Geldsorgen, Sinnsuche. So ging das tage–, manchmal wochenlang; und ich wurde immer müder, immer erschöpfter. Das Leben ging trotzdem weiter den gewohnten Gang, mit seinen Pflichten, Anforderungen, Plänen. Nach mehreren solcher Tage schlief ich dann meistens eine Nacht wie ein Toter durch, schöpfte neue Hoffnung – nur um zu erleben, dass es in der Nacht darauf wieder von vorn losging: Einschlafen, aufwachen, und keine Ruhe mehr finden.
Irgendwann war ich nicht mehr ich selbst. Meine körperliche Verfassung durch den andauernden Schlafmangel erinnerte mich an die Zeit meines Bandscheibenvorfalls Anfang 2000: Ich konnte damals, wenn überhaupt, nur seitlich angelehnt, halb sitzend, halb liegend und an einem Stapel Kissen angelehnt, mal ein paar Stunden ruhen; und das wochenlang. Nur damals hatte ich ja einen offensichtlichen Grund – meine Bandscheibe drückte auf einen Nerv, und verursachte unerträgliche Schmerzen.
Seit einigen Monaten waren sie wieder da, obwohl der Bandscheibenvorfall ganz zurückgegangen war. War ja auch kein Wunder: Durch die viele Arbeit in meiner noch frischen Selbstständigkeit fand ich überhaupt keine Zeit mehr, vom Schreibtisch und aus dem Auto heraus zu kommen. Da soll schon mal der Rücken weh tun. Selbst schuld! Nur das jetzt? Warum, um alles in der Welt, konnte ich jetzt nicht schlafen?
Meine Frau konnte es irgendwann nicht mehr mit ansehen (vielleicht sollte ich eher sagen, mich nicht mehr ertragen), und schickte mich zum Arzt. Ich hatte Glück: Unser Hausarzt war einer Derjenigen, die sich wirklich für die Probleme seiner Patienten interessieren, die auch über ihren Tellerrand hinaus sehen können. Und vor Allem: Der schon mal in einem psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet hatte. Nachdem ich ihm meine Situation geschildert hatte, schaute er mich eine kleine Weile nachdenklich an, beugte sich zu mir vor, und sagte mit einem Gesichtsausdruck zwischen Interesse, Erstaunen und Mitleid den Satz, den ich nie vergessen hab: „Mein lieber Freund – Sie haben eine Depression!!“. Schrieb mir eine Überweisung zum Psychiater, drückte mir die Daumen, und schickte mich los. Ich sehe es noch deutlich vor meinem geistigen Auge, als wäre es gerade erst gestern gewesen: Auf dem Zettel stand, handschriftlich und fett unterstrichen „Weint bei Ansprache!“.
Da saß ich nun etwas verdattert im Auto, und dachte: Aha. Ich habe also eine Depression. Ich bin depressiv. Und was bedeutete das denn jetzt – eine Depression? Und überhaupt: Ich und eine Depression? Ich konnte nicht schlafen, ja. Meine Gedanken kamen nicht zur Ruhe, auch gut. Aber depressiv?
Ein guter Freund von mir hatte mit so was seit einiger Zeit zu tun – und zwar heftig. Da hatte ich zuvor schon miterlebt, was das mit ihm machte: Unerklärlich anders als früher war er. Ohne jeden Antrieb. Tief traurig. Schwach. Es gab Tage, da konnte er nicht aus seinem Bett aufstehen, nichts essen, nichts tun. Konnte monatelang nicht arbeiten. Der war depressiv. Aber ich? Gut, seine Gedanken kreisten auch immer um dieselben Themen; so wie bei mir. Nur, ich war sonst ganz aktiv, machte weiter wie zuvor: Ich arbeitete, kümmerte mich um meine Familie, lebte irgendwie mein Leben. Also, was sollte das dann?
Zu Haus erzählte ich davon, und meine Frau sagte mir, dass sie das schon eine ganze Weile vermutet habe. Sie ist Krankenschwester, und hatte auch schon bei ihren Patienten Ähnliches erlebt. Und schließlich hatte sie die Veränderungen an meinem Wesen schon eine ganze Weile registriert. Ganz im Gegensatz zu mir: Ich war ja der Überzeugung, dass ich nach wie vor derselbe sei. Nur etwas gereizter als sonst, etwas ungeduldiger als früher. Etwas unzufriedener, etwas abwesender. Kein Wunder, ich schlief ja auch schlecht, hatte Sorgen – das war für mich der Grund. Aber Depression? Das war doch wohl ganz was anderes; so was Verrücktes eben. Was für Psychos und merkwürdige Weicheier, dachte ich. Nichts wusste ich über Depressionen – aber das sollte sich bald ändern.
Eine ganze Weile machte ich noch so weiter, ging körperlich und seelisch auf dem Zahnfleisch. Heute denke ich, dass ich damals schon spürte, dass, würde ich erst mal damit beginnen, den Dingen auf den Grund zu gehen, etwas passieren könnte, das mein Leben auf den Kopf stellen würde.
Kurzum, ich ging schließlich zum Psychiater. Zu dem, der auch meinen Freund behandelte.
Schöne Aussichten
„Wenn der, der etwas notwendig braucht, dies ihm Notwendige findet,
so ist es nicht der Zufall, der es ihm gibt, sondern er selbst,
sein eigenes Verlangen und Müssen führt ihn hin.“
Aus „Demian“, von Hermann Hesse
Psychiater sind manchmal etwas merkwürdig in ihrer Art: Ich kannte einen von früher, er war Kunde an der Tankstelle meiner Eltern. Er kam regelmäßig um zu tanken, um sein Auto warten und reparieren zu lassen. Keine Ahnung, was er machte, wo und als was er arbeitete. Aber, er war immer irgendwie woanders mit seinen Gedanken. Abwesend, so schien es. Zumindest von meinem äußeren Eindruck über ihn. Ein seltsamer Vogel, dachte ich immer, und: Machte mich insgeheim darüber lustig. Psychiater! Hah! Selber verrückt!
Als junger Schreiner arbeitete ich mal ein paar Tage in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus, eine Station bekam eine neue Küche. Angeliefert hatten wir die Teile dazu freitags, montieren sollte ich sie allein. Montags darauf fuhr ich wieder hin . Es war mir schon ein bisschen seltsam: Ich hatte vorher noch nie „so was“ von innen gesehen, und alle möglichen Spukgeschichten gingen mir durch den Kopf. Was man eben über Verrückte wusste, oder besser: meinte zu wissen.
Damals gab es ja noch keine Mobiltelefone, nur Telefonzellen – und zu so einer musste ich: Fehlende Teile nachbestellen. Ich war in einer Stimmung zwischen leicht furchtsam und amüsiert über mich selbst, als ich Richtung Pforte, wo die Telefonzelle war, ging: Was würde mir wohl dabei über den Weg laufen? Verrückte natürlich, was denn sonst – die nach mir schlagen würden, mich anspuckten oder nackt durch die herbstliche Landschaft liefen. Oder sonst so was.
Natürlich geschah nichts dergleichen. Lediglich, als ich in der Zelle stand und telefonierte, kam eine etwas ältere Frau, etwas wirr aussehend, und schrie von außen auf mich ein. „Es ist nicht meine Schuld! Ich kann nichts dazu!“. Vorsichtshalber blieb ich erst mal in der Zelle, man konnte ja nicht wissen. Zum Glück kam kurz darauf ein Pfleger, und brachte sie fort.
Wozu konnte sie wohl nichts ?
Kurzum: Mein Bild von Psychiatrie war also sehr – sagen wir mal: Undeutlich. Und nun war ich selbst auf dem Weg zu einem Psychiater, weil mit mir „etwas“ nicht stimmte!
Seine Praxis war in einer alten Fachwerkvilla, so wie sie für das Bergische Land, woher ich stamme, typisch sind. Als Erstes fiel mir auf, dass es dort nicht nach Arztpraxis roch, und es sah auch anders darin aus. Die Einrichtung war ein wenig zusammen gewürfelt, das Licht gedämpfter. Als Zweites: Ich hatte ja einen Termin bekommen, an dem ich erscheinen sollte. Dass man schon mal warten muss kennt man ja als Kassenpatient von Arztbesuchen. Jedoch, als mir die Sprechstundenhilfe sagte: „Es wird noch eine Weile dauern, haben Sie vielleicht noch was Anderes zu erledigen?“, war ich etwas erstaunt, denn so was kannte ich noch nicht. Nun gut, irgendwas ist immer zu tun; ich fragte wie lange etwa, und bekam als Antwort, dass ich erstmal in etwa einer Stunde wiederkommen solle, und trollte mich. Kaffee trinken gehen, Zeitung kaufen. Zur vereinbarten Zeit war ich zurück, vernahm dass es noch etwas dauere, aber ich könnte schon mal im Wartezimmer Platz nehmen.
Dort wartete bereits eine Dame: Eine ganz stille Person, sie las nicht, tat nichts – saß nur da und wartete, mit einem ganz und gar unbewegtem Gesicht. Das fängt ja gut an mit den Verrückten, dachte ich, nahm was zu lesen, und fügte mich fürs Erste in mein Schicksal.
Nach etwa weiteren fünfundvierzig Minuten ging ich zur Sprechstundenhilfe, fragte nach, wie es denn nun so aussehe, und wann ich denn nun endlich dran käme – ich hätte ja schließlich noch anderes, nämlich Wichtigeres zu tun! Sie lächelte mich gelassen an, sagte, dass es manchmal eben so wäre: Wenn der Herr Doktor etwas länger für seine Patienten brauche. Und dass es jetzt bestimmt bald soweit sei.
Ich weiß nicht mehr wie lange ich tatsächlich wartete; es erscheint mir im Rückblick ewig. Wahrscheinlich war ich währenddessen immer mal drauf und dran wieder zu gehen: Das Ganze ,Gedöns´ nur wegen so ein bisschen Schlaflosigkeit! Aber irgendwann war es dann aber doch endlich so weit. Ich nahm im Behandlungszimmer Platz und schaute mich um: Ein wenig durcheinander alles, viele Bücher in Regalen, eine altmodische Reispapierlampe von der Decke hängend, irgendein Öko–Fußboden, so was wie ein Jutegewebe oder so ähnlich. Bilder an den Wänden, wie von Kindern gemalt und gezeichnet, Fotos von Landschaften. Ein paar Pflanzen, hier und da etwas Deko. So wie eine WG–Wohnung aus den Siebzigern, dachte ich. Auf dem Schreibtisch Fotos von Familie, und von einem Mann mit Brille: Vor einem Fahrrad stehend, und fröhlich in die Kamera blickend. Ganz gemütlich alles, nichts Bedrohliches soweit. Dann ging die Türe auf, und der Mann vom Foto trat ein: Einigermaßen groß, schlank, dunkelhaarig. Natürlich im weißen Kittel, leger offen getragen, und um den Hemdkragen ein „Bola tie“, eine Cowboy–Krawatte: Eine geflochtene Lederschnur, die vorn von einer dekorativen Brosche zusammen gehalten wird. Silbern, glaube ich. Er lächelte mich freundlich an, begrüßte mich einigermaßen jovial – und los gings.
Nachdem ich ihm alles geschildert hatte sagte er mir, dass es sich ganz sicher und ganz typisch um eine depressive Erkrankung handele. Er würde mir erst mal ein Antidepressivum verschreiben, das mich schlafen lasse; damit sich mein Schlafrhythmus wieder normalisiere, was sehr wichtig sei. Er erklärte mir, dass es die unterschiedlichsten Formen von Depressionen gäbe: Manche seien nur kurze Episoden, die man mit Medikamenten gut behandeln könne, und die nach wenigen Wochen oder Monaten vollständig geheilt wären.
Dass es allerdings auch solche Formen gäbe, die nicht so einfach verlaufen würden. Die manchmal Jahre dauern könnten, seiner Erfahrung nach zwischen fünf und fünfzehn Jahre. Und: Manche vergingen nie, blieben ein Leben lang. Ja – und dass ich mit Allem rechnen solle.
Er ließ wirklich nichts aus, war ganz offen. Beschönigte nichts, versprach nichts. Aber, er sagte mir auch, dass es immer ganz individuelle Verläufe gebe, dass jede Depression anders wäre. Und, und das betonte er, ernst, aber freundlich lächelnd: Dass ich diese Erkrankung sehen solle als Notbremse meiner Seele, die wohl dringend etwas mehr Beachtung brauche.
Ich weiß nicht mehr wie lange ich bei ihm saß, bestimmt eine Stunde oder mehr. Wir redeten über alles Mögliche, auch über das Foto, dass ihn vor dem Fahrrad stehend zeigte: Fahrräder sind neben Motorrädern seit langem mein Hobby, ich kenn mich da ein bisschen aus. Und so fachsimpelten wir ein wenig, über Leder– oder Kunststoffsättel, Federungen oder nicht, und über seine neue Rohleff–Zwölfgangnabe. Was ganz Feines, ziemlich teuer; jedenfalls damals. Heute hätte er vielleicht ein E–Bike. Übers Leben halt, und so weiter. Jetzt wusste ich, warum ich so lange hatte warten müssen.
Wenn man weiß, wie wenig Zeit rein rechnerisch für jeden Patienten bleibt, bei den paar Euro, die ein Psychiater von den Krankenkassen pro Patient und Quartal erhält, und dass viele genau das machen – nicht mehr tun als ihnen bezahlt wird: Dieser hier war einer, dem das völlig egal schien. Er nahm sich einfach die Zeit, die seiner Meinung nach individuell nötig erschien. Ich kann nur jedem wünschen, dass er am Anfang seiner „Depressions–Karriere“ an so einen Arzt gerät.
Irgendwann abends, im Dunklen, verließ ich die Praxis, stand eine Weile draußen unschlüssig herum. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich fühlte; wahrscheinlich aber etwas erleichtert: Wenn man den Feind kennt, kann man ihn sich auch genauer ansehen.
Jetzt war ich schon mal einen kleinen Schritt weiter. Allerdings: Wie klein dieser Schritt war, konnte ich damals auch nicht im Entferntesten ahnen.
Die Einsicht
„Wenn alle Tage gleich sind, dann bemerkt man auch nicht
mehr die guten Dinge, die einem im Leben widerfahren.“
Aus „Der Alchimist“, von Paulo Coelho
Antidepressiva sind merkwürdige Medikamente: Bis sie eine Wirkung auf die Stimmung zeigen, vergehen immer einige Wochen. Die Auswirkungen auf den Körper hingegen zeigen sich sehr schnell. Die Wirkung kann bei jedem unterschiedlich sein: Medikament X zeigt bei einem Menschen keinerlei antidepressive Wirkung, bei einem anderen sehr wohl. Wobei die Wirkung aber auch nicht immer unbedingt stimmungsaufhellend sein muss – es kann auch gerade das Gegenteil eintreten. Und obwohl man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es einem noch schlechter gehen kann, wenn man sowieso schon ganz unten ist: Es geht wirklich!
Wenn man also nach einigen Wochen – in denen man sich manchmal erst an die verschiedensten Nebenwirkungen hat gewöhnen müssen – merkt, dass es einem nicht hilft: Wechselt man zum Nächsten, und dem Nächsten, und dem Nächsten. Bis man vielleicht etwas findet, was einem hilft. Dabei trifft man hoffentlich auf einen Arzt, der in seiner Praxis schon Erfahrungen mit den unterschiedlichen Wirkstoffen hat sammeln können, und nicht nur aus der Roten Liste agiert.
Die Rote Liste ist das jährlich, in elektronischer Form halbjährlich erscheinende Verzeichnis der in Deutschland zugelassenen Arzneien und Medizinprodukten, mit allen Informationen der Industrie dazu. Dabei liegt die Veröffentlichung darin wohlgemerkt in der Verantwortung der Hersteller (!); und was das gegebenenfalls bedeutet, kann sich nun jeder mal überlegen.
Wenn jetzt also ein Arzt erst wenig durch eigene Berufserfahrungen über die Wirkstoff-Eigenschaften der Antidepressiva weiß, und während der Behandlung in so einem dicken, roten Wälzer nachschlägt oder verdächtigt lange im PC wühlt, und dann sagt: „Versuchen wir doch mal XYZ, das scheint mir bei Ihnen zu passen – oder haben Sie das schon mal probiert?“ – tja dann: Weiterhin noch viel, viel Glück, und toi, toi, toi!
Im Ernst: Unser Gesundheitssystem lässt es zum Glück zu, dass jeder sich den Arzt suchen kann, der zu ihm passt. Und zwar jederzeit!
Allerdings liegt es auch in der Verantwortung jedes Patienten selbst, dies auch zu tun, dazu aufgefordert wird er selten. Ich kann dazu nur ermutigen: Es ist für jeden essentiell wichtig. Überlebenswichtig sogar, wenn man eine Depression hat, glauben sie mir.
Mein erstes Antidepressivum war der Knaller: Die angegebene Anzahl an Tropfen auf einen Löffel, hinein damit, und noch ein Glas Wasser dazu. Dann ins Bett, noch mal ein Buch aufgeschlagen – und es war, als ob einer die Lampe ausgeknipst hätte: Wow! Ich konnte wieder schlafen! Und wie!
Nur: Am nächsten Tag lief ich mit einem Gefühl herum, als würde ich durch fein gesponnene Watte wandern; so ein Gefühl von zu lange geschlafen, und ein bisschen verkatert – allerdings den ganzen Tag lang. Und das blieb auch so über die Dauer der nächsten zwei Wochen, denn so lange nahm ich das Zeug ein. Das konnte es ja nun auch nicht sein! Also hin zum Arzt, und ein Anderes versucht.
Wenn man zwischen den verschiedenen Medikamenten wechselt, muss man, bevor man mit dem Neuen beginnt, das Alte erst einmal „ausschleichen“: Das heißt, der Wirkstoff des Ersten soll erst mal den Körper komplett verlassen, damit es zu keinen Wechselwirkungen kommt. Das ist zwar nicht immer zwingend vorgeschrieben – aber Vorsicht ist angebracht!
Ich habe im Verlauf der Jahre alle möglichen Medikamente ausprobiert. So richtig geholfen hat mir keins. Kurzfristig war oft eine Wirkung da, aber auf Dauer nicht. Was aber, wie gesagt, bei einem anderen Menschen ganz anders sein kann.
Mein persönliches Fazit zu Antidepressiva ist: Im akuten Fall einer Depression können sie so was sein, wie eine Krücke bei einem gebrochenem Bein – man muss es durch die Krücke entlasten, bis es heilt. Allerdings: Den Wiederaufbau der Muskulatur danach muss man ohne beides aktiv betreiben; und im übertragenden Sinne die Ursache für die Depression finden und beheben ebenfalls. Nur einfach ein Mittelchen einnehmen, und dann ist alles wieder gut, reicht häufig nicht: Die Ursache muss gefunden werden!
So wie bei mir: Langfristig ging nichts ohne Therapie, denn offensichtlich lagen die Gründe für meine Erkrankung tiefer, als nur eine „einfache“ Überbelastung. Mein Leben hatte mich scheinbar an einen Punkt gebracht, an dem meine Seele nicht mehr mitmachte. Ich hatte nicht auf sie gehört: Immer, wenn sich mein Bauchgefühl meldete, hatte ich weg gehört. Sogar, als sie versuchte, mir über körperliche Signale Bescheid zu geben, mich dazu zwingen wollte, dass ich inne hielt, war ich nicht aufmerksam geworden: Der Bandscheibenvorfall, die davor und auch danach immer wiederkehrenden Rückenschmerzen waren die ersten Signale; nicht mehr schlafen zu können das Nächste.
Ich bin manchmal ziemlich uneinsichtig, andere würden es Sturheit nennen: Ich will immer unbedingt das erreichen, was ich mir als nächstes Ziel gesetzt hab. Vielleicht, weil ich im Sternzeichen Skorpion geboren bin. Aszendent Widder, wenn es jemand genau wissen will. Das war schon immer so: Wenn ich etwas wollte – oder auch nicht – dann bohrte ich so lange herum, bis ich mein Ding machen konnte; oder im anderen Fall, bis man mich in Ruhe ließ. Jetzt allerdings war ich doch arg verunsichert, denn ich war ja nicht mehr so ganz ich; jedenfalls, nicht mehr so, wie ich bisher gedacht hatte zu sein. Und: Wenn einigermaßen intelligente Menschen um mich herum mir sagten: „Du machst was falsch!“, und dazu diese körperlichen Signale mich aufhorchen ließen – so uneinsichtig war ich dann doch nicht!
Also, wenn die Medikamente nicht wirklich was bewirkten: Lag die Ursache für mein Zweifeln, mein Unvermögen, meine Hilflosigkeit doch vielleicht tiefer? Nicht nur im Geist, im Gehirn – sondern darin, was man Seele nennt? Irgendwie war das unbehaglich: diese Vorstellung, dass da in mir etwas war, von dem ich bisher nichts wusste.
Und jetzt, so schien es, kam da was hoch: Das endlich beachtet werden wollte.
Die grüne Lederjacke
„Wie von einem Stück Spiegelglas ein Lichtstrahl reflektiert
und in einen dunkeln Raum geworfen wird, so blitzt oft
mitten im Gegenwärtigen, durch eine Nichtigkeit entzündet,
ein vergessenes, längst gewesenes Stückchen Leben auf,
erschreckend und unheimlich.“
Aus „Eine Fußreise im Herbst“, von Hermann Hesse
2002
Zwei Therapeuten waren mir empfohlen worden, eine Frau und ein Mann. Ich rief die Frau an: Warum ausgerechnet sie, weiß ich nicht mehr. Es war vielleicht zum ersten Mal auf dieser langen Reise, dass ich unbewusst wirklich mal auf mein Gefühl hörte. Später stellte sich heraus, dass dieser Anruf mein ganzes Leben verändern würde – und zwar so nachhaltig, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte.
Frau H. arbeitete tiefenpsychologisch, und erstmal musste sie mir erklären, was das überhaupt bedeutet: Worin die Unterschiede zwischen Tiefenpsychologie und Verhaltenspsychologie liegen.
Im Rahmen der Tiefenpsychologie geht man davon aus, dass in der Tiefe liegende, unbewusste psychische Vorgänge eine Wirkung auf die psychische Gesundheit des Menschen haben. Unbewusste Konflikte oder verdrängte Erfahrungen sind aus dieser Sichtweise heraus ein sinnvoller Ansatzpunkt, um psychische Störungen zu behandeln. Im Unterschied zur Verhaltenstherapie liegt der Schwerpunkt damit deutlich weniger auf der unmittelbaren Beeinflussung des Verhaltens des Patienten, sondern auf einer Klärung der zugrundeliegenden Ursachen, wodurch indirekt bzw. in der Folge eine Verringerung der Beschwerden eintreten soll.
Verhaltenstherapeutische Verfahren basieren ursprünglich auf der Lern–Theorie. Die Grundidee ist, dass störungsbedingtes Verhalten erlernt wurde und auch wieder verlernt werden kann bzw. dass angemessenere Denk– und Verhaltensweisen erlernt werden können.
Ja, das erschien mir logisch: Erst mal die Gründe herauszubekommen, warum ich so bin wie ich bin. Obwohl: Für mich war ja klar, dass alles nur damit zu tun haben konnte, dass ich es nicht auf die Reihe bekam mit meiner Arbeit sinnvoll umzugehen. Dass mich die finanziellen Sorgen auffraßen. Und: Dass ich dadurch meine Familie vernachlässigte.
Zu Beginn der Therapie hatte mich Frau H. vorgewarnt: Es könne sein, dass die Therapie sehr tief gehen könne, und lang Verborgenes zum Vorschein käme. Und, dass es zunächst einmal schlimmer werden könne. Klar, was auch sonst: Genau so wurde es! Niemals hätte ich mir vorstellen können was nun, im Laufe der Therapie, mit mir passierte: Meine Depression brach mit aller Macht hervor – meine Seele war nicht mehr bereit das, was mich so sehr daran hinderte Ich selbst zu sein, weiter zu unterdrücken!
Der Begriff Depression stammt von dem lateinischen Verb für niederdrücken, deprimiere. Genau das passiert nämlich mit den Gefühlen wenn man sie nicht zulässt, ihnen keinen Raum gibt, sie nicht leben lässt: Sie werden niedergedrückt, beiseitegeschoben. Bis es nicht mehr geht, und die Seele sich wehrt, sich meldet und krank wird. Und dies äußert sich nicht nur in der Stimmungslage – sondern auch ganz gravierend körperlich.
Bisher hatte ich körperlich noch durchgehend funktioniert. Jetzt, wo ich es zulassen musste, dass ich meine Seele nicht länger knebeln konnte, wurde dies immer schwieriger: Momente, Minuten, Stunden, in denen es unmöglich schien, die einfachsten Tätigkeiten zu verrichten. Tage, an denen das Aufstehen aus dem Bett immer schwerer wurde. Wochen, in denen alles nur grau schien. Es gab Tage, an denen ich im Sessel saß, die Unterarme und die Hände auf den Armlehnen – und das Gefühl und die feste Überzeugung hatte, ich könne die Arme nicht mehr heben, nicht mehr von den Lehnen lösen.
Und: Alles, was ich jemals in meinem Leben getan hatte, schien mir nun als völlig schlecht, sinnlos, vergebens. Falsch war das vorherrschende Gefühl.
Ich war falsch.
Ich habe in meinem Leben nie erlebt, dass ich schlechte Arbeiten abgeliefert hätte – von wenigen Ausnahmen, die völlig im Rahmen des Normalen waren, abgesehen. Niemals hatte mir jemand vorgeworfen, dass meine Methoden meine Töchter zu erziehen falsch seien, oder dass ich im Leben sonst wie versagt hätte.
Jetzt – war ich in meinen Augen die größte Niete, der völlige Loser: Alles hatte ich falsch gemacht! Und wenn mir doch mal etwas einfiel, was eigentlich ganz positiv gewesen war, dann machte mein Hirn daraus etwas ganz und gar Negatives.
An solchen Tagen vermied ich jeden Kontakt zu anderen Menschen: Nur die vage Möglichkeit außerhalb des Hauses einen anderen Menschen zu treffen, mit dem ich kommunizieren müsste, hielt mich stundenlang davon ab das Haus zu verlassen. Wenn ich dann tatsächlich doch jemanden traf, funktionierte ich: Redete freundlich, machte Smalltalk. Danach war ich völlig leer, kraftlos, ohne Energie. So lange es nur um mich ging, war das ja noch relativ problemlos. Blieb ich halt drin. Aber: Wir hatten ja einen Hund: eine wundervolle Beagle–Terrier–Mischlings–Hündin namens Cleo. Da ich meine Arbeitszeit selbst einteilen konnte, war es tagsüber, wenn die Familie außer Haus war, meine Aufgabe mit dem Hund spazieren zu gehen. Wir wohnten damals etwas außerhalb, vom Haus bis zum Wald waren es keine fünf Minuten zu Fuß. Dort gab es dann einen Rundweg, der für mich immer sehr schön war: Ging er doch teilweise über freies, offenes Gelände, teilweise durch Wald und durch eine sehr großes Farngebiet, in dem Cleo herrlich herumstöbern konnte, während ich meinen Gedanken und Plänen nachhängen konnte.
Ich werde nie den Tag vergessen, als zum ersten Mal dieses Gefühl auftauchte, das nun immer öfter mein Begleiter sein würde. Wieder einmal ging es mir nicht gut, das Medikament funktionierte nicht wirklich, und ich war schon mit einer großen Traurigkeit aufgewacht, die anhielt. Ohne Anlass, ohne Grund. Einfach so.
Das ist auch so etwas, was der Depressive und seine Umgebung lernen müssen, sonst wird alles noch viel schlimmer: Eine depressive Episode ist einfach, und dass sehr oft ohne erkennbaren Grund. Es hilft nichts zu sagen „Ich nehme mich jetzt zusammen“. Und es hilft überhaupt nicht dem Depressiven zu sagen, es sei doch alles nicht so schlimm, er solle doch mal an was Schönes denken. Depressiv zu sein hat nichts damit zu tun, dass man deprimiert ist, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Deshalb: Depression ist, und Schluss. Kein wenn, kein aber.
Also, dieser bewusste Tag hatte schon so begonnen, und nun sollte es erstmals so richtig kommen. Der Hund musste ja nun raus, da war nichts dran zu machen. Und das tat mir ja auch im Allgemeinen gut – nichts ist besser gegen Depressionen als Bewegung, Sport, körperliche Betätigung.
Ich leine sie an, trete vor die Türe und gehe Richtung Wald.
Kaum bin ich auf der Straße, spüre ich plötzlich, wie eine Last aus dem Nichts auf mich niedersinkt –
und mit jedem Schritt wird sie größer und größer:
Zuerst ist es ein Gefühl wie eine Wolke, die über mir ist, und sich auf mich herabsenkt.
Die mich einhüllt, immer mehr und mehr und mehr; und dabei immer dichter wird.
Nicht gewichtslos wie Wasserdampf, sondern wie eine Masse aus etwas, dass immer kompakter wird. Zäher, steifer. Mich immer langsamer werden lässt – und jede Kraft aus mir saugt.
Mittlerweile sind wir am Rundweg angekommen, noch ein paar Meter, und ich kann den Hund frei laufen lassen. Jeder Schritt, jede Bewegung ist jetzt anstrengend, viel mühseliger als sonst. Es ist, als ob ich ganz plötzlich unglaublich schwer geworden bin. Als ob ich auf einmal ein großes Gewicht mit mir herumtrage. Wie eine Jacke, in der Steine, Bleigewichte sind.
Plötzlich ist dieses Bild da, von der alten, grünen Lederjacke: Mit achtzehn oder neunzehn hatte mir ein Freund eine alte Polizei–Motorradjacke geschenkt, die sein Vater trug, als er noch Motorradstreife fuhr. Diese Jacke, dreiviertel lang, im damals typischen dunklen Polizei–Grün, war aus sagenhaft dickem Leder. Sah megacool aus, niemand sonst in unserer Clique hatte so was – und sie war sauschwer. Ja, so fühlt es sich plötzlich an: Als hätte ich diese Jacke wieder an. Schwer, steif, unbeweglich. Und überhaupt nicht mehr cool!
Von nun an war sie ganz oft dabei, wenn ich mit dem Hund spazieren ging, oder wenn ich mit anderen unterwegs war: Machte mir jeden Schritt zur Last, lies mich atemlos werden. Brachte mich dazu, jede Gelegenheit zu nutzen, um zu verschnaufen; und war wie ein Panzer, den ich mit mir herumtragen musste. Oder: Tragen sollte?
Soll ich diese Last spüren? Trage ich sie vielleicht schon mein ganzes Leben mit mir herum – und habe sie bisher nur nicht gespürt?
Und wenn: Warum muss ich sie gerade jetzt zu spüren bekommen?
Koyies Frage
„Nicht ausgedrückte Gefühle sterben nicht.
Sie werden lebendig begraben, und kommen irgendwann
auf unschöne Weise wieder hervor.“
Sigmund Freud
Wieder und wieder überdachte ich mein Leben. Ich suchte nach Fehlentscheidungen, nach falschen Ratgebern, nach irgendetwas, das eine Erklärung böte, und fand: Nichts. Alles war doch so gekommen, wie ich es mir selbst so nach und nach ausgesucht hatte! Seltsam.
Was sich hier so kurz und knapp liest, war in Wirklichkeit ein langer, quälender, Monate dauernder Prozess, in dessen Verlauf ich immer wieder daran scheiterte, dass ich auf keinen Punkt kam. Was war das denn bloß, was mit mir nicht stimmte?
Mein Denken drehte sich um mich, geradezu permanent, und ich verlor immer mehr den Kontakt zu meiner Frau, zu meinen Töchtern. Auch wenn ich es natürlich nicht wollte – die Belastung durch mich für meine Familie wurde größer und größer. Meine Gefühle verließen mich, etwas wirklich zu spüren, wurde immer unwichtiger gegenüber der Frage: Warum?
Seit einiger Zeit war ich nun in ambulanter Therapie. So langsam kristallisierte sich heraus, dass nicht, wie ich immer gemeint hatte, meine berufliche Situation der Grund für meine Depression war. Sicher schien für meine Therapeutin aber, dass die dauernde Belastung durch meine Selbstständigkeit, und den damit verbundenen immer wieder auftretenden Problemen, für mich einfach zu groß geworden war – und dadurch der von mir bis dahin unbewusst aufrechterhaltene Damm zu meiner, wahrscheinlich schon seit Jahren im Verborgenen vor sich hin schwelenden Depression zu schwach geworden und gebrochen war. Die wirklichen Gründe blieben aber noch im Dunkeln.
Ein Grund für meine berufliche Unzufriedenheit war, dass ich es schon lange nicht mehr so recht vereinbart bekam dass das, was ich in meiner Arbeit tat, nicht meinen privaten Überzeugungen entsprach: Meine Aufgabe war es, mittels der Instrumente der Ladengestaltung, der Kundenführung, der Warenpräsentation usw. den Kunden zum Konsum zu verführen: Kaufanreize zu schaffen, Warenwelten zu kreieren (ja, so nennt man das tatsächlich). Ihn so zu führen, dass er möglichst das ganze angebotene Sortiment wahrnimmt, ihn zum möglichst langem Verweilen im Laden zu bewegen: Damit möglichst viel gekauft wird, Spontankäufe getätigt werden – und die Umsätze steigen.
Und das entsprach so überhaupt nicht dem, wie ich privat lebte: Ich hatte für mich schon lange erkannt, dass der in unserer Gesellschaft vorherrschende Weg des ständigen Konsums, des „Weiter! Größer! Mehr!“ mich nicht zu dem führt, was sicher die meisten Menschen suchen: Glück.
Ich bemühte mich nur das zu kaufen, was wirklich gebraucht wurde, sei es an Lebensmittel oder Gebrauchsgüter. Wir hatten ein Auto, das meine Frau und die Kinder benutzten – ich fuhr jeden Tag mit dem Rad die elf Kilometer ins Büro, oder mit dem Zug. Fleisch aß ich schon lange nur noch sehr selten, und wenn, dann kam es von einem Biohof in der Nähe. Ich hatte für mich erkannt: Weniger ist tatsächlich manchmal mehr.
Glück bedeutet heute für mich die Freiheit das zu tun, was ich wirklich will. Es gibt nichts, was mich glücklicher, zufriedener macht. Und ebenso weiß ich heute, dass ich das schon mein ganzes bisheriges Leben gesucht habe. Aber, wie es halt so geht: Die Umstände, die „Sach–Zwänge“ erforderten immer wieder was anderes.
Ich bin davon überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich lieber etwas ganz anderes machen würden, ihr Leben ändern möchten. Wenn… ja, wenn nur... aber, es geht ja nicht: Das Haus muss abgezahlt werden, ein zweites Auto muss sein, Urlaub mehrmals im Jahr, möglichst im Hotel mit so und so viel Sternen, und nur ja am besten auf der anderen Seite der Welt – auch wenn man dann dort nur im Ressort bleibt und das Land und die Menschen nicht kennenlernt (da könnte man doch auch eigentlich im Land bleiben und in eine Therme gehen?!). Zwei Porzellan–Services reichen nicht, es gibt ja auch immer wieder etwas Neueres, Schöneres. Dann reicht der Schrank dafür nicht mehr, die Tischdeko passt ebenfalls nicht, und das Besteck ist auch schon wieder so alt. Ach ja, und das Notebook ist auch schon wieder 3 Jahre alt, das Handy schon ein ganzes Jahr – gibt's da nicht schon wieder ein Nachfolger–Modell, das noch mehr kann? Und zum Glück gibt es ja Ratenkauf! Na, dann aber jetzt rasch los, zum nächsten Verbraucherzentrum! Immer mehr, mehr, mehr – und die Last wird immer schwerer.
Irgendwann begann ich darüber zu lesen, was Andere mit ihren Leben anstellten, welche Erfahrungen sie bei ihrer Selbstfindung machten. Das erste Buch zu diesem Thema, dass ich las, heißt „Lass endlich los und lebe“, von Richard J. Leider und David A. Shapiro, zwei amerikanischen Coaches und Autoren. Gleich zu Anfang schreibt Richard Leider über die Frage mit der alles begann – nämlich mit der nach dem Glück.
Er ist als Leiter einer Gruppe von Midlife–Crisis–Abenteurern unterwegs, am Rande der Serengeti in Ostafrika. Zu der Gruppe gehört ein Massai–Häuptling namens Thaddeus Ole Koyie, der sie führen wird. Dieser Massai ist kein ungebildeter Wilder (ich bitte um Entschuldigung, dies soll keine Diskriminierung von People of Colour sein, sondern nur eine Umschreibung aus dem Buch, das heute wahrscheinlich anders geschrieben werden würde), sondern ist in einer Missionsschule erzogen worden. Er lebte eine Zeitlang in der sogenannten westlichen Zivilisation, und kehrte dann irgendwann in sein Land zurück. Er ist gesellig, geistreich, gebildet – und vermittelt eine starke Verbundenheit zu dem Ort, an dem er lebt. Und: eine tiefe Zufriedenheit mit seinem Leben. Auf der Wanderung streift Koyies Blick immer wieder den Rucksack von Richard. Scheinbar vergleicht er das schwere Gepäck mit dem, was er mit sich trägt auf der Tour: Einen Speer und einen Stock für das Zusammentreiben von Vieh. Der Rucksack von Richard ist einer dieser Hightech–ultraleicht Modelle, mit maximaler Lastentrageeffizienz. Mit vielen Taschen, Schnallen, Reiß– und Klettverschlüssen. Und ist bis obenhin vollgestopft mit allem, was man sich nur vorstellen kann, um während einer Trekkingtour auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
An einem Abend fragt Koyie, ob Richard ihm mal den Inhalt des Rucksacks zeigen könne. Und dieser, ganz stolz die Errungenschaften der modernen Ausrüstung–Hersteller vorführen zu können, breitet alles vor ihm aus – bis es schließlich so aussieht wie auf einem Foto in einem Katalog für Expeditionsartikel. Richard ist sehr stolz, dass das alles ihm gehört, und dass er diese Kollektion zusammen gestellt hat. Koyie schaut ihn dabei amüsiert an, sagt aber nichts. Richard betrachtet die ganzen Einzelteile, weiß auch nicht so recht was er eigentlich dazu sagen soll.