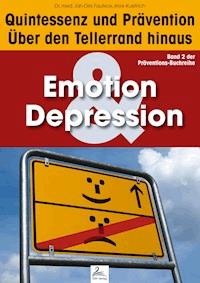Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: IGK-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In der Liebe zum Tier und dessen Zuneigung zu uns steckt eine besondere Energie: die Heilkraft der Tierliebe. Hunde und Katzen sind als "Hausärzte" besonders ideal. Tierfreunde führen bessere Ehen. Womöglich schützt das tägliche Streicheln sogar vor dem Herzinfarkt, vor Bluthochdruck, vor Depression, vor Burn-out. Warum das so ist, hat jetzt erst die Wissenschaft der Hunde-DNA enthüllt. Die großen Tierfreunde der Geschichte, von Franz von Assisi bis Thomas Mann, scheinen das Alles geahnt zu haben...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Tier & Mensch
Ein Herz & eine Seele
Die Heilkraft der Tierliebe – mehr Gesundheit, weniger Medikamente
Von Imre Kusztrich
Der Autor verfasste schon das erste deutschsprachige Buch über Tierliebe als Medizin, Pet Therapy („Haustiere helfen heilen“, Ariston Verlag, 1998). Auszüge daraus wurden für dieses Buch aktualisiert.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (insbesondere durch elektronisches oder mechanisches Verfahren, Fotokopie, Mikroverfilmung oder Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Ausgenommen davon sind kurze Text-Zitate in Rezensionen.
IGK-Verlag
7100 Neusiedl am See, Österreich
Copyright © 2016
ISBN: 9783936137149
Fotos: © PhilippHerbold-Fotolia.com, Engel-Fotolia.com
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Bisher war es allgemeine Auffassung, dass Menschen Hunde hatten – lange bevor sie die Schrift erfanden, Felder kultivierten und eine feste Bleibe suchten.
Aber möglicherweise war es umgekehrt. Hunde hielten sich Menschen.
Die wissenschaftliche Meinung kippte Anfang 2016, während bereits eines feststand: Die bisher größte Studie über die Abstammung des Hundes wird die Geschichte von der Entstehung der Beziehung des Menschen mit seinem besten Freund zumindest um ein spannendes neues Kapitel bereichern.
Ob es sich nahtlos in unser bisheriges verklärtes Bild vom geglückten Mensch-Hund-Arrangement einfügen lassen wird, bleibt abzuwarten.
Es geht um die Frage, wann und wie dieses emotional einmalige Band zwischen Menschheit und Tierwelt wirklich geknüpft wurde. Etwa 2,5 Millionen Euro investieren unter Leitung der Universität Oxford zwei Forschungsgruppen, das Natural Environment Research Council in England und das European Research Council, in die Suche nach einer endgültigen Antwort.
Das Forschungsgebiet der Domestifzierung ist immer für Überraschungen gut. Ende 2015 wären beispielsweise neue Erkenntnisse über das Haushuhn eigentlich geeignet gewesen, Liebhaber von Chicken Wings oder salaten mit Hühnerbruststreifen kurzzeitig zum Nachdenken zu bringen. Aus Fundstellen der Neusteinzeit kamen Hühnerknochen zum Vorschein, lange bevor es dort Landwirtschaft und Viehzucht gegeben hat. Menschen dieser Zeit sammelten Früchte, und wenn ihre Jagdbeute weiterzog, folgten sie ihnen. Die Vorstellung ist jedoch begründet, dass vor 7.000 bis 9.000 Jahren unsere Vorfahren sich diese leicht dressierbaren Tiere zum Vergnügen hielten und sie auf ihren Schultern herumtrugen, einfach weil sie Gefallen an ihnen hatten.
Um das Jahr 2000 hatten die Analysen von Erbbestandteilen erwiesen, dass Hunde und Wölfe unserer Tage sich aus einer gemeinsamen urzeitlichen Wolfsart entwickelten. Genanalysen ihrer Zellkerne zeigten eine Übereinstimmung in hohem Maße. Gleichzeitig waren die Unterschiede zu gering, um darüber hinaus präzisere Informationen abzuleiten – speziell, wann, wo und wie. Die Schätzungen, wann ein erster Wolf zum Hund mutierte, reichten bis zu 150.000 Jahre zurück. Vieles deutete damals auch darauf hin, dass sich dieser Entwicklungsschritt in Asien vollzogen hat.
Verhaltensbiologen der Konrad Lorenz Forschungsstelle und des österreichischen Wolfsforschungszentrum gingen dann gemeinsam mit den meisten anderen Verhaltensbiologen in ihrer Sicht der Dinge davon aus, dass es zwischen Menschen und Wölfen vor etwa 60.000 bis 80.000 Jahren zu engeren Erstkontakten kam. Die vierbeinigen Konkurrenten wurden von unseren Vorfahren als gefürchtete und geachtete Mythenwesen eingestuft, und auf ähnliche Weise wurde auch jeder Pflanze, jedem Stein und jedem anderen Tier eine Seele zugedacht.
Und sie kehren zurück. Anfang 2016 hatten sich in Deutschland 31 Rudel niedergelassen. allein 70 Wölfe in Niedersachsen.
Schon damals wird die Wahrnehmung einer Wesensverwandtschaft durch den Homo sapiens für möglich erachtet. Auch Wölfe jagten gemeinsam, beschützten ihre Nachkommen, bekämpften Feinde entschlossen und waren bei aller Scheu von großer Neugier erfüllt.
Viele Wissenschaftler fanden seitdem Gefallen an der Idee von weitsichtigen Jägern tausend Generationen vor unserer Zeit, die sich ein Wolfsjunges schnappten und nach und nach zahmere Wölfe züchteten. Dafür brauchten sie nur besonders wilde Exemplare von der Fortpflanzung auszuschließen.
Diese Vorstellung erscheint inzwischen als zu vereinfacht.
Teil 1: DIE URKRAFT
Der Hund erfand sich selbst
Im Gegensatz zum Genom des Zellkerns erlaubt mittlerweile das so genannte Chondrion einen besonders genauen Blick auf die Vererbung. So wird die DNA der Kraftwerke innerhalb einer Zelle bezeichnet, den Mitochondrien für die Erzeugung von Energie aus der Nahrung. Jede Zelle besitzt bis zu mehrere tausend von ihnen. Das führt dazu, dass es auf der Basis dieser mitochondrialen DNA, abgekürzt mtDNA, auch wesentlich mehr Erbbestandsteilchen, für wissenschaftliche Strudien als bisher zur Verfügung stehen. Dieses Material spielt in der Erforschung des Ursprungs eine besondere Rolle, da diese Erbinformationen in aller Regel nur mütterlicherseits weitergeben werden und wesentlich differenzierter sind. Das von der Universität Oxford betreute Wissenschaftsteam hat inzwischen einen großen Teil der angestrebten etwa 1.500 Genanalysen von Hunderassen, ergänzt durch Fotos und biometrischen Messungen, in aller Welt gespeichert und ausgewertet.
Der Grundgedanke entspricht nach wie vor der Idee, dass Menschen Wölfe nach ihren Vorstellungen auf die gleiche Weise zu Hunden züchteten, so wie sie heute den geliebten Vierbeiner in jeder vorstellbaren Form und Gestalt hervorrufen, mit allen nur erdenkbaren Eigenschaften und Fähigkeiten.
Doch der Beginn der Mensch-Hund-Freundschaft kristallisiert sich allmählich in ganz anderer Weise heraus. Die neue Forschung unterstreicht immer deutlicher, dass Wölfe immens schwer zu zähmen sind, auch nicht als Tierbaby. Den logisch denkenden Wissenschaftlern erscheint es demzufolge als weit plausibler, dass der Hund sich selbst erfunden hat.
Sie stellen sich vor, dass einzelne Wölfe weniger furchtsam waren in der Nähe von jagenden Nomaden. Sie labten sich an den Resten erlegter Tiere, und da ihr natürlicher Überlebenskampf am Rande der Lager immer leichter wurde, wurden sie mit der Zeit zahmer und zahmer und produzierten eine Menge Nachkommen.
In den mütterlicherseits weitergegebenen Erbinformationen von heute lebenden Hunden aus aller Welt entdeckten die Forscher jüngst keine Hinweise darauf, dass die Tiere besonders eng verwandt mit Wölfen aus Asien oder dem Nahen Osten sind. Im Gegenteil, ihre engsten Verwandten sind prähistorische Hunde und Wölfe aus Europa. Die Anthropologin Dr. Beth Shapiro von der University of California, Santa Cruz, zieht für ihr Team daraus die Schlussfolgerung: „Es ist ganz klar – die Domestizierung fand in Europa statt.“
In ihren Augen passt alles logisch zusammen. Die Abspaltung ereignete sich irgendwann zwischen 18.000 und 30.000 Jahren vor unserer Zeit. Der nördliche Teil Europas war von eisigen Gletschern bedeckt und auf den Steppen des Südens jagten Menschen das Mammut, die Elefantenart der Eiszeit, Pferde und anderes Großwild. Die Jäger konnten nicht ihre gesamte Beute verwerten oder mitnehmen. Sie ließen Rumpfteile zurück. Darüber machten sich Wölfe her. Sie begannen, den jagenden Zweibeinern bei ihrer Migration durch die Gegenden zu folgen. Und nach und nach isolierten sie sich von ihren eigentlichen Gefährten, den Wölfen.
An irgendeinem Punkt dieser Entwicklung präsentierten sie sich schwanzwedelnd als Bettler und wurden zum besten Freund des Menschen.
Die darauf folgende Domestizierung des Hundes erstreckte sich über Jahrtausende.
Die meisten der heutigen Hunderassen wurden im 19. Jahrhundert erfunden, dank der Besessenheit von der Idee, Hunde zu besitzen, im friedvollen Viktorianischen Zeitalter der Königin Victoria. Spezielle Zucht erzeugte eine Vielfalt an Größe, Gestalt und Arten des Fells. Heute werden etwa 350 Arten unterschieden.
Auch zahlreiche Verhaltensformen wurden den Tieren aufgezwungen, damit sie den Vorstellungen des Menschen entsprachen, für das Hüten von Herden, für die Jagd, zur Bewachung und schließlich als Gefährte. Diese einschränkenden Zuchtpraktiken resultierten verringerten einerseits ihre Gesamtzahl und erhöhten andrerseits den Austausch von genetischem Material untereinander. Das führte zu wesentlichen größeren Abweichungen innerhalb der einzelnen Rassen. Die Untersuchung von 85 unterschiedlichen Hundearten ergab, dass etwa 27 Prozent ihrer gesamten Erbanlagen innerhalb derselben Rasse sich voneinander unterscheiden konnten. Beim Menschen wird diese Divergenz auf fünf bis zehn Prozent der Gene beschränkt.
Zusätzlich zu ihrer erworbenen Zahmheit erwarben sich Hunde im Laufe der Entwicklung eine einzigartige Wesensart. Es ist ihre Fähigkeit, uns Menschen zu verstehen. Die beiden Anthropologen Brian Hare und Michael Tomasello am Max Planck-Institut in Leipzig publizierten 2005 ihre Arbeit über Formen der Kommunikation, die Hunde von Menschen erlernt haben müssen. Nicht einmal unsere nächsten Verwandten, Schimpansen, beherrschen sie. Die Wissenschaftler gehen einen Schritt weiter und vermuten: Hund und Mensch trainierten sich gleichsam gegenseitig gewisse mentale Potentiale an. Dazu wendeten die Anthropologen einen Trick an. Sie versteckten Essen oder sonst etwas Begehrliches in einem von mehreren Behältern und zeigten mit dem Finger darauf, als Hilfestellung, den versteckten Gegenstand zu entdecken. Menschliche Babys finden diese Aufgabe mit etwa 14 Monaten sehr leicht, und auch Hunde entwickeln große Flexibilität, um diese Herausforderung zu meistern.
Bereits der zum richtigen Ziel gerichtete Blick oder ein Nicken mit dem Kopf genügte den getesteten Hunden als Orientierung. Und sie schafften diese Prüfung sogar, wenn die Hand zur richtigen Box zeigte, während sich der Körper der impulsgebenden Person jedoch in eine andere Richtung weg bewegte.
Die Antropologen Hare und Tomasello fanden noch mehr heraus. Bereits neun Wochen alte Hundewelpen bewältigten diesen Test, und zwar, ohne dass sie vorher intensiv mit Menschen zusammenleben oder sie genauer studieren konnten. Im Gegensatz dazu versagten Wolfswelpen aus Gehegen bei der Herausforderung, ihre menschlichen Betreuer zu verstehen.
Das führt Wissenschaftler zu der Annahme, dass sich die sozialen Eigenschaften des Hundes während seiner Domestizierung entwickelten, in den Zehntausenden von Jahren, in denen die beiden Spezies Mensch und Hund miteinander lebten. Offen bleibt die Frage, welcher Druck den Hund bewogen haben mag, sich dem Menschen so anzupassen und so zu präsentieren.
Die Wissenschaft hält sich auch zurück bei der Festlegung, ab wann Hunde Gefühle wie Liebe und Treue empfunden haben mögen und ob sie ursprünglich schon aus Instinkt die dazugehörigen Verhaltensformen zeigten, weil sie schnell begriffen, dass die Partnerschaft mit dem Menschen ihnen ein leichteres Leben ermöglicht.
Wer heute sein Leben mit einem Hund teilt und sich eine andere Form nicht mehr vorstellen mag, vergisst, dass von den etwa eine Milliarde Hunde in aller Welt drei Viertel als Wildtiere leben. Sie ernähren sich von Abfällen auf den Straßen und betteln – meist freundlich, aber nicht des Menschen bester Freund.
Moderne Hunde haben sich ein gehöriges Stück weit von ihrem ursprünglichen Stammhalter entfernt. Sie nehmen begierig Nahrung auf in Gegenwart des Menschen. Der Wolf macht das nicht. Auf sich allein gestellt und in der Wildnis leben Hunde nicht in Rudeln. Manche Anthropologen lehnen deshalb Trainingsmethoden als unpassend ab, in denen der Mensch die Rolle des Rudelführers übernimmt. Der männliche Wolf bindet sich partnerschaftlich ein Leben lang und kümmert sich um den Nachwuchs. Hunde haben keinerlei Hemmung in Bezug auf häufig wechselnde Geschlechtspartner und betreiben keinerlei Fürsorge an der nächsten Generation. Davon abgesehen, vermehren Wolf und Hund sich untereinander mühelos.
Gefährte seit 30.000 Jahren
Auf Grund der frühesten Analysen der Erbbestandteile von Hunden wurde für möglich gehalten, dass der Ursprung seiner Abstammung mehrere zehntausend Jahre zurückliegt, womöglich bis zu 100.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Von dieser Einschätzung ist seit Anfang 2016 nicht mehr die Rede. Es gibt zweifellos schlüssige Beweise, dass der Hund vor etwa 15.000 Jahren bereits domestiziert war. Etwa 1.000 Jahre später wurden von Menschen erstmals Hundegräber angelegt, manche Vierbeiner wurden an der Seite von Menschen bestattet. Die Mehrzahl der Biologen errechnet inzwischen aus der verfügbaren DNA-Beweislage, dass der Beginn der Domestizierung deutlich mehr als 30.000 Jahre zurückliegt. Auch dafür gibt es Ernst zu nehmende Belege.
In Tschechien wurde 2014 ein etwa 30.000 Jahre alter Hundeschädel mit einem Stück Knochen zwischen den Zähnen entdeckt – offensichtlich ein von Menschen liebevoll bestattetes Exemplar.
Möglicherweise ist die belgische Paläonthologin Mietje Germonpré die Wissenschaftlerin, die den ältesten Fund eines Hundeschädels für sich in Anspruch nehmen kann, in einem vor etwa 32.000 Jahren angelegten Grab.
Das war jedenfalls immer noch ein Zeitpunkt, an dem der Mensch nicht sesshaft war, kein individuelles Zuchtvieh besaß und keine Felder bewirtschaftete. Der Hund konnte in der ersten Stunde an der Seite des Menschen weder als Hüter einer Herde, noch als Wächter von Nutzen sein, jedoch Partner bei der Jagd und Spielgefährte.
Anthropologen, die sich mit der Entstehung der Menschheit befassen, halten es für möglich, dass die Erfindung des domestizierten Hundes so etwas wie eine Zeitenwende war. Sie könnte wie ein Startschuss für eine neue Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt, zu den Tieren ebenso wie zu den Pflanzen, gewirkt haben.
Die Wissenschaft beginnt jedoch auch, sich darauf einzustellen, dass am Ende Fragen ohne Antwort bleiben werden. Es fällt immer schwerer, für notwendige Abgleichungen aus bestimmten Regionen der Welt die Erbinformationen von heute lebenden Wölfen zu sichern. Südchina beispielsweise ist mittlerweile derart dicht bewohnt, dass dort fast kein Wolf mehr anzutreffen ist. Von anderen Tierarten weiß man, dass die Domestizierung nicht nur einmal an einem einzigen Ort stattfand, sondern mehrfach, in Bezug auf das Schwein zum Beispiel sowohl in Anatolien und wie in China.
Überleben im Rudel
Lange bevor die ersten Wurfspeere flogen, beobachteten die Menschen bereits mit großem Interesse, wie Tierarten sich untereinander beeinflussten und aufeinander reagierten. In dieser Zeit muss es erste Annäherungen zwischen drei nur äußerlich sehr unterschiedlichen Gruppen von Lebewesen gegeben haben. Die Rede ist von Menschen, Wölfen und Raben. Das Schicksal verband sie auf Grund ihrer jeweiligen Fähigkeiten und Notwendigkeiten, komplizierten Aktivitäten auszuführen, in einer seltsamen Art von Jagdpartnerschaft und Fressgemeinschaft. Beispielsweise waaren alle durch die Größe ihrer möglichen Beutetiere förmlich dazu gezwungen, in Rudeln zu leben.
Den vierbeinigen Beutegreifern mit Familiensinn, den Wölfen, waren die schwarzen Vögel mit einer Lebensspanne von bis zu 30 Jahren sogar sozial ziemlich ähnlich. Zwischen diesen beiden in hohem Maße fähigen Kooperationstierarten entwickelten sich seltsame Formen von Freundschaft und Spielsucht.
All das mag den Menschen der Urzeit sehr gefallen haben.
Und alle waren hinter der gleichen Nahrung her. Sowohl Pflanzen, als auch Fleisch.
Bewunderte Tiere
In irgendeinem unbestimmten Augenblick der ersten Kontakte zwischen Jägern und Wölfen zündete dann wohl der Geistesblitz, dass Tieren übernatürliche Fähigkeiten innewohnen, die jene von uns Menschen übertreffen können.
Raben schließen sich zu großen Formationen zusammen, um sich der Gefahren durch noch größere Vögel zu erwehren, was ihnen mit ihrer Intelligenz, Wachsamkeit und Anpassungsfähigkeit auch gelingt. Damit erwiesen sie sich anderen Arten mit weniger ausgeprägten Verhaltensweisen weit überlegen. Sie jagen selbst im Flug, sichern sich aber auch Nahrungsreste und verbergen sie für später. Der Tierforscher Konrad Lorenz stimmte der Auffassung weiterer Wissenschaftler zu, dass Raben unter allen Vögeln über die am weitesten entwickelten mentalen Systeme verfügten.
Viele gruppeninterne Prinzipien konnten bei Wölfen und Raben beobachtet werden, und unsere Vorfahren haben mit der Zeit ihre Bedeutung bestimmt durchschaut. Aus dem Zusammenleben von Hochrangigen und Niedrigrangigen entwickelten sich leistungsfähige Systeme, von denen in Bezug auf Versorgung mit Nahrung oder Weiterentwicklung alle profitierten.
Das Beobachten eines Tieres spendet auch damals ihren Sinnen bereits enorme unterhaltende Bereicherung.
Weniger Arztbesuche
Moderne Therapeuten haben sich weit entfernt von den Ansichten urzeitlicher Jäger und Sammler, wonach auch Tieren übersinnliche Kräfte innewohnten. Sie verstehen aus anderen Gründen in hohem Maße die Heilwirkung der Nähe eines Tiers, das weder Übergewicht, noch eine hässliche Narbe oder ein fehlendes Glied als störend wahrnimmt. Tiere urteilen nicht vorschnell. Und sie wollen auch nicht immer Recht behalten.
Die Erkenntnis, dass Tiere sogar heilen helfen, wurde schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts in England von Quakern in einem Asyl für Geisteskranke, dem York Retreat, umgesetzt. Sie erlaubten ihnen auf dem Gelände regelmäßig den Kontakt mit Tieren von einem benachbarten Bauernhof. Das Bethlem Hospital, ebenfalls in England, führte auf Grund dieser Erfahrungen 1860 Tiere als Ergänzung des Betreuungsteams ein. Dr. Sigmund Freud, der Vater der Psychotherapie, der Patienten dazu brachte, ihr Innerstes nach außen zu kehren, besaß mehrere Hunde. Seinen Chow Jofi lernten während der anstrengenden Sitzungen viele Patientinnen und Patienten kennen. Dr. Freud vermutete eine Art Erleichterung der Patienten, wenn sie bemerkten, dass der Hund auf ihre oft intimen Beichten überhaupt nicht negativ reagierte.
Die Begründerin der Krankenpflege im heutigen Sinne, Florence Nightingale, schätzte ebenfalls schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts den Einfluss von Tieren in der Krankenbetreuung.
Das Militär der U.S.A. erkannte 1919 den therapeutischen Nutzen von Hunden in der Betreuung von Kriegsveteranen und hält daran bis heute fest.
Der Kinderpsychiater Dr. Boris Levinson prägte 1961 auf Grund seiner hervorragenden Erfahrungen bei verhaltensgestörten Schulkindern den Begriff Pet Therapy, den man im weitesten Sinne als Streicheltherapie übersetzen könnte.
Es ist heute unumstritten, dass mehr Herzinfarktopfer ein Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch am Leben sind, wenn zu Hause ein Hund auf sie wartet, dass aber auch schon der Blick in ein Aquarium heilsam sein kann. Ein Studie belegt: Von 92 herzkranken Tierbesitzern starben nach ihrer Schwersterkrankung sechs Prozent, während ohne ein Haustier die Todesrate auf 26 Prozent stieg. Interessante, abwechslungsreiche und kompliziert zusammenhängende tägliche Aktivitäten sind ein starker Vorhersagefaktor für langes Leben – Hundebesitzer haben das zweifellos in hohem Maße.
Schon die wortlose Kommunikation mit einem Haustier verschafft Entspanntheit und ein Gefühl der Sicherheit.
Vor allem viele Krebspatienten entwickelten einen hohen Überlebenswillen, weil sie überzeugt waren, dass ihr Tier sie braucht.
Kinder, die in einer Familie mit einem oder mehreren Haustieren aufwachsen, entwickeln bessere Fähigkeiten, sich in die Vorstellung anderer Menschen einzufühlen.
Die Wissenschaft nennt diese wichtige Eigenschaft Empathie – Psychopathen fehlt sie völlig.
Viele Effekte können gemessen werden. Die Wissenschaftler Dr. Alan Beck und Dr. Aaron Katcher an der University of Pennsylvania senkten mit Hilfe von Tieren hohe Blutdruckwerte, indem ihre Patienten Tiere streichelten oder zu ihnen sprachen. In einer Studie an 8.000 Australiern hatten Tierbesitzer eine geringere Herzerkrankungsrate, sogar wenn sie regelmäßig einen höheren Anteil an minderwertigem Junk Food verzehrten. Blutdruck, Cholesterinwerte und Blutfettspiegel waren niedriger als in der Vergleichsgruppe.
Menschen, die mit Tieren leben, brauchen um 16 Prozent weniger Arztbesuche. Das ergab 1990 die Auswertung von Versichertenunterlagen in England.
An Versuchen der Erklärung mangelt es nicht. Tiere reduzieren krankmachenden Stress, allein schon durch Ablenkung. 25 Studien aus Pflegeheimen bescheinigen den Tieren die Kraft, Lächeln auf die Gesichter der Patientinnen und Patienten zu zaubern. Aggression nimmt ebenso ab wie der Einsatz von Antidepressiva.
Soziales Kontrollsystem
Der österreichische Verhaltensbiologe Professor Dr. Kurt Kotrschal arbeitet regelmäßig mit Grauwölfen in einem besonders einfühlsam angelegten Gehege und unterstellt seinen Schützlingen eine enorm hoch entwickelte Fähigkeit, miteinander und untereinander vertraut umzugehen. Er nennt es wörtlich, „zu wissen, was man tut, und was nicht.“ Seine Wölfe im Forschungszentrum begreifen seiner Auffassung zufolge, dass sie sich innerhalb von Sekundenbruchteilen gewaltsam die Leckerlis in den Taschen der Betreuer aneignen könnten. Aber eine innere Stimme warnt sie vor Unverschämtheiten, denn sie würde die Partnerschaft zerstören
Inzwischen ist nachgewiesen, dass Menschen, Wölfe und Hunde von ähnlichen Gehirnstrukturen geleitet werden. Wissenschaftler schwärmen von der Existenz eines sozialen Gehirns, das erst ein intelligentes, rücksichtsvolles und soziales Miteinander möglich macht. Für das Ergebnis wurde von dem welt berühmten Psychoanalytiker und Philosophen Erich Fromm der Begriff Biophilie geprägt, ein Kunstwort aus den griechischen Wörtern für Leben und Liebe. Fromm, Schöpfer des Bestsellers „Die Kunst der Liebe“, befasste sich intensiv mit den mentalen Grundsystemen, die für eine befriedigende Bindung und als Voraussetzung für Wohlfühlen notwendig sind.
Stilbruch Flexileine
Biochemiker unserer Tage fügen ihre Kenntnis hinzu, dass durch als angenehm empfundene Berührung der menschliche Körper zur Freisetzung eines so genannten Bindungshormons, Oxytocin, veranlasst wird.
Hundebesitzer haben in der Regel einen höheren Spiegel dieses Kuschelbotenstoffes im Blut, ganz egal, ob sie ihren vierbeinigen Liebling häufig oder selten streicheln.
Es ist demnach vielleicht nicht übertrieben, wenn viele Tierforscher unserem heutigen Hund Einsichten zutrauen, die manchem zweibeinigen Zeitgenossen ziemlich fremd sein können. Große Psychoanalytiker, Philosophen und Ethiker wie Albert Schweitzer, Erich Fromm, Rainer Funk, Edward O. Wilson, Stephen Kellert oder der Sprecher für Managementethik Rubert Lay haben ihre positiven Grundprinzipien von Ethik so formuliert:
Im Laufe der Evolution hat sich eine Wesenverwandtschaft von Menschen zu den vielen Formen des Lebens und zu den Habitaten und Ökosystemen entwickelt, die Leben ermöglichen.
Einstellungen sind genau dann biophil, wenn sie eigenes und fremdes personales Leben eher mehren denn mindern.
Handle stets so, daß du das personale Leben in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen Menschen eher mehrst denn minderst.
Gut ist die Ehrfurcht vor dem Leben, alles, was dem Leben, dem Wachstum, der Entfaltung förderlich ist. Böse ist alles, was das Leben erstickt, einengt und alles, was es zerstückelt.
Allerdings darf der Mensch sich nicht aus dieser Beziehung nur herauspicken, was ihm besonders zusagt, und ein partnerschaftliches Zusammenleben mit dem Hund auf Augenhöhe in Wahrheit durch Dominanzhierarchie ersetzen. Achtsamkeit und Aufmerksamkeit als Pfeiler einer freudvollen Sozialgemeinschaft. Strenge Tierfreunde lehnen deshalb die automatische Flexileine ab, weil der Menschen sie benutzt, sich beim gemeinsamen Spaziergang gleichsam herauszunehmen, und halten deshalb auch die eifrige Benutzung des Mobiltelefons in der Zeit, die eigentlich überwiegend dem Hund gehört, für einen ethischen Stilbruch. Gemeinsame Erlebnisse werden von diesen Wissenschaftlern als wesentlich wirksamer eingeschätzt als auf der einen Seite das Schmusen und auf der anderen Seite das Bestrafen.
Anti-Diabetes-Faktor
Überzeugend sind Ergebnisse von Erfahrungen mit besonderen Gruppen der Gesellschaft.
Allen Resultaten liegen die gleiche Erkenntnisse zu Grunde, die für Biophilie, unsere Liebe des Lebens, Voraussetzungen sind: Der Anblick eines Tieres in Ruhelage oder in friedvollem Zustand startet in uns Empfindungen von Sicherheit und Wohlgefühl. Das ist womöglich die beste Voraussetzung für persönlich notwendige Veränderungen und für die ungehemmt volle Freisetzung unserer Selbstheilungskräfte.
In 18 Gefängnissen des U.S.-Staates Ohio dürfen Häftlinge herrenlos aufgegriffene Hunde so lange betreuen, bis die Tiere in Pflege oder zur Adoption abgegeben werden können. Das Privileg, für einen Hund verantwortlich sein zu dürfen, erhöht das Selbstwertgefühl. Die ganze Persönlichkeit verändert sich – so lautet eine erste Bilanz. In Gefängnissen mit Hunden werden weniger Probleme registriert.
Auch in der Betreuung von Opfern sexueller Gewalt tragen Hunde durch ihre Nähe zu einem stärkeren Gefühl von Sicherheit und Vertrauen während der Gesprächstherapie bei. Betroffene Frauen fühlen sich weniger von Angst belastet und sind zu mehr Zuversicht in Bezug auf auf ein positives Behandlungsergebnis fähig.
Diabetes wird ausdrücklich als eine Krankheit bezeichnet, die von Pet Therapy profitiert, abgesehen davon, dass die feine Hundenase die aus dem Ruder gelaufenen Blutspiegel von Glukose und Insulin erschnüffelt und so die häufig unentdeckt bleibende Lebensbedrohung offenbart. Natürlich fördern Hunde den regelmäßigen Spaziergang, was überlebenswichtig für einen Menschen mit Zuckerkrankheit sein kann. Sie verführen auch nicht zum Genuss von Süßigkeiten oder anderen gefährlichen Leckereien, die nicht schon auf dem Tisch stehen. Diabeteskranke prktizieren häufig eine besondere Form der üblichen sitzenden Lebensweise. Mit der Krankheit ist, oft wegen Übergewicht, ein Gefühl von Zurückweisung und Abwertung verbunden – nichts von dem hat Platz in einer Mensch-Tier-Beziehung.
Auch unter diesen Patienten und Patienten steigt die Bereitschaft zu Änderungen des Lebensstils, weil ihr Tier sie braucht.
Konrad Lorenz irrte
Zum Glück kann der Hund diese Fragen nicht lesen: Weshalb hat es so lange gedauert? Wie konnte das größte Geschenk des uns liebsten Tieres bis heute verborgen bleiben? Noch schmerzlicher: Warum versagte unsere Intuition? Wieso bedurfte es der Werkzeuge modernster Wissenschaft? Die Antworten könnten uns Schmerzen bereiten. Wenigstens sind wir in bester Gesellschaft: Auch der Nobelpreisträger Konrad Lorenz hat geirrt.
Der große Tier-Versteher glaubte: Wir, die Krone der Schöpfung, haben uns dieses Tier ausgeguckt und in ihm unseren vierbeinigen Liebling Nummer eins gesehen. Aber das ist falsch. In Wahrheit sind nicht wir die Schöpfer dieser Freundschaft. Wir wären dazu damals, in der Geburtsstunde der Tierliebe, auch nicht im Stande dazu gewesen. Was wir allerdings für uns reklamieren dürfen, ist: Der Mensch hat dem Hund im Laufe der Evolution so viele wilde Eigenschaften weggezüchtet, dass am Ende ein besseres Wesen als er selbst herauskam.
Nicht wir haben unseren treuesten Gefährten entdeckt und durch kluge Dressur in unser Herzstück verwandelt. Er wollte es so! Der Hund war es, der den Menschen zum Freund wählte. Er verzichtete darauf, diesen seltsamen Zweibeiner zu fürchten und zu jagen. Er war es, der die Lücke erkannte, die es in unserer Welt vor rund 3.000 bis 4.000 Generationen für ihn gab. Er war es, der sich mit großartigen Fähigkeiten einbrachte. Er war es, der unbedingt akzeptiert werden wollte. Und er war es, der in der Nähe zu den Menschen das viel bessere Schicksal witterte als seine Artgenossen, die weiter wie Wölfe in Rudeln lebten.
Für dieses Ziel überwand der vierbeinige Begleiter die künstlichen Grenzen des Menschen zur übrigen Schöpfung. Dazu bedurfte es eines schier unerschöpflichen Reservoirs an Instinkt oder Weitsicht. Die Menschen der Urzeit betrachteten wohl die Tiere, selbst wenn sie ihnen nachstellten, als gleichwertige Wesen. Sie hatten keine Macht über sie. Gnädig gestimmte Gottheiten entschieden über Erfolg. Sie jagten einander – aber auch miteinander. Mal begnügte sich der eine, mal der andere mit Resten der Beute.
Es war am Ende der Hund, der die Unterwerfung wählte. Ob seine eigene oder gar unsere, darüber diskutieren Wissenschaftler noch ...
Schon 3.000 Hundegenerationen
Alles begann weit, weit vor der Blüte des menschlichen Geistes.
Es ist die Gen-Wissenschaft, die uns seit eineinhalb Jahrzehnten näher und näher an den wahren Beginn dieses Mythos führt. An den Übergang vom wilden zum zahm gewordenen Tier. Bereits etwa 3.000 Hundegenerationen haben mit uns Menschen gelebt, seitdem der erste Wolf das Rudel verlassen und sich für die Nähe zu uns entschieden hat.
Vielleicht waren Jagdabfälle nur der Anlass. In Wahrheit ging es um sehr viel mehr. Das Tier begriff. Es hatte reges Interesse an der anderen Lebensform und strebte danach, sich einzubringen. Möglicherweise empfing es mit seinen Antennen bereits Hinweise auf die Zärtlichkeit, zu der wir Menschen fähig sein können.
Hundeartige der Urzeit erkannten das Potenzial.
Sie begriffen ohne Worte.
Sie unternahmen den ersten Schritt.
Sie wählten die Leitfigur.
Sie akzeptierten Nähe.
Sie verwandelten sich selbst in ideale Gefährten des Menschen.
Sie ersehnten Streicheln und Tätscheln.
Sie suchten Liebe.
Sie gaben Liebe.
Ja, Liebe ist nicht zu hoch gegriffen. Lorenz sprach es aus: „Der Hund liebt“. Instinktive Freundschaft war ihm zu wenig.
Für diese Liebe trennte sich der Hund vom Verlauf seines Schicksals. Er verließ die streng geordnete Welt des Rudels. Die Zuneigung des Menschen wurde zu seinem höchsten Gut. Ihr ordnete er alles, fast alles unter. Was immer er beitragen konnte, um sie zu erringen - er tat es. Dieses Ziel ist geblieben. Es befähigt ihn heute zu Leistungen, die auch in der Tierwelt ohne Beispiel sind. Einzig der Hund ist im Stande, einen Fingerzeig des Menschen zu verstehen oder gar einen einzelnen Blick. Manchesmal genügt sogar ein Gedanke ...
Der Hund war der erste in einer langen Reihe. Katze, Rind, Pferd, Kaninchen, Huhn, Hamster - sie alle erlebten es erst sehr viel später.
Bücher über diese unvergleichliche Freundschaft füllen bereits Bibliotheken. Doch erst jetzt ermessen wir den Anteil, den der erste Vierbeiner selbst in Wahrheit daran hat. Möglicherweise hat der Urmensch es ihm nicht leicht gemacht. Hat nicht den Nutzen und schon gar nicht die Gefühle erkannt, hat ihn verjagt, getötet wegen Eigenschaften, die ihm nicht gefielen, oder nur benutzt.
Der Hund ließ nicht locker, blieb, passte sich an, so intelligent, dass er sogar einen Nobelpreisträger täuschte. Heute wissen wir es besser. Es gebührt, danke zu sagen.
Der erste Funke
Stärker werden sich die Nebel der Urzeit nicht lichten. Wir sehen Landraubtiere. Laufjäger. Hetzende Beutefänger. Lange Beine mit nur geringer störender Masse. Ihre Muskelpakete verbirgt der Körper. Mit den Hinterpfoten treffen sie energiesparend die Trittspur der vorderen Extremitäten.
Es sind Wölfe.
Mit dem Leittier sind sie zu fünft. Ihr Fell zeigt das Gelblichbraun des Ingwers und reflektiert Farbtöne der Landschaft. In lockerer Formation folgen sie den Spuren von Antilopen. Ein Spürwolf ist weit vorausgeeilt. Hoch am Himmel kreisen Raben über der Herde – eine kleine Hilfestellung, geeignet, das Überleben der Beutejäger und ihrer Abfallschmarotzer zu erleichtern.
Die Wölfe haben bereits eine beträchtliche Strecke zurückgelegt. Die Witterung wird stärker und stärker. Sobald sie sich mit ihrem Späher vereinigen, beginnt der Kampf. Ihr Einsatz als geschlossen gefürhtes Rudel vermag eine ganze Herde in Bewegung zu setzen. Das ist der geniale Plan. Sie greifen die Gruppe an und jagen sie in die Flucht. Dabei werden sie erkennen, ob ein Tier schwächer ist als die anderen. Sie werden es abdrängen und attackieren.
Das Wittern dieser Chance weist jedem Einzelnen von ihnen in jedem Augenblick eine besondere Aufgabe zu. Das bedingungslose Zusammenwirken ihrer Fähigkeiten vergrößert die Aussicht auf Erfolg.
Diesmal sind sie da draußen nicht allein. In weiter Ferne sehen sie Wesen halb gebückt, halb mit aufrechtem Gang. Sie weisen geringes Haarkleid auf. Es ist eine kleine Schar Zweibeiner, und sie verfolgt offensichtlich das gleiche Ziel. Die Wölfe begegnen diesen Konkurrenten mit Respekt. Diese Jäger beherrschen besondere Künste. Sie schleudern Steine. Sie schlagen mit Knüppeln. Sie stellen aus Knochen und Geweihen wirksame Waffen her. Sie legen tiefe Gräben an und verdecken sie mit Zweigen. Sie verständigen sich durch Zeichen, Schreie und Schnalzlaute. Doch weder sind sie schnell genug, noch verfügen sie offensichtlich über weit reichenden Spürsinn. Denn häufig verlieren sie die Fährte. Meistens stehen sie am Ende mit leeren Händen da.
Die Achtung ist beidseitig. Die Zweibeiner erkennen beim Beobachten der Tiere die durchdachte Angriffstechnik des Rudels selbst gegen Herden größerer Beutetiere. Sie staunen über unglaublich erscheinende Fähigkeiten. Eine scharf ausgeprägte Riechorientierung. Ein beeindruckendes Sehvermögen noch in der Dämmerung. Über das Körperliche hinaus scheint jedes einzelne Wesen einem speziellen, ihm zugedachten Auftrag zu gehorchen.
In großem Abstand hetzen die Vierbeiner an ihnen vorbei. Vorne schließen sie zur Gruppe der Antilopen auf. Der Spähwolf hat bereits ein junges Tier ausgemacht. Sie kreisen die Herde ein und greifen an.
Bis die Zweibeiner die Stätte erreichen, ist die Jagd entschieden. Diesmal bleiben für sie wenigstens Abfälle übrig. Mit ihren geschickten Fingern und den winzigen Zähnen vermögen sie noch die winzigsten Fleischreste von den Knochen zu lösen.
Von Interesse getrieben
Warum schlich schließlich ein Protohund näher, legte sich ans Feuer und blieb?
Sein Interesse an den Menschen – und nicht umgekehrt - war die größte Energie. Mit einem einzigen Tier, vermutlich, begann es: Profitierte dieses Wesen einfach nur von Fähigkeiten des Zweibeiners? Der spürte diese Kreatur spürte den Funken? Diese Hungerte es vielleicht nach einem Gefährten? War es süchtig nach der Friedfertigkeit dieses Wesens?
Ahnte es gar seinen eigenen Beitrag zum unvorstellbaren und beispiellosen Siegeslauf des Menschen voraus?
Gleichzeitig war es unmöglich, die unübertreffliche Funktionalität der kommenden Partnerschaft mit dem Menschen vorherzusehen. Auf der einen Seite deutlich unterlegene Sinnesleistungen. Auf der anderen Seite ein überzeugendes Planungsvermögen, wenn etwa die jagenden Nomaden dieser Zeit nicht ortsgebunden sich auf Veränderungen ihrer Umwelt einstellten und sich erfolgreich immer wieder unerschöpfte Nahrungsquellen erschlossen.
Aber unmöglich ist nichts.
Über die Begleitumstände dieser Annäherung haben Forscher lange gerätselt. Ihre ersten Antworten basierten immer auf archäologischen Entdeckungen. Knochensplitter und Felszeichnungen. Fossile Hundeknochen wurden rund um den Erdball in unmittelbarer Nähe menschlicher Spuren gefunden. In Höhlen, in den Resten von Pfahlbauten, bei Kultstätten. Die ältesten Relikte waren beheimatet im heutigen Nahen Osten, in Europa und in Südostasien. Das Zeitfenster spannte sich zu Beginn des wissenschaftlich geprägten Nachdenkens über 10.000 bis 20.000 Jahre vor unserer Zeit und lag ein wenig vor den Anfängen des Ackerbaus.
Eines war erstaunlich. Diese Vorfahren hatten keine Herden, die zu bewachen waren, keinen Besitz, den es zu schützen lohnte, und sahen doch einen Nutzen von Tieren in ihre Nähe?
Abstammungslinien der Evolution
Die meisten Wissenschaftler vermuteten schon sehr lange, dass die ersten Hunde Abkömmlinge domestizierter Wölfe waren. Als ob das so einfach wäre. Wie zähmt man ein wildes Tier? Einige wenige glaubten hingegen, dass sie Kreuzungen mit dem Aas fressenden Schakal oder dem Präriewolf Kojote entstammten.
Heute wissen wir: Die Gene des Hundes erzählen eine völlig andere Geschichte als seine Knochen.
Besonders an der University of California in Los Angeles, UCLA, widmete sich in den 1990er Jahren ein Team von Molekularbiologen gewissenhaft der intensiveren Erforschung dieser ersten engen Tier-Mensch-Beziehung. Sie interessierten sich vor allem für genetische Informationen, die jedes Lebewesen in der Desoxyribonukleinsäure, englisch: desoxyribonucleic acid, abgekürzt DNA, speichert. Für ihre Analysen verwendeten sie Blutproben oder Tierhaare.
Die Experten untersuchten zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Abstammungslinien von 162 lebenden Wölfen aus 27 Rudeln in Europa, Asien und Nordamerika. Gene können sich im Laufe der Zeit langsam und allmählich neuen Lebenserfordernissen anpassen, und aus den Abweichungen ziehen Wissenschaftler Rückschlüsse auf den Zeitraum, in dem sich Mutationen entwickelt haben. Das gilt für Tiere, Pflanzen und Menschen gleich.
Je abweichender zwei Abfolgen sind, umso mehr Zeit muss in aller Regel den Molekülen für die Mutation zur Verfügung gestanden haben. Die jüngste, wissenschaftlich erforschte genetische Veränderung des Menschen, beispielsweise, betrifft die Anpassung von Bewohnern der Tiefebene Chinas an die Lebensbedingung in der Hochebene von Tibet: Erst nach etwa 3.000 Jahren war ein Dasein in 4.000 Meter Höhe ohne die damit eigentlich verbundene Erkrankungen dauerhaft möglich.
Auf gleiche Weise wurden 67 Hunderassen in der Gestalt von 140 Tieren enträtselt – vom afrikanischen Basenji (dem Einzigen, der nicht bellt) bis zum irischen Wolfshund. Die DNS-Analyse ergab Unglaubliches. Es gibt vier, höchstens fünf große Hundefamilien. Ihre größte und gleichzeitig vielschichtigste verrät erstaunlicherweise eine sehr enge Verwandtschaft relativ moderner Züchtungen mit prähistorisch geprägten, alten Hunderassen, wie des Retrievers und des Collies zum Dingo und dem in Neu-Guinea angesiedelten Singenden Hund. Eine andere Hauptgruppe mit dem Elchhund und dem Schäferhund ähnelt stärker bestimmten Wolfsarten als anderen Hunderassen auf.
Diese und weitere Resultate liefern keinesfalls Antworten auf alle Fragen. Aber zwei Erkenntnisse sind sicher. Die Erste: Der Hund besitzt keinen anderen Vorfahren als den Wolf. Alle Rassen, die wir heute sehen, stammen einzig von ihm, dem wildesten und scheuesten aus der großen Familie der Kaniden, ab. Kojote und Schakal standen niemals Pate bei dieser Entwicklung; nicht einmal bei jenen heute noch wild lebenden Vierbeinern, die äußerlich eine gewisse Familiennähe zu ihnen besitzen.
Wolf und Hund verbindet eine unmittelbare Abstammungslinie ohne Zwischenschritt. Wie eine unendlich lange Perlenkette besteht sie aus einer ungeahnten Abfolge einzelner Mutationen des ursprünglichen Erbguts. Erst jetzt begreifen wir den Umfang dieser Evolution. Erst jetzt erkennen wir die enorme Zahl genetisch bedeutender Informationen. Jede Veränderung vollzog sich über viele, viele Tiergenerationen. Jede Einzelne konsumierte einen beträchtlichen Zeitvorrat. Ohne die Kenntnis der Gene war es nicht möglich, die Summe dieser Intervalle auch nur zu schätzen. Schon damals sah die Forschung, 15.000 oder 20.000 Jahre hätten unter keinen Umständen ausgereicht, um aus dem wilden, äußerst scheuen Wolf den handzahmen Hund werden zu lassen. Alles muss weit, weit früher begonnen haben.
Freude und Nutzen
Es gab vor unserem geliebten Vierbeiner eine ausgeprägte Zwischenphase der Hundeartigen. Äußerlich waren sie noch Wölfe. Protohunde, Basishunde oder Wolfshunde – wie auch immer erfinderische Experten sie nennen mögen.
Fast jedes Mal, wenn unsere Vorfahren in ihrem Umfeld eines dieser Exemplare wahrnahmen, war auch Freude an ihrem Treiben im Spiel.
Die frühesten Menschenhunde, die sich anatomisch von den wilden Verwandten unterschieden, stammen erst aus der Dämmerung von Kultivierung und Zähmung.
Es war am Ende der Eiszeit. Die neuen Umstände brachten den Menschen von einer Lebensform ab, in der er davor 99 Prozent seines Daseins existiert hatte. Er wurde sesshaft, legte Felder an und begann intensiver, ausgewählte Tiere stärker als bisher zu seinem Vorteil zu nutzen.
Von Felsmalereien oder Höhlenzeichnungen abgesehen, kennen wir keine Momentaufnahme aus dieser Zeit. Deshalb sind Grabstätten für die Forschung so interessant, weil sie der Nachwelt überliefern, welche rituellen Beigaben aus Sicht der Hinterbliebenen für den Verstorbenen bedeutend waren. Vor allem vier Entdeckungen sind es, von denen die wissenschaftliche Meinung bestimmt wurde. In der Nähe des heutigen Rheinstädtchens Bonn wurde in jener Epoche ein junger Mann bestattet, dessen Arm auf der Schulter eines Hundes ruht. Ein ähnliches Arrangement zeichnete eine Totenkultstätte im Nahen Osten aus. Der dritte Beleg entstammt einer Ausgrabung nahe der Stadt Bohuslan (Schweden). Dort hat vor etwa 13.000 Jahren eine Familie gemeinsam mit ihrem Toten auch einen Hund bestattet. Ein Steinzeitgrab neben einer Höhle bei Oberkassel enthielt ein Stück Kieferknochen – es stammt aus dem Paläolithikum vor etwa 14.000 Jahren.
Doch nun öffnet die Wissenschaft gerade durch die Analyse der mitochondrialen DNA einen Vorhang, der das Entstehen unserer Tierliebe bisher verhüllt hat. Die Forscher erkennen so viele Abweichungen, dass sie die frühesten Hundeartigen weit vor der Zeit der Neandertaler ansiedeln. Denn hintereinander hat sich eine aus der anderen entwickelt.
Die Geburtsstunde des neugierigen Vierbeiners führt uns an die 50.000 und mehr Jahre unserer Entwicklung zurück. Es gibt keinen Zweifel - als unsere Vorfahren aus den Wäldern traten, erregten sie bereits die Aufmerksamkeit einiger weniger besonders schlauer, wagemutiger, intuitiver Kaniden – nicht mehr ganz Wolf, noch lange nicht Hund. Analysen der Erbanlagen zweigen Übereinstimmungen von heutigen Hunden eher mit den Wölfen Europas als aus dem damaligen Asien.
Kommunikationsfaktor Beutereste
Hinter ihrer Abstammung verbirgt sich bereits ein spannendes Schicksal. Natürlich konnten die Zweibeiner jener Zeit nicht im Entferntesten ahnen, was wir heute wissen: Die als erste identifizierte Genspur unserer Hunde führte eindeutig nach Asien, aber bei diesem Wissensstand ist es nicht geblieben. Dort hat sich jedenfalls zumindest ebenfalls eine derartige intuitive Annäherung ereignet. Ein Wolf, entweder aus dem Rudel verbannt, wegen Verletzung oder Ungehorsam zum Beispiel. Oder ein Wolf, erfüllt von der vagen Sehnsucht nach einem Dasein ohne die unerbittliche hierarchische Strenge seiner angestammten Gemeinschaft. Vielleicht aber auch wissender, rationaler als seine Genossen.
Diese jagenden Zweibeiner ließen stets Beutereste zurück. Die eisigen Verhältnisse zwangen sie, ihre Kräfte selektiv einzusetzen. Der suchende und ahnende Wolf musste ihnen nur geduldig folgen …
Viele Wissenschaftler sind sich sogar einig: Der schlaue Wolf witterte früh seine Chancen der Zusammenarbeit, so wie mit anderen Lebewesen seines Umfelds ebenso - so wie der Polarfuchs heute noch den als Jäger erfolgreichen Eisbären sogar dringend benötigt, um mit seinen Beuteabfällen zu überleben. Solche Möglichkeiten eröffneten sich dem Wolf auch bei den Zweibeinern mit ihren geschickten Händen. Allerdings hielt eine immens ausgeprägte Scheu ihn weit von den menschlichen Jagdgenossen fern. Unbestritten ist: Die frühen Hominiden mit den seltsamen Waffen interessierten ihn viel stärker als jene, die viel, viel später Felder anlegten. Wer immer also den Anfang machte, hat nicht lange gezögert ...
Vor mehr als 30.000 Generationen – das Erwachsenwerden dauerte beim primitiven Zweibeiner zwölf Jahre, beim Homo sapiens bis zu siebzehn - könnten unsere Vorfahren bereits Wölfen in weiter Ferne ansichtig geworden sein. Das belegen einzelne Zähne und Knochenreste aus Regionen, in denen beide zur gleichen Zeit lebten. Eine Existenz von unterschiedlichen Jägergruppen. Die einen hetzend, die anderen heranpirschend.
Möglicherweise haben die mit Holzspießen, Steinen, aber auch mit loderndem Feuer und lautem Geschrei agierenden Zweibeiner den scheuen Wildtieren gelegentlich sogar erfolgreich ihre Beute abgerungen.
Einige tausend Generationen vor unserer Epoche prägte die Evolution dann folgerichtig die ersten Hundeartigen. Sehr viel später - es ist erst 2.000 Generationen her - betrat der moderne Mensch die Lichtung. Aus den Formen, Zeichen und Farben seiner Felskunst kennen wir präzise seinen Dialog mit dem Wasser, der Sonne, dem Tier, dem Felsen. Wie niemand vor ihm war er interessiert, die Natur, ja, die gesamte Welt um ihn herum zu verstehen. Und es dauerte schließlich nicht mehr lange, bis erste Angehörige einen geliebten Hund an die Seite eines Verstorbenen betteten ...
Es war das Tier, das die Grenze zu uns überwand. Es hatte dafür auch zahllose Motive.
Damit kehren wir zurück in die mittlere bis jüngere Altsteinzeit.
Die Welt der ersten Stunde
Wildschwein, Höhlenbär, Auerochse, Höhlenlöwe und Rothirsch haben sich bereits vor langer Zeit über viele Regionen verbreitet. Wölfe jedoch sind die wahren Herrscher der Wälder und Wiesen. Sie leben in Verbänden zur gemeinsamen Jagd und Verteidigung. Erst das geniale Zusammenwirken ihrer großartigen Fähigkeiten unter strenger Hierarchie hat ihnen ihre überragende Stellung gesichert. Die einzelnen Tiere eines Rudels übernehmen mit Erreichen des Erwachsenenalters unterschiedliche Aufgaben. Diese Landraubtiere überleben in den unterschiedlichsten Prägungen. Unzählige Rudel existieren nebeneinander. Es gibt sie in Asien, in Europa, im heutigen Afrika.
Urmenschen sind erst vereinzelt anzutreffen. In unseren Regionen leben vielleicht einige tausend. Sie sind über große Gebiete verstreut und kämpfen um ihr Dasein an Hunderten, weit voneinander entfernten Schauplätzen. Sie schließen sich zu kleinen Gruppen zusammen, und ihre Gedanken konzentrieren sich auf die großen Herausforderungen: Sammeln, jagen, fortpflanzen. Sie bewegen sich innerhalb eines Areals im Ausmaß eines Tagesmarsches. Die Zweibeiner jener Zeit tragen einfache Fellkleidung, hausen im Freien, unter Dächern aus Baumrinde, in Höhlen oder Grotten und verfügen bereits über erste Spezialwaffen wie Faustkeile, Holzspieße und Wurfsteine. Sie stellen Tieren nach – oder vertreiben sie mit Steinen von ihrer Beute. Sie beherrschen das Feuer. Die übermächtigen Kräfte der Natur, der Zyklus von Geburt und Tod und der Einfluss von Träumen lassen erste religiöse Ahnungen entstehen. Hominiden bemalen ihre Körper mit Erdfarben und bringen den unbekannten Göttern Opfer dar. Kannibalismus hat zumindest als Kultform Bedeutung. Vereinzelte Zweibeiner zogen das Verzehren ihrer Vorfahren dem Bestatten vor.
Ihre Gemeinschaften entstehen aus den Gegebenheiten heraus, nicht aus Drang oder Intuition. Sie versuchen, einer Region das für das Leben Notwendige abzuringen. Sie bleiben, solange die Natur sie ernährt, und ziehen weiter, wenn die Überlebenschancen anders wo besser scheinen. Das Geschick der Gruppe wird nicht in seltenen Fällen von einer Frau bestimmt. Mütter und Töchter entscheiden darüber, wann ein heranwachsender Sohn die Lagerstätte verlassen und sich selbst ernähren und behaupten muss. Und auch, welche Männer geduldet werden – auf jeden Fall nur Tüchtige, so lange sie erfolgreich jagen und auch wirklich die gesamte Beute zurück bringen. Sobald jemand seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird er verstoßen.
So leben sie dahin, von Ebene zu Ebene, von Tal zu Tal, stets auf der Suche nach Nahrung. Wo immer diese Gestalten, halb gebückt, mit aufrechtem Gang auftauchen, einen Unterschlupf suchen und sich für eine Weile niederlassen, sind die Wölfe schon da, in großer Zahl.
Die Evolutionsgeschichte des Wolfes ist bis heute nicht geklärt. Primitive Fleischfresser der Familie der Miaciden lebten vor rund 52 Millionen Jahren. Im Jungtertiär bildeten sich daraus die beiden Hauptgruppen der Beutefänger, Kaniden (Wölfe, Füchse & Co) und Feliden, Vorfahren unserer heutigen Katzen. Wolf und Kojote, sein nächster wilder Verwandte, haben sich demnach vor rund einer Million Jahre getrennt und können als eine Art Geschwister gelten. Lange dominierte der eineinhalb Meter lange Canus Dirus, der Schreckliche Wolf. Er war damals vermutlich bereits auf allen Kontinenten heimisch, hatte eine Schulterhöhe zwischen 60 und 80 Zentimeter und wog ausgewachsen unter günstigsten Lebensbedingungen bis zu 60 Kilogramm, unter ungünstigen aber auch nur ein Drittel davon. Sein Aussehen ähnelte mehr einem Bären unserer Zeit. Offensichtlich war er im Stande, mit seinem Kiefer Knochen verendeter Grosstiere aufzubrechen. Aber während der Eiszeit verschwanden die meisten seiner Beutetiere, er fand nicht genug Nahrung und starb aus. Von den übrigen Arten erwiesen sich vor allem der mittelgrosse Canis Lupus, der Graue Wolf, und der Kojote als fähig, selbst schwierigste Lebensbedingungen zu meistern. Der Graue Wolf besitzt eine größere Hirnschale als sein „schrecklicher“ Verwandter, und seine Unterschenkel sind länger. Das machte ihn zum besseren Läufer.