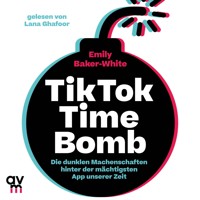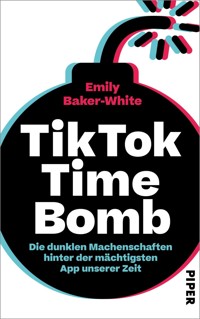
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das wahre Gesicht der erfolgreichsten App der Welt Die Forbes-Investigativjournalistin Emily Baker-White erzählt die Geschichte des kometenhaften Aufstiegs der AppTikTok, die seit ihrem offiziellen Launch im Jahr 2018 die Social-Media-Welt revolutionierte,Popkultur und Öffentlichkeit weltweit veränderte, und bereits mehr als 1,6 Milliarden User in über 150 Ländern aufweist. Baker-Whites Buch besteht aus den Enthüllungen ihrer spektakulären Investigativreche, die mit exklusiven Informationen von über 100 TikTok-Insidern die engen Verbindungen des chinesischen Staats zum TikTok-Konzern aufdeckt. Spannend wie ein Thriller enthüllt Baker-White Machtmissbrauch, Datenschutzverletzungen und mutmaßliche Algorithmus-Manipulationen bei TikTok –, bis sie und andere Journalisten bedrohlicherweise selbst ins Fadenkreuz des chinesischen TikTok-Mutterkonzerns ByteDance geraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-61179-4
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Every Screen on the Planet: The War Over TikTok bei W. W. Norton & Company Ltd., New York, 2025.
Copyright © 2025 by Emily Baker-White
© der deutschsprachigen Ausgabe 2025:
Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, www.piper.de
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Covergestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München
Covermotiv: Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Einleitung
AKT I
Kapitel 1 – Information auf der Suche nach Menschen
Kapitel 2 – Der moralische Held
Kapitel 3 – »Sehr ähnlich, wie einen Staat zu lenken«
Kapitel 4 – Drei Möglichkeiten, Geld im Internet zu verdienen
Kapitel 5 – Ein künstlicher Hype
Kapitel 6 – Ein Typ namens Jorge
Kapitel 7 – Content-Moderation
Kapitel 8 – Berichtigung
Kapitel 9 – Redefreiheit als Nutzerrecht
Kapitel 10 – Die fünfte Gewalt
AKT II
Kapitel 11 – Der Durchbruch
Kapitel 12 – Buzz Lightyear
Kapitel 13 – ’ne Sache für K-Pop-Stan
Kapitel 14 – Galwantal
Kapitel 15 – Chinas Marionette in Amerika
Kapitel 16 – Schlüsselgeld
Kapitel 17 – TikTok Global
AKT III
Kapitel 18 – Der Fahrer hat kein Bargeld
Kapitel 19 – Die Unternehmensgruppe
Kapitel 20 – Menschen verschwinden
Kapitel 21 – Besitz und Kontrolle
Kapitel 22 – Die TikTok-Tapes
Kapitel 23 – Interne Prüfung und Risikosteuerung
Kapitel 24 – Der fehlgeleitete Versuch
AKT IV
Kapitel 25 – Kriegszeiten
Kapitel 26 – Verkaufen, sonst …
Kapitel 27 – Shoutime
Kapitel 28 – Loyalitätsprüfungen
Kapitel 29 – »Kein Affront gegenüber ByteDance …«
Kapitel 30 – »Enshittification«
Kapitel 31 – »lol hallo Leute«
Kapitel 32 – PAFACAA
AKT V
Kapitel 33 – Seed und Flow
Kapitel 34 – Krisenstimmung
Kapitel 35 – Notstandspläne
Kapitel 36 – Der TikTok-Präsident
Kapitel 37 – Defensive Demokratie
Kapitel 38 – Per curiam
Kapitel 39 – Das Flackern
Kapitel 40 – Jetzt zwei Väter
Epilog
Danksagung
Bemerkungen
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Einleitung
Die Nachricht kam irgendwann um Mitternacht, ohne Briefkopf und ohne Adresse. Sie wurde von einem Unbekannten unter den Hotelzimmertüren von führenden Vertretern der Techbranche aus aller Welt hindurchgeschoben und stellte ihre Empfänger vor eine Aufgabe: Ihre Einwände müssten bis acht Uhr morgens angemeldet werden; anderenfalls würden ihnen die folgenden Ideen zugeschrieben werden.
Als die Gründer und Lichtgestalten der globalen Techbranche auf der World Internet Conference 2014 im chinesischen Wuzhen eintrafen, war ihnen nicht bewusst, was sie erwartete. Zusammen mit chinesischen Techmogulen wie Jack Ma von Alibaba und Pony Ma von Tencent wurden die Vertreter von Apple, Facebook und Microsoft in traditionellen schwarzen Booten in die noch ursprüngliche Touristenzone der Stadt gefahren. Die chinesischen Staatsmedien bezeichneten die vom Staat gesponserte Konferenz als eine Gelegenheit für ihre Regierung, die digitale Vorherrschaft der Vereinigten Staaten herauszufordern. Im Großen und Ganzen handelte es sich bei der Zusammenkunft jedoch um eine ganz normale Techkonferenz – bis zum letzten Abend, an dem die Teilnehmer jenes geheimnisvolle Schriftstück erhielten.
Es trug den Titel »Wuzhen-Erklärung« und wurde angeblich im Namen der Konferenzbesucher verfasst. Darin wurde eine Idee befürwortet, für die sich der chinesische Autokrat Xi Jinping starkgemacht hatte: Cybersouveränität. Das Konzept war einfach: Das Internet sollte wie die physische Welt in Länder aufgeteilt werden, und jede Regierung sollte ihr eigenes Hoheitsgebiet kontrollieren können.
Auf der Erklärung lag ein kurzes Deckblatt mit einer E-Mail-Adresse, an die die Teilnehmer Einwände oder Änderungsvorschläge schicken konnten. Eine Gruppe von ihnen handelte sofort, denn in China bedeutete »Cybersouveränität«, dass die Regierung ihre Bürger überwachen, zensieren und indoktrinieren durfte, da diese weder das Recht auf freie Meinungsäußerung noch auf eine freie Presse genossen. Die globalen Führungskräfte wollten indes nicht als Befürworter einer solch autoritären Haltung gesehen werden.
Die chinesische Regierung hatte gehofft, ein Dokument erstellt zu haben, das die amerikanischen und europäischen Ideale eines offenen Internets infrage stellen würde. Doch ohne die Unterstützung ausländischer Entscheidungsträger war die Erklärung nutzlos. Besiegt, aber stolz und stets Herr der Lage, taten die Organisatoren der Konferenz fortan einfach so, als hätte es das Schreiben nie gegeben.
Dieses Wagnis von Wuzhen aus dem Jahr 2014 war zwar bald schon vergessen, zeigte aber, dass es künftig Probleme geben würde. Heute kann man es sich kaum noch vorstellen, aber in jenem Jahr war das Internet noch ein optimistischer Ort. Die Nutzung sozialer Medien stieg sprunghaft an, und es schien, als würden die Träume der digitalen Pioniere aus der Anfangszeit des Internets Wirklichkeit werden: Das Netz würde ein Ort sein, an dem sich jeder frei äußern könnte und an dem der Austausch von Gedanken wie von Gütern jenseits aller geografischen Grenzen stattfinden würde.
Diese grenzenlose Freiheit bedeutete aber auch eine Bedrohung für die bestehenden Regierungen. Und ihre Bemühungen, sie einzuhegen, sollten das nächste Jahrzehnt des internationalen Wettbewerbs bestimmen.
Die Wuzhen-Konferenz wird rückblickend zwar als geopolitisches Projekt betrachtet, hatte aber auch noch eine einfachere Aufgabe: Sie sollte als Bühne für die Präsentation einer beeindruckenden Anzahl aufstrebender chinesischer Unternehmer dienen. Nur wenige Stunden bevor die Konferenzteilnehmer jenes Blatt Papier erhielten, lauschten sie einem Vortrag von Zhang Yiming, einem Gründer, dessen Produkt China innerhalb weniger Jahre genau die Soft Power verleihen würde, die es anstrebte – ohne die Unannehmlichkeiten gemeinsamer Erklärungen oder die Mithilfe anderer Regierungen. Yimings Schöpfung begeisterte Menschen auf der ganzen Welt so sehr, dass sie einen neuen Kalten Krieg entfacht und das Gleichgewicht der digitalen Macht zwischen den USA und China neu justiert hat.
Yiming war nicht der Hauptredner der Konferenz, obwohl noch die letzten Töne eines dramatischen Orchesterstücks gespielt wurden, als er die Bühne betrat. Er war klein und dünn. Seine Schultern reichten kaum über den Laptop hinaus, der offen auf dem Rednerpult stand. In seiner Präsentation stellte er Pläne für ein futuristisches Wunderwerk vor: ein Unternehmen, das mithilfe von maschinellem Lernen das Gefühl »Ich wünschte, ich hätte es gewusst« beseitigen wolle. Der Gedanke, dass ein Computer eines Tages unsere Wünsche besser erkennen könnte als wir selbst, war absonderlich. Denn diese Idee stellte grundlegende Vorstellungen von menschlicher Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung infrage. Würden wir wirklich jemals bereit sein, unsere eigene Neugier den Maschinen dieses Mannes zu überlassen?
Yimings Unternehmen hieß ByteDance und wurde von einem zentralen Algorithmus angetrieben, der Nutzer analysierte, ihre Interessen ermittelte und sie mit Nachrichten und Unterhaltungsangeboten versorgte, von denen er annahm, dass sie ihnen gefallen würden. Das Geheimnis war Aufmerksamkeit, und zwar so viel wie möglich. Denn wenn eine App die Aufmerksamkeit der Nutzer lange genug in Beschlag nehmen konnte, dann konnte sie auch deren Entscheidungen und Handlungen nachverfolgen und anhand dieser vorhersagen, was sie als Nächstes sehen wollten, schon bevor sie es selbst wussten.
ByteDance sollte schließlich eine App namens TikTok entwickeln: einen durchgängigen Feed mit kurzen, unterhaltsamen Videos, der präzise an den Interessen, Persönlichkeiten und dem Sinn für Humor der Menschen geschult wurde. Bis zum Jahr 2021 sollte TikTok Google als meistbesuchte Website der Welt überholen und bis zum Jahr 2024 eine Nutzerbasis von mehr als einer Milliarde Menschen haben – fast so groß wie die gesamte muslimische Weltbevölkerung.
Und TikTok führte täglich eine Volkszählung unter dieser weltumspannenden Bevölkerung durch und erfasste, mit wem seine Nutzer sprachen, welche Gedanken sie mit anderen teilten, worauf sie achteten und in welcher Stadt sie sich in jedem beliebigen Moment aufhielten. Der Algorithmus traf dann täglich Milliarden von Entscheidungen darüber, welche Informationen ihnen angezeigt werden sollten, und schuf so ein einzigartiges, individuelles Erlebnis für alle, die eine Beziehung zu der App aufbauten.
In wirtschaftlicher Hinsicht war ByteDance ein riesiger Erfolg. Es profitierte vom sogenannten Flywheel- oder Schwungrad-Effekt: Je mehr man seine Anwendungen nutzte, desto besser lernte das Unternehmen die eigenen Vorlieben kennen. Dadurch konnte es einem das präsentieren, was man mochte, was wiederum dazu führte, dass man seine Anwendungen noch öfter nutzte, wodurch sie immer besser wurden. Als ByteDance schließlich TikTok auf den Markt brachte, war das Unternehmen das wertvollste Start-up der Welt. Es hatte Hunderte Millionen Nutzer allein in China, doch Yiming wollte mehr. Er wollte, dass ByteDance auf allen Bildschirmen der Welt präsent sein sollte.
Als er sich anschickte, mit seinem Unternehmen die weltweiten Märkte zu erobern, konkurrierte er mit Firmen, die sich offen als Motor von Demokratie und Selbstbestimmung präsentierten. Facebook sagte, es gehe darum, Menschen zu verbinden, und Googles Slogan lautete »Don’t Be Evil«. Doch TikTok, die erste große Internetplattform, die nicht aus den USA stammte, präsentierte sich als reine Unterhaltungsmaschine. Wenn Yiming beide Seiten bedienen wollte, konnte er zu den heiklen Problemen, die das Schreiben in Wuzhen aufwarf, keine Stellung beziehen.
Der Aufstieg Chinas zu einer wirtschaftlichen und technologischen Supermacht ist in den USA schon endlos lange diskutiert worden. Doch bis in die späten 2010er-Jahre hinein wurde die Ankunft Chinas im Silicon Valley noch nicht wirklich wahrgenommen. Die amerikanischen Techgiganten vertraten die Ansicht, dass sie an einen moralischen Bogen gebunden seien, der sich in Richtung einer Online-Offenheit neige. Der Aufstieg von TikTok war allerdings zweifellos nicht an diesen Bogen geknüpft, und seine Kritiker behaupteten sogar, dass er einer ganz anderen, ja sogar einer ihm entgegengesetzten Entwicklungstendenz folge.
In den Jahren zwischen der Wuzhen-Konferenz und dem Start von TikTok hat Xi Jinping sein Vorhaben, das Internet zu fragmentieren, voll und ganz umgesetzt – zumindest in China. Drei Jahre nachdem die Resolution von Wuzhen abgeschmettert worden war, endete ein Projekt, das als Bemühung um einen Konsens begonnen hatte, mit einem Ruf zu den Waffen. Denn die chinesische Regierung verabschiedete im Jahr 2017 ein Gesetz, das besagt, dass jeder chinesische Bürger und jedes chinesische Unternehmen vom Staat zur Spionage verpflichtet werden kann und dies anschließend leugnen muss.
Yiming war aber weder Befürworter noch Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). ByteDance war ein Zufluchtsort für brillante, oft liberale chinesische Ingenieure und wurde regelmäßig von der Regierung ins Visier genommen, da es nicht hinreichend auf Parteilinie war. Doch Politiker in den USA, Europa und anderswo nahmen die chinesische Regierung beim Wort: Yiming und seine Mitarbeiter könnten als chinesische Staatsangehörige jederzeit und gegen ihren Willen verpflichtet werden, als Spione Daten zu sammeln oder verdeckt Propaganda zu verbreiten, um Chinas geopolitische Ziele zu fördern.
Auf der ganzen Welt fragten sich nun Politiker, inwieweit TikTok der Kontrolle der chinesischen Regierung unterworfen war. ByteDance drehte und wand sich und behauptete, die Plattform werde gar nicht von China aus kontrolliert. Doch das wurde sie sehr wohl, und ihre Mitarbeiter wussten das.
Die Öffentlichkeit war schockiert, als sie erfuhr, dass Details aus dem Privatleben der Menschen von chinesischen ByteDance-Mitarbeitern aufgezeichnet wurden. Whistleblower meldeten sich, um offiziellen Darstellungen der ganzen Situation zu widersprechen, was im Unternehmen für Panik sorgte. Angehörige der Innenrevision wurden entlassen, da sie Standortdaten genutzt hatten, um Journalisten – mich eingeschlossen – zu verfolgen. Oft war dies genau die Art von Spionage, die den Leuten Angst vor der chinesischen Kontrolle über die App machte, und führte zu strafrechtlichen Ermittlungen.
Das Weiße Haus verhandelte mit ByteDance und forderte es auf, das US-Geschäft von TikTok abzuschotten und der amerikanischen Regierung eine beispiellose Kontrolle über seinen Geschäftsbetrieb zu gewähren. Während dieser Verhandlungen investierte ByteDance mehr als zwei Milliarden Dollar in den Aufbau eines Systems, das die Daten der Amerikaner in den USA belassen sollte. Dieses als »Project Texas« bekannte System war ein neuartiger Versuch, Eigentum und Kontrolle voneinander zu trennen. Als aber seine Mängel ans Licht kamen, trat die amerikanische Politik in Aktion. Diese war wild dazu entschlossen, der chinesischen Regierung die Macht über TikTok zu entreißen, indem sie ByteDance zwang, die App zu verkaufen. Doch indem sie die Fähigkeit einer fremden Regierung, den Diskurs zu verzerren, ins Visier nahm, sprach sie letztlich auch ihrer eigenen Staatsführung diese zersetzende Fähigkeit zu.
Während sich die Regierungen noch um die Kontrolle über TikTok stritten und Investoren einen bevorstehenden Notverkauf erwarteten, übereigneten die Nutzer der App ByteDance weiterhin ihr wertvollstes Gut – ihre Aufmerksamkeit –, und das kostenlos. In 150 Ländern der Welt bauten die Menschen Beziehungen zu der App auf und verbrachten oft mehr Zeit mit ihr als mit ihrer Familie und ihren Freunden. Ob TikTok uns besser kennt als wir uns selbst, sei dahingestellt; fest steht aber: Die App kennt uns besser als so ziemlich jeder andere.
Dieses Buch handelt von einem Tauziehen zwischen den beiden mächtigsten Regierungen der Welt und dem Team von Transaktionstechnologen, das zwischen ihnen eingekeilt ist. Es schildert, wie eine private Internetplattform zu einem Giganten der Soft Power wurde – zu einem Zeitpunkt, als China die USA mit Blick auf ihren globalen kulturellen und wirtschaftlichen Einfluss zu überholen drohte. Es handelt außerdem davon, wie die Verdrängung bewusster menschlicher Entscheidungen ein zunehmend fragiles demokratisches Projekt noch stärker unter Druck setzt. Und nicht zuletzt geht es darum, wie die Führer der Welt versucht haben, sich eine Maschine zunutze zu machen, die die persönlichen Lebensrealitäten von mehr als einer Milliarde Menschen prägen kann.
Es ist unvermeidlich, dass starke Männer um ein Werkzeug, das die Aufmerksamkeit von so vielen Menschen auf sich ziehen und festhalten kann, miteinander kämpfen. Dies ist die Geschichte davon, was geschah, als sie es taten.
AKT I
Kapitel 1 – Information auf der Suche nach Menschen
An einem sonnigen Tag im Mai des Jahres 2019 zogen vier junge Frauen in Jeans und Turnschuhen durch die Straßen des Chicagoer Nobelviertels River North und suchten nach Leuten, die sie zu einer neuen App namens TopBuzz befragen konnten.[1] Diese Frauen waren Mitarbeiterinnen des in Peking ansässigen Techriesen ByteDance, der TopBuzz produziert hatte – was allerdings niemand wissen sollte. Ihr Boss hatte ihnen aufgetragen, sich als Collegestudentinnen auszugeben, die an einem Seminarprojekt arbeiteten.
Die Frauen waren in Chicago, um die amerikanische Gesellschaft kennenzulernen, ja sie regelrecht zu fühlen, damit ihr Arbeitgeber bessere Technologien für sie herstellen konnte. Während die vier also mit dem Ausflugsdampfer über den Lake Michigan schipperten oder für Fotos unter der berühmten Skulptur »Cloud Gate« (alias »The Bean«) posierten, hielt ihr Chef sie dazu an, mit so vielen Amerikanerinnen und Amerikanern wie möglich zu sprechen, um herauszufinden, was diese motiviere, interessiere und umtreibe.
Die App TopBuzz sollte ein Portal für alles im Internet sein.[2] Ein leuchtend gelber Rahmen umgab darin einen personalisierten »endlosen Feed«, zusammengestellt aus den Beiträgen Tausender Websites – von Klatschartikeln über die Reichen und Schönen aus USA Today und der Agence France-Presse (AFP) über Posts von Meme-Sites wie Cheezburger und Bored Panda bis zu Online-Communitys wie GirlsAskGuys und Quora. Zwischen echten Nachrichten, Boulevardthemen und Community-Chats fanden sich auch Posts von Accounts mit Namen wie Buzz Fire and PlayBuzz, die populäre Beiträge aus anderen Internetquellen reposteten – zum Beispiel beliebte Fotos von Instagram und Videos von YouTube.
Maschinenlernmodelle ordneten dabei jeden einzelnen Artikel, Blogpost und sonstigen Inhalt thematisch ein und spielten diesen dann gezielt an diejenigen aus, die zwar nicht unbedingt aktiv nach ihnen gesucht hatten, sie aber anklicken würden, wenn sie sie sahen. TopBuzz griff hingegen auf das Nutzerverhalten selbst zurück, um maßgeschneiderte Feeds zu erstellen. Jede Sekunde, die man in der App verbrachte, war eine Chance – ein Hinweis darauf, was die Aufmerksamkeit des Nutzers noch stärker binden und ihn beim nächsten Mal noch mehr fesseln würde. Und selbst wenn man nichts anklickte, so hatte man vielleicht eine Pause eingelegt, bevor man an einem bestimmten Thema oder Post vorbeiscrollte; möglicherweise zeigte sich auch ein Muster in den letzten Posts, die man betrachtet hatte, bevor man die App schloss.
Bis zum Frühjahr 2019 hatte TopBuzz über 40 Millionen amerikanische User gewinnen können, was in den USA ungefähr 60 Prozent der Twitter-Nutzer entsprach. Weil TopBuzz aber von China aus betrieben wurde, verstanden diejenigen, die für die App arbeiteten, die von ihnen kuratierten Nachrichten oft gar nicht. Mitarbeiter mit limitierten Englischkenntnissen und nur minimalen Bezügen zum amerikanischen Alltagsleben wählten amerikanische Nachrichten aus und veröffentlichten sie erneut – wobei sie sie zuvor durch einen Zensurfilter schickten, denn TopBuzz untersagte kategorisch die Publikation von Artikeln, die der chinesischen Regierung hätten missfallen können.[3]
In manchen Fällen war es den Mitarbeitern aber auch erlaubt, Artikel über die chinesisch-amerikanischen Beziehungen durchzuwinken, wenn – wie es einer unserer in China ansässigen Kollegen beschrieb – ihre Perspektive der KPCh gegenüber unkritisch war.[4] In anderen Fällen waren Nachrichtenbeiträge über China hingegen pauschal untersagt. Eine automatisierte Markierung als »Leader Sensitive« schloss Artikel aus, die zum Beispiel die Proteste in Hongkong im Jahr 2019, den chinesischen Autokraten Xi Jinping und sogar die Kinderbuchfigur Winnie Puuh erwähnten, von der es manchmal hieß, dass sie Xi ähnlich sehe.
Die Kuratoren bei TopBuzz hatten auch die Möglichkeit, bestimmte Artikel oder Videos an der Spitze des User-Feeds »anzuheften« oder »anzupinnen« – ein nützliches Feature für Eilmeldungen. Allerdings gaben einige Angestellte auch an, gelegentlich zum Anpinnen spezifischer Posts genötigt worden zu sein, wobei sie dem Unternehmen gegenüber durch Screenshots belegen mussten, dass sie die Aufgabe erfüllt hatten; so zumindest wurde es mir von ehemaligen Mitarbeitern berichtet. Einer von ihnen erinnerte sich daran, Pandavideos gepostet und touristische Reisen nach China in der App beworben zu haben, und ein anderer gab an, dass Kollegen von ihm ein inszeniertes Video eines Weißen angepinnt hatten, der berichtete, wie glücklich er mit seiner Entscheidung sei, sein Start-up-Unternehmen nach China verlegt zu haben.
An der Spitze des US-Geschäfts von TopBuzz stand ein chinesischer Techveteran in seinen Dreißigern namens Wang Xinyuan. Er war extrovertiert, gut gebaut und sympathisch, liebte das Reisen und hatte ein offenes Lächeln. Er war der Boss, der seine jungen Mitarbeiterinnen dazu angestiftet hatte, sich in Chicago als Studierende auszugeben und das Gespräch mit den Einheimischen zu suchen. Außer um sein in Peking ansässiges Team kümmerte sich Wang auch noch um eine kleine Gruppe amerikanischer Mitarbeiter, die als »Kulturdolmetscher« fungierten, indem sie ihren chinesischen Kollegen dabei halfen, in einem ihnen fremden Land eine Nachrichten-App zu betreiben.
Mit einigen der Praktiken von TopBuzz hatte das Team viel Ärger. So leisteten die Amerikaner Widerstand, als das Unternehmen Nachrichten zensierte (LGBTQ-bezogene Videos wurden häufig blockiert), und sträubten sich auch, als TopBuzz Artikel aus anderen Quellen mit ausgedachten Autorenangaben ohne Genehmigung der eigentlichen Verfasser publizierte. Ein Mitarbeiter sagte, jene ausgedachten Autorennamen »klangen wie die Künstlernamen von Strippern«.
Chinesische Beschäftigte des Unternehmens kritisierten zudem die Zensurpolitik ihrer Firma, wobei sie – anders als die Amerikaner – Konsequenzen für ihre Äußerungen fürchteten. Eine besonders unerschrockene chinesische Mitarbeiterin erklärte Freunden gegenüber, sie glaube, dass die Regierung ihres Landes sie aufgrund ihrer kritischen Aussagen nicht in die USA werde reisen lassen. Und ein anderer ebenso freimütiger chinesischer Kollege erschien eines Tages nicht mehr zur Arbeit, was bei seinen amerikanischen Kollegen die Sorge hervorrief, dass die Regierung ihn möglicherweise habe »verschwinden« lassen.
Als Wang und seine Mitarbeiter sich durch Chicago fragten, wurden sie von einigen seiner amerikanischen Mitarbeiter begleitet, die dem »Kulturdolmetscherprojekt« seines Unternehmens angehörten. Die Gruppe mietete ein paar Leihwagen an und fuhr nach Indianapolis. Auf der Autobahn staunten die Chinesen über die riesigen Werbetafeln am Straßenrand, auf denen es um Christentum und Abtreibung ging. Einer von ihnen fragte einen Kollegen, warum die Regierung es gestatte, dass Obdachlose auf der Straße lebten.[5]
Das US-Team hatte oft Schwierigkeiten damit, seinen chinesischen Kollegen zu vermitteln, was kulturell angebracht war und was nicht.[6] Eine Zeit lang unterhielt das Unternehmen eine interne FAQ-Liste, in der chinesische Mitarbeiter Fragen an amerikanische User richten konnten. Oft betrafen diese solche Themen wie race, Überwachung und Waffengesetze. Die amerikanischen Beschäftigten waren von den Fragen entsetzt, die sie manchmal als rassistisch ansahen. Einer von ihnen erinnert sich daran, die Frage »Warum sind die Schwarzen immer so laut?« gesehen zu haben.
In Indianapolis besuchten Wang und sein Team eine voll besetzte Craftbeer-Kneipe, deren Tische zu einem großen Rechteck angeordnet waren. Wang näherte sich einer Gruppe von Arbeitern an, gab ihnen Getränke aus und versuchte, sich mit ihnen anzufreunden. Als er bei dieser Gruppe saß, beobachteten seine amerikanischen Mitarbeiter alarmiert, dass er anfing, Witze über Asiaten zu reißen und sich selbst als »gelben Mann« zu bezeichnen. Am Ende des Abends hatten seine neuen Freunde offenbar Geschmack an seiner Performance gefunden.
Am folgenden Tag traf sich die TopBuzz-Gruppe in einem älteren Bürogebäude am nördlichen Stadtrand mit einigen leitenden Mitarbeitern ihrer Muttergesellschaft ByteDance. Deren Führungskräfte waren eingeflogen worden, um eine Sitzung bei IndyFocus zu beobachten, einem lokalen Marktforschungsunternehmen, in dem die Firma für einen Tag ein mit Einwegspiegeln versehenes Labor angemietet hatte.
Die Beleuchtung wurde gedimmt. Der Beobachtungsbereich des Labors lag wie ein Kreuz eingebettet zwischen einem kleinen Kinosaal und einem Vortragsraum. Auf der anderen Seite des Spiegels lag ein kleiner, trostloser Konferenzraum, der mit versteckten Kameras gespickt war. Dort führten die Interviewer von IndyFocus Einzelgespräche mit TopBuzz-Nutzern. Die Mitglieder der ByteDance-Gruppe sahen durch die Spiegel hindurch zu, wobei sie an ihrem Perrier-Mineralwasser nippten und Sandwiches aßen. Auf Monitoren waren Nahaufnahmen der Mimik der Befragten und der Bildschirme ihrer Telefone zu sehen. Einer der amerikanischen Kollegen mampfte Popcorn.
Am Ende jedes Interviews kamen die vom Jetlag gezeichneten Beobachter heraus, dankten den Befragten und überreichten ihnen einen Geschenkbeutel mit Merch von TopBuzz. Es gab zwei Arten. Im einen befand sich unter anderem eine blaue Kappe mit weißem Aufdruck und im anderen eine rote Kappe mit weißem Aufdruck, ganz ähnlich der ikonischen MAGA-Kappe des damals (und heute erneut) amtierenden Präsidenten Donald Trump.
Nachdem jeder der Interviewten durchgefiltert worden war, wurde im Beobachtungsbereich einer der Angestellten dazu aufgefordert, deren politische Neigungen einzuschätzen. Auf Grundlage dieser Einordnung erhielten vermeintliche Demokraten blaue und vermeintliche Republikaner rote Kappen – eine technisch überraschend schlichte Schlussfolgerung für ein so technikfokussiertes Unternehmen.
ByteDance legte TopBuzz im Jahr 2020 still und stritt später sogar ab, dass es dessen Angestellte jemals dazu gedrängt habe, seinen Usern prochinesische Videos unterzujubeln. Einige Amerikaner, die für TopBuzz gearbeitet hatten, verspürten am Ende allerdings ein tief sitzendes Unbehagen angesichts ihrer Zeit dort. Im Rückblick konnten sie es selbst kaum glauben: Eine chinesische NachrichtenApp, die in weiten Teilen von Menschen betrieben wurde, die die von ihnen kuratierten Nachrichten nicht einmal verstanden, hatte so viele Nutzer angehäuft, dass ihre Zahl mehr als der Hälfte der US-amerikanischen Twitter-User entsprach. Und diesen Nutzern setzten sie einen personalisierten Newsfeed vor, der aus unpassenden und zensierten Nachrichten bestand.
Am nächsten Morgen flogen Wang und seine Leute nach Hause. In einem Flughafencafé sah er in den Fernsehnachrichten einen Beitrag zum 30. Jahrestag des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens und brachte seinen Unglauben darüber zum Ausdruck. Er konnte einfach nicht fassen, dass Menschen offen darüber sprachen. Ein Kollege fragte ihn, warum ihn das so überrasche, wobei er den Begriff »Tian’anmen-Platz« benutzte.
Sofort wies Wang ihn an, still zu sein. (Der Kollege konnte nicht sagen, ob er vielleicht einen Scherz machte.) »Man weiß nie, wer zuhört«, meinte Wang.
Kapitel 2 – Der moralische Held
Zu der Zeit, als ByteDance seine App TopBuzz auf den Markt brachte, war das Unternehmen in China über zehn Milliarden Dollar schwer. Das Vorzeigeprodukt der Firma war eine NachrichtenApp namens Jinri Toutiao, zu Deutsch »Die Schlagzeilen des Tages«.
Die App ermöglichte eine butterweiche User-Erfahrung und hielt für chinesische Leser einen personalisierten Feed aus Nachrichten- und Unterhaltungsbeiträgen bereit – Jahre bevor Apple News in den USA an den Start ging. Mit Blick auf das Sammeln von Daten verfolgte die App einen maximalistischen Ansatz und wurde von einem kulturell informierten und verständigen Team betrieben. Durch die Besetzung mit einem kulturell kompetenten Mitarbeiterstab war die Macht ihres Algorithmus außerordentlich groß und verwandelte ByteDance bereits innerhalb weniger Jahre nach der Markteinführung der Software zu einem Techgiganten.
Toutiao war die Erfindung von Zhang Yiming, dem Gründer und CEO von ByteDance. Er war ein Technikoptimist, der von der Idee besessen war, Technologien zu entwickeln, die uns besser kennen würden als wir uns selbst. Yiming (wie er genannt zu werden bevorzugte) war ein schmächtiger, introvertierter Brillenträger. Manche seiner Kollegen charakterisierten ihn zwar als unterkühlt, doch fast alle stimmten darin überein, dass er bescheiden und vernünftig war und das Meisterstück vollbracht hatte, ein Unternehmen auf der Basis von Daten, Mathematik und Rationalität zu errichten.
Yiming wuchs als Einzelkind in einigermaßen privilegierten Verhältnissen auf. Seine Eltern waren im öffentlichen Dienst tätig und gehörten der oberen Mittelschicht an. Sein Vater arbeitete für die kommunale Kommission für Wissenschaft und Technik, bevor er einen beruflichen Wandel vollzog und eine Fabrik für elektronische Geräte eröffnete. In der Oberstufe entwickelte Yiming eine tiefe Liebe zu den Naturwissenschaften und zu Computern und besuchte anschließend die Nankai-Universität, eine angesehene öffentliche Forschungsuniversität in der chinesischen Region Tianjin, die mit staatlichen US-Eliteuniversitäten vergleichbar ist.
Yiming war zutiefst rationalistisch eingestellt.[7] Sein menschliches Dasein betrachtete er als eine Abfolge von Inputs und versuchte, die von diesen produzierten Outputs bestmöglich zu optimieren. An der Hochschule trat er keinem Studentenclub bei und fand sein Studium zumeist wichtiger als Freundschaften, Dating und all die anderen Eskapaden, die das studentische Leben auszeichnen. Er unterwarf sich einer extremen Selbstdisziplin und nahm fast immer Abstand davon, Filme anzusehen und Karten oder Videospiele mit seinen Kommilitonen zu spielen.[8] Dabei war er stolz auf seine Abstinenz – so sehr, dass er sich dafür selbst einen Spitznamen gab: »der moralische Held«.
Yiming heiratete seine Freundin, die er auf dem Nankai-Campus kennengelernt hatte, als er ihr anbot, ihren Computer zu reparieren. Seine Noten waren gut, aber nicht außergewöhnlich, und er besaß einen gemeinhin eher flachen Affekt: Nur selten war er erkennbar erregt, zeigte sich aber fast nie wütend oder aggressiv. In den raren Momenten, in denen er Werke der Populärkultur konsumierte, tat er dies von der Warte eines Gehirnforschers aus; dem chinesischsprachigen Blog 老郭种树 zufolge sah er einmal mit einigen Familienangehörigen einen Film aus der Twilight-Reihe, nur um ihn später auf Social Media auseinanderzunehmen und seine psychologischen Auswirkungen auf die Zuschauer zu analysieren.[9] »Die psychologischen Bedürfnisse der Nutzer zu befriedigen ist User Experience«, wie er dem Vernehmen nach einmal postete.
Yiming war nun der Überzeugung, dass seine individuellen psychologischen Bedürfnisse sich von denen der meisten anderen Menschen unterschieden. »Eine kleine Gruppe elitärer Personen strebt nach Effizienz und praktiziert Selbsterkenntnis, und diese Gruppe lebt in der Wirklichkeit«, wie er dem Magazin Caijing gegenüber zu Protokoll gab.[10] Die meisten Menschen würden in seinen Augen allerdings mehr oder weniger stark dem Laster anheimfallen, ob nun dem Alkohol, dem Glücksspiel oder irgendeiner anderen Versuchung. Er nahm also nicht an, dass andere diesen Verlockungen ebenso aus dem Weg gehen würden wie er selbst – tatsächlich bezeichnete er sein Vorzeigeprodukt Jinri Toutiao später selbst als eine Art Versuchung.
Für einen Menschen, der sich aufgrund seiner Enthaltsamkeit selbst als moralischen Helden bezeichnete, war Yiming ungewöhnlich stark an den Mechanismen von Verführung und Genuss interessiert. Als er versuchte, die Kunst des Belohnungsaufschubs in seinem Leben zu kultivieren, begann er damit, der Frage nachzugehen, wie Apps von ihren Interaktionen mit Menschen lernen könnten, um letztlich die gleiche Art von Belohnungszentrum zu simulieren, das er zu kontrollieren suchte. Als er David Kirkpatricks Buch The Facebook Effect aus dem Jahr 2010 las, eine bewundernde Erzählung darüber, wie Facebook Gemeinschaften auf der ganzen Welt miteinander verband, sagte er, es lese sich wie eine Auflistung der Eigenschaften von Dopamin.[11]
Nach der Hochschule war Yiming als Entwickler in verschiedenen Techunternehmen tätig. Eines davon war Microsoft, wo er bald feststellte, dass es ihm nicht gefiel, sich wie ein kleines Rädchen in einem großen Firmengetriebe zu fühlen. Nach Microsoft wechselte er zu Fanfou, dem ersten chinesischen Twitter-Konkurrenten, und lernte dort die Arbeit an Social-Media-Produkten kennen. Dies sagte ihm schon eher zu; er liebte das Tempo, die Spannung und das Nutzerengagement in Echtzeit auf der Microblogging-Plattform. Im Jahr 2009 jedoch war seine Zeit dort schlagartig zu Ende.
In jenem Sommer kam es in Ürümqi, einer Stadt in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang, zu ethnisch motivierten Unruhen. Fabrikarbeitern aus der muslimischen Volksgruppe der Uiguren wurde vorgeworfen, gegenüber einigen han-chinesischen (das heißt der ethnisch dominanten Gruppe des Landes angehörigen) Kolleginnen sexualisierte Gewalt ausgeübt zu haben. Proteste gegen die Anschuldigungen schlugen in eine Reihe von Aufständen um, bei denen fast 200 Menschen ums Leben kamen und die von der Regierung am Ende brutal niedergeschlagen wurden.
Zu jener Zeit galten Social-Media-Apps noch als weithin liberale Einrichtungen. In einer ganzen Reihe von Aufständen überall im Nahen und Mittleren Osten hatten Twitter und Facebook regierungskritischen Demonstranten geholfen, demokratische politische Bewegungen zu dokumentieren und öffentlich bekannt zu machen. Aus Furcht davor, durch die eigenen Apps auf vergleichbare Weise unter Rechtfertigungsdruck zu geraten, unternahm die chinesische Regierung einen beispiellosen Schritt: Sie blockierte den Internetzugang in der gesamten Provinz Xinjiang und schloss landesweit Plattformen, auf denen sich Bürger über die Aufstände austauschten.[12]
Die Regierung kündigte eine Reihe von Sperrungen und Abschaltungen auf Facebook, YouTube und Twitter sowie auf einem ganzen Haufen ähnlicher chinesischer Plattformen an, darunter auch Fanfou. Dies war eines der ersten Male – und bei Weitem nicht das letzte Mal –, dass sich Yiming von der Unterdrückung der freien Rede seitens des chinesischen Staates frustriert zeigte. In einem mittlerweile gelöschten Blogpost äußerte er seine Solidarität mit Google, einer weiteren Zielscheibe der Niederschlagung des Aufstands. »Geht raus und tragt T-Shirts mit Slogans, die Google unterstützen«, schrieb er. »Wenn ihr das Internet blockiert, werde ich das, was ich zu sagen habe, eben auf meine Klamotten schreiben.«[13]
Als Fanfou im Jahr 2009 schloss, ging Yiming ein kalkuliertes Risiko ein und gründete im Alter von 26 Jahren gemeinsam mit seinem Unimitbewohner Liang Rubo sein erstes Start-up-Unternehmen. Sein Produkt war eine Immobiliensuchmaschine namens Jiujiufang, »99 Zimmer«, die behauptete, den Kauf eines Hauses mittels der neuen Telefone ganz erheblich zu vereinfachen. Smartphones standen damals in China noch ganz am Anfang. Yiming erkannte allerdings, dass sie unsere Beziehung zu Computern verändern würden. Anders als viele seiner Konkurrenten war Jiujiufang nach einem Designprinzip gestaltet, das sich »vertical search« nannte – vertikal, weil die Anwendung für die aufrechte Ausrichtung von Mobiltelefonen optimiert war statt für die horizontale Ausrichtung von Computermonitoren.
Jiujiufang wurde ein Erfolg. Bis zum Jahr 2011 hatte die Seite pro Monat mehr als sechs Millionen aktive User.[14] Nach nur drei Jahren war Yiming allerdings schon bereit, das Suchmaschinengeschäft hinter sich zu lassen. Suchen war ineffizient. Es erforderte die volle Aufmerksamkeit der Nutzer; Menschen sind nun aber einmal intrinsisch faul. Das ideale System würde ihnen daher die Informationen liefern, die sie wollten, ohne dass sie danach fragen müssten.
Yiming glaubte, dass die Techbranche einen Wandel durchmache, und zwar »von Menschen auf der Suche nach Informationen« hin zu »Informationen auf der Suche nach Menschen«.[15] Daher machten er, Rubo und ein paar weitere Entwickler von Jiujiufang sich daran, ein neues Projekt namens ByteDance ins Leben zu rufen, das sich darum drehen sollte, Apps zu konstruieren, die voraussagten, was man gerne sehen würde, und die es einem präsentieren, ohne dass man sie dazu auffordern müsste.
Ihre erste App war fast schon unangenehm simpel gestrickt.[16] Sie trug den Namen »Hilarious goofy pics«, also etwa »Lustige Quatschbilder«, und spielte den Usern einen Strom von, nun ja, lustigen Quatschbildern vor. Ähnlich schlichte Kreationen aus dem Hause ByteDance trugen Bezeichnungen wie »Inspirational quotes« (»Inspirierende Zitate«), »I’m a foodie« (»Ich bin ein Foodie«, für Bilder von Speisen) oder »Real Beauties – Every day 100 beautiful girls« (»Echte Schönheiten – jeden Tag 100 hübsche Mädchen«). Unter diesen Apps aus den Anfangstagen des Unternehmens war die erfolgreichste eine Comedy-App namens »Neihan Duanzi« (»Angedeutete Witze«), die einen endlosen Strom lustiger Memes lud. Die User konnten diese Memes mit einem Daumen hoch oder runter bewerten, und je nach Bewertung entschied sich dann, welcher Post ihnen als Nächstes angezeigt wurde. Je mehr Stimmen ein Nutzer abgab, desto besser war die App in der Lage, auf seine Art von Humor zu schließen.
Auf Basis derselben Theorie begann das Team außerdem damit, einen Algorithmus so zu trainieren, dass er vorhersagen konnte, welche Nachrichtenartikel die User am liebsten lesen wollten – jenen Algorithmus, der später auch das Herzstück von Jinri Toutiao (»Die Schlagzeilen des Tages«), des ersten eigentlichen Erfolgsprodukts von ByteDance, bilden sollte.
Im Vergleich mit der durch Useranfragen gesteuerten Suchmaschine »99 Zimmer« war der prognostische Aspekt für Yiming das Wesentliche an diesem Projekt. Seiner Meinung nach konnten Algorithmen Dinge für die Menschen besser identifizieren als sie selbst, sodass Vorschläge und Empfehlungen letztlich die Suche als primäre Art und Weise unserer Informationsgewinnung und -aufnahme ablösen würden. Mit dieser Idee war Yiming seiner Zeit voraus; später sollte sie alle möglichen Apps – von Facebook über Baidu bis hin zu Spotify – befeuern und sogar die Form der Darreichung von Informationen seitens der großen Zeitungen beeinflussen. (Heute zeigt selbst die New York Times auf ihrer Homepage personalisierte Nachrichten an.)
Toutiao fing an, jene Daten zu sammeln, durch die Empfehlungsengines angetrieben werden, nämlich Hinweise – so viele wie möglich – auf die Gewohnheiten, Netzwerke und Präferenzen der User, und zwar sowohl explizit angegebene als auch implizite. Im Jahr 2013 umfassten diese Signale die Surfgewohnheiten und Kommentare der Nutzer, die Zeiten, die sie mit der Lektüre bestimmter Artikel verbrachten, und die Artikel, die sie an andere weiterleiteten.[17] Die Plattform ermöglichte zudem eine Integration mit Weibo, einer chinesischen Social-Media-Plattform im Stile von Twitter (heute X). Die Einwilligung der User vorausgesetzt, bekam Toutiao Zugriff auf alle ihre Posts, Kommentare, Likes und andere Daten von Weibo – eine reichhaltige Datenquelle, besonders im Hinblick auf neue Toutiao-Nutzer, die dem Algorithmus noch keine weitergehenden bedeutsamen Informationen über ihre Interessen mitgeteilt hatten.
Toutiao war ein fast sofortiger Erfolg. Ende 2013, als Yiming gerade 30 Jahre alt geworden war, hatte die App schon über 60 Millionen Nutzer aggregiert. In ihrer Frühphase hatte sie den Ruf gehabt, Trash-News zu verbreiten. Die Leute kamen zwar immer wieder, doch wonach es sie verlangte, waren der neueste Klatsch und Tratsch sowie kitschige Fotos anstelle ernsthafter, journalistisch aufbereiteter Nachrichten. Für Yiming war dies allerdings kein Grund zur Sorge. »Die User brauchen ein gewisses Maß an Vergnügen«, wie er in einem Interview sagte, »ob es sich dabei um Religion, Romane, Liebe oder eben um Jinri Toutiao handelt. […] Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob man Texas Hold’em spielt oder Rotwein trinkt und dabei Boulevardberichte und Videos schaut.«[18]
Es dürfte keine allzu große Überraschung sein, dass die Kommunistische Partei Chinas nicht gerade eine Anhängerin von Yimings Traum von einem vollautomatischen, personalisierten Nachrichtenkurator war – wobei es nicht der Klatsch und Tratsch war, der ihr am meisten Sorgen bereitete. In China übte die Regierung eine engmaschige Kontrolle über die Medien aus und verlangte von ihnen, bestimmte Narrative zu stärken und andere zu unterdrücken. Wenn ein Algorithmus aber dazu dienen sollte, den Menschen Nachrichten zu präsentieren, wie sollte ByteDance dann sicherstellen, dass es »die nationale Einheit« hinreichend förderte oder genügend Regierungspropaganda verbreitete?
Yiming vertrat die Ansicht, dass das Fehlen menschlicher Redakteure etwas Gutes sei. »Hätte Toutiao einen Chefredakteur, dann würde er unweigerlich Inhalte nach seinem Gusto auswählen; wir hingegen wählen eben gerade nicht aus«, sagte er gegenüber Caijing.[19] Er räumte zwar ein, dass ein gewisses Maß an menschlichem Mittun immer nötig sein werde, wenn es um Apps gehe, auf denen jedermann posten könne. »Gesetzes- und Regelverstöße erfordern ein Eingreifen Dritter«, wie er sagte, »aber wir mischen uns nicht in die Präferenzen unserer Nutzer oder in die Vielfalt des Contents ein, die von der Gesellschaft und vom Gesetz toleriert werden.«
Ganz grundsätzlich war Yiming der Auffassung, dass sich die Leute eigentlich nur selbst im Wege standen. Das wesentliche Produkt von ByteDance – sein Algorithmus – war im Grunde nur eine Prognosemaschine: Er nahm Unmengen von Daten darüber auf, wie sich eine Person in der Vergangenheit verhalten hatte, und verwendete sie für Vorhersagen darüber, wie sie sich zukünftig verhalten würde. Und Yiming glaubte, dass dieser Algorithmus es besser bewerkstelligen würde, den Leuten die Nachrichten auszuspielen, die sie wirklich interessierten, als es irgendein Mensch vermocht hätte.
Die Geschichte von ByteDance ist in weiten Teilen die seines Algorithmus – desselben, den Yiming zuerst für Toutiao geschrieben hatte und der am Ende auch die Basis für Dutzende weitere ByteDance-Apps bildete. Anfang der 2010er-Jahre trat ByteDance seinen Siegeszug an der Seite von Unternehmen wie YouTube, Facebook und Twitter an, um die moderne Empfehlungsmaschinerie zu definieren. Was Yiming hingegen einzigartig machen sollte, war sein Beharren darauf, dass sein Code nicht nur dazu dienen könne, chinesische Konsumenten besser kennenzulernen, als sie sich selbst kannten, sondern dass er diese prognostische Kraft auch für jedes andere Land und jede andere Kultur überall auf der Welt entfalten könne.
Im Jahr 2014 nahm Yiming an einer Gruppenreise für chinesische Techgründer ins Silicon Valley teil, die vom chinesischen Start-up-Inkubator GeekPark organisiert wurde.[20] Die Gruppe besuchte die Techcampus von Google, Facebook, Yahoo, Tesla und anderer bekannter amerikanischer Start-ups und nahm an Podiumsdiskussionen und Fragerunden mit einigen der prominentesten Technologen der Welt teil. In einem Blogbeitrag über die Reise schrieb Yiming in bewunderndem Tonfall über den Anbruch eines neuen Zeitalters des Teilens, in dem das Internet es den Menschen erlaubte, alles vom Haus (Airbnb) über das Auto (Uber) bis hin zum Design (Pinterest) und ihren Ideen (Twitter) gemeinschaftlich zu nutzen.
»Manche Leute mögen behaupten, sie seien nicht dazu bereit, ihr Eigentum mit anderen zu teilen, ebenso wenig wie ihre privaten Daten – doch dies sind nur die Ansichten von heute«, wie er schrieb. »Wir stehen immer noch am Anfang jener Ära des Teilens. Mit der Zeit werden sich immer mehr Menschen beteiligen, was zu einem Umbau der Wirtschaft und gesellschaftlicher Ressourcen sowie zu einem beschleunigten Zusammenbruch traditioneller Grenzlinien führen wird. Technik und Internet haben keine Grenzen.«[21]
In Wirklichkeit hatten sie solche Grenzen sehr wohl – oder würden sie zumindest sehr bald erhalten. Und obwohl er es noch nicht wusste, würde Yiming die kommenden zehn Jahre seines Lebens damit verbringen, sie zu finden, zu verschieben, zu überschreiten und die Welt dazu zu zwingen, sie zu definieren.
Kapitel 3 – »Sehr ähnlich, wie einen Staat zu lenken«
Im Oktober 2016 versammelte sich ein gediegenes Publikum im schicken Veranstaltungsort The Pearl im angesagten Dogpatch-Viertel von San Francisco zur jährlichen #ProductSF-Konferenz der Risikokapitalgesellschaft Greylock Partners.[22] Auf dem Programm standen zahlreiche obskure, jargonlastige Podiumsdiskussionen zu Themen wie »The Journey of the Pivot« (»Die Reise des Dreh- und Angelpunkts«) und »Secrets Every PM Should Know« (»Geheimnisse, die jeder Produktmanager kennen sollte«). Eine dieser Diskussionen fiel allerdings besonders aus dem Rahmen, da sie sich weniger auf Produkte als vielmehr auf eine Vision von der Zukunft fokussierte, in der Plattformen wie Länder funktionieren und miteinander konkurrieren, um die mächtigsten Unternehmen und Institutionen der Welt an ihre Gestade zu locken. Der Referent war ein chinesischer Hippie in Jeans und Turnschuhen, der ein langärmeliges T-Shirt und einen Schal trug – was inmitten eines Ozeans von streng zugeknöpften Hemden und Businessjargon irgendwie ganz charmant wirkte.
Alex Zhu war 37 Jahre alt, hatte ein kantiges Kinn und glänzend dunkles Haar, das er bis über die Schultern trug. Er war schlank, nahezu hager, sprach mit sanfter Stimme und hatte ein so vollständig glatt rasiertes Gesicht, dass darin auch nicht die geringste Spur von Bartwuchs zu sehen war. Sein Start-up Musical.ly war den Zuhörern praktisch unbekannt, sofern sie keine Kinder zwischen 8 und 16 Jahren hatten. Denn Musical.ly war eine App, die es den Nutzern ermöglichte, sich selbst dabei aufzunehmen, wie sie zur Musik lippensynchron mitsangen und tanzten. Für ältere Teenager war sie hingegen uninteressant, ja sogar »cringe«. Wenn man Auto fahren oder Bier kaufen durfte, war man der App entwachsen. Nur wenige Leute über 25 Jahre hatten überhaupt jemals von ihr gehört. Für junge amerikanische Teens und Tweens war sie allerdings der Mittelpunkt der Welt.
Im Herbst 2016 verzeichnete Musical.ly etwa 50 Millionen monatliche User, viele davon unter 13 Jahre alt. Einer Schätzung zufolge waren fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in den USA auf der App, was gelegentlich zu einer eigenartigen Medienberichterstattung führte – zum Beispiel dazu, dass eine Nachrichtensprecherin von ABC ein Video im Fernsehen zeigte, das von ihrer neunjährigen Tochter gedreht worden war, oder dazu, dass ein lokaler Sender aus Denver eine dritte Klasse interviewte.[23] Und ein Artikel aus der New York Times stellte die Frage: »Wer ist zu jung für eine App?«[24]
Gary Vaynerchuk, Unternehmer und Internetpersönlichkeit, erklärte Musical.ly »ohne Frage zum jüngsten sozialen Netzwerk, das wir je gesehen haben«.[25] Auch schon zuvor hatten auf die Jugend zugeschnittene Apps wie Instagram und Facebook Nutzer im Kindesalter umworben, vermarkteten ihre Software allerdings zumeist an Erwachsene und ältere Teenager.
Musical.ly hatte zwar Büros in Los Angeles, doch Alex und sein Team betrieben das Unternehmen primär von seinem Hauptsitz in Shanghai aus. Um zu gewährleisten, dass es die Bedürfnisse ihrer User – Teens und Tweens auf der halben Welt – verstand, hielt das Team über die chinesische Messenger-App WeChat laufenden Kontakt zu Gruppen aus den der App am treuesten ergebenen Anhängern. Das Team von Musical.ly hostete täglich Threads auf WeChat mit »Musern«, wie die Nutzer der App genannt wurden, und bat diese um Feedback zu seinem Produkt und Vorschlägen für neue Funktionen. Manchmal chattete man aber auch einfach nur über nichts Bestimmtes miteinander. Gelegentlich dienten diese Gespräche also »lediglich zum Reden, um zu verstehen, was die Leute dachten, zum Witzereißen und dazu, sich tief in die amerikanische Teenagerkultur einzufühlen«, wie Alex erklärte.
Auf der Bühne der Greylock-Partners-Konferenz fragte ihn der Risikokapitalgeber Josh Elman, wie er die Idee finde, eine Nutzercommunity aufzubauen – gerade angesichts der Tatsache, dass Wettbewerber wie Instagram und Snapchat versuchten, die jungen Stars der App abzuwerben. Alex’ Antwort lautete, dass er nicht bloß eine App konstruiere, sondern eine ganz neue Gesellschaft errichte – mit eigener Regierung, eigenen Gesetzen und Anreizen. »So wie ich die Sache sehe, ist der Aufbau einer Gemeinschaft sehr ähnlich wie die Lenkung eines Staats, einer Volkswirtschaft«, sagte er.
Alex’ Meinung nach betrat Musical.ly völliges Neuland, das nur darauf wartete, besiedelt zu werden. Er verglich die Plattform mit den kolonialen Vereinigten Staaten und seine Konkurrenten – Facebook, Instagram und YouTube – mit europäischen Ländern. »Die Wirtschaft Europas ist bereits sehr stark entwickelt, und in deinem Land hast du keine Einwohner, nicht wahr, da passiert dann nicht so viel«, so die Analogie, die er Elman gegenüber ins Feld führte. »Da gibt es keine Ökonomie. Wie kann man also die Leute ins Land locken?«
Alex beantwortete seine eigene Frage wie folgt: Die Leute gehen in Kolonien, weil sie dort Chancen wittern, Aufstiegsmöglichkeiten, den American Dream. Und dieser Traum – oder zumindest seine Illusion – war etwas, was er konstruieren konnte. Zu Elman sagte er, dass diese neue Kolonie »einen Großteil des Reichtums […] an einen kleinen Prozentsatz der Menschen« verteilen werde, »damit diese dann reich werden« – und damit alle anderen sähen, wie sie reich würden.
Diese wenigen Glücklichen würden »Vorbilder für andere werden, die in [einem metaphorischen] Europa leben«, so Alex weiter, was auch sie dazu inspirieren würde, in jenes neue Musical.ly-Land zu kommen. »Man muss normalen Menschen die Chance geben und dafür sorgen, dass sie Befriedigung finden können. Man muss sicherstellen, dass sie eine aufstrebende Mittelklasse sind.«
Elman fragte Alex, welche Rolle sein Chinesischsein in der Entwicklung von Musical.ly gespielt habe. »Wenn es um Planwirtschaft und eher kapitalistische Volkswirtschaften geht, dann haben Sie diesen wirklich einzigartigen Blickwinkel dadurch, dass Sie in China leben«, so Elman. Und er fragte, wie Zhus chinesisches Team in der Lage sei, die Wünsche und Sehnsüchte von Teenagern in den USA so genau nachzuvollziehen.
Alex entgegnete, dass viele Chinesen den US-Diskurs sehr genau mitverfolgten. »Zahlreiche meiner Landsleute kennen die amerikanische Kultur sehr gut. Wenn man heute in China auf die sozialen Medien geht, dann reden da zum Beispiel viele Leute über die Präsidentschaftswahlen, die Debatten.«
»Wirklich?«, fragte Elman.
»Ja, die Leute reden mehr über die amerikanischen Präsidentschaftsdebatten als über die chinesische, denn« – an dieser Stelle verriet Alex’ Stimme eine gewisse Nervosität – »es gibt keine.«
Elman und das Publikum lachten verlegen.
Alex’ Vortrag war überzeugend – so überzeugend, dass sein Charisma Verhaltensweisen normal wirken ließ, die bei einem anderen Referenten möglicherweise für Skepsis gesorgt hätten. Gegen Ende des Gesprächs gab Alex in der Fragerunde eine etwas unverhohlenere Antwort auf die Frage, wie er sich ein so genaues Bild von der jugendlichen US-amerikanischen Nutzerschaft von Musical.ly machen konnte: Er habe sich selbst als Teenager ausgegeben, einige seiner »Altersgenossen« gefragt, was sie von der App hielten, und versucht, ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Posts die Menschen auch erreichten.
»Ich persönlich bin auf eine Menge von Fake-Accounts gestoßen und habe meine Fake-Identität dazu benutzt, mit Usern auf der Plattform zu sprechen, ihre Videos zu kommentieren und herauszufinden, warum sie diese Videos posten. Ich wollte einfach nur versuchen, zu verstehen und Empathie zu entwickeln.«
Alex Zhu wurde um das Jahr 1979 im chinesischen Anhui geboren, vier Jahre vor ByteDance-Gründer Zhang Yiming. Wie dieser besuchte auch Zhu eine Elitehochschule – die Zhejiang-Universität –; im Gegensatz zu jenem »moralischen Helden« hegte Alex allerdings eine Leidenschaft für die Künste: Er liebte Design, Musik und andere Formen des kreativen Ausdrucks.
In den Zwanzigern reiste Alex viel. Er erkundete und fotografierte Destinationen von Italien und den Niederlanden über Tahoe und Yosemite bis hin zu den Wüsten der Inneren Mongolei. Anders als Yiming rauchte und trank er gerne und schien alles auskosten zu wollen, was das Leben zu bieten hatte. Er trug seine Haare lang – manchmal fast bis zur Hüfte – und weite, künstlerhaft anmutende Kleidung. »Er sieht absolut wie ein Dichter aus«, erklärte Elman später gegenüber Bloomberg. »Wie ein antiker chinesischer Maler, der am Ufer eines Flusses sitzt und eine dieser riesigen Rollenmalereien anfertigt.«[26]
Elman wusste wahrscheinlich nicht, dass Alex tatsächlich ein Schriftsteller war und das Internet schon seit Unitagen als persönliche Leinwand für seinen kreativen Output genutzt hatte. Im Jahr 2002 hatte er die Domain www.keepsilence.com registriert, eine Website, die ihm in den Zwanzigern als persönlicher Blog dienen sollte.[27] Dort empfahl er seinen Lesern Musik – von Rock- und Folksongs bis hin zu klassischen und buddhistischen Kompositionen. Zudem stellte er dort die Werke von Schriftstellern online, die er mochte, vor allem die des Dichters Haizi, und postete auch eigene literarische Produktionen – manchmal Prosa, meist aber Lyrik.
In den Zwanzigern schrieb Alex über klassische Topoi wie Liebe und Tod, Sucht und Religion. »Wenn mein zerbrechliches Leben im Augenblick seines Beginns von achtlosen Pferdehufen in den Dreck getrampelt worden wäre, dann hätte meine ewig ungebundene Seele ihren letzten Duft in einer sanften Brise verstreut. Einer Sache bin ich aber gewiss: Der Herr des Himmels wird seinem letzten Kind auf Erden Gnade erweisen. Er erlaubte mir, im Stillen zu erblühen, zu singen und sogar mich zu widersetzen.«[28]
Er widmete sich auch abstrakteren Themen. So trug eines seiner Gedichte den Titel »Über das Jahrhundert und das Vaterland«.[29]
Mit zunehmendem Alter reifte auch seine Schriftstellerei heran. Auf der Domain blogHi fing er mit Ende 20 an, mehr über Psychologie und die Informationsverarbeitung des menschlichen Gehirns zu schreiben.[30] (Dieser Blog war, anders als der ursprüngliche auf keepsilence.com, in englischer Sprache verfasst.) In einem Eintrag aus dem Jahr 2005 erkundete er die kognitionswissenschaftlichen Grundlagen des menschlichen Gedächtnisses und in einem anderen – einem Kommentar zu einer im Salon veröffentlichten Kurzgeschichte – schrieb er: »Sei stets neugierig auf unsere wundersame Welt. Alles, was uns umgibt, birgt gewaltiges Wissen, aber wir ignorieren es einfach.«[31]
Diese Passage offenbart eine weitere Parallele zwischen Alex und Yiming: Beide waren davon besessen, durch die Beobachtung der Menschen in ihrem Umfeld zu lernen – etwas, was Alex in den USA fast ein ganzes Jahrzehnt lang bewusst tun sollte, bevor er Musical.ly an den Start brachte.
In den Jahren 2004 bis 2007 und erneut von 2011 bis 2015 hatte Alex einen spaßigen Job in einem langweiligen Unternehmen: Beim deutschen Softwarekonzern SAP, der Lösungen für den Businessbereich wie etwa Plattformen zur Organisation von Lieferketten und zur Ausgabenkontrolle entwickelte, war er zuerst »Solution Manager«, anschließend »User-Experience-« oder »UX-Designer« und am Ende der amtierende »Futurist« der Firma. Seine Aufgabe bestand darin, neue Features zu ersinnen, die SAP konstruieren könnte, und die Anwendung der Tools des Konzerns für die Endkunden leichter verständlich zu machen – sodass sie intuitiv wissen würden, was jede Taste, jede Funktion und jedes Produkt taten und warum sie diese nutzen wollten. Und als Gegengewicht zum eintönigen Alltag der üblichen Konzernlaufbahn legte er sich zudem einen Twitteraccount mit dem Handle @bullshitting zu.
SAP erlaubte Alex, seiner Kreativität und seinem künstlerischen Talent freien Lauf zu lassen. Doch am Ende war der Job einfach zu konzernmäßig, als dass er Alex an das Unternehmen hätte binden können. In The Pearl sagte er Elman, das Unternehmen sei schlicht »nicht sexy genug« gewesen. Er wollte lieber etwas für normale Menschen aufsetzen statt für Firmen.
»Ich will ein sexy Mann sein«, scherzte er.
Somit verließ Alex im Jahr 2013 den SAP-Konzern, um sich mit einem Freund namens Louis (Luyu) Yang zusammenzutun. Diese beiden künftigen Gründer hatten mehrere Jahre zuvor gleichzeitig als Produktmanager bei einem Shanghaier Versicherungsunternehmen namens eBaoTech gearbeitet. Anfangs träumten sie davon, eine Bildungsplattform mit dem Namen Cicada aufzusetzen, wo Nutzer kurze Videos hochladen, mit denen sie anderen etwas beibringen – wie man einen Seemannsknoten bindet, eine Tulpenzwiebel behandelt oder ein Lied auf der Gitarre spielt. Doch diese Idee scheiterte. So wie Alex es darstellte, war die Einstiegshürde schlicht zu hoch. Denn die Ersteller der Inhalte mussten relativ viel Zeit und Mühen aufbringen, um solche Lehrvideos zu produzieren, und die Zuschauer mussten ihnen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit widmen.
Alex und Yang analysierten das Scheitern von Cicada und fragten sich, was sie hätten anders machen können. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass die App friktionslos sein müsste: »Wenn man eine neue UGC-Plattform [UCG: user-generated content, »nutzergenerierte Inhalte«] oder ein neues soziales Netzwerk aufbauen möchte, dann müssen die Inhalte extrem leicht sein, was bedeutet, dass ihre Erstellung und ihr Konsum innerhalb von Sekunden statt Minuten oder Stunden erfolgen können müssen«, wie Alex sagte.
Im Jahr 2014 legten er und Yang Musical.ly auf, wobei sie die App gleich am Anfang parallel in China und in den USA ausrollten. Bei den jungen Chinesen kam sie nicht so gut an, während sie auf der anderen Seite des Pazifiks regelrecht explodierte. Später bekundete Alex gegenüber dem Economist, dass dies an der zusätzlichen Freizeit gelegen habe, über die amerikanische Teenager im Vergleich zu ihren chinesischen Altersgenossen verfügten, und da jene oft mehr Freiheiten dazu gehabt hätten, einfach nur zum Spaß Videos zu drehen.[32]
Musical.ly war eine der ersten Apps für Jugendliche, die das Leben vor dem Internet nicht mehr kennengelernt hatten. Facebook, Instagram und YouTube hatten den Millennial-Teenagern eine spannende neue Zutat zu ihrem existierenden, offline geführten sozialen Leben angeboten. Die User von Musical.ly waren hingegen echte Digital Natives; Telefone, Computer und Tablets gab es für sie schon immer und wurden von ihnen ebenso für Lernzwecke wie zur Unterhaltung und zum Vergnügen genutzt. Und natürlich halfen ihnen ihre Geräte auch dabei, sich voneinander abzugrenzen. Sie waren das entscheidende Mittel, um Freundschaften zu schließen, und definierten erstmals den Stil, die Kultur und das kollektive Bewusstsein einer ganzen Gruppe.
Heute verweist die Gen Z auf ihre Identität als Digital Natives, indem sie sich auf eine Beobachtung bezieht, die sie als »Millennial-Pause« bezeichnet. Wenn Menschen, die in den 1980er- oder frühen 1990er-Jahren geboren wurden, Videos aufnehmen, dann stehen am Anfang oft eine oder zwei Sekunden Stille. Der Creator sucht in dieser Zeit nämlich möglicherweise nach der Bestätigung dafür, dass sein Telefon tatsächlich aufnimmt – oder nimmt sich einfach einen Augenblick Zeit, um sich zu sammeln. Das Video ist schließlich eine öffentliche Performance, die Veröffentlichung einer mit bestimmten Absichten erstellten Bild- und Tonaufnahme.
Die Gen Z fühlt die Performance hingegen nicht. Für sie gibt es keine Grenze zwischen physischer und digitaler Präsenz, sondern nur Präsenz schlechthin, von der fast jede Facette sowohl auf die Online- als auch auf die physische Welt verteilt ist. Friktionslos ein Video aufzunehmen und zu posten, heißt einfach zu existieren.
Lange bevor Alex Musical.ly startete, dachte er darüber nach, wie eine neue Ära des digitalen Teilens das soziale Leben der Menschen verändern würde. Im Januar 2012 veröffentlichte er auf einem neuen Blog namens The Passion of Sisyphus eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Social Network, Big Data«, die aus der Sicht eines Internetanthropologen erzählt wird und 200 Jahre in der Zukunft spielt.
Der Anthropologe untersucht die von ihm so genannte »erste Welle von Nutzern sozialer Netzwerke« und beschreibt, wie er seine Forschung »ausschließlich« innerhalb der Letzteren durchführt. Er spricht von den Folgen, die der Tod von Menschen für die Social-Media-Unternehmen hat, und denkt über das Beharrungsvermögen nach, das das Internet den Verstorbenen verleiht, deren »Lebensweisen und Gedanken« zu »digitalen Fossilien« werden, »die die vergangenen Zeiten verzeichnen«.[33]
Die Figur des Anthropologen beschreibt ihre Arbeit als »Mikrohistorie« und berichtet davon, wie sie die Social-Media-Profile der Toten genau analysiert. Dabei sucht sie nach Hinweisen in Selfies und anderen Posts – nach allem also, was ein Fenster zum individuellen Verständnis der Welt und zur ebenso individuellen Reaktion auf sie aufstoßen könnte. »Dann nutze ich Werkzeuge zur Mustererkennung, um ihre oder seine Kontakte zu analysieren […] und die Herausbildung, Intensität und das letztendliche Abkühlen jeder zwischenmenschlichen Beziehung zu beobachten.«
Alex’ Schilderung des modernen digitalen Lebens – rückblickend aus der Zukunft – ist verspielt und empathisch. So sagt sein anthropologischer Protagonist über die frühen Social-Media-User: »Ihr Wissenssystem war überraschend simpel, und dennoch behielten sie ein leidenschaftliches Interesse an allen gesellschaftlichen Ereignissen zu allen Zeiten bei und brachten stets ihre Meinung zum Ausdruck. Ihre Technologie war primitiv, was gerade der Grund dafür ist, dass wir sie um den fast idyllischen Lebensstil jener Zeit beneiden.«
Alex’ Blogpost war zwar fantasiereich, thematisch aber das übliche 08/15-Science-Fiction-Material. Das Ausmaß, in dem unsere Welt sich dem von ihm Geschilderten innerhalb von nur zwölf Jahren angeähnelt hat, deutet jedoch darauf hin, dass es von realem Wert war. Seine Erzählung hat eine nostalgische Note, betrauert »die schönen Landschaften, die lebendigen Städte und die vielen Pflanzen- und Tiergattungen, die ausgerottet wurden«, und behauptet, dass »die Menschen jener Zeit glücklich waren, weil sie so ahnungslos waren«. Die Erzählung besitzt aber auch eine dystopische Dimension. So waren in dieser futuristischen Welt des Jahres 2012 »die Gedanken und die Privatsphäre der Menschen […] vollständig in [einem] Rechenzentrum auf dem Mond gespeichert«, von wo aus sie »von ihren Nachfahren gründlich untersucht« wurden. Und der vielleicht finsterste Teil war die Beschreibung des Erzählers, wie das Leben in 200 Jahren aussehen wird, wenn wir alle in »Nährstofftanks« leben und »Informationswesen« genannt werden.
Kapitel 4 – Drei Möglichkeiten, Geld im Internet zu verdienen
Wie Alex Zhu behauptet, kam ihm die Idee zu Musical.ly im Jahr 2014, als er mit dem Caltrain von den SAP-Büros im Silicon Valley zu seiner Wohnung in San Francisco fuhr. Unterwegs beobachtete er eine Gruppe Teenager, von denen einige Musik hörten, während andere spontane Foto- und Videoschnappschüsse für Social Media anfertigten, und dachte: Warum nicht beides miteinander kombinieren?
Alex war jedoch nicht der einzige Unternehmer, der diese Idee hatte. Die führende und tonangebende Plattform für Kurzvideos von und für Teenager war damals Vine. Diese war im Besitz von Twitter und erlaubte es den Nutzern nur, Videos von höchstens sechs Sekunden Länge zu erstellen. Aufgrund dieses äußerst engen Zeitrahmens, in dem es gelingen musste, Inhalte zu vermitteln, bestanden die Videos auf Vine vornehmlich aus Stunts und anderen grellen oder absurden Handlungen, die die Aufmerksamkeit der Zuschauerschaft sofort in Beschlag nahmen.
Bald schon drängten mehrere andere Start-ups auf den Markt, um Vine Konkurrenz zu machen. Diese spezialisierten sich auf ein besonderes Genre, das damals unter Kindern und Jugendlichen beliebt war, nämlich lippensynchrones Mitsingen und Tanzen zu populärer Musik. Einer dieser Mitbewerber war Flipagram, eine Diashow-App, auf der die User Foto- und Videocollagen erstellen und mit Popsongs unterlegen konnten. Ein anderer war Dubsmash, eine App, mit der man lippensynchron zu Audioclips mitsingen und seine eigene Gesangsspur über Videoclips legen konnte.
Anfangs zeigte Flipagram – mit dem ByteDance sich in den USA später erstmals in das Segment der Kurzvideos vorwagen sollte – ein gewaltiges Potenzial. Die App konnte Stars wie Britney Spears und Macklemore als Pioniere vorweisen, und Anfang 2014 investierte der renommierte Sequoia-Capital-Partner Michael Moritz zusammen mit den bedeutenden Risikokapitalgebern Kleiner Perkins und Index Ventures 70 Millionen Dollar in die Diashow-App. »Das Ding kam uns wie ein Monster vor«, sagte John Doerr von Kleiner Perkins. »Wie etwas in der Größenordnung von Instagram.«[34]
Doch Doerrs Prognose bewahrheitete sich nicht. Denn Flipagram war kein Ersatz für Instagram, sondern lediglich eine Ergänzung. Die App war ein Werkzeug, mit dem man schicke Videos produzieren konnte, aber kein Ort, an den man ging, um sie sich anzusehen. Die Teenager nutzten sie, um technisch perfekte und fesselnde »Storys« vorzubereiten, die sie dann aber auf Instagram oder Snapchat posteten. Für Flipagram war dies zwar kostenlose Werbung (da die Diashows ein sichtbares Wasserzeichen hatten), es kam damit allerdings seinen eigenen Ambitionen in die Quere. Denn hier wurde weder Neuland im Sinne von Alex Zhu erobert noch eine neue Gesellschaft gegründet; vielmehr war die App einfach nur ein Werkzeug, das den Leuten dabei half, sich in ihren bereits existierenden Ländern und Gesellschaften etwas reibungsloser zurechtzufinden.
Flipagram war von Farhad Mohit gegründet worden, einem Absolventen der Wharton School of Business und Serienunternehmer, der gerade eine Reihe gescheiterter Projekte hinter sich gebracht hatte. Mohit war älter als Alex und eher auf die geschäftliche Seite der sozialen Medien fokussiert. Von Haus aus gelernter Programmierer, betrachtete er sich selbst als eine Art Hybrid aus Softwareingenieur und Unternehmer. Einem lokalen Techblog gegenüber sagte er im Jahr 1999: »Ich […] sah mich als den idealen Kandidaten dafür an, diese Kluft zwischen Technikfreaks und Anzugträgern zu überbrücken.«[35]
Lange bevor er überhaupt an Flipagram dachte, hatte Mohit bereits ein Vermögen im Silicon Valley gemacht. Mitte der 1990er-Jahre hatten er und ein Kommilitone Bizrate ins Leben gerufen, eine Website, auf der Kunden die von ihnen beauftragten Anbieter bewerten konnten, sowie Shopzilla, eine damit verbundene Anwendung zum Vergleichen von Preisen und Produkten. Im Jahr 2005 verkauften sie beide Websites für 525 Millionen Dollar an die E. W. Scripps Company. Mohit war für den Rest seines Lebens reich – zwei Jahre später kaufte er eine 14 000 Quadratmeter große Villa in Bel Air, die heute einen Wert von 38 Millionen Dollar hat. Aber Mohit war noch immer erst in den Dreißigern und total besessen von der Leidenschaft, Unternehmen aus dem Nichts heraus aufzubauen. Also probierte er mehrere andere Ideen aus. Da gab es Gripe, einen Ansatz, um Verbraucherbeschwerden über Unternehmen in soziale Netzwerke zu integrieren, und Cheers, das, wie er es ausdrückte, »der ›Gefällt mir‹-Button für die Welt um einen herum« war. Zuvor gab es schon DotSpots, eine Plattform, die »normalen Menschen, oder wie wir es nennen, der ›Weisheit der Massen‹«, ermöglichte, nutzergenerierte Inhalte an journalistische Beiträge anzuhängen. Mohit räumte allerdings später auf LinkedIn ein: »Das hat nicht so geklappt wie geplant.«[36] Als Bearbeitungswerkzeug war Flipagram also ein Erfolg. Millionen von Menschen, vor allem Teenager, nutzten es, um ihre Snapchat- und Instagram-Storys cooler zu gestalten. Mohit wollte aber, dass die Leute Flipagram anstelle von Instagram benutzten – weil dort das große Geld wartete.
In einem Wharton-Podcast aus dem Jahr 2009, in dem es um DotSpots ging, legte Mohit dar, was damals auf dem Spiel stand: »Es gibt nur drei Möglichkeiten, Geld im Internet zu verdienen. Nummer eins ist der Verkauf von Abos. Wir verkaufen keine Abos. Nummer zwei ist der Verkauf von Software. Wir verkaufen keine Software. Nummer drei ist der Verkauf von Werbung in irgendeiner Form. Heute verkaufen wir keine Werbung. Und wissen Sie, warum? Wir haben niemanden, der das verdammte System nutzt. Und wenn wir nie irgendwen bekommen, der es nutzt, dann ist es für mich sinnlos, hier zu sitzen und Ihnen zu erklären, wie wir Geld damit verdienen.«[37]
Was für DotSpots galt, galt ebenso für Flipagram. Mohit hätte die Nutzung von dessen Diensten kostenpflichtig gestalten können, indem er einfach für jede vom User erstellte Slideshow Geld verlangte oder etwa einen monatlichen Abobeitrag in Rechnung stellte. (Letztlich hat er tatsächlich etwas Ähnliches ausprobiert und die Nutzer mit 1,99 Dollar zur Kasse gebeten, wenn sie das Flipagram-Wasserzeichen aus ihren Slideshows entfernen wollten.) Das wirklich große Geld steckte im Silicon Valley der frühen 2010er-Jahre allerdings in der Werbung, was bedeutete, dass Mohit mit dem Ziel, allgegenwärtig zu sein, nach Aufmerksamkeit strebte. Fortan erzählte er, dass sich Flipagram von einem Tool zu einem Netzwerk weiterentwickelt habe, und das Unternehmen versuchte verzweifelt, Creator anzulocken und bei der Stange zu halten, die exklusiv für die App Videos und Slideshows erstellen sollten. Wenn sie nicht auf Instagram unterwegs waren, verbrachten die Flipagram-User hingegen immer mehr Zeit auf einer anderen App, nämlich Alex Zhus Musical.ly.
Im August 2015 gab Musical.ly