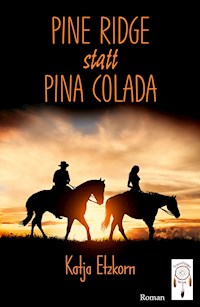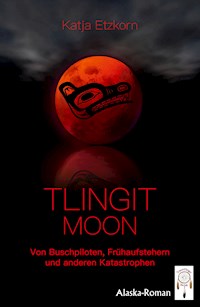
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Josephine, genannt Joe, stammt aus New York und reist für ihre Forschungsarbeit als Hydrologin an die Südost- Küste Alaskas. Die Landschaft und die unberührte Natur der Inside Passage überwältigen sie. Inmitten von Fjorden, Gletschern und dicht bewaldeten Bergen beginnt sie mit ihrer Arbeit. Meer und Wetter sind rau, und die Wildnis ist unbarmherzig. Doch Josephine bekommt Hilfe von Gooch, einem einheimischen Buschpiloten, der zum Stamm der dort beheimateten Tlingit gehört. Zunächst läuft alles problemlos, doch dann muss Joe feststellen, dass jemand ihre Forschungsarbeit sabotiert. Wasserproben weisen verdächtige Werte auf, Messergebnisse verschwinden und ihr Computer wird gehackt. Gemeinsam mit Gooch versucht Joe den Ereignissen auf den Grund zu gehen. Ein Katz- und Mausspiel beginnt, das zunehmend gefährlicher wird. Ein packender Öko-Krimi - mit viel Fachwissen erzählt, verbunden mit einer interkulturellen Liebesgeschichte in atemberaubender Kulisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TLINGIT MOON
RomanvonKatja Etzkorn
Impressum
TLINGIT MOON, Katja Etzkorn
eBook Ausgabe Mai 2021
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2020
Datenkonvertierung: Bookwire
eBook ISBN 978-3-948878-01-6
Lektorat: Michael Krämer
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Titelbild: „Mond“ von Adobe Stock; „Wolf“ von Katja Etzkorn
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG,
Hohenthann
Printed in Germany
Inhalt
Vorwort
Die große, weite Welt
Kleider machen Leute
Alaska
Eiszeit
Braunbär Smoothie
Die Eule
Verschwörungstheorien
Von Bären und Menschen
Wölfe unter sich
Chaos und Kommoden
Träume und Siege
Wie der Rabe die Sonne stahl
Xunaa Shuká Hit
Männergrippe
Mondsüchtig
Der große Krieger
Café crema
Lichtblicke
Erleuchtung
Die Schwestern
Frühlingserwachen
Home sweet Home
New York, New York
Der Wolf und sein Mond
Danksagung
THE WOLVES
I threw myself to the wolves,only to learn of the tenderness in their howl,and the loyalty in their blood.
– Isra Al-Tibeh –
Vorwort
Liebe Leser,
die Tlingit verwenden in ihrer Sprache achtundvierzig Buchstaben, von denen rund die Hälfte für europäische Zungen nur sehr schwer auszusprechen sind. Dieser Umstand macht es unmöglich, die Worte zu schreiben, wie man sie spricht. Daher entsprechen alle Wörter, Sätze und Redewendungen in diesem Buch der korrekten Schreibweise, geben aber nicht den Klang der Sprache wieder. Nur so viel sei gesagt: Das häufig verwendete X wird gesprochen wie das „CH“ in den Worten „Ich“ oder „Buch“.
Der Name der Hauptfigur Gooch wird „Guutsch“ ausgesprochen.
Die große, weite Welt
Es war zwei Uhr nachmittags. Gooch saß auf dem Pilotensitz seiner de Havilland Beaver, ging die Checkliste durch und ließ sich die aktuellen Wetterdaten durchgeben. Neben und hinter ihm saß eine Familie, die bei ihm einen Rundflug über die Insel und die Glacier Bay gebucht hatte.
Wolkenfetzen hingen hartnäckig in den Zedern und Tannen, die an den Hängen von Hoonah wuchsen, und es nieselte leicht. Nicht unbedingt das beste Wetter für einen Rundflug, aber wenn er tief genug fliegen würde, kämen die Gäste trotzdem auf ihre Kosten. Gutes Wetter war selbst während der Sommermonate Mangelware in Alaska. Die Südost-Küste war eines der regenreichsten Gebiete der USA. Wer hier Urlaub machte, hatte besser eine Regenjacke im Gepäck.
Die Maschine rollte auf die Startbahn, beschleunigte und hob ab. Die Landschaft unter ihnen wurde kleiner, und erst jetzt, oberhalb der waldreichen Hänge des White Alice Mountain, hatte man einen atemberaubenden Ausblick. Bis zum Gletscherfeld reichte die Sichtweite allerdings nicht.
Hoonah war ein Fischerdorf im Norden von Chichagof Island, die Huna Tlingit lebten schon seit Jahrhunderten in dieser Region. Ursprünglich hieß der Ort Gaawt‘ak.aan, was so viel bedeutete wie ‚Dorf an der Klippe‘. Später änderte man den Namen in Xu.naa, ausgesprochen Hoonah – ‚Wo der Nordwind nicht weht‘. Die Insel lag in der Inside Passage an der Südost-Küste Alaskas. Hier lebten hauptsächlich Alaskas Ureinwohne: Tlingit und auch Haida, die weiter aus dem Süden stammten. Etwa fünfzig Kilometer westlich auf dem Festland klebte Juneau, die Hauptstadt Alaskas, an den Felswänden der Coast Mountains. Die einzige Hauptstadt, die nicht per Auto erreichbar war. Wollte man hierher, ging das nur per Schiff oder Flugzeug. Gleiches galt, wenn man weg wollte.
Das war der einzige Grund, warum Gooch immer noch auf der Insel lebte. Als Teenager hatte er immer davon geträumt, diesen isolierten Flecken am Ende der Welt zu verlassen, aber ohne Geld war das unmöglich. Sich an eine Straße stellen und trampen, führte buchstäblich in eine Sackgasse. Willkommen in Alaska!
Seinen Traum, Pilot großer Verkehrsmaschinen zu werden und die Welt kennenzulernen, hatte er schon früh begraben müssen. Diese Ausbildung kostete ein Vermögen. Seine Mutter hatte ihn allein großgezogen und kam damals gerade so über die Runden. Stattdessen hatte er auf dem kleinen Flughafen in Hoonah gejobbt und sich das Geld für Flugstunden mit einmotorigen Maschinen verdient. Inzwischen war er siebenundzwanzig und besaß seine eigene de Havilland Beaver amphibian mit Schwimmern und ausfahrbarem Fahrwerk, was eine Landung auf dem Wasser und auf dem Land ermöglichte – in Alaska einfach unerlässlich. Das Innere einer großen Verkehrsmaschine hatte er noch nie zu sehen bekommen, aber es wurmte ihn nicht mehr, denn die große, weite Welt kam mittlerweile zu ihm. Die ganze Sommersaison hindurch legten große Kreuzfahrtschiffe aus Seattle und Vancouver am Icy Strait Point an und brachten Touristen und damit Geld auf die Insel. Sie brachten auch noch etwas anderes – Goochs bevorzugte Jagdbeute: junge Frauen.
Nein, er war kein Serienkiller – nur ein Schürzenjäger. Gooch bedeutete in der Sprache seines Volkes, der Tlingit, Wolf und dieser Name passte ausgesprochen gut zu ihm: immer auf der Jagd. Er war ein Alphamännchen wie aus dem Bilderbuch – eitel und sehr von sich überzeugt. Um seine Beute möglichst schnell zu ködern, legte er viel Wert auf sein Äußeres. Er stemmte in jeder freien Minute Gewichte, trug einen gepflegten Zwei-Tage-Bart, hatte seine Arme vom Handgelenk bis zur Schulter mit Tattoos verzieren lassen, und sein langes, schwarzes Haar verlieh ihm den eisgekühlten exotischen Touch. Mutter Natur hatte es in dieser Hinsicht mehr als gut mit ihm gemeint. Neben dem ebenmäßigen Gesicht mit den hohen, kantigen Wangenknochen und den leicht schrägstehenden schwarzen Augen hatte sie ihm auch Charisma mit auf den Weg gegeben.
Gewöhnlich reichte das völlig, um Gooch die Mädchenherzen zufliegen zu lassen. Falls es mal nicht reichte, half er mit Charme und Witz etwas nach, aber letztendlich bekam er immer, was er wollte. Der Vorteil seiner Jagdstrategie war, dass die jungen Damen nicht anfangen konnten zu klammern, denn für gewöhnlich legten die Schiffe nach zwei Tagen wieder ab. Der Nachteil dabei war, dass er nur im Sommer auf seine Kosten kam. Im Winter herrschte Saure-Gurken-Zeit: keine Schiffe – keine Mädchen. Trotzdem kam eine feste Beziehung für Gooch nicht in Frage. Zu stressig, fand er. Vor einiger Zeit hatte er es mal versucht, doch es scheiterte an den alltäglichen Nichtigkeiten.
Fliegen konnte er dagegen das ganze Jahr hindurch. Er bot nicht nur Rundflüge für Touristen an, sondern arbeitete in erster Linie für eine Forschungsstation im Glacier Bay National Park and Preserve. Die Station war ganzjährig besetzt, um unter anderem auch die Klimaerwärmung und ihre Folgen zu erforschen. Den Job hatte er seinem Cousin zu verdanken, der die Ranger Station des Parks leitete und auch für die Koordination der wissenschaftlichen Exkursionen der Forscher verantwortlich war. Der Job sicherte Gooch ganzjährig ein regelmäßiges Einkommen, und in der freien Zeit verdiente er sich mit den Touristen noch ein fettes Zubrot. Genau genommen ließ die Klimaerwärmung seine Kasse klingeln. Die Touristen kamen, um die Gletscher in der Glacier Bay kalben zu sehen, und die Forscher versuchten die Ursachen und Auswirkungen näher zu ergründen. Traurig, aber wahr. Gooch versorgte die Station mit Vorräten, Equipment und neuen Doktoranden, die meist für ein paar Wochen bis zu einem Jahr auf der Station blieben. Er begleitete auch die einzelnen Gruppen in die Wildnis zur Feldforschung und zu Messungen auf dem Gletscherfeld und in der Bucht – sicherheitshalber mit dem Gewehr im Anschlag, denn hier gab es mehr Bären als Menschen.
Gooch schwenkte nach links ab, vorbei an der Glacier Bay mit Blick auf das riesige Brady-Gletscherfeld, das sich durch die Fairweather Range schob.
Nach dem Rundflug setzte er die kleine Touristengruppe wieder am Schiff ab und aß im Restaurant seiner Mutter zu Abend. Goochs Mutter, Leah McKenzie, war eine sehr resolute Frau. Sein Erzeuger hatte sich damals, angesichts der zu erwartenden Vaterfreuden, schleunigst aus dem Staub gemacht und nie wieder gemeldet. Unterhalt hatte er erst recht nicht gezahlt.
Sie war ganz auf sich allein gestellt gewesen, und hatte sich und ihren Sohn mit schlecht bezahlten Jobs über Wasser gehalten. Harte Arbeit war sie gewöhnt. Gooch hatte ihr schon als Kind, so gut es eben ging geholfen, und Leah war stolz auf ihn. Nur die Tatsache, dass er so gar keine Anstalten machte, sich fest zu binden und eine Familie zu gründen, sondern eher nach seinem Vater kam, erfüllte sie mit Besorgnis. Die Eröffnung des Icy Strait Point, des privaten Kreuzfahrthafens, bot ihr die Chance auf ein besseres Leben. Der Hafen war das Zentrum einer ehemaligen Lachskonservenfabrik, die jahrzehntelang stillgelegt, schließlich von der Huna-Totem-Corporation gekauft und saniert worden war. Nach dem Umbau bot sie nun Platz für verschiedene Geschäfte mit Kunst und Kunsthandwerk, ein Museum, Souvenirläden und Boutiquen sowie ein Restaurant. Leah hatte die Gunst der Stunde genutzt, einen Kredit aufgenommen und das Restaurant eröffnet.
Seitdem ging es aufwärts. Die Kreuzfahrtschiffe brachten unablässig neue Kundschaft, und auch viele Gäste der örtlichen Hotels sorgten für Umsatz. Sie hatte drei Angestellte – alles junge Frauen, die ein ähnliches Schicksal zu bewältigen hatten wie sie selbst damals.
Hoonah hatte viel zu bieten. Die höchste und längste Zip Line der USA, Schulen von Buckel- und Schwertwalen zogen in der Icy Strait und im Port Frederick direkt an der Stadt vorbei und lockten zahlreiche Beobachter ans Wasser. Die diversen Wasserwege, die die Insel durchzogen, boten Kajakfahrern einen abenteuerlichen Trip durch die Wildnis.
Goochs Büro war neben dem Restaurant untergebracht, und so stolperten die Gäste automatisch über sein Dienstleistungsangebot. Nach dem Essen sah er noch die Termine für den nächsten Tag durch, wünschte seiner Mutter eine gute Nacht und fuhr nach Hause. Mit Hilfe einiger Freunde hatte er sich etwas abseits von Hoonah ein Blockhaus gebaut, umgeben von Wald, mit Blick aufs Meer und in der Nähe des kleinen Flughafens. So entging er dem touristischen Trubel in der Hauptsaison und hatte seine Ruhe. Außerdem war es weit genug vom Haus seiner Mutter entfernt. Er liebte sie, keine Frage, aber er schätzte auch seine Privatsphäre. Dafür nahm er gern in Kauf, dass sein Haus nicht an die örtliche Wasserversorgung angeschlossen war. Stattdessen hatte er ein kleines Bassin in den Fels geschlagen und einen Bach umgeleitet, der nun stetig plätschernd das Bassin mit Frischwasser füllte und anschließend über einen Überlauf wieder ins sein ursprüngliches Bett floss. Das reichte für seine Bedürfnisse, ebenso wie das Plumpsklo unweit des Hauses.
Gooch parkte vor dem Haus, stieg aus seinem Auto und wurde von einem riesigen Giant Alaskan Malamute freudig begrüßt. Diese Rasse war um einiges größer als die normalen Malamutes und konnte schon mal hundertfünfzig Pfund auf die Waage bringen. Allerdings war er nicht ganz reinrassig, was seine hellblauen Augen verrieten. Der Hund sprang an ihm hoch und war nun fast so groß wie sein Herrchen. Was ist riesengroß, schwarz-weiß, frisst Fische und schwimmt im Meer? Genau, ein Orca! Und eben deswegen hieß der Hund Keet. Das Tlingitwort für Orca. Seine Vorliebe fürs Schwimmen hatte der Hund schon als Welpe gezeigt, und wenn er schon mal dabei war, konnte er auch Fische fangen. Er fraß zwar auch Hundefutter, aber nur, wenn nichts anderes da war. In Alaska fütterte man Hunde ohnehin meist mit Fisch. Gooch klopfte seinem vierbeinigen Freund den dichten Pelz und ging mit ihm ins Haus. „Wie ich sehe, hast du schon gefressen“, stellte er fest, als sein Blick auf ein paar fischige Überreste auf der Veranda fiel. Keet wedelte freudig mit dem Schwanz, um sich noch einen Leckerbissen zu erbetteln, schließlich war man als Hund nie satt. Gooch öffnete den Kühlschrank, nahm ein Stück Käse für Keet und ein Bier für sich heraus und setzte sich auf die Veranda. Mit dem Hund an seiner Seite genoss er sein Bier und den Blick auf das Meer.
Auf der anderen Seite des Kontinents hielt Joe beim Kofferpacken inne und blickte ebenfalls aufs Meer – in diesem Falle auf den Atlantik, der vor dem Anwesen ihrer Familie an den Strand von Long Island brandete. Hier draußen in den Hamptons bekam man von dem hektischen Treiben im rund zweihundert Kilometer entfernten New York nichts mit. Die Stadt, die niemals schlief, war zwar ausgesprochen attraktiv für Geschäftsleute und alle Anderen, die ihr Glück dort versuchen wollten, aber wer es sich leisten konnte, flüchtete an den Wochenenden und in den heißen Sommermonaten aus der Millionenstadt. In den Hamptons lebte die High Society. Die Immobilienpreise waren astronomisch hoch, und deswegen blieb man unter sich. Für viele wäre Joes Leben ein Traum gewesen – für sie war es eher ein Alptraum, und das reichlich protzige Anwesen ihrer Eltern war ein goldener Käfig, dem sie nun entfliehen wollte.
Offiziell hieß sie Josephine Marie – nicht nur, weil ihr Großvater Joseph hieß, sondern auch, weil ihre Mutter eine glühende Verehrerin Napoleons war. Joe hasste diesen Namen und ließ sich von ihren Freunden nur mit der männlichen Kurzform ansprechen. Wer den Fehler machte, sie Josie zu nennen, bereute das sofort und nachhaltig. Sie bezeichnete sich gern selbst als das schwarze Schaf der Familie – der einzige Punkt, in dem sie sich mit ihrer Mutter einig war.
„Sie ist völlig aus der Art geschlagen!“, beklagte sich Jeanne Cunningham gerne bei ihrem Mann, wenn er den Fehler gemacht hatte, sich am Wochenende in den Hamptons einzufinden. Wenn ihm das Gezeter seiner Frau zu viel wurde, flüchtete er in die Wildnis – sprich: auf den Golfplatz – den sein holdes Weib niemals betreten würde, weil es dort keine befestigten Wege über den Rasen gab.
Jeanne kultivierte ihre Langeweile mit Cocktailpartys, Kunstausstellungen und sogenannten Charity-Veranstaltungen, deren Erlös allerdings eher Museen zugute kamen, als Einrichtungen für wirklich Bedürftige zu unterstützen. Die einzige Leistung ihres Lebens hatte darin bestanden, standesgemäß zu heiraten und zwei Kinder in die Welt zu setzen. Die Aufzucht dieser ehelichen Notwendigkeiten hatte sie aber lieber Nannys und später Eliteinternaten überlassen. Die hatten ganze Arbeit geleistet. Joes Bruder – nein, er hieß nicht Napoleon, sondern Nathaniel, was Joe genauso fürchterlich fand – war dem Vorbild seines Vaters gefolgt und Jurist geworden. Gemeinsam waren sie nun damit beschäftigt, die schmutzigen, fetten Hälse solventer Klienten aus Justitias Schlinge zu ziehen, was sie sich teuer bezahlen ließen. In Joes Augen war diese Art des Erwerbs eine Form von Prostitution, denn sie boten ihre Dienste dem Höchstbietenden an – ganz egal, wie unlauter dessen Absichten auch waren. Wer nicht mindestens siebenstellig verdiente, stand auch nicht in der Klienten-Kartei der Kanzlei Cunningham & Son.
Joe war sechs Jahre jünger als ihr Bruder, hatte ihr Studium an der Columbia-Universität abgeschlossen und die letzten zwei Jahre damit verbracht, am theoretischen Teil ihrer Dissertation zu arbeiten. Doch anders als Nathaniel war sie nicht der Familientradition gefolgt und Rechtsverdreher geworden, sondern hatte Hydrologie und Geoökologie studiert und wollte nun auf dem Gebiet der Gewässerökologie promovieren. Speziell die Ökosysteme, die unter dem direkten Einfluss der Gletscherschmelze standen, interessierten sie. Von jeher hatte sie die Natur geliebt und jedes kranke oder verwahrloste Geschöpf mit nach Hause geschleppt und wieder aufgepäppelt – sehr zum Leidwesen ihrer hysterischen Mutter. Einen besonders giftigen kleinen Kläffer hatte Joe behalten. Sie nannte ihn Bonaparte, wegen seiner geringen Größe und seines völlig übersteigerten Egos. Er war nicht stubenrein und erledigte sein Geschäft am liebsten im großen Salon, in dem ein Gemälde seines Namensvetters über dem Kamin hing.
Joe hielt ihn für einen Kunstkenner, Jeanne sah das anders. „Schaff diese Bestie aus dem Haus! Er ruiniert mir den Teppich!“, hatte sie von ihrer Tochter gefordert.
Doch Joe ignorierte das Gezeter. Sie demonstrierte gegen Tierversuche, Umweltverschmutzung und Ölkonzerne. Sie hatte in einer Nacht- und Nebel-Aktion auch schon Versuchstiere aus einem Labor für Kosmetikprodukte befreit und es sich nun zum Ziel gesetzt, gegen den Klimawandel und seine Ursachen zu kämpfen. Aus der Sicht ihrer Mutter eine gesellschaftliche Boykotterklärung, aus der Sicht ihres Vater nur eine Laune, die irgendwann schon wieder vergehen würde. Ihr Bruder hielt sich, wie üblich, aus dieser Diskussion heraus. Nichtsdestotrotz hatte Jeanne keinen Versuch unterlassen, ihre Tochter gesellschaftlich zu etablieren. Mit anderen Worten: Sie wollte Joe möglichst standesgemäß verkuppeln. Ihrer Meinung nach brauchte eine Frau keinen Beruf, sondern einen gutsituierten Ehemann. Die Batterien an arroganten Lackaffen mit prall gefüllter Brieftasche und leerem Kopf, die Jeanne aufgefahren hatte, hätten jede Elite-Partner-Vermittlung vor Neid erblassen lassen.
Doch Joe hatte mit ihrer spitzen Zunge alle Kandidaten an die Wand fahren lassen. Sie wollte keinen dieser Lackaffen, und die testosterontriefenden Halbaffen der Sportfakultät hatte sie ebenfalls gründlich satt. Sie suchte nach einem Exemplar, das neben einem Kopf und Muskeln vor allem über ein Rückgrat verfügte. Einen, der mit beiden Beinen auf dem Boden stand, wusste, was er wollte, den Mut hatte, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Kurz: einen richtigen Mann. Aber bisher war ihr noch nichts Passendes begegnet; offensichtlich waren diese Exemplare sehr spärlich gesät. Deswegen hatte sie die Suche danach vorläufig auf Eis gelegt und wollte sich erst mal mit Feuereifer um die Feldforschung für ihre Dissertation kümmern.
Sie hatte laut gejubelt, als sie Post von der UAS, der University of Alaska Southeast, erhielt, die ihre Bewerbung um eine Doktorandenstelle angenommen hatten. Endlich konnte sie dem goldenen Käfig entfliehen und auf eigenen Beinen stehen. Euphorisch wie sie war, fühlte sie sich wie Supergirl, bereit, die Welt zu retten. Strahlend verkündete sie am Wochenende beim Dinner die Neuigkeiten, doch dank ihrer Familie landete sie ziemlich schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen.
Jeanne wurde hysterisch. „Josephine! Du bringst mich noch frühzeitig ins Grab!“, lautete ihr Vorwurf. „Wie kannst du nur ernsthaft in Erwägung ziehen, nach Alaska zu gehen! Dort ist es absolut unzivilisiert! Nur Bären, Ungeziefer und Wilde!“ Genaugenommen machte sie sich eher Sorgen darum, was die Hamptoner Gesellschaft davon halten würde. Alaska bedeutete bestenfalls einen Karriereknick, schlimmstenfalls den Abstieg in die Gosse. Jeanne grübelte fieberhaft darüber nach, wie sie diese Katastrophe ihrem Bekanntenkreis verkaufen konnte, ohne dass jemand die frisch operierte Nase rümpfte.
„Wilde was?“, fragte Joe provokativ, weil sie davon ausging, dass ihre Mutter nur ein anderes Tier nicht näher benennen konnte. Schließlich lief so etwas in den Hamptons nicht herum.
„Indianer! Was sonst!“, antwortete Jeanne abfällig. Ausnahmsweise war Joe für einen Moment sprachlos vor Empörung. Das Kastensystem ihrer Mutter war um ein Vielfaches ausgeprägter als das eines Hindus. Offenbar hielt sie sich für einen Brahmanen und Ureinwohner für Unberührbare. Bevor Joe explodieren konnte, äußerte auch ihr Vater Richard seine Bedenken, allerdings deutlich pragmatischer als seine Frau. „Denk noch mal darüber nach, Joe. Wenn du als Columbia-Absolventin an einer staatlichen Universität promovierst, mindert das deine spätere Reputation! Kannst du das nicht auch hier machen?“
Es war wie üblich: Alle dachten nur darüber nach, was andere davon halten würden – statt sich für sie zu freuen.
Joe rang um Fassung und versuchte ihre Enttäuschung zu verbergen. „Ich weiß nicht, Dad, vielleicht kaufst du mir ja einen hübschen Gletscher und lässt ihn hierher liefern. Dann musst du aber für eine Weile auf Golf verzichten, bis das Ding wieder abgetaut ist. Wenn es euch so peinlich ist, erzählt euren Freunden doch, ich sei mit einem Flugzeug abgestürzt! Ihr müsst euch dann nicht für mich schämen, und ich kann friedlich mit Bären und Wilden in einer Höhle hausen. Da wird wenigstens der scheiß Teppich nicht dreckig!“, schrie Joe mit überschlagender Stimme.
Tränen schossen in ihre Augen, und sie rannte hoch in ihr Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Dann ließ sie sich auf ihr Bett fallen und heulte in die Kissen. Immer das Gleiche – nie ein Lob, nie ein bisschen Anerkennung, geschweige denn eine Umarmung. Sie hatte so schwer geschuftet und ihren Master mit magna cum laude gemacht. Außer Nathaniel hatte das niemand zur Kenntnis genommen. Alle taten immer so, als würde sie nur bunte Briefmarken sammeln.
Wenig später klopfte es an der Tür, und Nathaniel kam herein.
„Geht‘s wieder?“, fragte er mitleidig und schloss leise die Tür.
Joe schniefte und wischte sich die Augen trocken. Ihr Bruder setzte sich zu ihr aufs Bett und nahm sie in den Arm.
„Hey, Kleine! Mach dir nichts draus. Sie haben noch nie begriffen, worum es geht.“
Joe nickte und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. „Wie hältst du das aus und kannst dabei so ruhig bleiben?“
„Ich ignoriere das Geschwafel, ziehe meinen Kram durch und erzähle ihnen nichts davon. Hat schon immer funktioniert“, meinte er.
„Hätte ich wohl besser auch getan. Aber jetzt ist es auch egal. Ich fliege übermorgen nach Juneau und werde nicht zurückkommen. Mir reicht es“, stellte sie traurig fest.
Nathaniel drückte sie zuversichtlich an sich und lächelte. „Du schaffst das schon. Ich bin stolz auf dich, Joe. Ich fahre dich zum Flughafen, und wenn mir mal der Kragen platzt, besuche ich dich bei den wilden Bären.“
Joe lachte leise, als sich ihr Bruder auf diese Weise über ihre Mutter lustig machte.
„Und wenn du was brauchst, rufst du mich an“, fügte er noch hinzu.
Sie umarmte ihn dankbar, bevor er ihr Zimmer verließ, und begann danach ihren Koffer zu packen.
Es war eine warme Sommernacht; sie blickte hinaus aufs Meer und beschloss, ein letztes Mal schwimmen zu gehen. Im Wasser war Joe in ihrem Element. Sie liebte es, zu schwimmen und zu tauchen, hatte sogar in den Semesterferien einen Kurs für Rettungsschwimmer absolviert und ehrenamtlich als Strandwache gejobbt. Alle anderen Sportarten ließen Joe kalt. Sie hatte sich nie dazu überreden lassen, mit ihren Kommilitonen durch den Central Park zu joggen wie eine Herde gehetzter Antilopen. Beim Schwimmen war sie allein und genoss es, wenn ihr die salzige Gischt ins Gesicht spritzte. Im Mondlicht sagte sie dem Atlantik Adieu und freute sich auf den Nordpazifik.
Kleider machen Leute
Früh am Morgen warf Gooch die Pumpe an, die Wasser aus dem Felsbassin in den Boiler im Badezimmer beförderte, setzte Kaffee auf und zog seine Laufschuhe an. Die Eroberung des vergangenen Abends hatte er spät in der Nacht noch zurück zum Schiff gefahren und sich mit einem Kuss für immer von ihr verabschiedet. Nach der ersten Tasse Kaffee startete Gooch sein übliches Morgenprogramm: zehn Meilen laufen. Keet wartete schon auf der Veranda und trabte begeistert mit. Als die beiden zurückkehrten, ging Keet schwimmen, während Gooch noch Liegestützen und Situps machte. Das Wasser im Boiler war inzwischen heiß genug zum Duschen. Es war einer der seltenen sonnigen Tage, und der Wetterbericht im Radio versprach geradezu sensationelle zweiundzwanzig Grad. Das kam selten genug vor und bewegte die Bewohner der Küste für gewöhnlich dazu, fast alle Hüllen fallen zu lassen, um ja keinen Sonnenstrahl zu verpassen. Hier nahm gewöhnlich warme und wasserdichte Kleidung ganze Schränke ein, während sommerliche Bekleidung gerade einmal eine Schublade füllte.
Gooch war da keine Ausnahme. Nach dem Duschen schlüpfte er in die einzige kurze Hose, die er besaß, eine übergroße Basketballshorts, die ein ganzes Stück unter dem Knie endete, ein dazu passendes Tanktop und Badelatschen. Er hatte heute nur einen Frachttransport nach Juneau auf dem Plan, sollte dort einen weiteren Studenten auflesen und zur Forschungsstation nach Bartlett Cove fliegen. So blieb ihm genügend Zeit, um in Ruhe zu frühstücken. Er warf Keet einen getrockneten Ketalachs zu, die traditionelle Hundenahrung. Diese Fischart war sehr fett und dementsprechend energiereich, schmeckte aber nicht so gut wie Königs- oder Silberlachs. Deswegen bekamen ihn die Hunde. Keet war das egal, und er verzog sich zufrieden mit seinem Fisch hinters Haus.
Joe hatte am Morgen das Haus verlassen, ohne sich von ihren Eltern zu verabschieden. Nathaniel hatte sie zum JFK Airport gefahren, und nun war sie auf dem Weg nach Seattle. Nach allem, was in der letzten Zeit vorgefallen war, fiel es ihr nicht schwer, New York den Rücken zu kehren. Es war für alle besser so. Sollte sich die Schickimicki-Horde ihrer Mutter doch das Maul über sie zerreißen und „wilde“ Spekulationen anstellen. Es war ihr egal. Genaugenommen war es ihr sogar recht, denn der Tratsch würde ihre Mutter an den Rand eines Nervenzusammenbruchs treiben. Joe wollte keinen Gedanken mehr daran verschwenden. Sie hoffte auf ein paar nette Kollegen und freute sich auf ihre zukünftige Arbeit. Der gesamte Flug, inklusiv Zwischenstopp in Seattle, dauerte fast zehn Stunden. Die Zeitverschiebung abgerechnet würde sie am Nachmittag Ortszeit in Juneau ankommen. Wie es dann weitergehen sollte, wusste sie noch nicht; man hatte ihr nur mitgeteilt, dass sie dort jemand abholen würde. Joe stellte die Rückenlehne etwas zurück, sah aus dem Fenster und gab sich ihren Tagträumen hin. Endlich frei!
Gooch genoss seinen Flug nach Juneau. Die Sonne schien, und mit der Fracht, die er an Bord hatte, musste er sich nicht unterhalten. Obwohl er schon unzählige Male das Gebiet der Inside Passage überflogen hatte, konnte er sich nie sattsehen an dieser Landschaft, die schon seit Jahrtausenden die Heimat seines Stammes war. Inzwischen hatte er nicht mehr das Bedürfnis, diesen Teil der Welt zu verlassen. Warum auch? Die Zeit lief hier langsamer, Lärm und Hektik einer Großstadt brauchte er nicht. Nicht einmal in Juneau war es besonders hektisch. Nur wenn die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe die Innenstadt bevölkerten, wurde es manchmal etwas voll. Aber genau das sicherte sein Einkommen und sorgte für ein gut gefülltes Auftragsbuch. Er konnte sich keinen besseren Job vorstellen.
Wenig später kontaktierte er den Tower von Juneau und bat um Landeerlaubnis. Aufgrund des hohen Flugaufkommens verwies man ihn zum Wasserlandeplatz. Er bestätigte die Angaben des Towers und schwenkte in Richtung Wasser ab. Der Tower erteilte die Freigabe zur Landung, und kurz danach setzten die Schwimmer der Beaver auf der Wasseroberfläche auf. Nachdem er den Anleger erreicht und seine Maschine vertäut hatte, begann er die Ladung aus der Kabine zu räumen und baute danach die Sitze wieder richtig ein. Ein kleiner Transporter fuhr auf den Anleger zu, um die Fracht aufzuladen. Der Wagen hielt, der Fahrer stieg aus und grüßte.
„Hey, George!“, grüßte Gooch zurück. „Kannst du mich gleich am Terminal absetzen? Ich muss einen Passagier abholen.“
„Klar! Kein Problem“, erwiderte der Fahrer und wuchtete die letzte Kiste in den Wagen. Gooch fischte noch seine Notizen aus dem Cockpit, bevor er sich ins Auto setzte. Auf dem Weg zum Terminal suchte er die Flugnummer und den Namen seines Passagiers aus den Notizen. Er sollte um kurz nach drei mit der Maschine aus Seattle landen. Er schaute auf seine Uhr und beschloss, sich die Wartezeit mit einem Kaffee zu versüßen.
Joe war in Seattle umgestiegen und befand sich kurz vor Juneau. Aufgeregt blickte sie aus dem Fenster. Die Coast Mountains kamen immer näher, und bald konnte man nichts anderes mehr sehen. Der Meeresarm war auf der anderen Seite der Kabine und blieb vorerst unsichtbar für sie. Zwanzig Minuten später zog sie ihren Koffer vom Laufband an der Gepäckausgabe, schulterte ihre Tasche und machte sich auf den Weg in die Halle des Terminals. Dort angekommen hielt sie Ausschau nach der Person, die sie abholen sollte.
Etwas gelangweilt hob Gooch das kleine Pappschild mit dem Namen seines Passagiers hoch und hielt nach den üblichen Verdächtigen Ausschau. Junger Mann mit Brille, Flanellhemd und Computertasche unter dem Arm. Mit ein paar kleinen Abweichungen kam das für gewöhnlich hin. Dann erregte der Anblick einer jungen Frau seine volle Aufmerksamkeit. Sie war schlank und zierlich, steckte in einer Röhrenjeans und einem grobgestrickten Oversize Pulli mit tiefem V-Ausschnitt. Ihr schmales, mädchenhaftes Gesicht wurde von zimtfarbenen Haarsträhnen umrahmt, die sich aus dem gewollt unordentlichen Knoten gelöst hatten. Sie trug kein Make-up – trotzdem wurde ihr Gesicht von ihren ausdrucksvollen Katzenaugen beherrscht. Lange, dunkle Wimpern und gerade, volle Brauen ließen sie noch größer erscheinen. Sie hielt kurz inne und schaute sich um. Gooch vergaß für einen Moment alles um sich herum, und seine Kinnlade sackte leicht nach unten, als sie ihn ansah.
„Sportaffe“, dachte Joe, als sie den dümmlich dreinblickenden Mann im Basketball-Outfit entdeckte, der ein Schild mit ihrem Namen hochhielt. Während sie auf ihn zu ging, musterte sie ihn genauer. Vom leicht beschränkt wirkenden Gesichtsausdruck einmal abgesehen – oder vielleicht gerade deswegen – wirkte er sehr maskulin. Groß, schlank, durchtrainiert, mit einem schönen Gesicht und den breiten Schultern war er in der Schule gewiss der Schwarm aller Mädchen gewesen. Auch das Tanktop und die Tattoos fand sie noch recht attraktiv, aber von der Taille an abwärts wurde es dann kriminell. Nun hieß es zwar: Einen schönen Menschen entstellt nichts, aber das stimmte nicht ganz. Wer war nur auf die Idee gekommen, Männer in kurze Hosen zu stecken? Die sackförmigen Basketballshorts, die seine Waden umspielten, gaben den Blick auf haarige Kalkstelzen preis und konnten damit auch die riesigen, mit Badelatschen verzierten Füße nicht kaschieren. Offensichtlich brauchten auch Ureinwohner gelegentlich Sonne, um braun zu werden. Joe schmunzelte bei dem Gedanken, was wohl ihre Mutter täte, wenn dieser junge Mann auf dem heiligen Teppich im kaiserlichen Salon stehen würde. Die Nationalgarde rufen oder gleich tot umfallen?
Dieser Engel schwebte weiterhin auf Gooch zu, und als er bemerkte, dass sie ihn musterte, verfluchte er zum ersten Mal in seinem Leben das schöne Sommerwetter. Seine Traumfrau stand vor ihm, und er sah aus wie ein Idiot! ‚Verdammter Mist!‘, stöhnte er im Geiste und verwünschte gleichzeitig auch die Sekretärin der Forschungsstation, die ihm offensichtlich einen unvollständigen Namen gegeben hatte, denn das hinreißende Geschöpf blieb vor ihm stehen und lächelte ihn an.
„Hi, ich bin Joe Cunningham. Bringen sie mich nach Barlett Cove?“, fragte sie und hielt Gooch die Hand hin.
Noch nie hatte er solche Augen gesehen. Helles Eisgrün. Wie die Farbe des Wassers, wenn es Eisbrocken umspülte, oder Grünspan auf Kupfer. Einen Moment lang starrte er wie paralysiert in ihr Gesicht; dann riss er sich zusammen, ergriff ihre Hand und räusperte sich, um ein halbwegs vernünftiges Wort herauszubringen. „Hi, ich bin Gooch McKenzie. Die Station hat mich geschickt. Kann ich dir den Koffer abnehmen? Es ist ein weiter Weg zum Anleger.“ Er versuchte ein charmantes Lächeln aufzusetzen. Doch er stand immer noch neben sich, und all seine sonst üblichen Strategien versagten kläglich.
Seine dunkle, rauchige Stimme brachte eine Saite in Joe zum Schwingen, als er wie selbstverständlich ihren Koffer ergriff.
„Danke schön“, sagte sie und schenkte ihm ein wohlwollendes Lächeln.
Wieder versank er in diesen großen, grünen Katzenaugen und brachte kein Wort heraus. Draußen ließ die Sonne Joes zimtbraunes Haar rötlich schimmern. Ein paar Sommersprossen tummelten sich auf ihrer frechen Stupsnase, und der Schmollmund ließ Gooch nur noch ans Küssen denken.
Während sie zum Anleger gingen, wollte er etwas Nettes sagen, aber sein Sprachzentrum hatte immer noch Ladehemmung. „Du verursachst also den Klimawandel?“, hörte er sich sagen und biss sich direkt danach auf die Zunge, als er ihre Reaktion bemerkte.
Die schwingende Saite in Joe riss mit einem Knall und verursachte ebenfalls einen Wandel – einen Stimmungswandel. Er wanderte von der Schublade, die sich Sport- und Lackaffen teilten, eine Etage tiefer in die unterste Macho-Schublade, und im Geiste drehte Joe noch den Schlüssel um und warf ihn weg.
Eigentlich hatte er vorgehabt, etwas zu sagen wie: Du hast gutes Wetter mitgebracht. Aber sie war heiß. In seinem momentanen Geisteszustand hatte er Wetter mit Klima assoziiert, und Sigmund Freud hatte ihm prompt ein Bein gestellt. Er konnte nicht ahnen, dass er eine Punktlandung im Fettnapf gemacht hatte.
„Ich erforsche die Auswirkungen des Klimawandels!“, erwiderte sie scharf.
Jetzt war er sich des Fettnapfes deutlich bewusst und beschloss, bis Barlett Cove die Klappe zu halten, um ja keine Wellen zu machen. Falls das überhaupt möglich war. Den Rest des Weges schwiegen sie.
Als sie den Anleger erreichten, staunte Joe nicht schlecht. Sie hatte mit einem Boot gerechnet, nicht mit einem Wasserflugzeug. Schneeweiß und rot lackiert dümpelte die Maschine am Steg und glänzte in der Sonne.
„Cool!“, rutschte es ihr heraus. Sie bereute es gleich, als sie merkte, dass diese Äußerung seine Macho-Mühlsteine erneut in Gang gesetzt hatte.
Nach dem Bauchklatscher hatte Gooch sich wieder im Griff und lächelte souverän, während er ihren Koffer auf die hinteren Sitze verfrachtete, damit nur noch der Platz neben ihm frei war. Er lief auf dem Schwimmer entlang, tauchte unter dem Flügel durch und öffnete ihr galant die Tür. Joe kletterte hinein und setzte sich. Gooch löste die Taue und verstaute sie im Fußraum, dann kletterte er auf der anderen Seite ins Cockpit.
Während er die Checkliste abarbeitete, sah sie sich um und bemerkte erst jetzt, dass es sich gar nicht um ein natürliches Gewässer handelte. Es war vielmehr ein riesiges Bassin direkt neben der asphaltierten Landebahn.
„Schnall‘ dich bitte an und setz die Kopfhörer auf“, sagte er zu ihr. Dann rief er den Tower über Funk. Er startete den Motor, nachdem er die Startfreigabe erhalten hatte, und brachte die Maschine in Position.
„Beaver November Sierra Zulu. Ready for take off. Over“, meldete Gooch dem Tower.
Einen Moment später erhielt er die Startgenehmigung. „Approved. Beaver November Sierra Zulu. Over and out“, kam es über die Kopfhörer.
Gooch gab Gas. Immer schneller glitt die Maschine übers Wasser und hob kurz danach ab. Er schwenkte nach links und zog die Beaver hoch, nachdem er die Einflugschneise verlassen hatte. Vor ihnen lagen nun offenes Wasser und die Nordspitze von Admirality Island. Joe stand vor Begeisterung der Mund offen, dann strahlte sie über das ganze Gesicht. Der Anblick, der sich ihr bot, war atemberaubend schön. Unter ihnen funkelte das Wasser des Lynn Canal so blau wie ein Saphir. Wild zerklüftete Fjorde schnitten sich tief in die Inseln, und die Hänge der Berge waren dicht bewaldet.
Hinter Admirality Island lag die Icy Strait. Gooch nahm Kurs auf Bartlett Cove. Links von ihnen lag ein Kreuzfahrtschiff vor einer Insel. Ein zweites fuhr in ihrer Richtung mit Kurs auf die Glacier Bay.
„Ist das Icy Strait Point?“, fragte Joe unverbindlich und deutete auf die Schiffe.
Er nickte. „Ja, und an der Südseite des Berges liegt Hoonah.“
Joe hatte sich ein wenig belesen, um mehr über die Gegend zu erfahren, und wusste, dass in Hoonah hauptsächlich Tlingit lebten. Sie ging davon aus, dass auch er dort wohnte, und wurde neugierig. „Was bedeutet Gooch?“, fragte sie weiter und betrachtete ihn. Von der Seite war er irgendwie noch schöner, und da seine nackten Beine nun unter der Armaturenkonsole verschwanden, störten sie nicht länger ihr ästhetisches Empfinden. Sein klassisches Profil wirkte ausgesprochen männlich, und den dunklen Bartschatten fand sie aufregend sexy. Allerdings hätte sie sich lieber die Zunge abgebissen, bevor sie das zugeben würde. Erst jetzt fiel ihr der unglaublich lange Zopf auf.
„Wolf. Kaagwaantaan áyá xát“, erwiderte er schmunzelnd auf Tlingit.
Joe verstand kein Wort und hakte nach. „Was heißt das?“
„Ich bin vom Wolfs-Clan. Aber mein Name hat damit nichts zu tun. Wofür steht Joe?“, wollte er jetzt seinerseits wissen, um von seinem Namen abzulenken.
Sie zögerte einen Moment – fragen war noch erlaubt, nur aussprechen nicht. „Josephine, aber ich hasse diesen Namen“, warnte sie ihn vor.
Gooch warf ihr einen Seitenblick zu und lächelte. „Ist doch eigentlich ganz hübsch. Familiäre Altlasten?“, mutmaßte er, weil ihr Name nicht so schrecklich war, wie er erwartet hatte.
Sie nickte nur.
„Kenn ich“, meinte er leidgeprüft. „Na, dann hoffe ich für dich, dass die Leute auf der Station nicht auch annehmen, dass du ein Mann bist. Ansonsten musst du dir wohl in den nächsten Wochen mit einem anderen Kerl das Zimmer teilen“, bemerkte er noch amüsiert.
Joe sah ihn entsetzt an. Erst jetzt ging ihr ein Licht auf, warum er sie so irritiert angeschaut hatte; denn dümmlich, wie er anfangs auf sie gewirkt hatte, war er nicht. So viel hatte sie inzwischen festgestellt. Das war für Joe allerdings noch lange kein Grund, ihn aus der Macho-Schublade zu entlassen.
„Ich bleibe ein ganzes Jahr“, bemerkte sie mit der bangen Hoffnung, dass die Uni ihre vollständigen Unterlagen zur Station geschickt hatte. Die Aussicht, sich mit einem wildfremden Mann das Zimmer teilen zu müssen, behagte ihr ganz und gar nicht.
Gooch hingegen feierte im Geiste gerade eine Party. Wenn sie auch den Winter auf der Station verbringen würde, gab ihm das die Gelegenheit, sich die Saure-Gurken-Zeit zu versüßen. Er setzte Joe auf seine Abschussliste und grinste zufrieden.
„Wo liegt dein Forschungsschwerpunkt? Gletscherschmelze?“, erkundigte er sich, um das Gespräch am Laufen zu halten.
Sie lächelte erfreut darüber, dass sich endlich mal jemand für ihre Arbeit interessierte. „Ja, hauptsächlich geht es um die steigende Kohlendioxid-Anreicherung im Meer, die durch die erhöhte Schmelzwasserzufuhr nicht mehr gepuffert werden kann und zu einem steigenden Säuregehalt des Meeres führt. Das kann ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen. Erst recht ein so sensibles Ökosystem wie dieses hier“, erklärte sie ihm ernst. „Kennst du dich damit aus?“
Gooch nickte. „Ich arbeite schon ein paar Jahre für die Forschungsstation und den Nationalpark. Da bekommt man mit der Zeit so einiges mit. Hast du schon einen bestimmten Gletscher im Visier?“
„Nein, ich muss mich mit den Einzelheiten erst noch vertraut machen, aber ich bin nur an den Gezeitengletschern interessiert“, gab sie zurück.
Vor ihnen tauchte Bartlett Cove auf. Gooch sah auf die Tankanzeige und überlegte kurz. Es lief gerade so gut, und er wollte sie noch nicht vom Haken lassen. „Davon haben wir hier reichlich. Möchtest du dir einen aussuchen?“
„Wie meinst du das?“, fragte sie irritiert.
Er antwortete nicht, sondern drehte etwas ab in Richtung Glacier Bay. Bald darauf kamen die ersten Gletscher in Sicht. Vorbei am Reid-Gletscher flog er immer tiefer in die Bucht. Eisbrocken trieben an der Wasseroberfläche des Meeresarms. Am Ende erreichten sie die Abbruchkante des Grand-Pacific-Gletschers. Völlig hingerissen starrte Joe auf dieses großartige Naturschauspiel. Bläulich-weiß präsentierte sich diese gewaltige Gletscherwand, durchzogen von grünen und türkisfarbenen Adern aus klarem Eis. „Mein Gott, sind das wunderschöne Farben!“
„Wie deine Augen“, schwärmte er unverhohlen.
Nun konnte Joe mit dem boshaft geheuchelten Smalltalk im Salon ihrer Mutter wesentlich besser umgehen als mit ernstgemeinten Komplimenten junger Männer, und so errötete sie leicht und schwieg.
Er bemerkte ihre Reaktion und drehte zufrieden ab. Damit hatte er die Scharte des Freudschen Klimawandels wieder ausgewetzt, hoffte er.
„Kannst du noch ein Stück über den Gletscher fliegen?“, fragte sie.
„Nein, leider nicht. Hier verläuft die Grenze zu Kanada. Ohne Genehmigung darf ich nicht in den kanadischen Luftraum, und ich würde meine Fluglizenz gerne behalten“, erklärte er.
„Klar“, meinte sie und warf einen vorerst letzten Blick auf den Giganten aus Eis. „Das war toll! Danke!“ Sie strahlte ihn an.
Zufrieden mit seinem Erfolg, begann Gooch ein Lied zu summen, dessen Melodie Joe irgendwie bekannt vorkam. „Come Josephine, in my flying maschine. Going up she goes, up she goes … up, up a little bit higher, oh, my, the moon is on fire … Come Josephine, in my flying machine …“, sang er mit dieser rauchigen Stimme, von der Joe eine Gänsehaut bekam.
Als sie den Text hörte, fiel ihr wieder ein, woher sie dieses Lied kannte. „Titanic? Echt jetzt?“, spottete sie, weil sie dieses Lied für eine schmalzige Aufreißermasche hielt.
Gooch sah sie irritiert an. „Was hat ein Schiff damit zu tun?“
„Dieser Song ist aus dem Film Titanic“, erklärte sie.
Gooch schüttelte den Kopf. „Kenne ich nicht. Dieser Song ist bedeutend älter als dein Hollywood-Schinken. Er erschien 1910 und basiert angeblich auf der Geschichte von Josephine Sarah Magner, die im Jahr 1905 der erste weibliche Fallschirmspringer Amerikas war. Fiel mir ein, als ich deinen Namen hörte.“
Joe staunte nicht schlecht über seine Geschichtskenntnisse. Vielleicht hatte sie ihn ja tatsächlich unterschätzt. „Na, hoffentlich brauche ich nie einen Fallschirm.“
„Nicht, solange du mit mir fliegst! Ich beherrsche meinen Job!“, erklärte er.
Kurze Zeit später landete Gooch auf dem Wasser vor Bartlett Cove. Sie wurden schon erwartet: Ein Ranger des Parks stand vor einem Geländewagen, um Joe abzuholen. Er grinste breit, als sie aus der Kabine kletterte. Gooch half ihr auf den Steg und holte noch ihren Koffer und die Tasche aus dem Flugzeug.
„Hey, Ben!“, begrüßte er den Ranger.
„Hey, Gooch! Ich dachte schon, du hast dich verflogen“, spottete Ben, denn als er sah, was sein Cousin da mitgebracht hatte, war ihm klar, warum der Flug länger als üblich ausgefallen war. Er lud Joes Gepäck in den Wagen und setzte sich hinein.
Gooch erwiderte nichts, sondern verabschiedete sich von Joe. „Bis morgen Abend“, stellte er fest und lächelte vielsagend.
Joe saß auch schon im Auto und sah ihn überrascht an. „Wieso? Was ist morgen Abend?“
Er lehnte sich ans Auto und beugte sich zu ihr hinunter. „Ach, weißt du, ein Tag ohne mich ist zwar theoretisch möglich – aber wer will das schon?“, stellte er selbstbewusst fest, klopfte auf das Autodach und lief zurück zum Flugzeug.
‚Aufschneider – Geschichtskenntnisse hin oder her!‘, dachte Joe und sah ihm perplex nach.
Ben grinste immer noch. „Gooch?“, rief er ihm hinterher. Der drehte sich um. „Schicke Hose!“, meinte Ben und fuhr lachend davon.
Im Spiegel konnte Joe erkennen, wie Gooch dem Ranger den Stinkefinger zeigte, und musste unwillkürlich grinsen. „Ist er immer so?“, fragte sie.
Ben lachte und meinte: „Dazu sage ich lieber nichts. Gooch ist mein Cousin. Aber morgen Abend ist eine Willkommensparty für die Neulinge der Station. Da kommen alle, die hier arbeiten“, erklärte er. „Ich bin Ben McKenzie, einer der Ranger des Parks.“
„Joe Cunningham“, stellte sie sich vor und musterte ihn ebenfalls unauffällig. Ben hatte im Gegensatz zu Gooch einen modischen Kurzhaarschnitt. Er war schätzungsweise ein paar Jahre älter und wirkte reifer und vernünftiger als sein Cousin. An seiner linken Hand trug er einen Ehering. Das erklärte dann auch, warum er vernünftiger wirkte.
„Ist das die Forschungsstation?“, fragte sie, als sie an einem großen Gebäude aus Holz, mit spitzen Gaubenfenstern und einer großen Veranda, vorbeifuhren.
„Nein, das ist die Lodge – ein Hotel mit etlichen kleineren Holzhütten für Touristen. Die Station liegt tiefer im Wald“, erklärte er ihr.
Die schmale Straße wand sich in mehreren Kurven durch das Waldgebiet. Ein abzweigender Weg führte zur Parkverwaltung und Ranger-Station, erfuhr sie von Ben. Danach zog sich die Straße schnurgerade immer tiefer in den Urwald aus Sitkafichten, Hemlock- und Schierlingstannen, dazu noch ein paar Zypressen und Küstendouglasien. Das Unterholz aus Farnen, moosbewachsenen Steinen, Blaubeeren und dem stacheligen Devil‘s Club war so dicht, dass man kaum einen Meter hineinsehen konnte, und von den Ästen und Stämmen hingen dichte Flechten – typisch für das feuchte Klima der Küstenregion. Ben bog links ab auf eine gerodete Lichtung. Mehrere kleinere und ein großes Gebäude verteilten sich über den Platz. „Da wären wir“, verkündete Ben und parkte vor dem Haupthaus.
Der Zufall hatte Gooch noch ein paar Fluggäste beschert, die sich spontan entschlossen hatten, mit nach Hoonah zu fliegen. Er freute sich über den zusätzlichen Verdienst und nahm Kurs auf Chichagof Island. Doch noch mehr freute er sich über die neuen Aussichten, die ihm dieser Tag beschert hatte. Joe war eine lohnenswerte Beute. Er dachte an ihre grünen Augen und legte sich eine Strategie zurecht, um möglichst viel Zeit mit ihr verbringen zu können – und da kam ihm seine Arbeit für die Station gerade recht. Ben war zuständig für die Einteilung der Begleitpersonen der einzelnen Forschertrupps. Je nach Forschungsgebiet standen Boote oder Flugzeuge zur Verfügung, um die Wissenschaftler an Ort und Stelle zu bringen. Ranger begleiteten die Exkursionen, um für Sicherheit zu sorgen, aber auch einheimische Guides wie Gooch. Er lächelte siegesgewiss und setzte zur Landung vor der Seaplane Base in Hoonah an. Nachdem er seine Passagiere verabschiedet und sein Flugzeug vertäut hatte, schwang er sich in sein Auto und fuhr auf der Küstenstraße nach Hause. Ein Abendessen mit seiner Mutter vermied er tunlichst. Sie hätte ihm seinen frisch erwachten Jagdmodus sofort angesehen und ihm Löcher in den Bauch gefragt.
Leah war wie eine Eule. Sie sah alles und hörte alles, näherte sich lautlos – und noch ehe man sich der Gefahr bewusst wurde, saß man schon in ihren mütterlichen Klauen fest. In Ermangelung von Geschwistern war Gooch für gewöhnlich ihr bevorzugtes Opfer – deswegen auch der räumliche Sicherheitsabstand. Zwar war er nicht so naiv zu glauben, dass seine Mutter annahm, er könnte noch grün hinter den Ohren sein. Aber sich mit einem One-Night-Stand erwischen zu lassen, wäre ihm mehr als peinlich gewesen.
Er parkte vor dem Haus und hielt Ausschau nach Keet. Der Hund war Tag und Nacht draußen, stromerte durch die Gegend, ging schwimmen, fing Fische und hielt aufdringliche Bären vom Haus und von den Mülltonnen fern. Selbst im Winter zog er es vor, draußen zu schlafen, denn wie alle Schlittenhund-Rassen liebte er Eis und Schnee und war von der Natur mit einem dicken, dichten Pelz ausgestattet. Zum Schutz vor Dauerregen oder eisigem Wind hatte Gooch ihm eine komfortable Hundehütte auf der Veranda gezimmert. Dieser Hund war sein Ein und Alles. Mit ihm saß er Abends vor dem Haus und vertraute ihm seine Gedanken an. Keet hörte aufmerksam zu und tratschte nicht.
Unweit des Hauses lief irgendetwas krachend durchs Unterholz, dann erschien Keet mit einem Fisch im Maul. Wedelnd lief er auf Gooch zu und legte ihm einen kapitalen Chinook, einen Königslachs, den er aus der nahegelegenen Bucht gezogen hatte, vor die Füße.
„Hey, mein Großer, das wäre aber nicht nötig gewesen“, sagte Gooch und begrüßte seinen Hund. „Wie ich dich kenne, hast du nicht mit dem Essen auf mich gewartet?“, fragte er und nahm den Fisch an sich. Wie zur Bestätigung rülpste Keet und rollte sich satt und zufrieden auf der Veranda zusammen. Gooch nahm den Fisch aus, schnitt den Kopf ab und faltete ihn auseinander. Auf einen gespaltenen Zweig gespießt und am Feuer halb geräuchert, halb gegrillt – eine echte Delikatesse. Er machte ein kleines Feuer vor dem Haus, bohrte den Zweig neben den Flammen in den Boden und verkürzte die Wartezeit bis zum Essen mit einem Bier.
Joe hatte inzwischen einen Rundgang über die Station absolviert und ihr Zimmer bezogen. Zum Glück für sie hatten sich ihre Befürchtungen nicht bewahrheitet. Ihre Zimmergenossin hieß Trisha, hatte eine Rubensfigur, lustige blonde Locken, die ihr wild ins Gesicht hingen, und eine fröhliche, hilfsbereite Art. Joe mochte sie sofort. Trisha gehörte zur Stammbesatzung der Station und war als Chemikerin der gute Geist des Labors.
„Hat Gooch dich hergebracht?“, fragte sie mit einem verräterischen Leuchten in den Augen, während Joe ihren Koffer auspackte.
Joe lachte spöttisch. „Du meinst diesen aufgeblasenen Schönling?“
Trisha sah sie erstaunt an. „Okay, er ist ein bisschen von sich eingenommen, aber optisch ist er ein echter Leckerbissen.“ Sie grinste.
Joe klappte den leeren Koffer zu und schob ihn unter ihr Bett. „Mag sein, aber ich verzichte dankend, bevor ich mir an diesem Leckerbissen den Magen verderbe.“
Trisha fing an zu kichern. „Davon bin ich weit entfernt, aber Appetit holen ist erlaubt. Verhungern kann ich immer noch zu Hause“, meinte sie selbstironisch.
„Blödsinn!“, versuchte Joe sie aufzumuntern. „Andere Mütter haben auch schöne Söhne.“
„Hilft mir nicht! Ich brauche Namen und Adressen! Du hast leicht reden, du hast den Richtigen bestimmt schon gefunden“, stellte Trisha neidlos fest.
Joe schüttelte den Kopf. „Nein – entweder schwenken die Typen ihre Kreditkarten wie ein Pavian seinen roten Hintern, oder sie haben keine Karte und trommeln sich stattdessen auf die Brust wie ein Berggorilla. Ich kann auf beide Sorten verzichten“, versicherte sie.
„Und was suchst du?“, wollte Trish wissen.
„McGyver, nur in hübsch mit Holzfällerhemd und Axt. Bereit, jedem Umweltsünder den Schädel zu spalten!“, alberte Joe und fiel in Trishas Lachen ein.
„Ich bin froh, dass du da bist“, meinte Trisha. „Deine Vorgängerin hatte absolut keinen Humor – und ihr einziges Gesprächsthema waren Foraminiferen.“
„Na, das ist doch ein evolutionärer Quantensprung! Von den Einzellern zu den Primaten“, bemerkte Joe sarkastisch und lachte.
Währenddessen hatte sich jemand ins Büro geschlichen und durchforstete hektisch die Unterlagen der Neuankömmlinge. Als er fündig wurde, hielt er inne und begann interessiert zu lesen. Wenig später schlug er die Akte zu, schob sie zurück in den Stapel und notierte sich einen Namen.
Josephine Marie Cunningham.
Alaska
Während des gemeinsamen Abendessens lernte Joe auch ihre anderen Mitstreiter kennen. Sie arbeiteten an völlig unterschiedlichen Projekten, die sich aber letztendlich alle mit den Auswirkungen des Klimawandels auf das sensible Ökosystem befassten. Darunter auch Barney, der einen etwas verwirrten Eindruck machte und sich mit der Entwicklung von Computerprogrammen zur Simulation von Strömungsverhältnissen beschäftigte. Lillian, die das Wanderungsverhalten der Lachse erforschte, und Marc, der wie Trisha zu den Festangestellten gehörte und für die Wartung aller technischen Geräte der Station verantwortlich war. Die wissenschaftlichen Leiter der Station, ein Biologe und ein Klimatologe, ließen sich an diesem Abend nicht blicken.
„Die sind noch an der Uni in Juneau“, erklärte Trisha. „Aber morgen zur Party sind sie wieder da.“
Joe entging nicht das Funkeln in den Augen ihrer Zimmergenossin. Sie vermutete, dass Gooch die beiden abholen und dann, wie von ihm angekündigt, auch auf der Party erscheinen würde.
„Du kommst doch auch, oder?“, fragte Barney. Er bekam hektische Flecken im Gesicht und schob seine große Brille wieder hoch.
„Klar!“, erwiderte Joe fröhlich und vermutete, dass Barney sich noch nicht allzu oft von seinem Computer entfernt hatte. Er sah aus wie der klassische Retro-Nerd. Kurze Haare, kurzer Bart, beides dunkelblond, Brille und ein Ohrstecker auf der linken Seite. Auch ihn mochte Joe sofort. Er balzte nicht herum wie die meisten Männer, sondern war etwas schüchtern und das fand sie sehr sympathisch. Sie unterhielten sich noch eine Weile, dann fiel Joe todmüde ins Bett und schlief sofort ein.
Gooch verzog sich von der Veranda ins Haus. Draußen wurde es frisch; das Wetter schlug um, und Nebel waberte vom Meer aus in die Fjorde, kroch aufs Land und blieb an den bewaldeten Bergen hängen. Er stellte die Reste des Lachses in den Kühlschrank und ging in sein Schlafzimmer. Als er die Bettdecke zurückschlug, entdeckte er ein knappes rotes Höschen – Souvenir der vergangenen Nacht. Er lächelte, hob das winzige Stück Stoff auf und ließ es im Mülleimer verschwinden. Er nahm nicht an, dass die Besitzerin zurückkäme und es abholen würde. Die verwünschte Basketballshorts pfefferte er wütend in die nächste Ecke, ging schlafen und träumte von grünem Eis.
Trishas Radiowecker startete mit wildem Gedudel. Gutgelaunt stand sie auf und verschwand im Bad. Ein kleiner Luxus in der Unterkunft der Frauen – die Männer hatten eine Gemeinschaftsdusche. Joe zog sich mürrisch das Kissen über den Kopf und dämmerte noch mal weg. Wenig später kam Trisha aus dem Bad und versuchte Joe zu wecken, doch das gestaltete sich schwieriger als angenommen. Irgendwann richtete Joe sich zerknautscht auf und versuchte Trishas Redeschwall einzudämmen.
„Erst Kaffee, dann reden“, maulte sie und rang sich angesichts Trishas Gesichtsausdruck zu einer Erklärung durch. „Unter drei Tassen Kaffee läuft in meinem Hirn nur das Testbild.“ Sie stand auf und schlurfte ins Bad. Frisch geduscht hatte sich der Nebel im Kopf zwar verzogen, aber ihre Laune besserte sich erst, als ihr Trish eine Tasse in die Hand drückte.
„Bitte sehr. C8 H10 N4 O2, heiß mit Milch“, verkündete Trish mit einem breiten Grinsen.
„Was bedeutet das?“, fragte Joe und schenkte ihrer Zimmergenossin einen dankbaren Blick.
„Das ist die Summenformel für Koffein.“
Joe schlürfte andächtig das heiße Gebräu und lächelte selig. „Unter diesem Aspekt kann ich mich mit Chemie anfreunden.“
Gleich nach dem Frühstück erschien Ben McKenzie auf der Station, um den Cheechakos, den Neulingen, eine Lektion in Sachen Wildnis und Wildtiere zu erteilen. Die größte Gefahr ging von Elchen und Bären aus. Wölfe fanden im Sommer genug zu fressen und mieden die Nähe des Menschen. Bären waren Opportunisten und Feinschmecker und stöberten deswegen gern nach menschlichen Nahrungsmitteln, besonders an Campingplätzen, in Mülltonnen und Autos. Sie waren darauf aus, sich möglichst viel Speck für die Winterruhe anzufressen. Und die Schokoriegel von Touristen und anderen ahnungslosen Leuten waren kalorienreicher und einfacher zu bekommen, als den ganzen Tag Beeren zu suchen. Während der Lachs-Saison waren sie allerdings meist gut gesättigt. Einer Bärin mit Jungen sollte man besser aus dem Weg gehen. Gleiches galt für Elchkühe. Die Mütter verteidigten ihren Nachwuchs bis aufs Blut. Was Joe allerdings wirklich erstaunte, war die Tatsache, dass die meisten Todesopfer auf das Konto von Elchbullen gingen.
„Im Herbst sind die paarungsbereiten Bullen im Hormonrausch und betrachten jeden Eindringling als Nebenbuhler, der erbittert bekämpft wird“, erklärte Ben.
„Zu viel Testosteron schadet der Gesundheit“, flüsterte Joe amüsiert.
Lillian und Trisha bissen sich auf die Lippen und kicherten. Außerdem lernten sie, dass man Nahrungsmittel nur in einem verschließbaren Container aufbewahren durfte, der zudem noch weit weg vom Lager und vom Transportmittel gelagert werden musste. Bären hätten noch feinere Nasen als Hunde und könnten jeden lumpigen Kekskrümel meilenweit wittern.
„Für alle, die mit einem Boot oder Kajak unterwegs sein werden und Walen begegnen: Das Gesetz schreibt einen Mindestabstand von dreihundert Fuß vor. Falls die Wale näherkommen, bewahrt die Ruhe und entfernt euch langsam. Ein Wal kann beim Auftauchen mühelos ein Kajak zum Kentern bringen, und das Wasser ist sehr kalt. Also haltet besser Abstand“, fügte Ben noch hinzu und ermahnte alle, immer wasserfeste und trockene Kleidung zum Wechseln mitzunehmen, da man auch im Sommer schnell unterkühlen könnte, wenn man nass würde.
Gooch joggte an diesem Morgen, begleitet von Keet, bis Icy Strait Point, um die Büroarbeit nachzuholen, die er am vergangenen Abend vernachlässigt hatte. Der Nebel hatte sich noch nicht verzogen, und so kam er nicht verschwitzt, sondern nebelfeucht dort an. Keet enterte das Restaurant, um sich von Großmutter, wie Gooch seine Mutter Keet gegenüber nannte, ein paar Leckerbissen zu erbetteln. So früh am Morgen waren noch keine Gäste da. Gooch bestätigte Buchungen per E-Mail, schrieb Rechnungen für Stammkunden und hätte am liebsten auch die folgenden Wochen geplant, doch er war noch nicht dazu gekommen, mit Ben über sein Anliegen zu sprechen. Das musste bis zum Abend warten. Als er daran dachte, fing er leise an zu summen.
So fand Leah ihren Sohn vor, als sie Keet zurückbrachte. Lautlos wie immer hatte sie sich an die Tür gestellt und beobachtete ihn interessiert. Er wirkte etwas geistesabwesend, hatte ein leichtes Lächeln im Gesicht und summte gutgelaunt vor sich hin. Sie schmunzelte und schaute ihn liebevoll an. All die Mädchen, die er immer vor ihr zu verheimlichen versuchte, hatten es bislang nicht geschafft, dieses spezielle Lächeln in sein Gesicht zu zaubern. Er dachte, sie wüsste nichts davon, und Leah ließ ihn in diesem Glauben. Stattdessen behielt sie ihre Sorgen um ihn für sich. Ihn jetzt so zu sehen, ließ ein Fünkchen Hoffnung in ihr aufkeimen.
Gooch blickte vom Computer auf und entdeckte seine Mutter in der Tür; gleichzeitig fühlte er sich ertappt – er wusste nur nicht, warum.
Er stand auf und begrüßte sie mit einem Kuss auf die Wange. „Hey, Mom!“
„Hallo, mein Junge. Keet ist satt – wie steht es mit dir?“, fragte sie harmlos.
„Ich komme gleich. Will nur schnell die Rechnungen fertig machen“, vertröstete er sie.
Später saß er in einem kleinen Eck des Restaurants und schlürfte einen Kaffee.
„Kommst du heute Abend zum Essen?“, fragte sie.
Gooch schüttelte den Kopf. „Nein, tut mir leid. Ich fliege nachher noch nach Juneau und dann weiter zur Station. Heute Abend ist Party in der Lodge. Ich nehme Keet mit und übernachte bei Ben.“ Damit hatte Leah die Informationen, die sie brauchte. Der Grund seiner guten Laune befand sich in Barlett Cove, und die Tatsache, dass er von vornherein plante, bei seinem Cousin zu übernachten, sprach wiederum für das Mädchen. Sie grinste ein wenig zu offensichtlich vor sich hin, und Gooch witterte Lunte.
„Was freut dich daran so?“, fragte er etwas misstrauisch.
Leah erhob sich und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. „Nichts weiter. Ich wünsch dir einen schönen Abend.“ Sie lächelte geheimnisvoll und verschwand in der Küche.
Und zack! Sie hatte ihn schon wieder erwischt, ohne dass er es rechtzeitig bemerkt hatte. Wenigstens war ihm die Diskussion über Enkel erspart geblieben, aber genau das machte ihn nur noch misstrauischer.
Am frühen Abend hockte Joe im Schneidersitz auf dem Bett und tippte noch einiges in ihren Laptop. Der ganze Tag war mit Besprechungen angefüllt gewesen. Außerdem koordinierte Ben die Terminplanung für die Exkursionen, um sie mit den Dienstplänen seiner Leute in Einklang zu bringen.
Trisha kam, in eine Wolke Parfum gehüllt, aus dem Bad und sah Joe entgeistert an. „Willst du dich gar nicht aufbrezeln?“
Joe sah maulend von ihrem Computer auf. „Muss ich?“
„Na klar! Heute Abend wird gefeiert!“, entgegnete Trisha aufgekratzt.
„Okay“, meinte Joe, ging an ihren Schrank und zog einen weiteren ihrer Oversize Pullis heraus. Diesmal grobgestricktes Leinen in Olivgrün, der ihr über die Schulter rutschte und einen BH-Träger preisgab. Dazu die üblichen Röhrenjeans. Sie öffnete ihren Zopf, fuhr mit den Fingern ein paarmal durchs Haar und knotete geschickt einen Messy Bun, der aussah, als hätte ein Hair-Designer drei Stunden dafür gebraucht. Das Ganze steckte sie mit einer hölzernen Haarnadel fest.
„Fertig!“, verkündete Joe.
Trisha verdrehte gutmütig die Augen und schüttelte den Kopf. „Kein Make-up?“, fragte sie vorsichtig nach.
Joe protestierte. „Bloß nicht! Dann sehe ich aus wie die dämliche Schaufensterpuppe, die meine Mutter lieber als Tochter gehabt hätte.“
Trisha sah sie verwundert an. „Willst du den Jungs denn nicht gefallen?“
„Nein, es reicht mir, wenn sie Angst haben!“, bemerkte Joe mit einem diabolischen Lächeln.
Lillian klopfte an die Tür. „Seid ihr fertig? Wir wollen los!“
Gutgelaunt machte sich die ganze Truppe mit mehreren Autos auf den Weg zur Lodge.
Dort angekommen stellte Joe erleichtert fest, dass der Schönling fehlte. Trisha war sichtlich enttäuscht. Viele der Ranger, darunter auch einige Frauen, waren schon da – und auch einige der Hotelgäste hatten sich eingefunden. Die Party war keine geschlossene Gesellschaft; Gäste waren immer herzlich willkommen. Die Mädels suchten sich einen Platz, Barney setzte sich todesmutig dazu und hielt sich nervös an der Bierflasche fest. Marc sicherte sich einen Platz an der Bar und begann mit einem der weiblichen Ranger zu flirten. Musik spielte, einige Leute begannen zu tanzen. Trisha behielt den Eingangsbereich im Auge, während die anderen mit Fachsimpeleien anfingen.
Gooch hatte sich bewusst lässig gekleidet. Bootcut Jeans, schwarzes Shirt, Lederjacke. Dazu den üblichen Zwei-Tage-Bart. Niemand sollte denken, er hätte mehr als zwei Minuten auf sein Äußeres verwendet. Tatsächlich war es deutlich länger gewesen. Allein die Haare zu trocknen nahm für gewöhnlich schon mehr als eine halbe Stunde in Anspruch. Mit Keet ging er zu Fuß rüber zur Lodge. Die beiden Professoren fuhren mit dem Auto zur Station und wollten später nachkommen. Sie waren etwas spät dran. Der Nebel hatte in Juneau für Verzögerungen gesorgt. Von draußen hörte man schon die Musik, und er freute sich darauf, mal wieder zu tanzen. Drei Ranger, die sich nach Feierabend noch in Schale geschmissen hatten, traten zusammen mit Gooch und dem Hund ein.
Während er von einigen Leuten begrüßt wurde, scannte er den Saal auf der Suche nach Joe. Trisha entdeckte ihn zuerst und seufzte hingerissen.
„Vorsicht! Paarungsbereite Bullen im Hormonrausch!“, bemerkte Lillian trocken, als sie die vier Männer im Eingang sah. Joe saß mit dem Rücken zur Tür, kicherte und drehte sich um. In diesem Moment entdeckte auch Gooch sein Zielobjekt und versenkte lässig die Hände in den Hosentaschen. Dann sah er, wie Joe strahlte und auf ihn zuging. ‚Das läuft ja besser als erwartet‘, dachte er und setzte siegessicher sein Verführer-Lächeln auf – bis er ernüchtert feststellen musste, dass sie gar nicht ihn anstrahlte, sondern Keet. Er brauchte einen kurzen Moment, um sich von diesem Schock zu erholen. Noch bevor er sie warnen konnte, dass der Hund Fremden gegenüber leicht reizbar war, hatte sich Joe auf die Knie sinken lassen und kraulte Keet begeistert den Pelzkragen. „Hallo, mein Großer! Mein Gott, bist du schön!“, säuselte sie hingerissen und strahlte über das ganze Gesicht.
Gooch wäre es deutlich lieber gewesen, wenn sie ihn so begrüßt hätte und nicht seinen Hund, aber das war vielleicht doch ein wenig zu viel verlangt. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit zeigte Keet nicht seine gefährlich langen Eckzähne, sondern wedelte freundlich und begann Joe das Gesicht abzulecken, was sie sich lachend gefallen ließ. Ein Hund wusste instinktiv, wann er einen wahren Hundeliebhaber vor sich hatte. Gooch beneidete Keet um dieses Privileg.
Alle umstehenden Leute, die Keet kannten, hatten entsetzt die Luft angehalten, und Ben rang sichtlich um Fassung, um nicht in schallendes Gelächter auszubrechen. Der verdatterte Blick seines Cousins war unbezahlbar und würde ihm die Lacher auf jeder Familienfeier in den nächsten zehn Jahren sichern. Und davon gab es bei den Tlingit viele. Keet legte sich begeistert auf den Rücken, um sich auch den Bauch kraulen zu lassen.
‚Verräter‘, dachte Gooch. „Déi áwé!“ – es ist genug, raunte er seinem Hund zu, und Keet stand auf. Joe sah an ihm hoch und bemerkte die langen Hosen.
„Er gehört dir?“, fragte sie erstaunt.
„Eigentlich schon“, antwortete er und hielt ihr die Hand hin, um ihr beim Aufstehen behilflich zu sein. Vielleicht war Keets Showeinlage ja doch ganz nützlich.
Sie griff nach seiner Hand und ließ sich hochziehen. „Ich habe noch nie einen so großen Malamute gesehen.“
„Das ist die XL-Variante“, erklärte Gooch lächelnd. „Tanzen wir?“, nutzte er die Gelegenheit.
„Ich muss mir erst mal das Gesicht waschen“, stellte sie fest und huschte an ihm vorbei zur Damentoilette. Noch ehe er sich‘s versah, war sie ihm schon wieder entglitten. Keet folgte ihr und legte sich draußen vor der Toilettentür hin.
Ben ging zu Gooch und drückte ihm ein Bier in die Hand. „Dein Hund hat einen Narren an ihr gefressen“, meinte er schmunzelnd. „Und ich habe den Eindruck, du auch!“, fügte er mit einem verschwörerischen Lächeln hinzu.