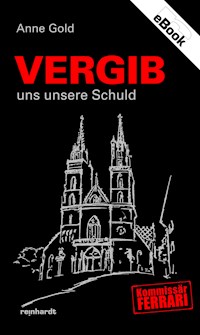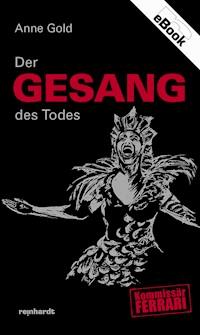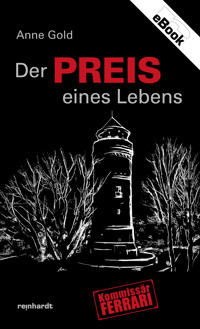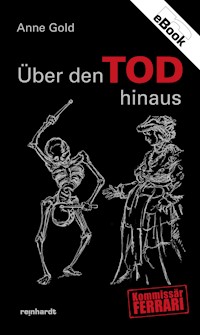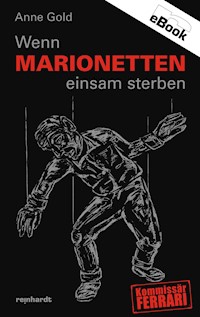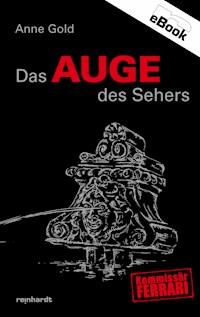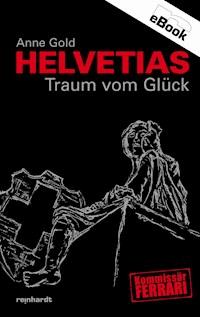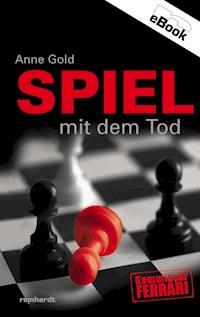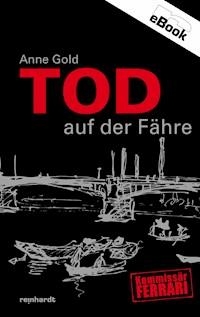
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reinhardt, Friedrich
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissär Ferrari
- Sprache: Deutsch
Kommissär Francesco Ferrari liebt Basel, seine Stadt. Sie ist beschaulich und friedlich. Zumindest meistens. Ein Anruf reisst ihn eines frühen Morgens aus seinen Gedanken und führt ihn zum Rheinufer. Auf einer der Fussgängerfähren ist ein toter Mann gefunden worden. Ferrari wird den Eindruck nicht los, das Gesicht des Toten schon einmal gesehen zu haben. Mit Recht, denn der Ermordete war ein berühmter Künstler aus der Basler Schickeria. Und ehe sich der Kommissär versieht, steckt er mitten drin in einem undurchsichtigen Sumpf aus Korruption, Macht und bedingungsloser Liebe, umgeben von einflussreichen Verdächtigen, die aus ihrer Abneigung zu dem Toten keinen Hehl machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Gold
Tod auf der Fähre
Alle Rechte vorbehalten
© 2006 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
© eBook 2013 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Lektorat: Claudia Leuppi
Gestaltung: Bernadette Leus, www.leusgrafikbox.ch
ISBN 978-3-7245-1946-1
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-1691-0
Ungekürzte Taschenbuchausgabe 2010
3. Auflage 2012
www.reinhardt.ch
Wyti Blätz und stilli Egge,
Diirm und Muure, brait und grooss,
Hyyser, wo sich fascht verstegge,
Dalbeloch und Freii Strooss,
halb Seldwyla und dernääbe
au e Groossstadt, wo sich streggt,
bald verschlooffe, bald voll Lääbe,
wenn der Moorgestraich si weggt,
Lyt mit Fraid an Traditioone,
und fir s Nei doch intressiert,
gäärn baraad, die andre z flohne,
und uff ai Mool reserviert,
Stadt, wo d Wind um d Gränze waihe
und wo d Fäärni loggt und griesst
und wo graad, wenn di wottsch fraie,
dir der Fehn in d Gnoche schiesst …
I bi doch in dyne Muure
mit der Aarbed, mit de Draim,
mit de Fraide, mit em Druure
fir e Lääbe lang dehaim.
Aus «My Stadt» von Blasius
1. Kapitel
Der Fährimann tastete sich die steilen Stufen zum Landungssteg hinunter. Das Boot schwankte in der starken Strömung unruhig hin und her. Es war Ende Juni. Der Sommer hatte mit sintflutartigen Regenfällen und Temperaturen um die zwanzig Grad begonnen. Der Pegel des Rheins stand bereits so hoch, dass die Schifffahrt seit zwei Tagen eingestellt worden war. Zum Glück kam das nicht allzu oft vor. Denn Peter Tobler liebte seinen Beruf. Diese wohl tuende Ruhe, das stete Gleiten und immerwährende Fliessen, das konnte er mit Worten nicht beschreiben. An normalen Arbeitstagen gehörte die allererste Fahrt ihm allein. In einer halben Stunde würde er dann die ersten Arbeiter vom St. Johannsquartier ins Klingental bringen. Die Touristen kamen erst später am Tag, meist nur bei schönem Wetter. Und genau das war nicht in Sicht. Die Wetterprognose sagte nach kurzen Aufhellungen neue starke Regenfälle auf den Mittag voraus.
Elender Mist. Peter Tobler hatte eine unruhige Nacht hinter sich. Irgendetwas machte ihn nervös und trieb ihn trotz Hochwasser auf seine Fähre. Er schlurfte vorsichtig über den glitschigen Steg, griff nach seinem Schlüsselbund, um die Kette an der kleinen Holztür zu öffnen. Irritiert betrachtete er die am Boden liegende, durchtrennte Kette. Peter Tobler fluchte. Chaoten hatten sich in der vergangenen Nacht einen üblen Streich ausgedacht. Das kam öfters vor. Dieses elende Gesindel schwärmte nachts durch die Stadt und machte vor nichts Halt. Eine Schande war das! Allmählich drängten sich ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkenwand. Auch Toblers Gesicht hellte sich etwas auf, denn seine Fähre schien keinen Schaden genommen zu haben. Keine Sprayereien, keine eingeschlagenen Scheiben. Glück gehabt. Vermutlich hatte das junge Pack nur ein paar Bierchen gekippt und sich dann wieder verzogen.
Der Fährimann öffnete die Kabinentür. Was war das? Die Tür war nicht verschlossen. «Ich werde langsam alt und vergesslich», brummte er vor sich hin, «oder …» Tobler verschlug es die Sprache. Auf dem Boden lag ein Mann. Sein erster Schrecken wich einem Wutanfall. Ein Betrunkener, dachte er. Tobler versetzte dem Mann mit dem Fuss einen Tritt, um ihn wachzurütteln. Mürrisch, noch immer fluchend, da sich der Kerl nicht rührte, drehte er den Mann unsanft auf den Rücken und starrte in die Augen eines Toten.
2. Kapitel
Francesco Ferrari fuhr mit dem Dreier ins Kriminalkommissariat, als sein Handy piepste. Er übersah die vorwurfsvollen Blicke seiner Mitfahrer, die ihm peinlich waren. Diskret schaltete er das Gerät auf lautlos und stieg an der nächsten Haltestelle aus. In der Hektik hatte Ferrari sein Handy ausgeschaltet. Er fluchte halblaut, gab den Code ein und wählte die Nummer seines Büros. Der Rufton erklang einige Male, dann hörte er die Stimme seines Assistenten.
«Baer.»
«Ferrari hier. Haben Sie vor einigen Minuten versucht, mich zu erreichen?»
«Ja, Chef, ich habe Sie angerufen. Stimmt etwas mit Ihrem Handy nicht?»
«Wie kommen Sie darauf?»
«Zuerst läutete es ganz normal, dann war die Verbindung auf einmal ganz weg.»
«Hm, ich werde es beobachten, hatte bis jetzt den Eindruck, dass es ganz gut funktioniert», brummte Ferrari in die Muschel, wenn man die kleinen Pünktchen überhaupt als solche bezeichnen konnte. «Sie rufen mich aber bestimmt nicht an, um mit mir über mein Handy zu diskutieren, oder?»
«Nein, Chef, auf der Klingentalfähre wurde ein Toter gefunden, wahrscheinlich ermordet.»
«Gut oder vielmehr nicht gut. Dann treffen wir uns am Rheinufer. Wo liegt die Fähre?»
«Im Kleinbasel.»
«Treffen wir uns …», Ferrari blickte kurz auf seine Uhr, «sagen wir in zwanzig Minuten auf der Fähre.»
Ferrari stellte sein Handy erneut auf lautlos und versicherte sich, dass er es nicht wieder aus Versehen ausgeschaltet hatte. Ein Toter auf der Klingentalfähre. Musste das sein? Ausgerechnet an einem Ort voller Kindheitserinnerungen! Auf der Bank knieend, liess er als kleiner Junge die Hände übers Wasser gleiten und wurde für ein paar Minuten zum Kapitän einer gigantischen Piratenflotte, zum unberechenbaren Herrscher der Weltmeere, der die Seefahrernationen in Angst und Schrecken versetzte. Manche Kinderträume blieben eben nur Träume. Anstatt eines Tages als Pirat am Galgen zu enden, hatte er sich auf die Seite des Gesetzes geschlagen. Auch gut. Er schritt zügig am Gebäude der UBS vorbei, warf einen Blick in die Eingangshalle, in der ein riesiger Rubin hing. Oder war es ein Saphir? Egal, mit einem echten Edelstein in dieser Grösse wäre er auf alle Fälle jegliche finanziellen Sorgen los und müsste nicht Tag für Tag im Waaghof zur Arbeit erscheinen. Nachdenklich betrachtete er den Hammering Man. Langsam, sehr langsam hob und senkte sich der Arm der Eisenplastik. Schlag für Schlag. Ununterbrochen.
Das Gedränge auf dem Aeschenplatz verstärkte sich. Mühsam bahnte er sich einen Weg durch die Menschenmenge. Obwohl die Stadt über ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln verfügte, hatte Ferrari den Eindruck, stundenlang auf das nächste Tram zu warten. Endlich fuhr der Achter in die Haltestelle ein und spuckte eine weitere Menschenladung aus. Ferrari stieg in den hintersten Wagen. Seine Miene verfinsterte sich unheilvoll. Der vorderste Platz auf der rechten Seite war besetzt. Das war sein Platz, dort sass er immer. Provokativ stand er neben diesen Sitz und wartete so lange, bis der andere Fahrgast resignierte und ihn freigab. Nicht immer siegte Ferrari in einem solchen stummen Duell, manchmal bewies ein Gast Nervenstärke und blieb einfach sitzen.
An der Rheingasse stieg der Kommissär aus, überquerte die Strasse und trottete die Treppe zur Rheinpromenade hinunter. Von Weitem sah er bereits eine Schar von Neugierigen, die eine Sensation erhaschen wollten, und zwei Polizeifahrzeuge, die das Rheinufer absperrten. Er war erstaunt, dass sich um diese Zeit so viele Menschen an der Promenade aufhielten. Er bahnte sich einen Weg durch die Menge, begleitet von bösen Bemerkungen einiger Leute, die ihn für besonders sensationslüstern hielten. Ein uniformierter Polizist erkannte ihn, salutierte und half ihm, eine Schneise zu bahnen.
Baer hatte die Spurensicherung und den Polizeiarzt mit seinem Team aufgeboten. Ferraris Assistent war ein ehrgeiziger Mann, übereifrig wäre wahrscheinlich eher der richtige Ausdruck. Baer hatte es innert Kürze zum Detektiv-Wachtmeister gebracht. Nicht immer mit legalen Mitteln, wie man munkelte. Er wurde von Staatsanwalt Borer protegiert. Und dieser Borer hatte ihm den jungen Mann als Assistenten zugeteilt, besser gesagt, aufgedrängt. Um ihm ein wenig die Flügel zu stutzen, wie sich der Staatsanwalt ausgedrückt hatte. Der letzte Fall war Baer gründlich entglitten und zu einer persönlichen Katastrophe ausgeartet. Er war mit seinen Ermittlungen in einer Sackgasse gelandet, hatte von Anfang an geglaubt, den Täter zu kennen. Nachdem ein anderer Kommissär zufälligerweise den wirklichen Täter gefasst hatte, musste Baer Abbitte leisten. Er erhielt einen Verweis mit einem Eintrag in seiner Personalakte, da die zu Unrecht beschuldigte Person eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn eingereicht hatte. Staatsanwalt Borer liess Milde walten, versetzte ihn als Assistenten zu Ferrari, um ihn für einen oder zwei Fälle aus der Schusslinie zu ziehen, gab Baer aber unmissverständlich zu verstehen, dass er sich im Wiederholungsfalle in der Uniform wiederfinden würde.
Ferrari zog den Reissverschluss seiner Jacke hoch. Hier unten am Rheinufer wehte eine starke Bise. Er trampelte unbeholfen über den Steg zur Fähre. Der Fährimann, den er vom Sehen her kannte, sass zerknirscht auf einer Holzbank. Als er die unsicheren Schritte des Kommissärs bemerkte, erhob er sich und half ihm ins Boot.
«Vielen Dank, Herr …»
«Tobler.»
«… Herr Tobler. Ich bin Kriminalkommissär Ferrari. Ich ermittle in diesem Fall. Haben Sie den Toten entdeckt?»
«Kommissär?»
Ferrari schmunzelte.
«Sie haben schon richtig gehört, Herr Tobler. Ä anstatt a. Lassen Sie den Kommissär einfach weg, das ist am einfachsten. Also, Sie haben den Toten entdeckt?»
«Ja. Die Kette war aufgebrochen.»
Er deutete auf den Steg. Ferrari drehte sich um. In seiner Angst, dass der klapprige Holzsteg unter ihm zusammenkrachen könnte und die schadenfreudigen Kollegen ihn aus dem trüben Wasser fischen müssten, hatte er das Holztürchen überhaupt nicht bemerkt.
«Ich dachte, dass irgendwelche Chaoten das Schloss geknackt hätten. Das ist schon öfters vorgekommen. Dann erst habe ich bemerkt, dass die Kabinentüre nicht verschlossen war. Mann, bin ich erschrocken, als da einer lag. Ich wäre fast auf ihn getreten! Und sauer war ich auch. Ziemlich unsanft habe ich ihn umgedreht.» Er machte mit dem Kopf eine ruckartige Bewegung zur Leiche hin, neben der Baer und der Polizeiarzt knieten.
Ferrari trat ins Innere und betrachtete den Toten genauer. Er lag mit entstelltem Gesichtsausdruck da, nein, falsch, mit ungläubigen, von Entsetzen geweiteten Augen. Ferrari war nahe daran, sich zu übergeben. Verstärkt wurde sein drückendes Gefühl in der Magengegend noch durch das Schwanken der Fähre.
«Ah, da sind Sie ja, Chef. Ich habe bereits alles Notwendige veranlasst. Der Mann ist wahrscheinlich erschlagen worden.»
Ferrari nickte mit zusammengepressten Lippen. Wahrscheinlich müsste er erbrechen, wenn er jetzt etwas sagen würde. Als er den Polizeiarzt Strub fragend anschaute, bestätigte dieser kopfnickend Baers Theorie.
«Die genaue Todesursache und alles Weitere erhältst du morgen früh, Francesco. Wenn du ins Büro kommst, liegt der Autopsiebericht auf deinem Schreibtisch. Du siehst bleich aus. Ist dir übel?»
Ferrari setzte sich auf die Holzbank im Innern der Kabine. Langsam bekam er seine Magenwände wieder in den Griff.
«Ich habe immer gedacht, dass ihr Italiener ein Volk von Seefahrern seid. Du scheinst aus der Art geschlagen zu sein», stichelte Strub.
Der Kommissär fühlte sich viel zu schlecht, um mit seinem Kollegen zu streiten. Das einzig Italienische an ihm war sein Name. Seine Familie lebte seit mehreren Generationen in der Schweiz. Er selbst war mit Leib und Seele Basler und sprach kein einziges Wort Italienisch, wenn man von Ciao absah. Komisch, dachte er, wie ein Name eine Verbindung schaffen kann.
«Du weisst ganz genau, Peter … ach was … was solls?», wischte er seine letzte Bemerkung mit einer Handbewegung weg. «Du bist ein hoffnungsloser Fall.»
Ferrari wandte sich wieder dem Toten zu. Er war wie ein Handwerker gekleidet. Er trug einen Overall, oben über der behaarten Brust geöffnet, dazu Turnschuhe. Seine feingliedrigen Hände passten irgendwie nicht zu seiner Kleidung. Eine attraktive, athletische Gestalt, so um die Fünfzig. Der Mann war sich seines guten Aussehens bestimmt voll bewusst gewesen. Es kam ihm vor, als ob er ihn schon einmal gesehen hätte.
«Ich kenne den Mann von irgendwoher.»
«Da bin ich sicher. Jeder hier kennt ihn, Chef.»
Und als der Kommissär seinen Assistenten fragend anschaute, fuhr dieser betont genüsslich fort. «Da liegt der berühmte Frank Brehm, seines Zeichens der bedeutendste Schweizer Künstler der Gegenwart.»
Ferrari schlug sich mit der rechten Hand gegen die Stirn. Natürlich! Frank Brehm, der grosse Basler Künstler, Gaststar an der Documenta in Kassel, hatte zahlreiche Auszeichnungen in verschiedenen Ländern erhalten und bedeutende Museen nahmen seine abstrakten Werke in ihre Sammlungen auf. Und, wenn er sich nicht irrte, dann fand zurzeit in einer Basler Galerie eine weit über die Grenzen hinaus gerühmte Ausstellung der neusten Werke des Genies statt. Gestern oder vorgestern hatte er einen ganzseitigen Bericht in der «Basler Zeitung» über die Ausstellung überflogen. Ein Loblied, eine einzige Hymne. Ferrari nahm sich vor, den Artikel zu Hause nochmals zu lesen.
«Das gibt einen interessanten Fall», hörte er Baer sagen.
«Interessant?»
«Aber ja doch, Chef. Stellen Sie sich die Publizität vor, wenn wir den Mörder stellen!», Baers glänzende Augen waren nicht zu übersehen. Er fuhr mit der Hand durch die Luft und schrieb bereits die Schlagzeilen: «Basler Polizei fasst den Mörder von Frank Brehm!»
«Vorerst wird es wohl erst einmal heissen, Frank Brehm ermordet, die Basler Polizei tappt im Dunkeln!», murmelte Ferrari.
Die Leiche wurde abtransportiert.
«Francesco. Willst du die Leiche nochmals sehen?», fragte Strub.
«Das muss nicht sein.»
«Für einen Kommissär bist du manchmal recht zart besaitet», bemerkte der Arzt, nickte Baer kurz zu und verliess die Fähre.
«Haben Sie die Personalien des Fährimanns aufgenommen, Baer?»
«Aber selbstverständlich, Chef.» In der Antwort seines Assistenten schwang eine Spur von Ärger und Arroganz mit. Baer stapfte dem Polizeiarzt nach. Der Kommissär sah sich nochmals in der Kabine um. Wahrscheinlich, nein, sicher war seinem Assistenten nichts entgangen, aber man konnte ja nie wissen. Das Innere der Kabine war schlicht und zweckmässig eingerichtet. Bänke den Wänden entlang, für die Fahrgäste, falls es regnete und sie sich ins Trockene setzen wollten. Eine Ablage mit kleinen Basler Souvenirs und eine Kiste mit persönlichen Dingen des Fährimanns. An den Wänden hingen einige Ansichtskarten, die begeisterte Touristen geschrieben hatten. Ferrari nahm ein von Blasius verfasstes Buch in die Hand. Er blätterte es durch, las ein Gedicht des Stadtpoeten, legte es zurück und strich in Gedanken versunken über den Fähri-Pin.
«Was kostet der?»
«Zehn Franken. Leider ist er nicht mehr so gefragt», antwortete Tobler.
Stimmt. Nicole, die Tochter seiner Freundin, hatte ihn ausgelacht, als er ihr vor ein paar Monaten einen Pin geschenkt hatte. Das sei doch Schnee von vorgestern. Dann halt nicht, der Kommissär liess sein Portemonnaie wieder in der Hosentasche verschwinden.
Ferrari hatte seine Freundin Monika Wenger nach dem tragischen Unfall ihres Mannes kennen gelernt. Zuerst deuteten alle Verdachtsmomente auf ein Tötungsdelikt hin. Ferrari stellte während der Ermittlungen sehr bald fest, dass Monikas Mann mit dem Leben nicht mehr fertig geworden war. Sie sprach vor einigen Monaten erstmals offen aus, was er immer wieder gedacht hatte. Sein Tod sei ein unglücklicher Zufall gewesen. Er sei gestorben, wie er gelebt habe. Nie habe er eine Entscheidung getroffen. Und das Schicksal hatte ihm die letzte abgenommen. Ferrari war Monika dankbar für ihre offenen Worte. Sie hatten zuvor nie darüber gesprochen. Ihre Offenheit war ein untrügliches Zeichen, dass sie nach Jahren endlich mit der Vergangenheit abgeschlossen hatte.
Ferrari bedankte sich bei Peter Tobler und verliess die Fähre. Baer hatte sich inzwischen an der Rheinpromenade in Szene gesetzt. Er wurde vom stadtbekannten Journalisten Norbert Strahm interviewt. Als der Kommissär sich näherte, senkte Baer verlegen seinen Blick.
«Ah, da ist ja auch der Commissario.»
Irgendwann musste er wohl oder übel einen Italienischkurs belegen, um den Vorurteilen der Leute gerecht zu werden.
«Ihr Assistent hat mich vollständig informiert. Eine sensationelle Story! Möchten Sie den Ausführungen Baers noch etwas hinzufügen?»
«Ich vermute, dass er Ihnen alles gesagt hat, was es zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen…», Ferrari konsultierte seine Armbanduhr, «und immerhin arbeiten wir bereits dreissig Minuten an diesem Fall, was es zu diesem Zeitpunkt zu sagen gibt. Und was er Ihnen nicht sagen konnte, weil wir es schlicht und einfach nicht wissen, werden Sie bestimmt dank Ihrer Fantasie sinnvoll ergänzen, damit Ihre Leser nach der Fortsetzung lechzen», fügte er mit sarkastischem Unterton hinzu. Der Journalist lachte.
«Wunderbar, wie immer bestens gelaunt. Eine wahre Quelle der Weisheit, die vor Informationen nur so sprudelt.»
«Nun, da alles gesagt ist, müssen Sie uns entschuldigen.»
Der Kommissär packte seinen Assistenten am Arm und zog ihn mit festem Griff fort.
«Was haben Sie dem Typen alles erzählt, Baer?»
«Nichts. Ich meine …», er reagierte trotzig wie ein getadeltes Kind. «Ich habe ihm nur gesagt, wer der Tote ist und wie er umgebracht wurde.»
«Dann wissen Sie mehr als ich. Bevor wir den Autopsiebericht nicht in Händen halten, sollten wir mit derartigen Auskünften vorsichtig sein.»
Baer verkniff sich eine rechtfertigende Antwort, um nicht noch mehr anzuecken.
«Jetzt brauche ich einen anständigen Kaffee und ein Croissant. Wo gibt es das hier in der Gegend, Baer?»
«Am besten gehen wir ins Café ‹Spillmann›.»
3. Kapitel
Schweigend überquerten sie die Mittlere Brücke. Ferrari sah auf den Rhein hinunter. Keine Frachtkähne weit und breit und auch keine Kajakfahrer in Ufernähe. Nur ein dreckigbrauner, tobender Fluss, der wahllos Äste und Sträucher mit sich riss. In der Mitte trieb ein mächtiger Baumstamm, einem Ertrinkenden gleich nach Luft schnappend, um innert Sekunden wieder unter Wasser gerissen zu werden. Nichts erinnerte mehr an den sonst so gemächlich fliessenden Rhein. Die Lieblichkeit war gewichen. Wenn der Regen anhielt, würde der Fluss bald über die Ufer treten. So wie damals im neunundneunzig. Ein heftiger Windstoss erfasste die Bäume entlang der Kleinbasler Rheinpromenade. Der Kommissär hielt sich für einen kurzen Moment am Geländer fest, während einige Passanten verzweifelt versuchten, ihre Regenschirme aufzuspannen.
Im Café «Spillmann» bestellte Ferrari zwei Cappuccino – oder hiess es Cappuccini? – und einige Croissants.
«Hören Sie, Baer, Sie wurden mir zugeteilt. Wir brauchen nicht näher darauf einzugehen weshalb. Dies ist unser erster grosser gemeinsamer Fall und, wenn es nach Borer geht, auch unser letzter. Es war mir von Anfang an klar, dass er Sie nur für kurze Zeit aus der Schusslinie ziehen will. Nach der Aufklärung, so Gott will, werden sich unsere Wege wieder trennen.»
Der Kellner brachte den Kaffee. Ferrari trank genüsslich und mit jedem Schluck besserte sich seine Laune.
«Sie wissen ganz genau, dass ich mich nicht um Sie als Assistenten gerissen habe. Sie sind ein sehr guter Polizist und Borer wird weiter an Ihrer Karriere basteln. Aber Sie und ich wissen, dass Ihr nächster grösserer Fauxpas das Ende Ihrer Laufbahn bedeutet. Ich will damit nur sagen, halten Sie sich zurück, mein Lieber. Seien Sie mit Ihren Äusserungen vorsichtig.»
Er ass ein Croissant und bestellte nochmals einen Cappuccino.
«Für Sie auch noch einen?»
«Nein, danke», brummte Baer sichtlich schlecht gelaunt.
«Bravo, jetzt sind Sie auch noch eingeschnappt. Das ist die beste Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Sie können es mir offen sagen, wenn Sie sich versetzen lassen wollen.»
«Und dann? Habe ich überhaupt eine Wahl? Meinen wichtigsten Fall habe ich vermasselt und der Kommissär, dem ich zugeteilt wurde, will mich loswerden. Das wars dann wohl. Karriere futsch, oder?»
«Ich will Sie keineswegs loswerden. Davon kann keine Rede sein. Ich will aber auch nicht Babysitter für einen übereifrigen Beamten spielen.»
Der letzte Satz war Ferrari herausgerutscht. Er hätte sich dafür ohrfeigen können.
«Ich habe verstanden, Chef. Bitte geben Sie mir Ihre Anweisungen. Sie werden keinen Augenblick bedauern, mit mir zusammenarbeiten zu müssen.»
So gewinnst du keine Freunde, Francesco, ärgerte sich Ferrari. Da sein Assistent auf stur machte und ziemlich alles an Floskeln über die Lippen brachte, die der Situation angepasst waren, betrachtete er die Diskussion als beendet. Worte konnten manchmal tödlicher sein als Waffen. Er gab seinem jüngeren Kollegen einige Anweisungen und bestellte sich, nach Baers förmlichem Abgang, einen weiteren Cappuccino.
Ferrari stellte die Fakten oder das, was er beiläufig aus der Presse und durch Monika über Frank Brehm wusste, zusammen. Brehm galt als die künstlerische Entdeckung der vergangenen Jahre schlechthin. Seine Mäzenin, die ihn entdeckt und die er dann auch geheiratet hatte, hiess Olivia Vischer. Nebst den Familien Merian, Sarasin, Burckhardt und einigen weiteren, die Ferrari nicht einfielen, gehörten die Vischers zu den alten Patrizierfamilien, die in Basel massgeblich die Fäden in den Händen hielten. Kein Anlass, kein Bankett, keine wichtige Veranstaltung konnte ohne diesen Basler «Daig» auskommen. Was für ein passendes Wort, schmunzelte Ferrari.
Nach Anfangsschwierigkeiten, denn es war ungeheuerlich, dass ein hergelaufener Taugenichts vom Lande eine Vischer heiratete, wurde Frank Brehm in den wohlhabenden Kreisen aufgenommen. Die Lästerer, die in ihm einen Heiratsschwindler, einen Erbschleicher sahen, verstummten nach und nach. Olivia Vischer hatte sich durchgesetzt, nicht zuletzt dank der Unterstützung ihres Vaters, Albert Vischer. Er hielt die Mehrheit an einem der grossen Pharmakonzerne der Stadt und zählte damit zu den reichsten Männern der Schweiz. Ferrari hörte bereits den Staatsanwalt, der ihn zu sich zitieren würde. Er wusste, dass er sehr diskret zu ermitteln hatte. Und falls er etwas zu Tage fördern würde, das in der oberen Schicht für Unruhe sorgen könnte, würde er den Staatsanwalt umgehend informieren. Die Macht des Geldes sollte man nicht unterschätzen, das hatte Ferrari früh gelernt.
Ferraris ungeliebtes Handy vibrierte. Es war Baer.
«Was gibt es?»
«Der Herr Staatsanwalt will Sie sprechen, Chef. Dringlichkeitsstufe eins!»
«Ich bin in einer Viertelstunde da.»
Der Kommissär bezahlte und verliess das Café. Er seufzte. Es war wärmer geworden, doch es regnete wieder. Mit hochgeschlagenem Kragen schlich sich Ferrari den Hauseingängen entlang. Der Regen verstärkte sich und artete ohne Vorwarnung zu einem Sommergewitter aus. Als er im Waaghof ankam, war er bis auf die Unterhose nass. Wahrscheinlich würde er sich eine Erkältung holen. Aber vielleicht immer noch besser, als sich mit der Hochfinanz anzulegen und einen mürrischen Staatsanwalt im Nacken zu spüren, der über jeden seiner Schritte genauestens informiert werden wollte. Und der notfalls eingreifen würde, falls er in ein Wespennest stechen würde. Ferrari trocknete sich mit einem Handtuch ab. Auf dem Weg zu seinem Vorgesetzten philosophierte er darüber, dass er sich an Tagen wie diesem unter der Bettdecke verkriechen sollte. Einfach gar nicht erst aufstehen. Das wäre mit Abstand das Beste.
4. Kapitel
Staatsanwalt Jakob Borer lief unruhig in seinem Büro auf und ab. Nervös kramte er einen Gesetzesband aus dem Bücherregal, legte ihn wieder zurück und ergriff wahllos den nächsten. Als es klopfte, öffnete er innert Sekunden die Tür, ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, Besucher mindestens ein paar Minuten warten zu lassen.
«Ah, endlich, da sind Sie ja, Ferrari. Kommen Sie herein.»
Bevor er wusste, wie ihm geschah, wurde Ferrari vom Staatsanwalt durchs Zimmer geschoben und auf einen Stuhl gedrückt. Borer eilte um den Tisch herum, schlug sich das Bein an der Tischkante an und setzte sich fluchend, das malträtierte Bein massierend, auf seinen Ledersessel.
«Eine vertrackte Geschichte.»
«Tuts weh?»
«Das meine ich nicht, Ferrari. Ich meine den Tod von Frank Brehm.»
«Ja, es scheint so, als ob ihm jemand den Schädel eingeschlagen hat.»
«Und das ausgerechnet auf dem Höhepunkt seiner Karriere.»
Der Kommissär stellte sich die Frage, ob es Frank Brehm eine Rolle gespielt hätte, sich am Anfang seiner Karriere oder erst jetzt, auf dem Zenit, ermorden zu lassen. Da er die Antwort mit ins Grab genommen hatte, behielt er die Frage für sich.
«Ich möchte Sie um eines bitten.»
Ferrari wusste bereits, was folgte: Diskretion war angesagt, weil wichtige und einflussreiche Persönlichkeiten mit dem Fall zu tun hatten, ja Taktgefühl, und er wünsche, über sämtliche Schritte, die unternommen werden, unverzüglich informiert zu werden.
«Ich bitte Sie, dass Sie alles Erdenkliche unternehmen, damit der Mörder gefasst wird. Sie haben meine vollste Unterstützung.»
Er wartete darauf, dass Borer auf den Punkt kam.
«Haben Sie mich verstanden, Ferrari?»
«Wie? Ja, natürlich. Haben Sie noch weitere Anweisungen für mich?»
«Nein, ich wollte Ihnen nur meine vollste Unterstützung signalisieren. Ich erwarte von Ihnen eine lückenlose Aufklärung des Tötungsdelikts. Und dies so schnell wie irgend möglich.»
Heute war definitiv nicht sein Tag. Schlechtes Wetter, ein Mord an einem berühmten Künstler und nicht einmal auf Borer und seine Floskeln war Verlass. Er fühlte sich unwohl und informierte sichtlich irritiert den Staatsanwalt über seine nächsten Schritte.