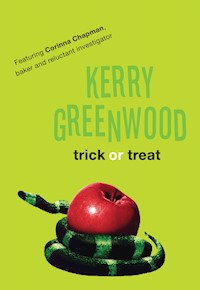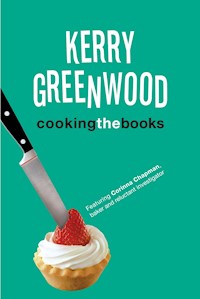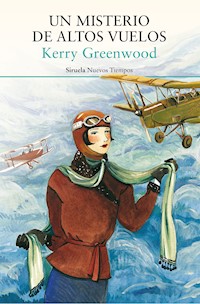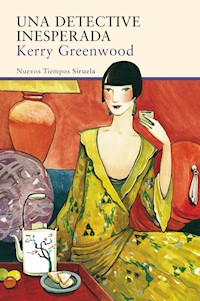11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wieder einmal ist Miss Fishers Spürsinn gefragt. Ein Orchesterdirigent, von niemandem besonders gemocht, wird tot aufgefunden: ermordet auf höchst extravagante Weise, in der Mendelssohns Elias eine zentrale Rolle spielt.
Während die clevere Detektivin entschlossen ist, das Rätsel um die ›Partitur des Todes‹ zu lösen, versucht sie zeitgleich, auf ihre einzigartige Weise, einem alten Freund zu helfen, der unglücklich in den genialen wie unsympathischen Mathematiker und Codeknacker Rubert Sheffield verliebt ist.
Glamourös, klug und unabhängig, eine moderne Frau und eine gewitzte Detektivin – das ist Miss Phryne Fisher. Die wohlhabende englische Aristokratin genießt ihr Leben im Melbourne der wilden Zwanziger in vollen Zügen – und löst nebenbei einen Mordfall nach dem anderen. Nicht immer zur Freude der örtlichen Polizei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Titel
Kerry Greenwood
Tod eines Dirigenten
Miss Fishers mysteriöse Mordfälle
Roman
Aus dem australischen Englisch von Regina Rawlinson und Sabine Lohmann
Insel Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Originaltitel Murder and MendelssohnAllen & Unwin, Crows Nest, AustraliaCopyright © 2013 by Kerry Greenwood
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4923.
Erste Auflage 2022insel taschenbuch 4923Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfoto: Essie Davis als Miss Phryne Fisher in Miss Fisher’s Murder Mysterie, © Ben King, Every Cloud Productions, Yarraville
eISBN 978-3-458-77341-2
www.suhrkamp.de
Tod eines Dirigenten
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nachweise
Informationen zum Buch
1
Wie von der Kraft der heiligen Weisen
Die Sphären sich zu drehn anfingen,
Um ihren Schöpfer GOTT zu preisen
Und ihm sein himmlisch Lob zu singen;
So lässt, wenn diese Welt vergeht
Und vor dem Herrn und Richter steht,
Trompetenton die Welt erbeben:
Das Leben stirbt, die Toten leben,
Auf wird Musik den Himmel heben.
John Dryden
Ode auf den Tag der heiligen Cäcilie
Das Jahr 1929, ein lauer Sommermorgen in St. Kilda. Eingehüllt in eine Wolke aus betörenden Düften, saß die Ehrenwerte Miss Phryne Fisher in ihrer jasminumrankten Gartenlaube. Sie trug einen Morgenmantel aus blassgrüner Seide, bestickt mit goldenen Phönixen, dem Symbol der chinesischen Kaiserin. Auf den weiten Flügelärmeln zogen flammende Perlen wie Kometen ihre Bahn. Das lackschwarze, zum adretten Pagenkopf geschnittene Haar umrahmte ihr Gesicht, während sie sich über ihre Lektüre beugte. Sie knabberte an einem Croissant und trank dazu eine Tasse Café au Lait. Mit ihren rosa Wangen, den roten Lippen und den grünen Augen sah sie wie eine kolorierte französische Modezeichnung aus.
Stolz wie die Katzengöttin Bastet thronte der schwarze Kater Ember vor ihr auf dem Tisch, in Erwartung der Leckerbissen, die für ein so wunderschönes, braves Geschöpf, wie er es war, mit Sicherheit abfallen mussten, vor allem nachdem er, dieser Ausbund an Geduld, noch nicht einmal eine Pfote nach dem kross gebratenen Frühstücksspeck ausgestreckt hatte. Für den Fall allerdings, dass die ihm gebührende Opfergabe noch sehr viel länger auf sich warten lassen würde, hatte er längst Maßnahmen zur tätigen Selbsthilfe erwogen.
Man wäre nicht überrascht gewesen, hätte man Phryne eine Vogue lesen sehen – oder den neuesten französischen Skandalroman –, dabei ihren von den Ausschweifungen der vergangenen Nacht gezeichneten Liebhaber hin und wieder mit einer geistreichen, launigen Bemerkung über das Buch unterhaltend. Was sie tatsächlich las, passte ganz und gar nicht in dieses Bild: Es war ein Obduktionsbericht. Auch bei ihrem Tischgenossen handelte es sich nicht um einen feurigen Galan, sondern um einen übernächtigten Polizeibeamten, der sich Mrs Butlers Frühstück schmecken ließ und als Mittel gegen den Schlafmangel große Mengen an starkem Schwarztee in sich hineinschüttete.
Phrynes Vertraute Dot saß dabei und bestickte die Tischwäsche für ihre Aussteuer mit Waratah-Blüten. Nachdem sie fest entschlossen war, sich in absehbarer Zeit mit Detective Sergeant Hugh Collins zu vermählen, wollte sie für jenen Freudentag gewappnet sein. Tinker und Jane hatten sich ein schattiges Plätzchen gesucht und spielten Schach. Ruth half Mrs Butler in der Küche beim Erbsenschälen und erörterte mit ihr die besten Zubereitungsarten für Ananas. Unter dem Tisch lag die schwarz-weiße Schäferhündin Molly, den Kopf auf die Füße des Inspectors gebettet, felsenfest davon überzeugt, dass er ihr ein Häppchen Speck abgeben würde, bevor seine Zehen einschliefen. Mit diesem Trick hatte sie noch immer Erfolg gehabt, und falls er einmal nicht funktionierte, kannte sie noch einen anderen. Männlichen Gästen legte Molly den Kopf in den Schoß und ließ andeutungsweise das Gebiss hervorblitzen, worauf sich das gewünschte Ergebnis in der Regel wie von selbst einstellte.
Begleitet von den leisen Geräuschen nützlichen Tuns, machte Mr Butler es sich in seinem weichen Sessel bequem, um sich ein Tässchen Kaffee zu gönnen, das er sich mit dem Servieren des Frühstücks redlich verdient hatte. Zum Glück konnte er nicht hören, worum sich das Gespräch im Garten drehte.
»Schön.« Phryne legte den Bericht weg und schenkte ihrem Lieblingspolizisten Tee nach, lakritzschwarz, wie er ihn am liebsten mochte, und so viel Tannin enthaltend, dass man damit einen Waschkessel Strümpfe hätte färben können. Er rührte einen Schuss Milch und drei Stück Würfelzucker hinein. Generationen von Teeliebhabern drehten sich im Grabe um. »Interessante Lektüre. Jemand hat einem Dirigenten einen Schwung Notenblätter in den Rachen gestopft, den Elias von Mendelssohn. Und er ist daran erstickt.«
»Genau«, sagte der Inspector.
»Kommt mir sogar für eine Musikkritik ein kleines bisschen übertrieben vor«, bemerkte Phryne. »Der Polizeiarzt hat den Leichnam sachkundig obduziert. Es wurden Blut- und Urinproben entnommen, der Mageninhalt analysiert. Es deuten keinerlei Anzeichen auf einen Kampf hin, weder Kratzer noch Schrammen, lediglich Blutergüsse auf den Schultern, die darauf schließen lassen, dass der Mörder auf ihm kniete, während er ihn erstickte. Die Abdrücke dürften von Kniescheiben stammen. Und warum hat er sich nicht gewehrt?« Sie hob die Augenbrauen. »Weil er genügend Opiate im Blut hatte, um ein kleineres Nashorn außer Gefecht zu setzen. Beziehungsweise, um ihn selbst zu töten. Weshalb man sich die Erstickung mittels Noten hätte sparen können. Barock, ja, schon fast Rokoko. Sie haben es mit einem extravaganten Täter zu tun, mein lieber Jack, mit einem Mörder, der etwas beweisen wollte.«
»Gut«, sagte Jack. »Aber was? Ich habe von Musik nicht den leisesten Schimmer. Und auch der dazugehörige Menschenschlag ist mir ein Rätsel. Da dachte ich mir …« Er verstummte und stärkte sich mit einem Schluck Teerwassertee.
Phryne lächelte. Weil sie wusste, wie sehr es Jack Robinson widerstrebte, sie inoffiziell um ihre unnachahmliche Mithilfe zu bitten, sprang sie ihm bei.
»Ich war schon immer eine große Mendelssohn-Freundin«, sagte sie. »Wer führt den Elias denn auf?«
»Der Melbourne Harmony Choir, begleitet vom Occasional Orchestra. Ein Laienchor, aber mit einem professionellen Dirigenten und verstärkt durch professionelle Solisten«, las Jack ihr aus seinen Notizen vor. »Der Tote – Hedley Tregennis, 45 Jahre alt, geboren in Richmond, von seiner Frau getrennt lebend, keine Kinder. Stand in dem Ruf, ein lauter, beleidigender und aufbrausender Mensch zu sein.«
»Das trifft auf die meisten Dirigenten zu.«
»Das ist ja genau meine Rede. Für mich ist das eine fremde Welt. Heute Abend findet im Gemeindesaal der Scots Church eine Chorprobe statt, vor dem öffentlichen Lichtbildvortrag. Könnten Sie mich dahin begleiten? Ihnen fallen bestimmt ganz andere Sachen auf als mir. Aber seien Sie gewarnt«, fügte er nervös hinzu, als er das verräterische Glitzern in ihren grünen Augen sah. »Kommen Sie mir bloß nicht auf die Idee, es wäre Ihr Fall. Das können Sie sich gleich aus dem Kopf schlagen.«
»Aber nein, wie käme ich denn darauf?«, gurrte Phryne. »Um wie viel Uhr geht es los? Soll ich Sie abholen?«
»Fährt Mr Butler?«, fragte der Inspector. Miss Fisher fuhr wie eine Dämonin. Er musste die ganze Zeit die Augen zusammenkneifen, um ihre vielen Verkehrsverstöße nicht zu bemerken, und wenn er mit geschlossenen Augen in einem fahrenden Auto saß, wurde ihm übel.
»Ja, in der Collins Street kann man doch nirgends parken.«
»Gut. Dann um halb sechs auf dem Revier.«
»Worum geht es denn bei dem Lichtbildvortrag?«, fragte sie, während er erst Molly und dann Ember ein paar Stückchen Speck zusteckte. Er wischte sich noch schnell mit der Serviette über den Mund und stand auf, bereit, erneut in die Welt hinauszutreten.
»Gehalten wird er von einem gewissen Rupert Sheffield«, antwortete er. »Und das Thema lautet ›Die Wissenschaft der Deduktion‹. Da kann ich ihn gleich um Hilfe bitten.« Damit verabschiedete er sich, Mrs Butler im Vorbeigehen noch ein Dankeschön in die Küche zurufend.
Unerklärlicherweise fühlte Phryne sich in ihrem Stolz getroffen. Die Wissenschaft der Deduktion? Was die Deduktion anging, konnte es die Ehrenwerte Miss Phryne Fisher jederzeit mit einem Mann namens Rupert Sheffield aufnehmen.
Lächerlich. Sie schüttelte sich wie eine gekränkte Katze und verspeiste mit weiß blitzenden Zähnen den Rest ihres Croissants.
»Haben wir einen Fall, Chefin?«, fragte Tinker. Wie ein struppiger kleiner Terrier hatte sich der Fischerjunge so lange an Phryne gehängt und sich nützlich gemacht, bis sie nicht mehr auf ihn verzichten wollte. Außerdem war er ein lieber, kluger Junge. Und ein begeisterter Sexton-Blake-Leser. Er passte gut in ihre kleine Familie. Ihre Adoptivtochter Jane brachte ihm Schach bei, während sich Ruth, die andere angenommene Tochter, über seinen unbändigen Appetit freute, den nicht einmal leicht misslungene kulinarische Experimente dämpfen konnten. Mr und Mrs Butler waren froh, dass die Küche regelmäßig mit frischem Fisch versorgt wurde, und Dot fand es beruhigend, dass im Gartenhaus jemand schlief. Molly begleitete Tinker gern zum Angeln, und Ember duldete ihn mit der ihm eigenen amüsierten Herablassung. Der Kater interessierte sich ausschließlich für die Familienmitglieder Phryne, Ruth und Jane, über die er seine schützende Pfote hielt. Andere Menschen kamen höchstens dann in den Genuss seiner Beachtung, wenn sie ihm essbare Gaben darbrachten. Dass Tinker stillschweigend von ihm toleriert wurde, verdankte sich auch der Tatsache, dass er mit Fisch nicht knauserte.
Kurzum, der Junge war vom gesamten Haushalt mit so viel Wohlwollen aufgenommen worden, dass er sich vollkommen natürlich hineingefügt hatte. Er bewunderte Phryne zutiefst, und genau wie Dot machte er sich ständig Sorgen um sie. Für jemanden, der gerade einmal einen Meter fünfzig maß und in einem mit Wasser vollgesogenen Soldatenmantel keine 50 Kilogramm auf die Waage gebracht hätte, war sie ihm viel zu wagemutig. Andererseits kann die Gefahr bei einer Chorprobe und einem Lichtbildvortrag wohl als überschaubar bezeichnet werden.
Tinker konzentrierte sich wieder auf die Ausführungen seiner heißgeliebten Chefin, die ihre Truppen hinsichtlich des merkwürdigen Mordes auf den neuesten Stand brachte.
Oder bestand doch ein gewisses Risiko? Wie so oft suchte er in seiner Sorge Dots Blick. Auch ihr schien bei der Sache nicht wohl zu sein.
»Irgendwelche Ideen?«, fragte Phryne in die Runde.
»Der Täter muss sehr wütend gewesen sein«, antwortete Jane.
»Wie kommst du auf Wut?«
»Weil ihm Mr Tregennis' Tod nicht gereicht hat«, analysierte Jane, die einmal Ärztin werden wollte. »An der Überdosis wäre er sowieso gestorben. Wahrscheinlich war er kaum noch am Leben, als man ihm die Notenblätter in den Rachen gestopft hat.«
»Sieht ganz so aus«, sagte Phryne.
»Das Morphium hätte genügt, um ihn zu beseitigen«, stellte Tinker mit der ganzen Abgebrühtheit eines Vierzehnjährigen fest. »Aber der Mörder wollte es ihm so richtig heimzahlen.«
»Wenn der Mörder ihn leiden sehen wollte, hat er das Pferd von hinten aufgezäumt«, sagte Dot. »Der arme Mann kann nicht mehr viel gespürt haben.«
»Ja. Seltsam, nicht wahr?«, warf Phryne ein. »Ihn auf so brutale Weise mit den Noten zu ersticken, deutet, wie meine verehrte Kollegin so richtig erkannt hat, auf Wut hin. Andererseits trat der Tod, wie meine andere verehrte Kollegin bemerkt hat, friedvoll und schmerzlos ein. Das Opfer hat weder Abwehrverletzungen noch Blutergüsse davongetragen. Es gibt keinerlei Anzeichen eines Kampfes. Woraus wir schließen …?«
Jane überlegte laut. »Hm, dass der Mörder entweder wahnsinnig ist, von heftigen Gefühlswallungen getrieben …«
»Oder?«
»Dass er ein schwächlicher Kerl ist«, sagte Tinker. »Jedenfalls nicht stark genug, um das Opfer zu Boden zu drücken und zu ersticken, ohne es vorher zu betäuben.«
Phryne las weiter aus ihren Notizen vor. Die Akte hatte Jack leider wieder an sich genommen. »Also, der Mageninhalt verrät, dass der Mann kurz vor seinem Tod einen exklusiven Imbiss verzehrt hat. Ein halbes Dutzend frischer Austern, ein, zwei Scheiben Räucherlachs, ein kleines Stück Stilton und salzige Kräcker.«
»Exklusiv ist richtig«, bestätigte Ruth. »Dafür hätte man ein hübsches Sümmchen hinblättern müssen. Stilton ist ein Importkäse, Austern darf man nur bei einem seriösen Fischhändler seines Vertrauens erwerben, und Räucherlachs kommt aus Schottland.«
»Ja, eine ausgesprochen erlesene Henkersmahlzeit. Getrunken hat er dazu anscheinend …«
»Champagner?«, riet Ruth, die genau wusste, welcher Wein zu welcher Speise passte. Mr Butler war ihr auf diesem Gebiet ein hervorragender Lehrmeister.
»Nein, merkwürdigerweise war es ein süßer Dessertwein. Muskateller vielleicht oder ein Tokajer«, antwortete Phryne. »Teuer, aber langweilig, wie ich finde, und zu süß.«
»Ich möchte wetten, dass er sich wunderbar dazu eignen würde, den Geschmack des Gifts zu überdecken«, stellte Dot fest. »Wie wenn man bittere Medizin in Sirup mischt.«
»Darauf bin ich nie reingefallen«, sagte Phryne grimmig bei der Erinnerung an die Hustensäfte aus Kindertagen. Besonders verabscheut hatte sie Buckley's Canadiol Mixture, die nach geschmolzenen Weihnachtsbäumen schmeckte. »Aber damit könntest du durchaus recht haben, liebe Dot. Wahrscheinlich war Mr Tregennis eine Naschkatze mit Vorliebe für Süßes, und sein Mörder wusste das. Statt ihm nach der Probe zu seinem Amuse-Bouche einen leichten, trockenen Sekt zu kredenzen, serviert er ihm ein klebriges Gesöff, damit er das Gift nicht schmeckt. Morphium ist nämlich extrem bitter. Man kann es nur mit einem von Natur aus bitteren Getränk oder Essen kaschieren. Merk dir das für deinen nächsten Giftmord.«
»Vor einem halben Jahr hätten Sie mich mit dieser Bemerkung noch schockieren können, Miss«, sagte Dot.
Phryne strahlte. »Du hat dich wirklich großartig herausgemacht, Liebes. Bravo.«
Weil Dot sich nicht sicher war, ob sie das Kompliment als Beweis für ihre zunehmende Weltgewandtheit nehmen sollte oder ob es nicht vielleicht doch nur ein Zeichen für ihren sittlichen Verfall war, nahm sie sich vor, es zu gegebener Zeit zu beichten. Der Priester war ein alter Mann. Er würde es verkraften.
»Das Opfer lag im Dirigentenzimmer auf dem Fußboden. Der Mann war schon einige Zeit tot, als die Putzfrau ihn fand. Sie kam um sechs Uhr morgens herein, um zu fegen. Zuletzt von allen lebend gesehen wurde er, als er nach einer besonders nervenaufreibenden Probe die Tür der Garderobe hinter sich zuknallte. Anscheinend war er so ein jähzorniger Tyrann, dass man auf die Idee kommen könnte, der ganze Chor hätte sich verabredet, ihn gemeinsam aus dem Weg zu räumen.«
Sie blickte in die Runde. Alle hingen aufmerksam an ihren Lippen.
»Von Geschirr, einem Glas oder Besteck im Dirigentenzimmer keine Spur«, fuhr sie fort. »Wer auch immer ihm das Essen brachte, hat keine Beweise zurückgelassen. Bei der polizeilichen Durchsuchung wurde kein Abschiedsbrief gefunden. Auch sonst hat sie nichts Nützliches wie beispielsweise verräterische Visitenkarten, Streichholzheftchen, ausländische Münzen, fremdartige Schriftzeichen an der Wand oder Schuppen von seltenen Giftschlangen zutage gefördert.«
»Ach.« Tinker war enttäuscht.
»Die Chormitglieder verließen geschlossen den Saal und fuhren mit der Straßenbahn nach Carlton, wo sie in einer nicht lizenzierten Kneipe einkehrten und bis mindestens drei Uhr morgens unanständige Lieder schmetterten.«
»Aber sie hatten einander doch sicher nicht die ganze Zeit im Blick«, wandte Dot ein. »Der eine oder andere musste bestimmt mal das stille Örtchen aufsuchen oder hat kurz draußen frische Luft geschnappt. Jeder von ihnen hätte die Gelegenheit gehabt, noch einmal zurückzugehen und Mr Tregennis zu vergiften.«
Phryne stimmte ihr zu. »Wie wahr, Dot. Deshalb möchte Jack Robinson, dass ich die Sänger genauer unter die Lupe nehme, um zu sehen, ob mir etwas Verdächtiges an ihnen auffällt.«
»Woher kam das Essen?«, fragte Ruth, die sich darüber schon die ganze Zeit den Kopf zerbrach. »So etwas kauft man nicht eben mal nebenbei an einer Würstchenbude. Das ist teures Restaurantessen.«
»Auch das ist ein Rätsel, das unsere überarbeitete Polizei gerade zu lösen versucht.« Phryne blätterte in ihren Notizen. »Noch Fragen?«
»Irgendwelche Anzeichen dafür, dass er … Damenbesuch hatte?«, fragte Dot, deren Entschluss, die Beichte abzulegen, immer dringlicher wurde. »Keine Lippenstiftflecken oder Ähnliches?«
»Ich werde deine unschuldigen Ohren nicht mit den grausen Einzelheiten peinigen, Dot, aber es steht fest, dass er zumindest einige Tage lang keinen … eheähnlichen Verkehr gepflegt hatte. Die Einzige, die mich fragen darf, woher ich das weiß, ist Jane, aber nur, wenn sie im Anatomiebuch vorher das Wort Bläschendrüse nachgeschlagen hat. Und auch nur unter vier Augen. Keinen Lippenstift, keine Schminke, keine Knutschflecke oder sonstige Unappetitlichkeiten, dafür aber einige lange blonde Haare auf dem Jackett. Die ersten Blondinen werden bereits durch die polizeiliche Mangel gedreht.«
»Weil es sich um ein intimes Souper handelte, wie es im Larousse Gastronomique beschrieben wird«, fügte Ruth hinzu. »Austern, Räucherlachs, Wein. Auch wenn es der falsche Wein ist.« Sie quälte sich. Wer sich Räucherlachs leisten konnte, hätte wissen müssen, dass man dazu Champagner trank.
»Vielleicht war es eine Tat aus enttäuschter Liebe«, sagte Jane.
»Aber wozu dann die Umstände mit den Noten?«, fragte Tinker.
Phryne klopfte ihm auf die Schulter.
»Wir brauchen mehr Fakten, wie Sherlock Holmes sagen würde. Deshalb werde ich uns heute Abend welche beschaffen. Und zwar allein, meine Süßen. Wenn ich wieder da bin, besprechen wir alles. Einverstanden?«
Tinker antwortete für alle. »Wie Sie meinen, Chefin.«
»Gut. Ich danke euch.« Phryne lächelte. »Ihr habt euch sehr achtbar geschlagen. Die Wissenschaft der Deduktion, pah! Dass ich nicht lache«, grummelte sie noch in sich hinein, während sie ins Haus entschwebte, um ein Bad zu nehmen und sich anzukleiden.
»Es ist doch bloß eine Chorprobe«, sagte Jane zu Tinker. »Was soll ihr bei einer Chorprobe schon groß passieren?«
»Unsere Miss Fisher wäre nicht mal im Himmel sicher«, sagte Dot und bekreuzigte sich.
2
Alles hat einmal ein Ende,
nur die Musik währet ewig.
Darum lasst uns fröhlich singen,
denn die Jugend kehrt nie wieder.
Traditioneller Kanon
Weil Phryne die Treppe zum Gemeindesaal der Scots Church nur zu gut kannte, trug sie, da sie sich zwei Tage zuvor beim Charleston-Tanzen leicht den Knöchel verdreht hatte, heute flache Halbschuhe. Um den Chor mit ihrer Erscheinung nicht zu überwältigen, hatte sie sich für ein Jackenkleid in gedecktem Türkis und einen farblich darauf abgestimmten Hut entschieden, dazu eine große Handtasche. Eine speziell eingenähte Tasche im Unterrock enthielt ihre eiserne Notfallausrüstung: Ersatzfeuerzeug, etwas Geld, Zigarettenetui und die kleine Beretta mit dem Perlmuttgriff. Man konnte schließlich nicht wissen, auf welche Krisen man bei einer Chorprobe gefasst sein musste. Mr Butler chauffierte Miss Fisher und ihren Polizisten ruhig und würdevoll in die Stadt, setzte sie an der Ecke Collins und Russell Street ab und fuhr den Wagen anschließend in die Werkstatt, in der er gebaut worden war. Seine Anweisung lautete, erst um neun Uhr wieder vorzufahren. Phryne hatte beschlossen, sich den Lichtbildvortrag anzuhören. Womöglich war er wider Erwarten ja doch lehrreich.
Während sie vorsichtig die Treppe hinaufstieg, ließ sie Jack Robinson an ihren Überlegungen teilhaben. Oben wurden sie bereits von Hugh Collins erwartet.
»Jack, mein Guter, Sie müssen herausfinden, wer ihm das Essen gebracht hat, und ich würde vorschlagen, dass Sie mit Ihren Nachforschungen im Hotel gegenüber anfangen. Es war eine teure Mahlzeit und kam nicht aus einer billigen Suppenküche, wie Ruth so richtig festgestellt hat. Suchen Sie die Geliebte des Dirigenten.«
»Seine Geliebte?«
»Aber ja doch. Diese aphrodisischen Leckereien stellen in gewisser Weise eine Einladung dar. Außerdem müssen Sie die Notenwartin befragen.«
»Warum?«, fragte Jack.
Er hatte noch nicht ausgesprochen, als plötzlich ein Mann den Arm um Phryne schlang und sie an sich zog. Zu seinem Glück musste er nie erfahren, in welch unmittelbarer Gefahr er sich dabei befand, an einer empfindlichen Stelle seiner Anatomie mit ihrem Knie Bekanntschaft zu machen, denn Phryne hatte ihn sofort erkannt.
»John!«, rief sie und drückte ihn fest. »John Wilson, du hier? Wie kann das sein? Augenblick mal eben.« Sie drehte sich in seinen Armen um und sagte zu Jack Robinson: »Die Notenwartin hütet die durchnummerierten Noten des Chors. Sagen Sie ihr, sie soll sich alle zurückgeben lassen. Von irgendwoher müssen die Blätter schließlich gekommen sein. Ich bin gleich wieder bei Ihnen.«
Jack Robinson schüttelte den Kopf, sammelte seinen Sergeant ein und ging schon einmal mit ihm voraus in den Saal. John Wilson lachte leise.
»Phryne, wie sie leibt und lebt! Immer noch die alte?«, fragte er. »Ich nicht. Ich bin nämlich jetzt Dr. John.«
»Wunderbar. Dann hast du nach dem … nach dem Krieg noch zu Ende studiert?«
John Wilson war 1918 als blutjunger Assistenzarzt einberufen worden. Inmitten der Schlacht an der Somme hatte er an vorderster Front einen Verbandsplatz geleitet, bis über die Ellenbogen im Blut, der Tod sein ständiger Begleiter. Gerade zweiundzwanzig Jahre alt, vom Grauen des Krieges erschüttert und gezeichnet, lernte er Phryne kennen, die ihm die Verwundeten herankarrte. Unter Beschuss liegend, hatten sie sich in ihrem Sanitätswagen eines Tages gegenseitig die Kleider vom Leib gerissen und sich, taub vom Lärm der Geschosse, verzweifelt aneinandergeklammert, zwei warme, lebendige Körper, die blind nach einem Notanker tasteten, während die Welt um sie herum in Explosionen und Trümmern versank. Es war nicht das einzige Mal geblieben, dass Phryne ihn zu sich in den Sanitätswagen holte, und er war ihrer Einladung immer gern gefolgt. Aber sie war und blieb die einzige Frau auf der Welt, für die John Wilson sich erwärmen konnte, denn ansonsten schlug sein Herz für Männer. Phryne wirkte auf ihn, als gehörte sie einer ganz eigenen Kategorie an. Wie er es auch drehte und wendete: Sie war eine Ausnahmeerscheinung.
Im November, kurz vor Kriegsende, hatte sich ein Scharfschütze die Zeit damit vertrieben, das Rote Kreuz auf Johns Zelt ins Visier zu nehmen. Phryne hatte Vollgas gegeben und den Sanitätswagen mit einem halsbrecherischen Manöver zwischen das Zelt und den Angreifer gebracht, sodass John lediglich ein Projektil ins Bein abbekam, statt mehrere Kugeln in Kopf und Herz. Er hatte nämlich direkt hinter dem Roten Kreuz gestanden. Nachdem er von seinen eigenen Krankenträgern ins Feldlazarett gebracht worden war, hatte er Phryne nie mehr wiedergesehen.
Sie sah aus wie früher, höchstens ein klein wenig fülliger als das magere Hühnchen von damals, aber das schwarze Haar und die roten Lippen waren unverändert, genau wie die grünen Augen, die einem direkt in die Seele blickten. Der frische Duft eines Shampoos und des Parfüms Jicky von Guerlain umgab sie. Sie wartete noch immer auf seine Antwort.
»Es hatte ja bloß mein Bein erwischt, Liebes, und nicht meine Hände. Ich komme ganz gut zurecht. Wenn es dich nicht gegeben hätte …« Er drückte sie an sich. »… würde es mich gar nicht mehr geben.«
Phryne küsste ihn auf die Wange. Er roch noch genauso wie beim letzten Kuss. Nach Kaffee und Pfeifentabak, warm und erdig. Anscheinend war er nicht als Arzt tätig, denn sie erschnupperte nicht die leiseste Äthernote. Seine blauen Augen blickten freundlich wie eh und je in die Welt, seine Haut war wettergegerbt, sein militärischer Haarschnitt an den Schläfen grau meliert. Er war breitschultrig und muskulös, und sie hätte nichts dagegen gehabt, John Wilson auch diesmal wieder in ihren Sanitätswagen zu zerren, beziehungsweise in ihr schönes Haus und das bequeme Bett. Nicht gerade der moralische Leitsatz des Tages.
»Was treibst du hier, Liebster?«, fragte sie. »Können wir zusammen essen?«
Er schmunzelte, genau wie damals. Als amüsierte er sich über ihre Energie. Ein stiller, lieber Mensch, ein unerschütterlicher Trostspender, während ihm die jungen Soldaten unter den Händen wegstarben. Aneinandergeschmiegt hatten Phryne und er den Tod der Hoffnung und der Unschuld beweint, und ihre Küsse schmeckten nach dem Pulverdampf. Wie hatte sie ihren Felsen in der Brandung nur aus den Augen verlieren können? Er kehrte nach England an die Universität zurück, sie blieb in Paris. Später war ihr zu Ohren gekommen, dass er mit einem Mann zusammenlebte. Wie hieß er noch gleich? Galahad? Lancelot? Etwas in der Richtung. Und sie war davon ausgegangen, dass er sein Glück gefunden hatte, doch nach seinen dunklen Augenringen zu urteilen, schien es damit vorbei. Sie tätschelte ihm die Wange.
»Wie meinst du das?«, fragte er. »Was treibe ich in Australien? Oder hier auf der Treppe zum Gemeindesaal, wo wir uns gerade zum Gespött der Leute machen?«
»Was hast du doch für eine wunderschöne Stimme«, sagte sie. »So tief und angenehm. Den armen Jungs ging es gleich viel besser, wenn sie dich nur gehört haben. Was ich meine? Ich meine in Australien und hier.«
»Ich begleite den Mathematiker Rupert Sheffield, im Krieg Codeknacker in Griechenland. Alles streng geheim. Er ist ein lieber Kerl, bloß ein bisschen vom Pech verfolgt. Wir hatten kaum einen Fuß an Land gesetzt, da wären wir am Hafen um ein Haar von einem vollbeladenen Frachtnetz erschlagen worden. Aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Rupert ist in Melbourne, um die Volksbildung zu fördern und die Massen in den Genuss seiner mathematischen Weisheiten kommen zu lassen. Und auf dieser Treppe stehe ich, weil er hier heute Abend einen Vortrag hält und mich gebeten hat, die Laterna magica zu überprüfen. Gestern Abend hat sie zu stark geflackert.«
»Der Sheffield? Der über die Wissenschaft der Deduktion referiert? Verstehe. Und seid ihr zwei beide …?«
»Nein«, sagte er hastig. »Durchaus nicht.«
»Und Arthur?« Nun war ihr der ritterliche Name doch noch eingefallen.
»Arthur ist gestorben«, antwortete er gefasst. »Schon vor langer Zeit. Herzversagen. Er hat nicht geahnt, dass er nicht ganz gesund war, und ich habe es auch nicht erkannt.«
»Ach John, du Armer«, sagte sie leise. Ganz kurz nur legte er ihr die Stirn auf die Schulter, dann drückte er wieder den Rücken durch. Das Militärische gewann die Oberhand. Er konnte nicht aus seiner Soldatenhaut.
»Jetzt muss ich mich um den Projektor kümmern«, sagte er. »Hilfst du der Polizei bei den Ermittlungen, Phryne?«
»Ja, aber nur bei den Chormitgliedern. Für meinen Lieblingspolizisten ist das eine fremde Welt, für mich nicht.«
»Madame.« Mit einer Verbeugung hielt er ihr die Tür auf.
»Wie sieht es aus? Kommst zu zum Essen? Dr. MacMillan wohnt auch in Melbourne. Sie würde sich so freuen, dich wiederzusehen.«
»Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, Phryne, aber ich muss erst Sheffield nach seinen Plänen fragen.«
»Alles klar«, sagte Phryne. John konnte ihr nichts vormachen, auch wenn er selbst die Symptome geflissentlich übersah: Hier lag ein akuter Fall von unerwiderter Liebe vor. »Wir können es auch nach dem Vortrag besprechen, ich wollte ihn mir sowieso anhören.«
»Danke«, murmelte er und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
Erfüllt von gemischten Gefühlen, steuerte Phryne den Teil des Saals an, in dem sich ein ausgewachsener choraler Aufstand abzuspielen schien. Einerseits war ihr alter Freund Dr. Wilson in Melbourne. Andererseits erschien es ihr mehr als unwahrscheinlich, dass sie an die alten Zeiten wieder anknüpfen konnten.
»Verflixt!«, murmelte sie – und stürzte sich ins Getümmel.
Ungefähr dreißig Sängerinnen und Sänger umringten genau eine Notenwartin, die verzweifelt versuchte, die durchnummerierten Noten ihren Benutzern zuzuordnen. Was ihr dabei gar nicht half, waren die Ausreden, man hätte die Noten 1) zu Hause vergessen, 2) in der Garderobe liegenlassen, 3) im Bus verloren oder 4) noch nie welche besessen, auch wenn man die Ausleihe mit seiner Unterschrift bestätigt hatte. Doch, ja, die Unterschrift stimme, aber man könne sich nicht daran erinnern, jemals irgendwelche Noten ausgehändigt bekommen zu haben. Man habe die ganze Zeit bei seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau mit hineingeschaut. Für Phryne als langjährige Chorsängerin war dieses Tohuwabohu nichts Besonderes, Jack Robinson aber stand irritiert davor. Und ein irritierter Polizist wird gern einmal etwas lauter.
»Ruhe!«, brüllte er mit der Stimme, die in den finstersten Ecken von St. Kilda schon so manchem Erzschurken das Blut in den Adern hatte gefrieren lassen und die übelsten Rabauken zur Räson bringen konnte. Dass die Krakeeler daraufhin verstummt wären, konnte man wirklich nicht behaupten, denn schließlich hat jeder Chor mit professionellem Angebrülltwerden Erfahrung, aber immerhin flaute das Gezänk so weit ab, dass sich der Inspector Gehör verschaffen konnte.
»Hedley Tregennis wurde ermordet«, verkündete er. »Bitte etwas mehr Respekt. Ich muss Sie der Reihe nach vernehmen. Wer möchte zuerst?«
Der Mangel an Freiwilligen war unübersehbar. Phryne, die sich einen Platz auf der Bühne gesucht hatte, überflog prüfend die Gesichter und deutete zuletzt mit dem Kopf auf einen strammen blonden Burschen mit blauen Augen. Er war eindeutig der Anführer dieser Truppe. Aller Augen hingen an ihm. Jack winkte ihn zu sich, woraufhin der junge Mann vor Aufregung über seine eigenen Füße fiel und sich von einem fassförmigen Bass wieder auf die Beine helfen lassen musste.
»Name?«, raunzte Robinson.
»Smith«, sagte er. »Matthew. Tenor.«
»Collins, schreiben Sie mit?«, fragte Robinson.
Der Sergeant leckte seinen Kopierstift an und nickte.
»Wann haben Sie Hedley Tregennis zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend«, antwortete Matthew Smith. »Er ist stinksauer von der Bühne gestampft und hat gesagt, wir sollen zur Hölle fahren und uns erst heute wieder blicken lassen.« Er zuckte mit den Schultern. »Da haben wir uns natürlich, wie gewünscht, zum Teufel geschert.«
»Wo waren Sie nach der Probe?«
»Ich bin nach Hause gegangen, die meisten anderen waren noch etwas trinken. Es muss wohl ziemlich spät geworden sein.«
»Oder vielmehr ziemlich früh«, bemerkte der Fass-Bass. »Ich war erst um vier wieder zu Hause. Meine Wirtin hat mich ausgesperrt, und ich musste in der Waschküche schlafen. Gott sei Dank haben wir Sommer.«
»Ich lag schon um halb vier im Bett, aber ich wohne ja auch in Carlton, und du musstest ja noch ganz schön weit nach Hause laufen«, bemerkte ein anderer Bass.
»Ja, Tom. Geld für ein Taxi hatte ich nicht mehr. Das habe ich alles verprasst, im Cri …« Er verstummte, als ihm eine kleine Altistin plötzlich den Mund zuhielt.
»Ich interessiere mich nicht für Flüsterkneipen«, sagte Jack Robinson, dessen Geduldsfaden zunehmend dünner wurde. »Ich interessiere mich dafür, wann Sie Hedley Tregennis zum letzten Mal gesehen haben. Aber wenn Sie mir etwas verheimlichen, veranstalte ich im Criterion eine Razzia und Sie sitzen fortan auf dem Trocknen. Stellen Sie sich in einer Reihe vor dem Tisch dort auf und nennen Sie dem Constable Ihren Namen, Ihre Adresse und die Uhrzeit Ihrer letzten Begegnung mit Hedley Tregennis. Wer etwas Auffälliges bemerkt hat, redet mit meinem Sergeant. Ich setze mich da vorne hin und warte, bis mir irgendeiner etwas Interessantes zu sagen hat.«
Er suchte sich einen Stuhl. Phryne blieb, wo sie war, und beobachtete weiter das Geschehen. Robinson war beeindruckt, wie unauffällig sie sich dabei anstellte. Mal betrachtete sie versonnen ihre Fingernägel, mal strich sie sich über das Bein, als ob sie eine Laufmasche ertasten wollte, mal zupfte sie an ihrer Frisur. Sie wirkte wie die Harmlosigkeit in Person, solange man nicht in ihr Blickfeld geriet. Anderenfalls fühlte man sich auf einmal nur noch wie eine Ansammlung minderwertiger Moleküle. Gewogen und für zu leicht befunden. Nachdem die Chormitglieder ihre Angaben gemacht hatten, sammelten sie sich auf der Bühne und sangen sich, kaum dass sie zu viert waren, schon einmal ein. Auf die Melodie von Bruder Jakob stimmten sie, angeführt von Tom, einen hinreißenden Nonsens-Kanon an, bis sich nach ein paar Runden plötzlich eine Sopranistin ans Herz griff und mit ausgebildeter Gesangsstimme heulte: »Wie können wir nur so grausam sein?!« Das Lied brach ab.
»Aber was ist denn schon dabei, Julia?«, fragte Matthew Smith. »Wir sind ein Chor, wir können hier nicht weg, und in zwei Wochen findet unser Konzert statt.«
»Der Inspector hat recht, wir sollten mehr Respekt zeigen«, tönte sie.
»Wieso?«, fragte ein hochgewachsener, affektierter Tenor mit seidig glänzenden braunen Haaren und Denkerbrille. »Er hatte doch auch keinen Respekt vor uns. Oder vor dem Werk. Den armen alten Mendelssohn in einem solchen Höllentempo runterzurattern …«
»Aber sollten wir nicht auch an den armen alten Toten denken?«, fragte eine rothaarige Altistin.
»Du hast leicht reden, du studierst ja Medizin, Bones, du siehst sicher jeden zweiten Tag einen Toten«, ereiferte sich Julia, die mager und dunkelhaarig war und spätestens mit vierzig nur noch ein Klappergestell abgeben würde. »Du bist Tote gewöhnt. Aber als er da auf dem Boden lag, wie ein altes Bündel … wie ein altes Notenbündel. Das geht einem doch an die Nieren!«
»Wer tot ist, ist tot.« Bones zuckte lässig mit den Schultern.
»Du bist ekelhaft!«, rief Julia empört.
Gebannt verfolgte Phryne das kleine Geplänkel. Sie gesellte sich zu den anderen, die in einer Schlange für eine Tasse Tee anstanden, und nahm Julia beiseite.
»Reden Sie mit mir«, sagte sie höflich.
Der jungen Frau stieg die Zornesröte ins Gesicht. »Warum sollte ich, was wollen Sie von mir?«
»Sie haben die Wahl. Mit mir oder mit der Polizei«, sagte Phryne.
Julia reagierte mit einem unwilligen Kopfschütteln, das eher halbherzig ausfiel. Phryne jedenfalls blieb davon unbeeindruckt und hob nur kühl die Augenbrauen. Die Sängerin gab sich geschlagen.
»Na schön, na gut. Aber wer sind Sie denn überhaupt?«
»Ich heiße Phryne Fisher. Kommen Sie, setzen wir uns. So, und jetzt erzählen Sie mir mal, woher Sie wissen, wie der verblichene Hedley Tregennis ausgesehen hat.«
»Das war nur geraten«, antwortete Julia.
»Wie ein altes Notenbündel«, zitierte Phryne gnadenlos. »Er hätte platt auf dem Bauch oder Rücken liegen oder tot im Sessel sitzen können, aber nein. Rein zufällig lag er zusammengerollt auf der Seite. Und Noten waren auch im Spiel. Woher wussten Sie das?«
Wie gehetzt blickte Julia um sich, doch niemand eilte zu ihrer Rettung herbei.
»Weibliche Intuition?«, sagte sie zaghaft.
Phryne lachte. »Verschonen Sie mich. Wann haben Sie den Toten gesehen?«
»Ach, was soll's?«, maulte Julia. »Ich wollte nicht mehr mit in den Pub, ich wollte nach Hause. Als ich auf der Treppe halb unten war, habe ich gemerkt, dass ich mein Notenheft vergessen hatte. Weil ich wusste, dass der Hausmeister erst nach dem Ende des Lichtbildvortrags um zehn Uhr abschließen würde, bin ich noch mal zurück. Hinter die Bühne, ins Dirigentenzimmer.«
»Wieso dahin?«, fragte Phryne.
»Es hat ein Schloss. Deshalb verwahrt die Notenwartin die vergessenen Hefte dort. Noten sind teuer. Sie macht immer einen furchtbaren Aufstand, wenn welche abhandenkommen.«
»Wie wollten Sie denn in das Zimmer reinkommen?«, fragte Phryne. »Haben Sie einen Schlüssel?«
»Nein, aber es hängt einer in der Garderobe. Für den Notfall. Davon weiß keiner was.«
»Bloß dreißig Sängerinnen und Sänger plus Anhang und Anhängsel – und der Pianist«, stellte Phryne fest. Julia biss sich auf die Lippe.
»Ach so, ja. Die auch. Also wir alle. Stimmt. Jedenfalls habe ich die Tür aufgeschlossen, und da lag er mausetot vor mir, und ich hatte solche Angst, dass ich einfach abgehauen bin.«
»Aber vorher haben Sie noch feinsäuberlich die Tür wieder abgeschlossen«, sagte Phryne, ohne eine Miene zu verziehen.
»Ja.«
»Und Ihre Noten an sich genommen.«
»Äh, ja. Sie lagen auf dem Schreibtisch. Ich musste nicht über ihn drübersteigen oder so«, erklärte Julia. »Und ich muss üben. Ich bin in einem Quartett: ›Heilig, heilig, heilig.‹ Alle trauen mir zu, dass ich es kann.«
»Schön für Sie«, sagte Phryne. Sänger! Und Sängerinnen, natürlich. Sie hatte ganz vergessen, wie diese Künstlerseelen tickten. »Sie schaffen es bestimmt. Und jetzt möchte ich, dass Sie die Augen schließen. Versetzen Sie sich zurück. Sie sind wieder im Dirigentenzimmer. Sie sehen den Toten nicht an, nur das Zimmer. Haben Sie es vor sich?«
»Ja«, hauchte Julia. Sie wäre ideal für eine Hypnose geeignet gewesen.
»Lassen Sie den Blick schweifen. Was sehen Sie?«, soufflierte Phryne mit leiser, sanfter Stimme.
»Schreibtisch, Stuhl, Notenblätter auf dem Tisch, Teekanne, Teetasse. Eine Jacke am Haken an der Tür. Überquellender Papierkorb.«
»Voll Notenpapier?«, fragte Phryne.
»Nein, einfache Briefbögen, mit schwarzer Tinte beschrieben. Das ist eigentlich schon alles. Toter Mann auf dem Fußboden. Mr Tregennis. Schrecklicher Mensch.«
»Inwiefern war er schrecklich?«, hakte Phryne nach. Die Gelegenheit war zu günstig. Sie durfte sich Julias Trance nicht entgehen lassen.
»Seine Hände«, sagte Julia. »Seine grapschenden Hände. Er hat alle begrapscht. Alle Frauen. Gezwickt und gezwackt und getätschelt. Wie ein Oktopus. Konnte seine hässlichen heißen Flossen nicht bei sich behalten. Er hat rumgebrüllt und mit dem Fuß aufgestampft und uns als Schlampen und Huren beschimpft, wenn wir auch nur einen Ton falsch gesungen haben. Es tut mir nicht leid, dass er tot ist.«
Julia erwachte aus ihrem Dämmerzustand. »Was habe ich Ihnen erzählt?«
»Nichts, worüber Sie sich sorgen müssten«, antwortete Phryne. »Sagen Sie mir, hatte Mr Tregennis vielleicht ein Techtelmechtel im Chor? Eine kleine Freundin?«
Julia verzog angewidert das Gesicht.
»Ausgeschlossen! Mit dem Ekel hätte sich keine von uns eingelassen.«
»Stimmt«, mischte sich die rothaarige Altistin ein. Sie gab Phryne die Hand.
»Annie«, stellte sie sich vor. »Sie sind Phryne Fisher, nicht wahr? Ich kenne Sie vom Sehen. Bei der Detektivarbeit, hm?«
»Ich bin nur hier, um meinem Lieblingspolizisten zu helfen, den Täter zu fassen.«
»Na dann, viel Glück. Wir waren es nämlich nicht. Was nicht heißen soll, dass wir uns jetzt die Augen aus dem Kopf weinen würden. So weit geht die Trauer denn doch nicht. Der Mann war ein Schwein. Was allerdings den Schweinen gegenüber unfair ist. Richten Sie Ihrem Polizisten aus, er soll nach Miss X suchen, der Großen Unbekannten«, schloss sie mit ironisch angehauchtem melodramatischem Pathos.
Phryne schmunzelte. »Und wer könnte diese Unbekannte sein?«
»Keine Ahnung«, rumpelte Annie. »Wenn wir das wüssten, wäre sie ja keine Unbekannte. Sie hat ihn immer nach den Proben besucht. Tommy behauptet zwar, er hätte sie mal gesehen, aber man kann ihm nicht trauen. Er führt andere Leute gern an der Nase herum. Oder auch hinters Licht. Sie kennen die Sorte. Fragen Sie ihn ruhig selber.« Sie lächelte boshaft.
»Glauben Sie, dass er versuchen wird, mich auch hinters Licht zu führen?«, fragte Phryne.
»Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich wäre zu gern dabei, wenn Sie ihn in seine Schranken weisen. Tommy ist in letzter Zeit eine ziemliche Nervensäge.«
»Sie überschätzen mich«, sagte Phryne abwehrend. »Ich hetze ihm meinen Polizisten auf den Hals. Das müsste reichen.«
»Danke«, antwortete Annie.
»Zurück zu Ihnen, Julia. Sie haben sich also Ihre Noten genommen und sind nach Hause gegangen. Um wie viel Uhr war das?«, fragte Phryne.
»Ich schätze, so um neun rum«, sagte Julia. »Was für ein Mensch bin ich bloß, ihn einfach so liegen zu lassen?«, jammerte sie.
»Ihm hätte nichts und niemand mehr helfen können«, versicherte Phryne ihr.
Nachdem Annie und Julia sich wieder in die Teeschlange eingereiht hatten, ging Phryne zu Jack Robinson hinüber.
»Er war bereits ungefähr um neun Uhr tot, und das Essenstablett war auch verschwunden. Um acht war die Probe zu Ende und der Lichtbildvortrag fing an. Um halb neun hatten die meisten Chormitglieder den Gemeindesaal verlassen, auch wenn bestimmt noch ein paar zur Toilette mussten und ihre Freunde auf sie gewartet haben. Vom Chor war jedenfalls nach halb neun nur noch eine Sopranistin im Haus. Außerdem der Hausmeister. Der Vortrag endete um zehn, da war Tregennis längst tot.«
»Ich frage Sie lieber nicht, woher Sie das alles wissen«, sagte Jack Robinson.
»Gut. Ich würde es Ihnen sowieso nicht verraten. Ich schlage vor, Sie nehmen sich mal den dunkelhaarigen Kraftmeier da drüben vor. Name: Tommy. Spezialität: Mätzchen. Wenn er Tregennis tot aufgefunden haben sollte, hätte er es womöglich witzig gefunden, ihm die Noten in den Rachen zu stopfen.«
»Ach ja?«, sagte Robinson. »Eine richtige Ulknudel also. Groß und kräftig genug ist er auf jeden Fall. Er wäre körperlich dazu imstande gewesen.«
Phryne nickte. »Hat sich bei Ihren Befragungen etwas Interessantes ergeben?«
»Wer nicht in der Kneipe war, ist brav nach Hause gegangen, manche heim zu Mama und Papa in die teure Villa, die anderen in ihre Studentenbuden. Der Klavierspieler wohnt in der Collins Street 88, der brauchte also bloß um die Ecke ins Bett zu kippen. Bevor er dem Alkohol verfallen ist, muss er ein richtig guter Tastenkünstler gewesen sein. Er sagt, er hätte unter Beecham gespielt. Und er sagt, Tregennis wäre ein Metzger gewesen.«
»Nur musikalisch, Jack, mein Guter. Soll heißen, er hat die Musik verhackstückt. Während Sie Tommy auf den Zahn fühlen, räumen wir anderen jetzt besser die Bühne. Der Vortrag über die Wissenschaft der Deduktion fängt bald an.«
»Könnte sehr nützlich sein«, sagte Jack Robinson abschließend und ging auch schon zu dem jungen Bass hinüber. Phryne schnaubte verächtlich. Die Deduktion war keine Wissenschaft. Sie war eine Kunst, die Phryne meisterhaft beherrschte.
Phryne suchte sich leise einen Platz in der hintersten Reihe. Der Saal war halb voll, keine schlechte Resonanz für ein Sommerwochenende, das die meisten Leute am liebsten am Strand verbrachten. Aber die Melbourner Bildungsbegeisterung kannte offenbar keine Grenzen. Neben der Laterna magica zeichnete sich die Silhouette von John Wilson ab, kompakt und Vertrauen einflößend. Die Stimme des Redners war wunderschön – kultiviert, ohne affektiert zu sein, tief und wohltönend, die englische Satzmelodie zutiefst harmonisch. Ein Klang wie Irish Coffee mit Kakaopulver auf der Sahnehaube.
Der Besitzer der Stimme war ebenfalls nicht zu verachten. Im Gegenteil. Er war eine echte Augenweide.
Großgewachsen und schlank, bewegte er sich elegant wie ein Tänzer, hin und wieder die Hand ausstreckend, um eine Aussage zu unterstreichen oder auf eine an die Wand geworfene Gleichung hinzuweisen. Er hatte dunkle Locken und blasse, wie in Marmor gemeißelte Gesichtszüge. Griechisch? Ja, aber im klassisch griechischen Stil. Markant. Eine herablassende Attitüde, als sei er sich bewusst, dass ihm das Publikum intellektuell nicht das Wasser reichen konnte. Und seine Augen! Solche seltsamen Augen hatte Phryne noch nie gesehen. Scharf und flink, wie die einer Katze, und so wachsam, dass es einen eiskalt überlief. Phryne hätte schwören können, dass sie je nach Lichteinfall lavendel- oder silberfarben schimmerten.
Die Erklärung dafür, dass John Wilson dem Mann verfallen war, lag auf der Hand. Der Inhalt seines Vortrags erschloss sich leider nicht halb so leicht. Wenn Phryne außer einem sporadisch auftretenden Heißhunger auf gedörrte Aprikosen und andere Leckerbissen aus Kindheitstagen eine Schwäche hatte, dann die: Sie war ein Mathemuffel. Liebestrunkene Physikstudenten hatten sich, um von ihr erhört zu werden, redlich, aber in der Regel erfolglos bemüht, sie für ihr Fach zu erwärmen, doch genau wie die Mathematik war für Phryne auch die Physik ein Buch mit sieben Siegeln geblieben – abgesehen von den Newton'schen Gesetzen, weil man sich, wenn man sie nicht beherzigte, leicht eine Kugel einfangen konnte.
Es gelang ihr nicht einmal ansatzweise, Rupert Sheffields Ausführungen zu folgen. Tschebyschow-Polynome und Interpolationsungleichungen waren und blieben ihr ein Rätsel.
Ein letztes Lichtbild, und der Vortrag war zu Ende. Die Zuhörer standen auf, reckten und streckten sich. Nach und nach leerte sich der Saal. Phryne stand noch bei John am Projektor, als der Redner geschmeidig von der Bühne sprang und sich zu ihnen gesellte.
Er bewegte sich wie eine Katze, eine Raubkatze. Wie ein Panther vielleicht. Phryne legte John die Hand auf den Arm. »Stellst du mich deinem Freund vor?«, fragte sie.
Er lächelte. »Aber natürlich. Rupert Sheffield. Die Ehrenwerte Miss Phryne Fisher«, sagte er. »Eine alte Freundin, die ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen habe.«
»Enchanté.« Rupert deutete eine Verbeugung an und gab ihr die Hand.
»Ganz meinerseits«, antwortete sie.
»Abgesehen davon, dass Sie wohlhabend sind, eine schwarze Katze besitzen, Jicky von Guerlain benutzen und sich beim Tanzen den Knöchel vertreten haben, weiß ich so gut wie gar nichts über Sie«, sagte er.
Nach dem Motto »Wie du mir, so ich dir« holte Phryne zum Gegenschlag aus. Sie sah ihm in die – tatsächlich – lavendelfarbenen Augen und sagte: »Abgesehen davon, dass Sie in Winchester aufs Internat gegangen sind, in Cambridge studiert und im Krieg als Codeknacker gedient haben, dass Sie Schuhe von Loeb und Anzüge aus der Savile Row tragen – und ich glaube, der Schlips ist von Westford in Soho –, dass Sie Ihre Haare mit Kokosöl pflegen, Rechtshänder und ein Freund meines lieben John Wilson sind, weiß ich auch nicht viel über Sie.«
John gluckste in sich hinein.
Rupert erstarrte und fasste sich an den Kragen. »Nicht von Westford, von Halligen«, korrigierte er.
»Mein Fehler.« Phryne lächelte liebenswürdig.
»Du bist wirklich einzigartig, Liebes«, sagte John.
Phryne konnte ihm nicht widersprechen. »Aber eine Frage hätte ich noch: Darf ich dich für morgen Abend zum Essen einladen?«
»Sie können über John verfügen«, sagte der Adonis gönnerhaft. »Sie genießen das Vorrecht der älteren Bekanntschaft. Ich werde mich anderweitig beschäftigen: mit Nachdenken.« Mit dieser kaum versteckten Spitze stolzierte er davon, wie ein Panther, dem eine Gossenkatze ein unsittliches Angebot gemacht hat.
»Und tschüss.« Phryne konnte sich das Lachen nur mit Mühe verbeißen. »Der dramatische Abgang der beleidigten Leberwurst.« Knallend fiel die Saaltür ins Schloss, und sie prustete los.
»Eigentlich ist er ein ganz patenter Kerl«, brummelte John. »Du darfst ihn nicht foppen, Phryne.«
»Er hat angefangen.«
»Sag mal, Phryne, du warst doch beim Geheimdienst, oder? Nach dem Krieg?«
»Ja, eine Zeitlang. Warum?«
»Mir gefallen diese … Unfälle gar nicht. Vielleicht hat es jemand auf Rupert abgesehen. Könntest du dich … ein bisschen umhören?«
»Natürlich.« Sie tätschelte ihm die Wange. »Sieben Uhr, bei mir? Bitte sehr, meine Karte. Und jetzt geh, und tröste deinen Freund. Ich habe nicht vor, dich ihm wegzunehmen, John.«
»Du … was? Nein, Phryne, da hast du etwas missverstanden«, rief er ihr nach. Sie war schon im Hinausgehen.
»Wäre nicht das erste Mal«, antwortete sie, die Hand auf der Klinke des Bühnenausgangs. »Ich muss weiter, einen Chor durch die Mangel drehen.«
Schon war sie entschwebt. Leicht atemlos, wie schon immer, wenn er mit Phryne auf Tuchfühlung gewesen war, packte John die Lichtbilder zusammen. Ihm kam der Gedanke, dass Rupert Sheffield in ihr womöglich zum ersten Mal im Leben einen ebenbürtigen Gegner gefunden hatte.
Und er musste ebenfalls laut lachen.
Jack Robinson hatte seine liebe Mühe mit dem Chor. Sängerinnen und Sänger liefen auf und ab. Sie redeten ununterbrochen. Sie wollten nach Hause. Sie schmollten.
»Es ist wie Katzen hüten, mein lieber Jack.« Phryne tätschelte ihm den Arm. »Passen Sie auf.«
Sie kletterte auf einen Stuhl, womit sie die männlichen Blicke auf sich – beziehungsweise auf ihre zierlichen Fesseln – zog, und klatschte zweimal in die Hände. Im Nu kehrte Stille ein.
»Wer noch in der Kneipe war, nimmt jemanden bei der Hand, von dem er weiß, dass er ebenfalls dort war, und stellt sich rechts auf. Aber nur, wenn dieser Mensch zusammen mit Ihnen dort eingetroffen ist. Dazu singen Sie bitte vierstimmig die Nonsens-Version von Bruder Jakob. Sopran, Alt, Tenor und Bass«, sagte sie.
Lammfromm folgten sie ihren Anweisungen und stellten sich händchenhaltend rechts auf.
Jack Robinson kam das Geträller ziemlich albern vor, aber es erfüllte seinen Zweck. Bald hatte sich mehr als der halbe Chor fröhlich singend zu einer Gruppe zusammengefunden. Die elf Mitglieder, die noch vor ihm standen, hatten sich am fraglichen Abend brav nach Hause begeben. Neben der unvergleichlichen Julia waren das die Sopranistin Jenny Leaper, die Altistin Helen Burke und Tabitha Willis, eine lebensstrotzende junge Frau mit schwarzen Locken, die so viel gesundes Wohlbefinden ausstrahlte, dass Phryne gar nicht anders konnte, als sie anzulächeln. Hätte man ihr den Kopf auf die Schulter gelegt, wäre jede Migräne verflogen. Natürlich war sie ebenfalls Altistin. Die zweite Sopranistin, Chloe McMahon, war von Statur und Umfang her wie für Wagner gemacht. Ihr fehlte nur ein gepanzertes Mieder und ein gehörnter Helm. Eine imposante Erscheinung. Der Rest waren Männer, Tenöre und Bässe, sowie der Pianist. Was die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei ihnen um die große Unbekannte handelte, doch erheblich schmälerte. Zwar gab es nichts, was es nicht gab, und die Geschmäcker waren verschieden, aber bei den Opfern von Mr Tregennis' Übergriffen hatte es sich ausschließlich um weibliche Chormitglieder gehandelt. Damit sich der Inspektor ungestört der Befragung der Damen widmen konnte, entführte sie kurzerhand die Herren. Jack Robinson warf ihr einen grollenden Blick zu, worauf Sie ihn mit einem Kusshändchen bedachte.
»Nun denn.« Sie setzte sich auf einen Tisch und ließ die Beine baumeln, wobei ihre seidenen Strümpfe erneut aufs Schönste zur Geltung kamen. »Was können Sie mir über das bedauernswerte Ereignis sagen?«
»Definieren Sie bedauernswert«, sagte ein magerer Knabe mit viel zu langen Haaren, der einen Stapel Notizen in der Hand hielt.
»Ach, halt die Klappe, Len«, knurrte Matthew, der sanfte Blonde mit dem Anflug eines Bartes. Wenn er mal richtig erwachsen war, würde er höchst überzeugend den Weihnachtsmann spielen können, ohne sich ausstopfen zu müssen. Zum Anbeißen. Phryne hatte eine Vorliebe für Männer, die zu einer gewissen Leibesfülle neigten. Und sei es nur als Kontrast zum knusprig knackigen Lin Chung, der leider, leider geschäftlich in Hongkong zu tun hatte. Sie riss sich zusammen. Jack wäre nicht sehr begeistert, wenn sie die Verdächtigen verführte.
»Stellen Sie sich bitte vor«, sagte sie. Sie traten der Reihe nach vor und schüttelten ihr die Hand: Leonard, Tenor und Nervensäge, der Knabe mit den Notizen; Oliver, ein weiterer wohlbeleibter Bass mit roten Haaren und wunderbarem Lächeln; ein großer, pomadiger Medizinstudent, von dem sie nur den Spitznamen Bones erfuhr; und ein eindeutiger Gigolo namens Luigi, der ihre Hand erst gar nicht mehr loslassen wollte, sich dann lange darüber beugte, um ihr einen Handkuss zu geben, ihr ein routiniertes Lächeln schenkte und nach Haarwasser duftete. Sie gönnte ihm einen glutvollen Blick. Er warf sich gockelhaft in die Brust. Dabei beließ es Phryne.
»Erzählen Sie mir von Ihrem Chorleiter«, forderte sie das kleine Trüppchen auf.
»Warum reden Sie nur mit uns und nicht mit den anderen?«, fragte Len misstrauisch.
»Weil ihr kein Alibi habt, Kinder. Ihr hättet heimlich wieder zurückgehen und ihn … zu Tode bringen können. Zeigt mir mal eure Noten.«
Nachdem die Sänger ihre Notenhefte aus Taschen und Tornistern hervorgekramt hatten, blätterte Phryne sie durch. Nirgendwo fehlten Seiten.
»Gut. Dann also weiter im Text.«
»Er war kein sehr netter Mensch«, sagte Matthew.
»Er war ein Schwein«, korrigierte ihn Oliver, vor Zorn rot anlaufend. »Er konnte seine Flossen nicht von den Sängerinnen lassen. Die eine oder andere wollte den Chor seinetwegen schon verlassen.«
»Ich war ja dafür, ihn zur Rede zu stellen«, sagte Matthew. »Aber die anderen waren dagegen.«
»Weil er nicht viel gekostet hat«, sagte Bones, der Medizinstudent. »Wir sind ja nur ein halbprofessioneller Chor. Wenn wir das Orchester bezahlt haben, bleibt für den Dirigenten nicht mehr viel übrig.«
»Arbeiten Sie im Krankenhaus?«, fragte Phryne ihn.
»Noch nicht. So was wie mich lässt man noch nicht auf die Kranken los, nicht einmal in der kostenlosen Armensprechstunde«, antwortete er. »Warum?«
»Drogen«, antwortete Phryne kryptisch.
»Ach was!«, rief Oliver. »Er wurde vergiftet?«
»Unter anderem. Werden im Chor Drogen konsumiert?«
»Von uns? Wie sollten wir uns so was leisten können? Außerdem schaden Drogen der Stimme«, antwortete Matthew. »Kann sein, wir trinken manchmal zu viel …«
»Beziehungsweise meistens …«, sagte Oliver.
»Wenn sich die Gelegenheit bietet«, warf Leonard ein.
»Oder wenn uns einer einen ausgibt«, stimmte Bones ihm zu.
»Aber Drogen nehmen wir nicht«, schloss Matthew.
Anscheinend waren Fugen ansteckend. Genau wie das mehrstimmige Singen. Der Rest des Chors trällerte noch immer den Nonsens-Kanon rauf und runter.
»Und was wissen Sie über die große Unbekannte?«, fragte Phryne.
»Tommy behauptet, er hätte sie gesehen«, sagte Matthew.
»Aber Sie kaufen ihm das nicht ab?«, fragte Phryne.
Die jungen Männer sahen sie erstaunt an.
»Woher wissen Sie das? Ach, egal. Machen wir weiter. Ich will nicht schon wieder im Morgengrauen nach Hause kommen und im Waschhaus schlafen müssen«, grummelte Len. »Nein, wir kaufen es ihm nicht ab. Wir waren alle neugierig, was die Frau anging. Ich bin sogar selber eines Abends länger geblieben, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Aber Fehlanzeige. Können wir jetzt gehen?«
»Wer übernimmt die Chorleitung, bis Sie einen neuen Dirigenten gefunden haben?«, fragte Phryne.
»Sieht ganz so aus, als ob es an mir hängen bleibt«, antwortete Matthew.
»Sie wollen kein Dirigent sein?«
»Nein«, sagte Matthew. »Ich möchte Diplomat werden. Ich studiere Sprachen.«
»Hier meine Karte.« Phryne teilte sie aus. »Rufen Sie mich an, wenn Ihnen noch etwas einfällt, was Sie einem Polizisten lieber ein wenig … gefiltert erzählen möchten.«
Sie lächelte in die Herrenrunde und begab sich zurück zu den Damen, derer Jack Robinson so gar nicht Herr wurde. Anscheinend waren sie nicht in der Lage, nacheinander zu antworten oder bei einem Thema zu bleiben, ohne abzuschweifen.
»Hier entlang, Ladys.« Phryne nahm Cloe bei der perlweißen, kindlichen Hand. Die anderen folgten, wie auf einer Schnur aufgezogen.
Phryne ließ die Sängerinnen im Halbkreis Aufstellung nehmen und sah ihnen der Reihe nach ins Gesicht. »Ihr habt zehn Minuten Zeit, mir alles über die geheimnisvolle Unbekannte zu erzählen, immer schön jede für sich. Wenn nicht, übergebe ich euch wieder dem armen Inspector, der euch dann über Nacht einsperren wird. Sein Geduldsfaden ist schon so gut wie durchgewetzt. Haben wir uns verstanden? Danach können wir alle nach Hause.«
»Na schön.« Die Altistin Tabitha schüttelte ihre dunklen Locken. »Die Unbekannte war keine von uns.«
»Gut«, sagte Phryne. Sie wusste genau, wie eng Sangesschwestern miteinander verbunden waren. Es wäre fast unmöglich gewesen, ein Geheimnis zu bewahren. »Und wer ist sie?«
»Das wissen wir nicht genau«, antwortete Chloe mit ihrer sahneweichen Stimme. »Tommy will sie angeblich gesehen haben, aber …«
»Das kaufen Sie ihm nicht ab. Ich weiß. Gibt es sonst noch Anhaltspunkte?«
»Sie muss groß sein«, sagte Julia. »Ich habe sie mal durch den Korridor gehen hören, und da trug sie flache Schuhe.«
»Und deswegen war sie groß?«, fragte Tabitha zweifelnd.
»Ja, Tab. Du weißt doch, dass er es nicht mochte, wenn eine Frau größer war als er, und dass er eine Vorliebe für hohe Absätze hatte«, erläuterte Julia. Phryne ließ sich die Erklärung durch den Kopf gehen. Irgendwie ergaben die Argumente schon einen Sinn. Einen ganz eigenen Julia-Sinn.
»Sie hat ihm Essen gebracht«, sagte Helen. »Am nächsten Tag hat es im Dirigentenzimmer danach gerochen. Nach teurem Essen. Meine Mutter kocht nämlich sehr gut, müssen Sie wissen.«
»Restaurantessen«, warf Jenny ein, ein kleines, energisches Persönchen. »Aber wir haben nichts davon abbekommen.«
»Und er hat sehr heimlich mit ihr getan«, ergänzte Chloe.
»Ich könnte mir vorstellen, dass sie Musikerin ist«, sagte Tabitha.
»Weshalb?«, fragte Phryne.
»Wenn sie abends da gewesen war, lag am nächsten Morgen immer die Orchesterpartitur auf dem Schreibtisch.« Tabitha dachte kurz nach. »Bei einer Sängerin wären es die Noten für ihre Stimme gewesen.«
»Und Tommy hat gesagt, sie hätte schwarze Haare«, ergänzte Chloe. »Aber das kaufen wir ihm nicht …«
»Okay, meine Damen. Die Notenhefte raus.«
Nirgends fehlte auch nur eine Seite. Dafür entdeckte Phryne beim Durchblättern ein paar gelungene Karikaturen von einem Schwein im Anzug, das einen Dirigentenstab schwenkte. Vielleicht von Miss Willis? Phryne überprüfte den Namen, der mit Bleistift auf das Deckblatt geschrieben war. Richtig geraten. Sie warf einen Blick auf Miss Willis; die grinste.
»Bitte sehr.« Phryne verteilte Visitenkarten. »Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas loswerden wollen, ohne dass die Polizei erfährt, von wem die Information stammt. Wir verstehen uns?« Ein forschender Blick in die Runde. Allgemeines Kopfnicken.
Sie durften gehen, genau wie der Rest des Chors, der auch schon, einen neuen Kanon anstimmend, hinausströmte.
Phryne gesellte sich wieder zu Jack. »Die geheimnisvolle Unbekannte«, sagte sie, »war entweder schwarzhaarig oder blond, wahrscheinlich größer als der Dirigent, vielleicht Musikerin. Sie hat ihm nach der Probe Essen gebracht. Mehr konnte ich beim besten Willen nicht herauskriegen, Jack, mein Guter.«
»Immerhin mehr als ich«, knurrte Jack. »Fahren Sie nach Hause?«
»Aber pronto.« Damit entschwebte sie auch schon in die Collins Street, wo Mr Butler geduldig auf sie wartete.
Er ließ den Hispano-Suiza anrollen. »Hatten Sie einen anregenden Abend, Miss Fisher?«
»Mehr als anregend.« Phryne lehnte sich in das weiche Polster zurück. »Ich habe einen alten Freund wiedergefunden, mir einen unverständlichen Vortrag angehört und mit einem ganzen Chor geplaudert.«
»Und dazu noch der kleine Mord …«, vervollständigte Mr Butler gemütlich die Liste. »Zu Hause bekommen Sie erst einmal einen schönen Cocktail.«
Phryne lächelte. »Mr Butler, Sie sind eine Zierde Ihres Berufsstandes.«
3
Gibts Leidenschaft, die bei Musik nicht kam und wich?
John Dryden
Ode auf den Tag der heiligen Cäcilie
Bei einem späten Abendessen ließ Phryne ihre kleine Wahlfamilie an den Erkenntnissen, die sie inzwischen über den ermordeten Chorleiter gewonnen hatte, teilhaben. Sehr viel Appetit hatten die anderen zwar nicht mehr, nachdem sie zur spätnachmittäglichen Teatime bestens verköstigt worden waren – Mrs Butler tolerierte keinen Hunger –, aber um halb zehn konnten sie doch schon wieder ein paar Bissen vertragen. Obwohl sich die Mädchen sehr erwachsen fühlten, weil sie so spät noch auf waren, machte sich um halb elf allgemeines Gähnen breit.
»Ab ins Bett«, befahl Dot.
»Miss Phryne? Kann ich mir den mathematischen Lichtbildvortrag auch ansehen?«, fragte Jane.
»Selbstverständlich. Morgen Abend, wenn du willst. Möchtest du Ruth mitnehmen?«
»Nein«, sagte Jane. »Sie würde sich nur langweilen. Kommst du mit, Tinker?«
»Wenn du mich dabeihaben willst«, antwortete der Junge. Er spielte gern den männlichen Begleiter, den tapferen Beschützer. Was nicht heißen soll, dass Phrynes Kinder durch die Ganoven der Stadt in Gefahr gewesen wären. Schließlich war Miss Fisher eine Größe ihres Fachs, deren Taten sich in der Unterwelt herumgesprochen hatten. Und wenn sich tatsächlich einmal ein leichtsinniger Halunke mit ihr anlegte, sorgte sein Schicksal im verruchten Stadtteil Little Lon noch tagelang für Gesprächsstoff. Es wurde gemunkelt, dass es einige sehr wohlgenährte Haie gab, die ihr den zerlegten Gegner buchstäblich aus der Hand fraßen. Andererseits konnte man natürlich immer einem Hallodri, Holzkopf oder heimatlosen Zecher über den Weg laufen, der ein junges Mädchen, das allein durch die Straßen ging, als Freiwild betrachtete. Nicht so, wenn sie den tapferen Ritter Tinker an ihrer Seite hatte. Als schmächtiges Kerlchen in einer Hafenstadt unter Rabauken aufgewachsen, machte ihm in Sachen Boxen, Hauen und Stechen, Treten, Kneifen und Nüsseknacken so leicht keiner etwas vor. Möglicherweise war der Vortrag ja sogar interessant. Tinker hatte bei sich eine Naturbegabung für die Mathematik entdeckt, die ihm eine ganz neue Sicht auf die Welt eröffnete. Und weil die Chefin für ihre alten Freunde ein Abendessen schmiss, würde er sowieso in die Küche verbannt werden. Wenn er Jane begleitete, konnten sie vor dem Vortrag in der Little Bourke Street chinesisch essen gehen – Lin Chungs Familie betrieb mehrere Restaurants – und nach dem Vortrag im Dunkeln mit dem Taxi heimfahren. Tinker konnte immer noch nicht richtig glauben, dass er einfach einen Wagen anhalten und sich vornehm nach Hause kutschieren lassen durfte. Jane fuhr auch gern Taxi. Ruth würde es genießen, Mrs Butler ganz für sich allein zu haben, um sie nach ihren Koch- und Küchengeheimnissen auszufragen, ohne dass Jane und er dauernd das Thema wechseln wollten. Es konnten alle mit ihrem Abend zufrieden sein, freute sich Tinker.
Phryne schlief die Nacht durch und träumte von Mendelssohn. George Bernard Shaw hatte sich fies über ihn geäußert, und was er komponierte, war ja auch tatsächlich das musikalische Äquivalent von Zuckerwatte. Trotzdem konnte man einige Choräle im Elias nur als grandios bezeichnen. »Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen«, zum Beispiel. »Greift die Propheten Baals, dass ihrer keiner entrinne, führt sie hinab an den Bach, und schlachtet sie daselbst!«, schmetternd, begab sie sich am Morgen die Treppe hinunter, um zu frühstücken.
»Guten Morgen, Dot, herrlicher Tag heute … Wo sind denn alle?«, fragte sie. Das Haus war seltsam still. Im Wohnzimmer traf sie nur Ember und Dot an. Dot stickte, und Ember lauerte nur auf die Gelegenheit, ein paar Hexenstiche beizutragen.