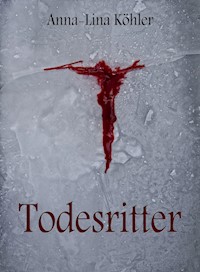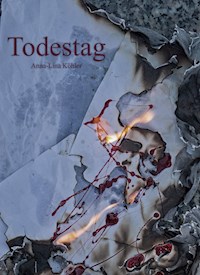Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Todes-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ihr ganzes Leben lang glaubte Lia, sie sei ein ganz normales Mädchen - bis sie beinahe ermordert wird. Von diesem Tag an verändert sich ihr ganzes Leben. Denn sie erfährt, dass sie dazu auserwählt worden ist eine grausame Bestie aufzuhalten, die aus der Hölle entkommen ist, um die Welt in einen Krieg zu stürzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna-Lina Köhler
Todes Tochter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Lunus Geschichte
Enago
Blindes Vertrauen
Eine helfende Hand
Eine tödliche Begegnung
Keira
Der steinige Weg zum Ziel
Der Lunus Berg
Blutkette
Rufus und Viridis
Margoi
Magie
Tödliche Gewissheit
Neue Gefährten
Folter
Training
Surah
Wanderseherin
Die Zeit vergibt nicht
Ein hilfsbereiter Feind
Innerer Kampf
Gefangen in der Finsternis
Lysia, das Orakle der Surah
Verräter oder Spion?
Aufgaben und Schicksale
Im Glaube des Verrates
Wähle eine Seite
Der schwarze Stein I
Der lebenserhaltende Wunsch nach Rache
Der schwarze Stein II
Das Leid des Verlustes
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Todes Tochter
Die kalten Schatten zweier finsterer Gestalten strichen über die Mauern und Wege und verloren sich manchmal in der Dunkelheit. Leise, ohne auch nur einen Laut von sich zu geben, schlichen sie durch den Wald. Ihre weiten Umhänge umhüllten ihre Körper und ihre tief sitzenden Kapuzen verhinderten, dass man einen Blick auf ihre Gesichter erhaschen konnte.
Die Sonne warf ihre letzten Strahlen auf die Erde und tauchte sie für einen kurzen Augenblick in ein warmes Licht. Dann wurde es dunkel. Die Vögel verstummten und alles Leben auf Erden schien in einen tiefen Schlaf zu fallen. Stille umgab die zwei Gestalten. Eine Stille, die sowohl zu beruhigen als auch zu ängstigen schien. Die Nacht war hereingebrochen.
Plötzlich vernahm ihr feines Gehör ein Geräusch. Blitzschnell griffen sie unter ihre Mäntel und umfassten die Griffe grausam aussehender Waffen. Das leise Ächzen der Zweige, die unter dem Gewicht einer dritten Gestalt zerbrachen, störten die Stille der Nacht und ließen die Gestalten aufhorchen. Vorsichtig näherten sie sich einer kleinen Lichtung. Im Schutz der Bäume und der Dunkelheit brauchten sie nicht zu befürchten schnell entdeckt zu werden. Doch sie wollten nichts dem Zufall überlassen.
Ihre Aufgabe war eindeutig, ihre Mission von ihrem Herrn und Meister bestimmt worden und sollten sie versagen, hinge ihr Leben am seidenen Faden – bereit zu reißen.
Vorsichtig schoben sie ein paar Äste, die ihnen die Sicht auf die Lichtung versperrten, zur Seite und hoben gespannt die Köpfe. Mitten im Wald stand eine weitere vermummte Gestalt. Auch sie trug einen schwarzen Umhang, an dessen Rändern jedoch rote Schriftzüge eingenäht worden waren.
Es war ein Mann, daran bestand kein Zweifel. Seine kräftig gebaute Statur und das lange Schwert mit dem silbernen Griff und der schwarzen Klinge, das an seiner Seite hing, sprachen dafür. Er stand mit dem Rücken zu seinen Beobachtern und auch, als das leise Klirren von Metall die Luft erfüllte, verharrte er weiterhin reglos. Jeder Schritt, den sie auf ihr Opfer zugingen, ließ ihren Blutdurst steigen. Die Nacht war erfüllt von Totenstille, kein Geräusch war zu hören, kein Laut – noch nicht.
Als sich der Mann im schwarzen Umhang endlich umdrehte und seine Angreifer sah, war es zu spät. Das schmatzende Geräusch von durchbohrtem Fleisch erfüllte die stille Nacht und scheuchte ein paar Vögel auf, die laut kreischend auf die nächsten Bäume flogen. Der unglückselige Mann sackte nieder und blieb reglos am Boden liegen. Blut tropfte unaufhaltsam aus einer breiten Schnittwunde an seinem Bauch.
„Er ist tot!“
Die Stimme, die da sprach, klang nicht menschlich. Sie war kalt und schrill. Es war wie ein Zischen, ein Rauschen in den Ohren, das sich durch das Trommelfell bohrte und sich langsam durch das Gehirn fraß. Die andere Gestalt nickte zustimmend. Ihre befleckten Klingen steckten sie zurück unter die Umhänge und griffen nach ihren Kapuzen. Langsam enthüllten sie ihre Gesichter – ihre Fratzen. Denn auch ihre Köpfe waren nicht so, wie sie hätten aussehen sollen. Schwarze, faltige Haut spannte sich über ihre Schädel und schien auch den Rest des Körpers zu bedecken. Doch sah man genauer hin, so konnte man erkennen, dass ihre weitere Haut hellrot gefärbt war. Dort, wo ihre Augen hätten sein sollen, befanden sich zwei weiße Flecke und ihre Lippen schimmerten in einem dunklen Blau. Nasen schienen sie keine zu besitzen und wenn doch, waren es Schlitze, die kaum sichtbar in ihre Haut geritzt worden waren. Die zwei Gestalten grinsten sich an und entblößten dabei reihenweise messerscharfe Zähne.
Langsam näherten sie sich dem Toten und beugten sich mit ihren großen Mündern über ihn. Das Schmatzen und Schlucken, das die beiden von sich gaben, fuhr einem durch Mark und Bein. Ihre Mägen füllten sich mit den Innereien des Mannes und aus ihren Mündern tropfte das Blut, das sie nicht rechtzeitig mit hinunterschluckten. Man empfand den Wunsch, sich zu verkriechen, sich zu verstecken, um dem Schicksal, das dem Mann soeben widerfahren war, zu entgehen.
Doch die Zeit war reif. Keiner würde sich verstecken und verkriechen können. Keiner würde seinem Schicksal entgehen. Denn ER hatte an Macht gewonnen, hatte sich von seiner anstrengenden Reise aus der Hölle erholt und gewartet. Lange gewartet. Nun würde sich alles ändern.
Die Welt würde sich ändern.
Jedoch nicht zum Guten!
Lunus Geschichte
Ein paar Meilen von dem Ort entfernt, an dem das grausige Verbrechen verübt worden war, lief ein junges Mädchens durch den Wald. Sie trug ein langes schwarzes Wanderkleid und einen dunkelroten Umhang, dessen Kapuze sie sich tief ins Gesicht gezogen hatte. Trotzdem fielen ihre langen braunen Haare heraus. Ihr schwarzes Kleid, das mit schönen roten Schriftzeichen verziert war, flatterte bei jeder ihrer Bewegungen im Wind. Sie lief mit einem beachtlichen Tempo kreuz und quer durch das Unterholz. Ihre Lunge brannte wie Feuer und das Stechen in der Seite ließ sich kaum noch ignorieren. Doch sie konnte nicht anhalten - nicht jetzt.
Hinter ihr liefen zwei größere Gestalten. Sie trugen Gürtel mit fürchterlich aussehenden Folterwerkzeugen und hatten sich die Kapuzen ihrer Umhänge tief ins Gesicht gezogen, sodass man ihre Gesichter nicht erkennen konnte. Ihre Gestalten schienen schwerfällig, ihre Bewegungen waren nicht mehr als ein Schatten und doch holten sie rasch auf. Seit Tagen schon verfolgten die Vermummten das Mädchen. Die zwei Gestalten waren ihr durch das Dorf, in dem sie lebte, gefolgt, hatten sie beobachtet und von jedem ihrer Schritte Notiz genommen. Und als sie ganz sicher glaubten, dass sie es war, die sie suchten, waren sie ihr in den Wald gefolgt, die Hände immer am Griff einer Waffe.
Plötzlich hörte sie hinter sich ein Surren. Sie kannte das Geräusch und warf sich panisch auf den Boden. Das Messer, das einer der Gestalten soeben geworfen hatte, bohrte sich haarscharf über ihr in einen Baumstamm. Keuchend rappelte sie sich auf und stürmte weiter. Wie lange sie schon durch den Wald hetzte, vermochte sie nicht zu sagen. Sie wusste ja noch nicht einmal mehr, wo sie sich überhaupt befand. Seitdem sie in blinder Furcht losgerannt war, hatte sie die Orientierung verloren, war einfach wild losgestürmt, in der Hoffnung, ihre Verfolger bald abzuschütteln.
Doch dieser Hoffnungsschimmer war schon bald endgültig erstickt worden. Im Gegensatz zu dem jungen Mädchen wiesen die Vermummten keinerlei Anzeichen von Erschöpfung oder Müdigkeit auf. Sie schienen gar mit jeder Minute, die verstrich, an Kraft zu gewinnen.
Das junge Mädchen sprang über einen im Weg liegenden Ast und griff voller Hoffnung in die kleine Tasche, die in ihrem Kleid eingenäht worden war. Doch schnell wurde ihr klar, dass sie ihr Messer in ihrer Hütte hatte liegen lassen. Leise fluchend rannte sie weiter. Sie war wehrlos und nur ihrer Schnelligkeit und mäßigen Ausdauer hatte sie es zu verdanken, dass sie noch nicht eingeholt worden war.
In diesem Moment traf sie etwas in die Schulter. Erschrocken schnappte sie nach Luft. Das Mädchen fühlte den Schmerz, den stechenden Schmerz, der ihr die Tränen in die Augen trieb. Sie sah sich um, sah eine kleine, aber scharfe Klinge aus ihrer Schulter ragen. Schnell griff sie nach dem Messer und zog es mit schmerzerfülltem Gesicht in einer schnellen Bewegung aus ihrer Schulter. Das Mädchen presste ihre Hand auf die Wunde und versuchte so die Blutung zu stoppen.
Der Schmerz verschleierte ihr die Sicht. Rennend und keuchend hetzte sie blindlings durch den Wald und bemerkte dabei nicht, dass ihr Weg ein Ende gefunden hatte. Plötzlich sackte der Boden unter ihren Füßen weg. Sie stürzte einen Abhang herunter, schlug ein paar Mal hart auf und spürte, wie ihr das Blut über den Arm und das Knie lief. Verzweifelt versuchte sie ihre Fersen in die Erde zu rammen oder nach heraushängenden Wurzeln zu greifen, doch der Boden war von den letzten Regenfällen aufgequollen und bot keinen Halt mehr. Dornen und andere spitze Pflanzen bohrten sich überall in ihre Haut und hinterließen kleine Kratzer. Als sie endlich unten aufkam, blieb sie erst liegen, keuchte und schrie dann vor Schmerz auf. Der Schrei hallte von den Bäumen wider und wurde auch von den zwei Gestalten nicht überhört.
Leichtfüßig, ohne Probleme, sprangen auch sie den steilen Abhang herunter und zogen dabei weitere Messer aus ihren Gürteln. Das Mädchen stöhnte gequält auf, wollte aufstehen, doch ihre Kraftreserven waren aufgebraucht. Außerdem lag ihre Hand noch immer auf ihrer Schulter, dort, wo sie das Messer getroffen und verwundet hatte. Die Wunde schmerzte fürchterlich. Die Gestalten hatten sie fast erreicht. Schon sah sie die Messer in der Sonne aufblitzen. Panik erfasste sie und sie hob schützend die Hände vor ihren Kopf. Angsterfüllt machte sie sich bereit zu sterben. Ihr Herz raste, ihr Atem ging stockend.
Doch mit einem Mal wurde die Luft von einem hässlichen Geräusch erfüllt und kurze Zeit später vernahm sie die Laute des Todes. Schmatzend und reißend bohrte sich Stahl in Fleisch und der beißende Gestank frischen Blutes stieg ihr in die Nase. Dann war es still. Aber sie empfand keine Schmerzen. War sie schon tot oder gar noch am Leben? Noch voller Angst blieb sie eine Weile am Boden liegen. Sie war schweißnass und zitterte. Doch nichts geschah. Verwundert hob sie den Kopf und blinzelte dem grellen Sonnenlicht entgegen.
Die zwei Gestalten lagen leblos am Boden. Die Kapuzen waren von ihren Köpfen gerutscht und die Gesichter, die darunter zum Vorschein kamen, waren ein Ebenbild der Hölle. Die Haut an ihren Köpfen und Händen war pechschwarz, sodass sie aussahen, als ob sie sich ihre Gesichter mit Ruß beschmiert hatten. Über ihren restlichen Körper schien sich eine blutig rote Haut zu spannen, die an manchen Stellen unter ihrem zerrissenen Umhang hervorlugte. Große, weiße Flecken ersetzten ihre Augen. Der Mund war ein klaffendes Loch, das alles aufzusaugen schien und aus dem sich eine Spur Blut zog. Über ihnen stand eine weitere Gestalt mit einem langen Schwert. Die Klinge war rabenschwarz, der Griff jedoch glänzte in einem wunderschönen Silber. Ihr Träger war mittelgroß und hatte kurze, braune Haare. Wie er dastand, mit erhobenem Schwert, das soeben noch den Geschmack frischen Blutes auf seiner Klinge geschmeckt hatte, ließ ihn mörderisch erscheinen und das Mädchen wusste im ersten Moment nicht, vor wem sie sich nun mehr fürchten sollte.
Die Gestalten hatten sie verfolgt und angegriffen und doch waren sie innerhalb weniger Sekunden von einem einzelnen Mann in den Tod gestoßen worden. Sie legte ihre Hand über die Augen, um das Gesicht ihres Retters erfassen zu können und plötzlich erkannte sie den Schwertträger. Er war kein Fremder für sie, ganz im Gegenteil. Das Mädchen lebte schon ihr ganzes Leben lang mit ihm zusammen.
„Ragon!“ Sie riss erschrocken die Augen auf. „Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden?“
Doch ihr großer Bruder antwortete nicht. Er packte sie nur am Handgelenk und zog sie mit sich. Das völlig verunsicherte Mädchen spürte den Schmerz der Verfolgung am ganzen Körper, als Ragon sie mit sich zog.
„Hey, lass mich los!“
Sie versuchte ihr Handgelenk aus Ragons Griff zu befreien, doch der hielt sie fest gepackt. Den ganzen Weg lang sprachen sie kein Wort. Dem Mädchen schien es, als ob ihr Bruder immer wieder verunsichert in alle Richtungen blickte, so, als ob er weitere Verfolger erwarten würde, doch es blieb ruhig. Bis sie vor der alten Hütte standen, die sie beide als ihr zu Hause bezeichneten, hielt der junge Mann sein Schwert fest in der Hand. Die Tür trat er mit einem festen Tritt einfach auf, sodass sie aus den Angeln zu fallen drohte und das Mädchen das Verlangen verspürte, sie festzuhalten. Sobald sie hindurchgetreten war, zog Ragon die Tür hastig zu und schloss sie ab. Das hatte er noch nie getan.
„Lia!“ Endlich er sprach mit ihr!
„Ragon was geht hier vor? Was hast du mit diesen Männern, mit diesen Dingern gemacht?“
„Wir haben keine Zeit mehr“, murmelte er. „Sie sind schon viel näher an uns dran, als ich gedacht hatte. Ich hätte es wissen müssen! Er ist stärker geworden – viel stärker!“
Er sah sie nicht an, während er sprach. In diesem Moment wollte Ragon sie nicht beachten, um auf ihre Fragen einzugehen, das spürte sie. Unruhig ging er im Raum auf und ab, in ein andauerndes Selbstgespräch versunken. Nach einer Weile hielt er schließlich inne und sah Lia verwundert an, so, als ob er gerade erst gemerkt hätte, dass er nicht alleine war.
„Was ist eben passiert?“, verlangte sie noch einmal zu wissen.
Doch er gab ihr keine Antwort.
„Ragon, was ist da soeben geschehen!“ Dieses Mal war es keine Frage, die das Mädchen ihrem Bruder gestellt hatte, sondern eine Aufforderung.
„Es geht um dich!“, flüsterte er. „Es ist zu kompliziert. Wir haben keine Zeit mehr! Ich hätte es dir doch schon viel früher erzählen müssen!“
„Was hättest du mir erzählen müssen?“
„Vergib mir!“ Ragon begann sein panisch wirkendes Auf- und Abgehen wieder aufzunehmen.
„Was hättest du mir erzählen müssen, Ragon? Was ist da soeben passiert und wer waren diese Kreaturen?“
Ragon lachte bitter auf.
„Zu viele Fragen, um sie alle beantworten zu können. Wir brauchen mehr Zeit. Aber, wir haben keine Zeit mehr!“
Lia begann wütend zu erröten.
„Fang doch damit an, mir zu erklären, was dein merkwürdiges Verhalten zu bedeuten hat!“
Plötzlich griff ihr Bruder nach ihrer Hand. Lia wollte sie erschrocken zurückziehen, überlegte es sich dann jedoch anders. Irgendetwas beunruhigte Ragon, aus seinen Gesichtszügen sprach die Furcht. Eine Zeit lang schien er nach den richtigen Worten suchen zu müssen. Er öffnete immer wieder den Mund, nur um ihn danach wieder zu schließen.
„Erinnerst du dich an die Geschichten, die ich dir früher immer erzählt habe?“ Endlich schien er den richtigen Anfang gefunden zu haben.
Lia nickte. Sie erinnerte sich. Es war eine uralte Geschichte. Eine Geschichte, die vom Tod und Leid einer ganzen Welt erzählte, erzählte, wie das Grauen in diese Welt kam, mit der Absicht, ihr Herrscher zu werden.
Sie handelte vom Leben und vom Tod.
Es war die Geschichte der Todes Tochter.
„Es war ein schwarzer Tag. Der Himmel hatte sich schon zur Mittagszeit verdunkelt und es waren weder die Sonne noch der Mond zu sehen. Ein alter Mann in einem langen braunen Umhang stand im Bett eines kleinen Baches und sah in den Himmel. Er hatte seine Arme erhoben und seine Handflächen zeigten geradeaus in den nahe gelegenen Wald. Der Bach entsprang an einem Apfelbaum, der am Rand des Berges stand und lief an seiner Oberfläche entlang, bis er plötzlich am Ende des Berges abknickte und hinunterlief. Das Wasser war kristallklar und eigentlich war es dem Mann angenehm, mit nackten Füßen im Wasser zu waten. Doch heute lag auf seinem Gesicht kein entspannter oder glücklicher Ausdruck, sondern eine Mischung aus Furcht und Besorgnis. Am rabenschwarzen Himmel stand kein Mond und es war dem Zauberer nur möglich zu sehen, indem er Fackeln entzündete. Fackeln mit blauem Feuer. Blaues Feuer, das ihm einst zusammen mit dem schwarzen Stein von der Göttin Surah überreicht worden war.
Surah war keine menschliche Gestalt, wie man annehmen konnte. Ihr Erscheinungsbild glich eher dem einer Seele oder eines Geistes. Sie war die Todesgöttin, jedoch schenkte sie auch gleichzeitig das Leben. Wurde ein Kind geboren, egal, ob in armer oder reicher Familie, dann pries man die Göttin und dankte ihr für das Geschenk des Lebens. Starb jedoch ein Mensch, trauerten seine Angehörigen am Grabe und sangen ein besonderes Lied, das die Güte und den Hass Surahs schilderte. Sie sangen zum Abschied des Menschen und wollte sich mit dem Lied selbst vor dem Zorn der Göttin und der Macht des schwarzen Steins schützen. Der schwarze Stein war das Objekt, mit dem es die Göttin vermochte, über Leben und Tod zu entscheiden. Selten nutzte Surah diese Kraft. Ihr war es lieber, die Dinge der Natur zu überlassen und sich nur so wenig es eben ging in ihren Lauf einzumischen.
Das unscheinbare Artefakt beinhaltete dunkle Magie, die das Leben nahm, sowie helle Magie, die es gab und dieser gefährliche Zauber wurde für sie alle zur Gefahr. Denn es gab Menschen, die diese Kraft für sich nutzen wollten. Und nicht nur Menschen verfielen diesem Wahn. Kreaturen, die aus dem Feuer der Hölle entsprungen waren, versuchten den schwarzen Stein zu erlangen. Die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden, würde sie unsterblich machen! Sie würden die Welt beherrschen und alle ihre Feinde mit einem kleinen Stein in den Tod schicken können. Unbegrenzte Macht und die Aussicht auf ein ewiges Leben trieben so manchen von ihnen in den Wahnsinn. In Scharen begannen die Menschen damit, sich das Leben zu nehmen, um so der Göttin selbst zu begegnen und ihr das Objekt ihrer Begierde zu entreißen.
So wandte die Göttin eine List an. Sie würde den schwarzen Stein verstecken, jemand anderem die schwerwiegende Aufgabe zuteilen. Sie würde ihn genau dort verstecken, wo ihn niemand entdecken würde – direkt vor ihrer Nase, auf der Erde. So kam der Zauberer Lunus zu dem Stein.
Er war ein mächtiger, weiser Mann und doch lebte er allein, abgeschieden vom Trubel der Städte und der Dörfer, auf einem kleinen Berg. Niemals wandte er seine Kräfte dazu an, anderen zu schaden und sollte er je einem Lebewesen ein Unrecht zugefügt haben, wusste er dies zu rechtfertigen. Er missbrauchte seine Macht nicht. So gab Surah den schwarzen Stein in seine Hände und ernannte ihn zu seinem Wächter. Lunus fröstelte. Der aufkommende Wind war beißend. Er grub sich unter seine Haut und setzte sich tief in seinem Inneren ab. Langsam stieg der alte Mann aus dem Wasser und setzte sich unter den Apfelbaum. Er war müde, unsagbar müde und dennoch konnte er sich nicht schlafen legen. Etwas plagte ihn, ließ ihn nicht mehr los. Etwas bereitete ihm unsagbare Angst.
Als er sich in der vergangenen Nacht schlafen gelegt hatte, war er von einem Albtraum heimgesucht worden. Er war umgeben von hellen Flammen, unsagbare Hitze hatte sich um ihn herum ausgebreitet und nagte an jedem Zweig, jedem Blatt, jedem lebenden Geschöpf, auch an ihm. Das Feuer war echt und doch verbrannte es nichts, das von seinen grellen Flammen verschluckt wurde. Es bereitete nur unsagbar große Schmerzen. Der alte Mann wusste, was es mit diesem magischen Feuer auf sich hatte. Sein Ursprung befand sich nicht dieser Welt, denn es war Höllenfeuer.
Lunus spürte, wie es ihm bei dem Gedanken die Kehle zuschnürte. Eine Kreatur, vielmehr ein Schatten, war aus der Hölle entkommen. Er hatte es tatsächlich geschafft, die unzähligen Barrieren zwischen den Welten zu überwinden, ohne dabei in Stücke zerrissen zu werden. Dem Zauberer war durchaus bewusst, aus welchem Grund die Kreatur in seine Welt gedrungen war. Doch wie hatte er davon erfahren können? Wie war es ihm gelungen, aus der Hölle zu entkommen? Es war dem Zauberer ein Rätsel und trotz seines schnellen Erwachens wusste er, dass er diesen Traum nicht umsonst gehabt haben musste. Es war kein bloßer Albtraum gewesen, vielmehr eine Warnung.
Schweißperlen begannen sich auf der Stirn des Zauberers zu bilden. Es war kalter Angstschweiß. Hastig sprang er auf und lief einmal um den Baum herum. Er bückte sich und zog an einer alten Wurzel, die mit einem ächzenden Geräusch nachgab und nach oben knickte. Der alte Mann atmete erleichtert auf. Dort unten, von mehreren Schutzzaubern umgeben, lag er. Vorsichtig löste er die schützenden Barrieren und streckte seine Hand nach dem mächtigen Artefakt aus. Er spürte die kalte, glatte Oberfläche, die makellose Hülle des schwarzen Steins. Vorsichtig ließ er ihn in seine Manteltasche wandern, dann klappte er die Wurzel wieder nach unten und richtete sich auf. Neben dem Fluss, noch immer unter den schützenden Zweigen des Baumes standen ein kleiner schwarzer Kessel und eine Holzschale. Lunus griff nach der Schale und begann damit das kristallklare Wasser in den Kessel zu füllen, bis er halb voll war. Dann zog er ein langes Messer unter seinem Umhang hervor. Während die Klinge tief in seine Handfläche schnitt, hielt er den Kopf abgewandt. Dann ließ er seinen kostbaren Lebenssaft ebenfalls in den Kessel tropfen und wischte sich die blutverschmierte Hand am Umhang ab. Als sich sein Blut mit dem Wasser aus dem Bach vermischte, färbte sich die Brühe mit einem Mal rabenschwarz. Zuletzt nahm er eine der aufgestellten Fackel und entzündete seine Tinktur mit dem blauen Feuer. Mit einigen Metern Abstand begann der Zauberer seine Hände nach beiden Seiten auszustrecken und mehrere Sprüche in einer fremden Sprache zu murmeln. Er begann am ganzen Körper zu zittern und kurz sah es so aus, als ob er zusammenbrechen würde.
Plötzlich erhoben sich plötzlich dunkle Nebelschwaden aus dem Kessel und begannen sich langsam zu einer Gestalt zu formen. Als der Nebel erloschen war, stand an seinem Platz ein Mann mit kurzen braunblonden Haaren und grünen Augen. Er trug einen schwarzen Umhang, auf dem rote Schriftzeichen eingenäht worden waren. Der Zauberer musterte ihn kurz und wiederholte dann den gleichen Vorgang ein zweites Mal. Wieder erhob sich erst der Nebel aus dem Kessel und als er sich legte, stand ein zweiter junger Mann vor Lunus. Er hatte kurze braune Haare, braune Augen und einen ebenfalls schwarzen Umhang mit den gleichen Schriftzeichen. Bevor der alte Mann den Vorgang jedoch ein drittes Mal wiederholte, griff er in seine Manteltasche und zog den schwarzen Stein hervor. Mit einem leisen Geräusch verschwand das Objekt in der dunklen Tinktur. Wieder begann der Zauberer verschiedene Worte zu murmeln, doch dieses Mal erschien nicht nur schwarzer Nebel. Rote Nebelschwaden umtanzten die schwarzen und trafen immer wieder mit ihnen aufeinander. Mit Ende des Zaubers erloschen die Nebelschwaden mit einem grellen Lichtblitz, dann wurde es dunkel. Für einen kurzen Moment erloschen selbst die Fackeln.
Lunus stützte sich schwer atmend am Stamm des großen Baumes ab. Auch ihn drohte ewige Finsternis einzuholen, doch mit letzter Kraft schüttelte der alte Mann die Hände des Todes von seinen Schultern. Vorsichtig beugte er sich über den Rand des Kessels. Die schwarze Tinktur war verschwunden. Anstelle dieser lag nun ein kleines Geschöpf in dem großen Kessel. Es war ein Baby, ein kleines Mädchen, das den schwarzen Stein mit ihren winzigen Händen fest umklammert hielt. Es schrie nicht, sondern hatte ihre Augen fest geschlossen und atmete ruhig und gleichmäßig. Ein warmes Lächeln breitete sich auf den Zügen des Zauberers aus. Er hatte es geschafft. Es war ihm tatsächlich gelungen!
Lunus nahm dem kleinen Kind den Stein vorsichtig aus den Händen und steckte ihn zurück in seinen Mantel, dann hob er es heraus und ging zu den Männern hinüber. Lunus legte es dem braunäugigen Mann in den Arm und wandte sich dem anderen zu. Er berührte mit seinen beiden Zeigefingern die Schläfen des jungen Mannes und begann zu flüstern.
„Erster Todesritter. Ich gebe dir hiermit mein Wissen und meine Kraft. Mögest du die Todes Tochter beschützen und ihr bei ihrer Aufgabe helfen, das Böse auf dieser Welt zu verhindern!“
Er wartete noch einen kurzen Augenblick, bis das blaue Licht in den Augen seines Gegenübers erloschen war, dann wandte er sich dem anderen Mann zu.
„Zweiter Todesritter. Ich gebe dir hiermit mein Wissen und meine Kraft. Mögest du die Todes Tochter beschützen und ihr bei ihrer Aufgabe helfen, das Böse auf dieser Welt zu verhindern!“
Schließlich ging er noch einmal zu dem Apfelbaum hinüber und griff nach ein paar Waffen, die dort unter etwas Laub versteckt lagen. Er überreichte dem grünäugigen Mann das erste Schwert. Es hatte einen silbernen Griff, seine Klinge jedoch war tief schwarz.
„Nimm es und beschütze die Todes Tochter außerhalb ihrer Heimat. Suche im Umland nach Feinden und lass sie in den Abgrund des Todes stürzen. Auch, wenn du mit deinem Leben bezahlst!“
Dann überreichte er dem zweiten Todesritter das gleiche Schwert.
„Nimm es und beschütze die Todes Tochter innerhalb ihrer Heimat. Sollte dein Gefährte versagen, wirst du sie weiterhin mit deinem Leben beschützen!“ Der alte Mann drückte ihm außerdem noch zwei weitere Waffen in die Hand. Sie waren um einiges kürzer als ihre Vorgänger. Ihre Klingen waren gebogen und wanden sich wie die Leiber von Schlangen. Auch ihre Griffe waren rabenschwarz. Die Kurzschwerter unterschieden sich darin, dass auf einem Griff ein grüner, auf dem anderen ein roter Edelstein saß.
„Dies sind die Schwerter der Todes Tochter“, erklärte er. „Ihr alle bekamt von mir schwarze Schwerter, mächtige Waffen, die euch im Kampfe unterstützen werden. Sie gleichen eure Schwächen aus und unterstützen eure Stärken. Nehmt sie als ein Geschenk meiner Achtung entgegen. Und nun geht!“
Der alte Mann wandte sich von seinen Schöpfungen ab. Ob er das Richtige getan hatte, vermochte er nicht zu sagen. Jedoch hatte sein Zauber ihn geschwächt. Er war nun Magie - und somit schutzlos und bereit, auf den Tod zu warten.
Ein paar Stunden später, noch in derselben Nacht, spürte Lunus, wie sich ein brennender Schmerz seines Körpers bemächtigte. Stöhnend schlug er die Augen auf und blickte in das Gesicht des Schattens.
Ragon lächelte sie an. „Dir hat die Geschichte immer gefallen.“
„Sie gefällt mir noch immer“, antwortete Lia. „Das Ende hast du mir nie erzählt.“
„Das liegt daran, dass es noch kein Ende gibt“, flüsterte Ragon.
Lia sah ihn verwirrt an. „Gibt es nicht?“
„Nein. Noch nicht, aber bald, denn wenn alles so wird, wie ich es mir erhoffe, dann werden wir all diesen Menschen all dieses unsagbare Leid ersparen können.“
„Moment!“ Lia schüttelte lachend den Kopf. „Du hast eben ‚wir’ gesagt!“
„Der Schatten wird niemals an die Macht gelangen, wenn er vorher von dir gestürzt wird. Du kannst ihn daran hindern!“
Das verwirrte Mädchen zog misstrauisch die Augenbrauen hoch.
„Ich?“
Ragon nickte.
„Ich weiß, es kommt gerade alles etwas plötzlich, aber die Geschichte hat sich wirklich so zugetragen, sie ist wahr!“
„Was soll das heißen, sie ist wahr?“
„Es soll heißen, dass du die Todes Tochter bist, Lia!“
Lia ließ seine Hand los und sah ihn an. Schon früher hatte sie an seinen Augen erkennen können, ob er log oder die Wahrheit sagte. Ein hektisches Glitzern oder Zucken hätte ihn verraten, doch er blieb ganz ruhig. Das hieß, dass er nicht log. Aber wenn er nicht log, dann musste er die Wahrheit sagen, seine Geschichte wäre wahr. War es denn möglich, dass es stimmte? Ihr Pulsschlag beschleunigte sich und sie schüttelte ungläubig den Kopf.
„Bist du vielleicht heute irgendwann auf den Kopf gefallen?“, fragte sie vorsichtig.
Ihr Bruder legte die Stirn in Falten.
„Es ist die Wahrheit", erklärte er. „Als ich die Schattendiener vor ein paar Tagen in unserem Dorf sah, wusste ich, dass unsere Zeit gekommen ist. Vielleicht aber habe ich auch zu lange gewartet!“
„Schattendiener?“ Lia sah ihn verwundert an.
„Ja, die Kreaturen, vor denen ich dich vorhin gerettet habe. Grässliche Wesen, die der Schatten mit dunkler Magie heraufbeschworen hat. Er hat sie nach seinem Abbild erschaffen. Nur die magischen Fähigkeiten und ein paar weitere Kleinigkeiten unterscheiden sie von ihm. Erst töten sie ihre Opfer und dann saugen sie sie aus.“
„Sie saugen sie aus?“ Lia schnappte nach Luft.
Ihr Bruder nickte.
„So bleiben sie bei Kräften. Jedoch habe ich noch nie solch starke Züchtungen gesehen. Ich hoffe, dass es noch nicht zu spät ist!“
Das junge Mädchen konnte immer noch nicht fassen, was ihr Bruder ihr da gerade erzählte. Immer wieder ließ sie sich seine Worte durch den Kopf gehen, fand aber auch keine passende Erklärung für sein merkwürdiges Verhalten. Nervös fuhr sie sich mit der Hand durch die Haare und schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf.
„Warum ausgerechnet jetzt?“ Ihre Stimme zitterte und sie musste gegen die Tränen ankämpfen, die aus ihr herauszubrechen drohten.
„Es gibt Zeichen. Wie gesagt, die Schattendiener, die dich verfolgt haben, zeugen davon, dass der Schatten an Macht gewonnen hat!“
„Welche Rolle spielst du in der Geschichte?“
Warum Lia fragte, wusste sie nicht. Sie fürchtete die Antwort bereits zu kennen.
„Ich bin einer der Todesritter“, flüsterte er, „und leider auch nicht dein wahrer Bruder!“
Wie er die letzten Worte aussprach, eiskalt und ohne Hemmungen, sprudelte es einfach so aus ihm heraus. Doch für Lia war es wie ein Schlag mitten ins Gesicht. Ungläubig keuchte sie auf und versuchte zu verstehen, was Ragon gerade gesagt hatte.
Frische Luft, sie brauchte jetzt frische Luft! Langsam ging sie zur Tür. Obwohl sie Ragons Gesicht nicht sehen konnte, wusste sie, dass er ihr verzweifelt hinterherblickte. Verwirrt stieß sie die Tür auf, die mit einem kräftigen Quietschen zurückfiel und an die Wand krachte. Kurz bevor sie die Hütte verließ, drehte sie sich noch ein Mal zu ihm um. Er saß einfach nur da, machte keine Anstalten, sie aufzuhalten.
Enago
Nur durch das leicht gedimmte Licht, das von ein paar Fackeln ausgestrahlt wurde, vermochte Enago etwas zu sehen. Die Kälte in der Höhle war beißend. Sie kroch ihm unter die Haut und ließ ihn frösteln. Doch nicht nur die Kälte war der Grund dafür, dass ihm die Haare zu Berge standen. Die Angst vor dem, was vor ihm lag, ließ ihn innerlich verkrampfen. Zitternd kroch Enago vor seinen Meister. Er suchte immer noch nach den richtigen Worten, die sein Versagen erklären konnten.
„Enago, was willst du hier? Warum vergeudest du meine Zeit?“ Es war eine grauenvolle Stimme, die da zu ihm sprach. Kalt und düster.
„Herr, ich habe euch aufgesucht, um euch etwas Wichtiges mitzuteilen.“
„Was denn?Ich habe nicht viel Zeit!“, fauchte der düstere Meister.
„Natürlich, mein Herr.“
Langsam kroch Enago vorwärts. Er zitterte am ganzen Körper und sein Herzschlag war so laut, dass er befürchtete, man könne ihn hören.
„Ich erhielt gerade Kundschaft von unseren Spionen. Die Schattendiener, die ich losgeschickte, die Todes Tochter zu finden und ihre Beschützer zu töten, waren in zweierlei Hinsichten erfolgreich.“
Ein gurgelndes Lachen drang ihm entgegen.
„Gut“, flüsterte die dunkle Kreatur. „Also haben sie sie gefunden und die Todesritter wurden in denendlosen Abgrund gestoßen?“
Enago schluckte. Er wagte es kaum, weiter zu sprechen.
„Sie haben sie gefunden, jedoch …“ Er räusperte sich und versuchte verzweifelt, die aufkommende Angst zu verbergen.
„Jedoch gelang es ihnen nur, einen der Beschützer zu töten. Danach haben auch sie den Tod gefunden.“
„Wie bitte?“
Unter den scharfen Worten des Schattens zuckte Enago erschrocken zusammen.
„Wessen Hand hat es gewagt, seine Klinge durch das dunkle Herz meiner Züchtungen zu stoßen?“
„Ich, ich weiß es nicht, mein Herr.“
Enago starrte gebannt auf den schmutzigen Boden vor ihm. Auf keinen Fall wollte er dem tödlichen Blick, den eiskalten Augen begegnen. Der Schatten verschmähte schlechte Nachrichten und von dem Großteil ihrer Überbringer hatte er nur ein paar leblose Fetzen übrig gelassen.
„Sie läuft also noch immer lebendig herum? Die Zeiten sind also noch fern, in denen sie um Gnade winselnd vor mir knien wird?“
Enago antwortete nicht. Der Schatten hatte ihm zwar eine Frage gestellt, war sich dessen Antwort jedoch bewusst. Außerdem konnte Enago nicht mehr sprechen. Der Kloß in seinem Hals wurde immer größer, er zitterte. Stille begann sich in der Höhle auszubreiten. Es war eine beunruhigende Stille, eine tödliche Stille. Vorsichtig wagte es Enago, leicht den Kopf zu heben. Doch er erblickte nur kalte Höhlenwände und richtete seine Augen zurück auf den Boden.
„Meister?“ Der Schattendiener rief verunsichert nach seinem Herrn.
„Enago!“
„Ja, Meister?“
Enago lief ein Schauer über den Rücken.
„Komm ein Stück näher!“
Langsam bewegte er sich, immer noch kriechend, in Richtung der grauenvollen Stimme. Dabei wanderte sein Blick immer wieder leicht nervös umher. An den Wänden der Grotte hingen Knochen und Schädel. Manche schon älter, aber andere noch so frisch, dass Enago das faule Fleisch, das an ihnen hing, sehen und riechen konnte. Zwischen den Knochen konnte man ebenfalls frische Gedärme bewundern. Ein Herz hing neben einer schon fast völlig zersetzten Leber und ein frisches Auge glotzte traurig auf Enago herab. Trophäen! Alles Trophäen, die aus den Körperteilen und Innereien der Feinde des Schattens bestanden. Die, die es gewagt hatten, die dunkle Kreatur herauszufordern, sie in Frage zu stellen – ihn zu enttäuschen.
Ihm wurde schlecht und er musste sich zusammenreißen, um sich nicht zu übergeben. Seine schwarzen Locken fielen ihm ins Gesicht und er konnte seinen Schweiß schmecken, der ihm aus lauter Furcht von der Stirn tropfte. Während er auf dem kalten Steinboden kroch, schnitt er sich schmerzhaft die Handflächen auf und sah sein Blut über den Boden rinnen. Doch das machte ihm wenig aus. Seine Angst vor dem, was vor ihm lag, war größer als jeder Schmerz.
Fast hatte er den steinernen Thron der Kreatur erreicht, als er plötzlich eine Hand an seiner Kehle spürte. Sie schloss sich fest um seinen Hals, drückte immer fester zu, so wie der würgende Griff einer Schlange. Er spürte, wie es ihm mit der Zeit die Kehle zuschnürte. Er schnappte nach Luft, konnte kaum noch atmen. Dann verlor er plötzlich den Boden unter den Füßen. Er wurde höher gehoben, bis er den fauligen Atem seines Meisters roch und in die weißen Augen blickte. Er versuchte nicht hineinzuschauen, doch das schien schier unmöglich! Es war ein Todesweiß, in dem er sich selbst wiederfand - unter Schmerzen sterbend.
„Bitte, Meister“, keuchte er, denn er bekam kaum noch Luft. „Lasst mich leben. Ich bekomme keine Luft mehr.“
„Und warum denkst du, dass ich dich leben lassen soll? Du hast dir in letzter Zeit zu viele Fehler erlaubt, Enago!“
Der faule Atem seines Herrn gab ihm fast den Rest.
„Ich werde sie für euch finden“, krächzte er verzweifelt. „Das, was eure Züchtungen nicht zu tun vermochten, werde ich für euch erreichen! Ich werde sie finden, euch persönlich bringen und sollte ich versagen, ...“
Die Hand, die sich um seinen Hals geschlossen hatte, war mit einem Mal verschwunden und er stürzte unsanft auf den Boden. Hart schlug er mit dem Kinn auf dem kalten Stein auf. Es wurde warm in seinem Gesicht.
„Dann ist dein Schicksal besiegelt!“
Hektisch richtete sich Enago auf und stürzte panisch davon, die zischende Lache seines Meisters im Genick. Er rannte, rannte einfach geradeaus und selbst als er die Höhle schon lange verlassen hatte, hielt er nicht an. Er wagte es nicht, auch nur einen kurzen Blick zurückzuwerfen.
Der Schatten sah seinen Diener in Todesangst die Grotte verlassen und mehr eine Fratze als ein Grinsen breitete sich auf seinem scheußlichen Gesicht aus. Es bereitete ihm große Freude, Lebewesen leiden zu sehen. Schmerz und Leid zu verbreiten, das waren seine besten Freunde. Plötzlich hefteten sich seine weißen Augen auf ein purpurrotes Kissen, das neben seinem felsigen Thron stand, auf dem er saß. Auf diesem Kissen lag der schwarze Stein, den der Schatten in jener Nacht dem Zauberer Lunus abgenommen hatte. Der alte Mann hatte damals kaum Widerstand geleistet. Noch nicht einmal einen einfachen Zauber hatte der einst so mächtige Magier bewirken können. Das Einzige, was er getan hatte, nachdem seine Kehle mit Blut befleckt worden war, war, wissend zu lächeln.
„Gerechtigkeit wird siegen. Der Tod wird auch dich zurück in dein dunkles Grab zerren!“
Dann hatte die grausame Kreatur den schwarzen Stein aus Lunus lebloser Hand genommen und durch seine weißen, toten Augen die letzten Atemzüge des Zauberers genussvoll angesehen. Nun schien er nicht mehr aufzuhalten zu sein. Doch seine Flucht aus der Hölle hatte ihn fast seine ganze Lebensenergie gekostet, sodass er sich in diese Höhle zurückgezogen und erholt hatte.
Nun war er bereit. Bereit, diese Welt mit der Kraft des schwarzen Steines zu vernichten. Wüsste er doch nur, wie man ihn benutzt!
Blindes Vertrauen
„Lia, bitte warte doch!“
Mit schnellen Schritten stürzte Ragon ihr nach.
„Ich komme wieder, wenn du damit aufhörst, dich so seltsam zu benehmen!“ Der Zorn, der in Lias Stimme mitschwang, war deutlich zu hören.
„Für wen hältst du mich, dass ich dir deine kleine Geschichte abkaufen soll? Ich bin keine Figur in einer Geschichte! Das hier ist die Wirklichkeit!“
Sie drehte sich nicht um, wagte es nicht, in Ragons Gesicht zu blicken, sondern trat die Flucht nach vorne an. Mit einem trotzigen Gesichtsausdruck marschierte sie in Richtung Wald. Der Wald, ein Zufluchtsort im Schutz der Bäume und der Dunkelheit. Ihr Herz schlug hart gegen ihre Rippen und Schweißperlen standen ihr auf der Stirn. Obwohl sie nicht rannte, fühlte sie sich ausgelaugt und müde. Die Wunde an ihrer Schulter hatte erneut angefangen höllisch zu brennen und schien sich mit jeder Sekunde tiefer in ihre Haut zu fressen. Noch immer konnte Lia Ragons Schritte hören, die sie entschlossen weiter verfolgten.
„Lass mich in Ruhe!“, keifte sie.
„Lia, bitte, ich kann es beweisen. Ich kann dir beweisen, dass die Geschichte wahr ist!“
Sie drehte sich mit gespieltem Erstaunen um.
„Ach ja! Wie willst du beweisen, dass sie wahr ist? Denn wie du eben richtig sagtest, es ist eine Geschichte. Es ist bloß eine Geschichte, Ragon!“
Ragon sah sie mit einer Mischung aus Wut und Verzweiflung an und Lia glaubte schon, dass er auf dem Absatz kehrtmachen und sich damit die ganze Sache erledigen würde. Doch er hatte nicht vor, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Mit einem schnellen Ruck zog er an dem Band, das seinen Umhang hielt. Nachdem er sich dessen entledigt hatte, begann er damit, sein Hemd auszuziehen.
„Was ...?“, fragte Lia verwirrt, als er sich das Hemd über den Kopf gezogen hatte.
Ragons Oberkörper war fast komplett mit schwarzen Zeichen bemalt. Sie begannen an der Brust und verliefen in geschwungenen Linien über die Rippen bis hin zum Bauchnabel. Ein Zeichen kam jedoch besonders oft vor. Ein geschwungenes T verzierte den Großteil seines Körpers.
Lia wusste nicht, was es bedeutete, aber einen kurzen Moment lang begann sie, daran zu zweifeln, dass seine Geschichte eine Lüge sein sollte.
„Diese Zeichen sind die der Todesritter. Sie sollen sie daran erinnern, dass sie eine Aufgabe haben. Und diese Aufgabe bist du. Auch wenn wir dabei unser Leben verlieren. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen, damit du leben darfst. Ich werde ihn zahlen und auch Lucio hat ihn gerne für dich gezahlt.“
„Wer ist Lucio?“ fragte Lia, noch immer misstrauisch.
Ragon sah sie traurig an. Er öffnete seinen Mund, doch schien er nicht die passenden Worte zu finden. Sein Blick wanderte leicht hilflos umher.
„Lucio? Lucio war der erste Todesritter, der zu deinem Schutz geschickt wurde. Ich habe ihn heute Morgen gefunden. Tot.“
Ragon blickte betrübt zu Boden und Lia konnte echte Trauer in seinen Augen erkennen.
„Schattendiener haben ihn getötet. Deswegen bin ich dich suchen gegangen. Ich wusste, dass es an der Zeit war, dir die Wahrheit zu sagen. Denn Schattendiener dürfte es eigentlich noch gar nicht geben. Die Zeit ist reifer als ich bisher dachte.“
Lia biss sich auf die Unterlippe, bis sie zu bluten begann.
„Sie haben ihn erstochen?“, fragte sie leise.
„Nein!“
Lia sah verwirrt auf.
„Schattendiener erstechen Menschen nicht. Sie saugen sie aus, bis nichts mehr in ihnen vorhanden ist und lassen dann ihre leblosen Hüllen liegen“, erklärte Ragon.
Sie sah angewidert auf. „Und du lügst mich auch ganz sicher nicht an?“
Ein erleichtertes Lächeln erschien auf seinem Gesicht.
„Nein. Es ist dein Schicksal, deine Aufgabe.“
Lia lächelte zurück. Sie vertraute ihm immer noch nicht vollständig, aber, dass er log, glaubte sie auch nicht mehr. Plötzlich spürte sie einen stechenden Schmerz in ihrer Schulter. Es war, als ob ihr jemand eine brennende Fackel ins Fleisch gedrückt hätte. Entsetzt stöhnte sie auf.
„Lia?“ Ragon setzte ein besorgtes Gesicht auf.
Das junge Mädchen spürte den Schmerz plötzlich überall. Er begann sich auszubreiten, sich in jeder Pore ihres Körpers festzusetzen. Stöhnend presste Lia ihre Hände auf die Schläfen. Ihre Beine zuckten gefährlich. Dann brach sie zusammen. Das Letzte, das sie hörte, bevor sie in Ohnmacht fiel, war das entsetzte Schreien, das aus Ragons Kehle drang.
„Lia!“
Langsam schlug sie die Augen auf. Stöhnend rieb sich das junge Mädchen den Kopf und richtete sich vorsichtig auf. Ihre Schulter kribbelte leicht, doch die starken Schmerzen, die sie vorhin empfunden hatte, waren verschwunden. Verwundert sah sie sich um. Sie lag in einem mit weißem Lack verzierten Bett aus Holz. An der Decke hingen kleine Fläschchen mit farbigen Inhalten, manche leuchteten in allen Farben, andere jedoch schienen trüb und dunkel wie die Nacht. Ihr Inhalt bestand aus einer schwarzen oder braunen Masse und Lia bedankte sich im Stillen dafür, dass sie nicht wusste, was es war. Die Wände waren mit verschiedenen Kräutern geschmückt. Sie waren getrocknet worden und ein paar von ihnen erkannte sie wieder. Sonst war der Raum eher schlicht ausgestattet. In der Mitte befand sich ein kleiner, runder Tisch mit vier Stühlen. Rechts neben Lias Bett stand ein kleiner Nachttisch, ebenfalls mit weißem Lack gestrichen und gegenüber von ihr ein großer Schrank, dessen Inhalt ihr nicht bekannt war.
Erneut fuhr ihr ein stechender Schmerz durch die Schulter und sie griff sich an den Rücken. Ihre Finger trafen jedoch nicht auf verletztes Fleisch, sondern fuhren über weiche Binden. Verwundert musste Lia feststellen, dass ihre Schulter verbunden worden war.
„Lia?“
Erschrocken drehte sie sich um. Es war Flynn, der Heiler des Dorfes. Sie musste sich in seinem Haus befinden. Neben dem Heiler stand Ragon, der sie mit einer Mischung aus Besorgnis und Wut ansah.
„Warum hast du mir nicht gesagt, dass ein Schattendiener dich verwundet hat?“, fragte er.
„Ich, ...“ Lia war noch immer etwas schummrig und sie hatte Mühe zu sprechen.
„Ich habe gerade erfahren, dass ich eine Figur in einer Geschichte sein soll. Du hast mir erzählt, ich sei die Todes Tochter. In diesem Moment habe ich mir eher Sorgen um dich gemacht! Außerdem dachte ich, es wäre nicht weiter schlimm. Es war nur eine kleine Klinge.“ Lia sah, wie sich Ragons Gesicht rötlich färbte.
„Diese kleine Klinge“, erklärte er, „ist das Todeswerkzeug der Schattendiener. Nachdem es in deine Haut gedrungen ist, setzt es ein Gift frei, das dich nach wenigen Sekunden bewusstlos werden lässt. Dann haben sie genug Zeit, um dich aufzuschlitzen und auszusaugen.“
Ein kalter Schauer jagte Lia über den Rücken. Die Vorstellung, ausgesaugt zu werden, ließ sie in dem doch warmen Raum frösteln.
„Aber warum bin ich erst so spät in Ohnmacht gefallen?“, fragte sie leicht verwundert.
„Du bist die Todes Tochter. Eine deiner zahlreichen Fähigkeiten ist das Verwerten von Gift. Du nimmst es ins Blut auf und wandelst es in Wasser um. Dieses Gift jedoch ist eines der stärksten, das ich jemals gesehen habe und da du noch nicht vollständig ausgebildet bist, konntest du das Gift nicht gänzlich umwandeln.“
Lia entzog sich seinem Blick. Zu viele Gedanken schwirrten ihr im Kopf herum. Sie fühlte sich nicht gut. Ihr Atem ging stockend. Plötzlich wirbelte sie herum und sah Flynn erstaunt an. Der lächelte sie an.
„Keine Angst, ich bin ein Freund. Schon als Ragon und du in unser Dorf gekommen seid, habe ich aufgepasst, dass du dich nicht verletzt. Ragon hat mich außerdem dazu gezwungen, niemandem zu verraten, wo ihr wohnt, noch dass ich euch überhaupt kenne.“
Lia lächelte zurück und doch breitete sich Sorge in ihr aus. Wenn es wahr war, wenn Ragons irrsinnige Geschichte wirklich stimmte, schenkten sie Flynn gerade blind ihr Vertrauen. Sie kannte ihn kaum. Ab und zu war er ihr über den Weg gelaufen und hatte zum Gruß die Hand gehoben. Er besaß ein freundliches Gesicht. Lustige grüne Augen, die im Licht immer wieder aufblitzten und mehr an einen kleinen Jungen als an einen erwachsenen Mann erinnerten. Lia hatte sich noch nie ernsthaft verletzt, sodass sie die Dienste des Heilers bisher auch nicht benötigt hatte.
Das junge Mädchen seufzte, griff sich mit der Hand an den schmerzenden Kopf. Sie war erschöpft, die Welt drehte sich, alles schien mit einem Mal unglaublich kompliziert. Müdigkeit breitete sich in ihr aus, sodass sie ihre Augen kaum noch offenhalten konnte. Langsam ließ sie sich zurück ins Bett gleiten.
Todes Tochter?
Sie ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen, wiederholte ihn in Gedanken. Es hörte sich seltsam an. War sie wirklich die Todes Tochter? Das Mädchen aus den Geschichten, die ihr immer und immer wieder erzählt worden waren?
Eine helfende Hand
Enago stürzte sich ins Wasser und begann sich das Blut von den Handflächen zu waschen. Den stechenden Schmerz, der ihm dabei die Tränen in die Augen trieb, versuchte er zu ignorieren. Den ganzen Weg von dieser verfluchten Höhle bis zu diesem Fluss war er gerannt, in der ständigen Angst, zurückgeholt zu werden. Der faulige Atem seines Meisters hatte ihn fast ohnmächtig werden lassen. Er war gerannt, soweit ihn seine Füße noch getragen hatten. Denn er wusste nicht, wie lange er seine Kraftreserven noch weiter erschöpfen konnte. Seine einzige Chance auf Gnade bestand darin, die Todes Tochter zu finden und sie seinem Meister zu bringen. Sollte ihm das nicht gelingen, würde er seine Füße, seinen ganzen Körper nicht mehr brauchen. Er würde seine einzelnen Gliedmaßen auf der ganzen Welt suchen und wieder zusammennähen können, sollte er erneut versagen. Die Geduld seines Herrn war schon zu oft auf die Probe gestellt worden und bei seinem nächsten Fehler würde der dünn gespannte Faden endgültig reißen.
Doch wie um alles in der Welt konnte er die Todes Tochter zu seinem Meister schaffen?
Sie besaß magische Kräfte und war ebenfalls eine Meisterin im Schwertkampf. Das hatte man ihm zumindest erzählt. Natürlich war es als Schattendiener keine Besonderheit, die Kunst des Schwertkampfes zu beherrschen, dennoch war sich Enago sicher, dass er einer der Besten war, wenn es darum ging, Körper aufzuschlitzen und Feinden den Kopf abzuschlagen. Jahrelang war er vom Schatten persönlich ausgebildet worden. Er vermochte nun perfekt mit jeglicher Waffe umzugehen und seinen Gegner in Sekundenschnelle zu töten. Jedoch war er sich der Tatsache bewusst, dass er seine Feindin dieses Mal nicht umbringen, sondern lediglich gefangen nehmen sollte. Der Schatten höchstpersönlich würde ihm sein Schwert in den Leib rammen oder ihn enthaupten lassen, wenn er der Todes Tochter die Kehle durchschneiden würde.
Außerdem blieb noch immer der zweite Todesritter, ihr Beschützer. Leise fluchte Enago vor sich hin. Sie waren zu zweit. Er dagegen war alleine. Er, ein völlig verdreckter, vor Furcht schlotternder Niemand, besaß die geradezu törichte Absicht, sich gegen gleich zwei Feinde behaupten zu wollen, die mit ihren magischen Fähigkeiten seine natürlichen Kräfte weit überragen würden. Was hatte ihn nur dazu getrieben, seinem Meister diesen absurden Vorschlag zu unterbreiten?
Unruhig fuhr er sich mit der Hand durch die Haare. Es war Angst gewesen, die ihn getrieben hatte – Todesangst. Langsam schleppte Enago sich aus dem Fluss und brach völlig erschöpft am Ufer zusammen. Das Wasser hatte sich zum Teil rot gefärbt und sein Blut begann langsam mit den Stromschnellen flussabwärts zu fließen. Enago beobachtete, wie sein kostbarer Lebenssaft im klaren Wasser verschwand. Wie konnte es nur so weit kommen? Warum nahm er all diese Strapazen, all diese Schmerzen auf sich, um einer Kreatur aus der Unterwelt zu gefallen? Zorn wallte in Enago auf. Der Schatten hatte ihm versprochen, aus ihm einen wohlhabenden Mann zu machen, sodass er über sein eigenes Reich herrschen würde und ebenso mächtig wäre wie ein König. Dafür hatte er mit seinem Blut geschworen, dass er ihm dienen würde – ein Leben lang. Bis jetzt waren Schmerzen und Kummer der einzige Lohn gewesen, den er jemals erhalten hatte. Dazu kamen Furcht vor dem baldigen Tod und Folter für sein Versagen.
Die Flucht aus der Hölle hatte den Schatten viel Kraft gekostet. Es hatte lange Zeit gebraucht, bis er sich wieder vollständig erholt und zu seiner alten Kraft gelang war. Doch nun war die dunkle Kreatur wieder so mächtig wie zuvor, sie hatte sich erholt und war nun bereit, diese Welt in ihre Gewalt zu bringen. Die Zeit schien reif. Schon seit einigen Jahren verweilte der Schatten in seiner Höhle. Er hatte sich Wissen angehäuft, magisches Wissen, und damit Diener seines Abbildes erschaffen, die Schattendiener.
Auch Enago war ein Schattendiener, doch war er auch ein Mensch. Ein Mensch, der sich dem dunklen Meister aus freien Stücken angeschlossen hatte. Wie er letztlich zu seinem jetzigen Herrn gekommen war, das war bloß noch ein ferner Gedanke. Wenn sich Enago zu erinnern versuchte, was vor seinem Leben als Schattendiener passiert war, tauchten bloß ein paar verschwommene Bilder in seinen Gedanken auf. Auf den meisten von ihnen sah er sich selbst, sich und eine Menge Blut. Der Schatten hatte ihn manipuliert, das war ihm inzwischen klar geworden. Man brauchte keine magischen Fähigkeiten, keine außergewöhnlichen Begabungen, um mit Lug und Trug das Vertrauen leichtgläubiger Menschen zu gewinnen. Es war viel einfacher, dies wusste er jetzt. Und hätte Enago früher geahnt, welches Leid auf ihn zukommen würde, er hätte zweimal überlegt, bevor er aus Gier zu dem wurde, was er heute nun einmal war. Doch es war zu spät. Es gab kein Zurück mehr – nie wieder.
Plötzlich huschte ein schelmisches Grinsen über sein Gesicht, in seinen Augen blitzte ein Schimmer der Hoffnung auf. Er blieb nur kurz, bevor er wieder erlosch, dennoch reichte es dem Schattendiener aus, um ein Stück seines angenagten Selbstvertrauens wiederzuerlangen. Er musste die Todes Tochter nicht bekämpfen. Es war doch so viel einfacher! Hastig rappelte er sich auf und machte sich auf den Weg. Er begab sich auf den Weg, doch wohin er ging, gehen musste, wusste er selbst nicht.
Es war Abend geworden. Die Sonne versteckte sich schon halb hinter den Bergen, als der Schattendiener ein kleines Dorf erreichte. Völlig ausgelaugt, schleppte er sich durch die immer dunkler werdenden Gassen auf der Suche nach einem Wirtshaus oder sonstigen Unterkunft, die ihm für heute Nacht als Schlafstätte dienen konnte. Plötzlich hörte er lautes Gelächter und sah mehrere Lichter aus dem hinteren Teil des Dorfes. Es roch angenehm nach Braten, aber auch der strenge Geruch von Alkohol und Erbrochenem lag in der Luft. Angetrieben durch Hunger, Durst und Müdigkeit, lief er durch die Straßen, begegnete immer wieder ein paar Betrunkenen, die in düsteren Gassen ihren Kater ausschliefen oder sich aus vollem Halse übergaben. Das Licht wurde heller und das Gelächter lauter und schon bald erreichte er ein altes, heruntergekommenes Gebäude. Die Farbe an den Wänden begann langsam abzublättern und Enago sah, dass neben ein paar eingeschlagenen Fenstern auch das scheinbar undichte Dach einen Handwerker nötig hatte. Das Schild, das vor der Tür hing und eine betrunkene Wildsau zeigte, schien nicht sehr einladend. Doch Enago war den halben Tag lang gelaufen und hätte wahrscheinlich auch in einem Fass übernachtet, hätte man es ihm angeboten. Seine Hand hielt kurz inne, bevor sie die Klinge erreichte, er zögerte. Doch die Vorstellung, ein halbwegs gemütliches Strohbett gegen eine kalte Gasse mit betrunkenen Raufbolden einzutauschen, ließ ihn letztlich die schwere Holztür aufstoßen.
Die Inneneinrichtung war lieblos und nicht anders zu erwarten gewesen - alt, heruntergekommen und schlicht eingerichtet. Überall standen kleine, runde Tische, um die winzige Hocker gequetscht worden waren und auf denen mehrere betrunkene Männer mit fetten Bierbäuchen saßen, die ständig in gackerndes Gelächter ausbrachen.
Enago spürte, wie sein Verstand ihm sofort riet zu verschwinden. Mit riesigen, muskelbepackten Männern war nicht zu spaßen, erst recht nicht, wenn sie betrunken waren und er war zu erschöpft, um heute noch gegen einen dieser Trunkenbolde bestehen zu können. Einen kurzen Moment lang kämpfte er mit sich selbst, betrachtete den großen Raum, als sein Blick plötzlich auf die unscheinbare Theke am hinteren Ende des Raumes fiel. Auch hier saßen riesige Kerle mit noch riesigeren Bierkrügen in den Händen und kicherten wie kleine Mädchen. Hinter der Theke stand der Wirt, den das ganze Spektakel nicht zu interessieren schien. Der Wirt schien nicht recht in das ganze Spektakel seines Hauses zu passen, er fiel auf wie ein Tropfen Blut im sonst so makellos weißen Schnee. Anders als seine Gäste war er klein und schmächtig und anstatt eines Grinsens auf den Lippen zierte ihn ein gelangweilter Gesichtsausdruck.
Enago zog es wieder zur Tür hinaus, doch dann siegte die Müdigkeit und er ließ sich an einem der Hocker neben der Theke nieder.
„Was darf’ s sein?“
Die tiefe Stimme des Barkeepers, die so gar nicht zu seinem Aussehen passte und ihn eher lächerlicher als männlicher erscheinen ließ, ließ ihn hochschrecken.
„Wie bitte?“
„Was willst du?“
Die Bohnenstange hauchte ihm seinen miefigen Atem ins Gesicht und einen kurzen Augenblick lang sah sich Enago wieder über den kalten Höhlenboden kriechen. Hastig versuchte er den grausamen Gedanken wieder abzuschütteln.
„Ich möchte bitte ein Wasser“, stotterte er.
Der Wirt sah ihn kurz irritiert an, so als ob er von diesem Getränk noch nie in seinem Leben etwas gehört hätte. Schließlich ging er jedoch zu einem der unzähligen Fässer, die hinter ihm aufgereiht waren und begann eine braune Brühe in ein verdrecktes Glas zu füllen. Enago war sich nicht sicher, ob das, was ihm der Wirt da auf den Tisch knallte, wirklich Wasser war. Aber er war sich sicher, dass es nicht gesund sein konnte.
„Danke.“
Langsam hob er das Glas zum Mund, überlegte es sich schließlich doch anders, als er den toten Körper einer Fliege im Glas schwimmen sah und ließ es wieder auf die Theke sinken. Nur mit Mühe hielt er den Inhalt seines Magens davon ab, zum Vorschein zu treten. Plötzlich fühlte er sich unangenehm beobachtet. Ein kalter Hauch breitete sich in seinem Nacken aus, ließ ihn leicht frösteln.
Enago hatte im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür entwickelt, die Dinge nicht nur mit seinen Augen zu sehen, sondern sich auf alle Instinkte und Gefühle zu verlassen und drehte sich ruckartig um. Hinter ihm stand ein riesiger Mann. In Enagos Kopf erschien sofort das Bild eines gewaltigen Ochsen. Der Vergleich war keineswegs übertrieben. Der Typ war locker zwei Meter groß und besaß das Gesicht eines Stiers. Seine Nase war ziemlich breit und platt. Enago vermutete, dass sein Riechorgan durch eine Schlägerei so zugerichtet worden war. Seine Augen waren im Verhältnis zum Rest seines muskelbepackten Körpers winzig und blickten trotzdem grimmig drein. Sein rechtes Ohr schien unversehrt. Vom linken jedoch fehlte die Hälfte und sein Atem, den er ihm ununterbrochen ins Gesicht hauchte, sprach dafür, dass er heute nicht nur ein Bier zu sich genommen hatte.
„Was für ein Mädchen haben wir denn hier?“ Seine Stimme passte völlig zu seinem Aussehen.
„Entschuldigung, was hast du gesagt?“
Enago erhob sich von seinem Hocker und stellte sich dem Kraftprotz gegenüber. Er fühlte sich dadurch jedoch nicht besser, musste er doch seinen Kopf in den Nacken legen, um ihm überhaupt in die Augen sehen zu können.
„Ich will keinen Ärger“ Enago setze sich wieder.
Der Dicke fing an zu lachen.
„Ich schon!“, entgegnete er. „Und wie ich sehe, haben wir einen Gewinner.“ Er stemmt seine dicken Arme in die Hüften.
„Du Wicht sitzt auf meinem Stuhl!“, schnaubte er.
„Verzeih, das wusste ich nicht“, säuselte der Schattendiener. „Ich habe gar kein Schild gesehen, auf dem ein fetter Ochse abgebildet ist.“
Gleich nachdem die Worte seinen Mund verlassen hatten, biss sich Enago hastig auf die Zunge. Doch es war zu spät. Er hatte den Riesen in aller Öffentlichkeit beleidigt und das würde er sich sicher nicht gefallen lassen. Eine Menge Schaulustiger hatte sich währenddessen um die Theke herum versammelt und gaffte Enago neugierig von allen Seiten her an. Enago sah, wie die Meute aufgeregt zu tuscheln begann und ein paar der Kraftprotze Wetten über den Ausgang des unvermeidbaren Streites abzuschließen begannen. Hastig legte Enago eine Münze auf die Theke und erhob sich erneut. Doch der Kraftprotz, dessen Gesicht ein zorniges Rot angenommen hatte, schob sich vor ihn.
„Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du das, was noch von dir übrig ist, von der Straße kratzen.“
Er hatte sein Gesicht ganz dicht vor Enagos geschoben und seine kleinen Augen funkelten ihn bedrohlich an. Der Schattendiener unternahm einen weiteren kläglichen Versuch, sich an dem Riesen vorbeizudrücken, doch dieser packte ihn an der Schulter und drückte ihn zurück auf den Hocker. Enago sah sich verzweifelt nach dem Wirt um, doch der starrte wie gebannt auf einen Fleck auf der Theke und bearbeitete ihn unentwegt mit einem braunen Putzlappen.
„Wo willst du denn hin? Hat das kleine Mädchen die Hosen voll?“
Der Dicke und seine Kumpels, die sich mittlerweile hinter ihm aufgebaut hatten, grölten vor Lachen. Für einen kurzen Moment achtete der Riese nicht mehr auf Enago, sondern amüsierte sich über seinen eigenen Witz. Enago jedoch reichte dieser kurze Augenblick aus, um sich aus dem Staub zu machen. Blitzschnell huschte er zwischen den Beinen seines Gegenübers hindurch zur Tür, riss sie auf und rannte auf die Straße hinaus. Er blieb kurz stehen, um sich zu orientieren, doch das stellte sich als Fehler heraus.
Der Riese schien körperlich zu schwerfällig und zu besoffen, um ihm schnell folgen zu können, doch trotz der erheblichen Menge an Alkohol hatte er schnell begriffen, dass sein Opfer die Flucht ergriffen hatte. Plötzlich wurde er an der Schulter herumgezogen. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte unsanft auf das harte Pflaster. Enago wollte sich aufrichten, um zum Angriff überzugehen, doch da folgte der nächste Schlag mitten ins Gesicht. Er spürte, wie sein Nasenbein brach. Keuchend warf er sich auf den Bauch und entging damit nur knapp einem weiteren Fausthieb. Panisch versuchte er den Griff seines Schwertes, das er unter seinem Umhang verborgen hatte, zu erreichen, doch da spürte er, wie ein paar mächtige Hände ihn packten und erneut zu Boden schleuderten. Enago wurde die Luft aus den Lungen gepresst. Hustend und Blut spuckend, wand er sich am Boden und rang verzweifelt nach Atem. Doch selbst eine kurze Pause schien ihm nicht gegönnt. Es folgte der nächste Schlag. Er spürte, wie die Faust des Ochsen ihn zum Röcheln brachte und sein Fuß hart gegen seinen Kopf und sein Schienenbein trat. Enago versuchte aufzustehen, wollte sich verteidigen, doch da packte ihn die kalte Hand des Todes. Verzweifelt versuchte er sie abzuschütteln und nicht in ewiger Finsternis zu versinken. Im letzten Augenblick, kurz bevor der Fuß des Raufboldes seinen Kopf ein zweites Mal erreichte, hörte er die Stimme eines weiteren Mannes.
„Hey Ron, das reicht jetzt langsam. Er hat seine Lektion gelernt!“
Es bestand kein Zweifel darin, dass der schmächtige Wirt ihm gerade das Leben gerettet hatte, seine tiefe Stimme war schon nach kurzer Zeit unverkennbar. Ron brummte etwas Unverständliches, ließ dann jedoch von Enago ab und zog sich zurück in das Wirtshaus. Enago wurde blutend auf der Straße zurückgelassen. Alles drehte sich um ihn herum. Ihm war schlecht. Das heiße Blut aus seiner Nase floss ihm direkt in den Mund. Er musste schlucken, doch das Blut hinderte ihn daran. Ihm wurde übel und er übergab sich auf die Straße. Er fror. Es war mittlerweile stockdunkel geworden und nur das leichte Licht des Mondes erhellte die Straßen.
Der Schattendiener spuckte Blut, versuchte krampfhaft aufzustehen oder die Augen zu öffnen, doch beides gab er nach ein paar kläglichen Versuchen auf. Fast wünschte er sich, der Riese hätte ihn mit dem letzten Schlag ins Jenseits befördert, da er so kläglich erfrieren würde.
Plötzlich hörte er Hufgetrappel. Es waren die Schritte von ein oder zwei großen Pferden. Er spürte, wie der Boden leicht vibrierte, als ein Reiter auf den Boden sprang.
„Komm steh auf.“
Die helle Stimme, die zu ihm sprach, gab ihm neue Kraft und half ihm dabei, langsam aufzustehen. Die Welt drehte sich weiter und er drohte wieder zu fallen. Doch die Gestalt packte und hielt ihn fest.
„Wir sind gleich da, halt durch.“
Enago wurde auf ein Pferd gehoben und mit einem Seil am Sattel festgebunden, damit er nicht herunterfallen konnte. Langsam setzte sich das Tier nun in Bewegung. Mit wem Enago mitging und wohin, das war ihm nicht bewusst. Es war ihm auch egal. Nur diese Übelkeit sollte aufhören.
Eine tödliche Begegnung
„Du nimmst das schwarze Pferd.“
Als Ragon auf das rechte Tier zeigte, nickte Lia bloß. Sie war noch immer geschwächt. Das Gift hatte seine Spuren hinterlassen. Lia hätte es bevorzugt, sich noch eine Weile zu erholen und erst in ein paar Tagen zu ihrer Ausbildung aufzubrechen, doch Ragon hatte darauf bestanden, sofort loszureiten. Nicht gerade elegant schwang sie sich auf ihr Pferd. Sie war schon ein paar Mal geritten, doch so recht hatte sie sich nie mit den großen Tieren anfreunden können. Auf ihrem Rücken schwankte es zu sehr und das Mädchen befürchtete, den harten Boden schneller kennenzulernen als ihr lieb war.
Ragon tat es ihr gleich, nur wesentlich geschickter schwang er sich in den Sattel. Die Pferde schlugen einen ruhigen Gang ein und schon nach einer Weile waren sie in den dichten Wäldern verschwunden.
„Wo reiten wir eigentlich hin?“, wollte Lia wissen.
„Zum Lunus Berg.“