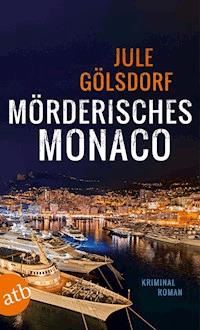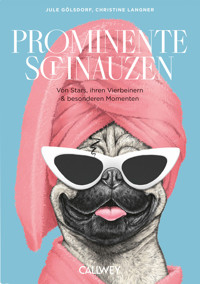8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Henry Valeri & Coco Dupont
- Sprache: Deutsch
Ein Serienmörder in Monaco?
Im Hafen von Monaco wird eine weibliche Leiche angespült. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, doch keine vierundzwanzig Stunden später gibt es die nächste Tote: Beim berühmten Zirkusfestival von Monte Carlo wird eine Artistin von einem Tiger angegriffen und getötet. Ein tragisches Unglück oder doch ein Mord? Und was haben die Tierschützer damit zu tun, die rund um das Festival demonstrieren? Kommissarin Coco Dupont ermittelt mit ihrem wortkargen Kollegen Henri Valeri, der mitten in einer Ehekrise steckt. Doch für die Lösung privater Probleme bleibt keine Zeit, denn es gibt weitere Todesfälle ...
„Eine neue, frische Stimme, und sie kann erzählen!“ Klaus Peter Wolf.
„Jule Gölsdorf erzählt mehr als nur eine Krimigeschichte, sie erzählt etwas über das Funktionieren dieses kleinen Piratenstaates.“ Dieter Wedel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Ein Serienmörder in Monaco?
Im Hafen von Monaco wird eine weibliche Leiche angespült. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, doch keine vierundzwanzig Stunden später gibt es die nächste Tote: Beim berühmten Zirkusfestival von Monte Carlo wird eine Artistin von einem Tiger angegriffen und getötet. Ein tragisches Unglück oder doch ein Mord? Und was haben die Tierschützer damit zu tun, die rund um das Festival demonstrieren? Kommissarin Coco Dupont ermittelt mit ihrem wortkargen Kollegen Henri Valeri, der mitten in einer Ehekrise steckt. Doch für die Lösung privater Probleme bleibt keine Zeit, denn es gibt weitere Todesfälle …
»Eine neue, frische Stimme, und sie kann erzählen!« Klaus Peter Wolf
»Jule Gölsdorf erzählt mehr als nur eine Krimigeschichte, sie erzählt etwas über das Funktionieren dieses kleinen Piratenstaates.« Dieter Wedel.
Jule Gölsdorf
Tödliche Vorstellung
Ein Monaco-Krimi
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Vorspann
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Danksagung
Über Jule Gölsdorf
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Für meinen Vater,
der mich immer inspiriert.
Der Blick in die Tiefe löste eine diffuse Todessehnsucht in ihr aus. Das knallblaue Wasser des Mittelmeers lag still und friedlich, fast unbeweglich unter ihr, nur ein paar kleine, harmlose Wellen formierten sich kurz vor dem Ufer und liefen leise an der felsigen Küste auf. Die Wasseroberfläche war von hier oben, diesem geschichtsträchtigen Ort, von dem aus sie hinabsah, rund achtzig Meter entfernt. Ein tiefer Sturz. Wie lange würde sie wohl fallen?
Wie oft schon hatte sie in letzter Zeit auf Brücken oder Balkonen gestanden und sich gefragt, wie es sich anfühlen würde, wenn sie hinabstürzen und weit unten auf dem Erdboden oder der Wasseroberfläche aufschlagen würde. Hätte sie starke Schmerzen oder würde der Rausch der Geschwindigkeit, der Schock des tiefen Falls ihre Sinne trüben?
Ein starker Wind zerrte an ihren langen roten Haaren. Jeder Versuch, sich die Strähnen aus dem Gesicht zu streichen, scheiterte, legten sich die Haare doch immer wieder durch den Wind, der ein Gefühl von Freiheit und den Geschmack des Meeres hoch auf den berühmten Felsen des Fürstentums von Monaco trug, erneut widerspenstig vor ihre Augen. Trotzdem versuchte sie es erneut, spürte gleichzeitig ein schmerzhaftes Gefühl von Sehnsucht, einer Sehnsucht, die von nichts und niemandem erfüllt werden konnte: den verzweifelten Wunsch nach einer Erlösung in der Unendlichkeit. Wenn sie dort unten sterben würde, in den unergründlichen Tiefen des blau-grünen Wassers der Côte d’Azur, im Reich des Poseidon und seiner Gefährten, hätte das nicht sogar eine gewisse Form der Schönheit, des Glanzes, etwas Dramatisch-Romantisches? Sie verlor sich in diesen schwermütigen und von kitschigen Bildern überlagerten Gedanken und blickte ins Leere.
War es die Sehnsucht nach dem Tod oder ihr Schicksal, das sie in diesem kurzen Moment zu erahnen wähnte? Sie dachte an den Ehemann, den sie nie kennenlernen würde, an die Kinder, die sie nie bekommen würde, an eine glückliche Zukunft, die sie nie haben würde. Eine tiefe Melancholie erfasste sie und das Gefühl trauriger Gewissheit, dass ihr Leben früh zu Ende gehen würde. Zu früh.
1
Kommissar Valeri dachte über das Böse nach. Was war das eigentlich genau? War das Böse einfach die Quelle allen Übels? Ließ es sich kausal erklären und genau definieren? Als das Gegenteil des Guten? Oder trug jedes Individuum einen gewissen Anteil des moralisch Falschen in sich? Die Gedanken über die menschlichen Abgründe machten sich in Valeris Kopf breit, während er mit seinem Kumpel Stéphane durch die Berge der Côte d’Azur wanderte. Neben den Gedanken über Licht und Schatten, die Sollbruchstellen der Seele und den Hang zu einer dunklen Seite fesselte ihn immer noch der weite Blick über die Küste, auch wenn er bestimmt schon an die hundert Mal hier gewesen war und hinabgeschaut hatte. Er sah die riesigen Felsen, die gewaltig vom Festland aus ins Mittelmeer hineinragten, das knallblaue Wasser, das so glasklar unter ihm lag, dass er den Meeresboden von hier oben aus erkennen konnte, die vielen Schattierungen von Blautönen, die sich durch die unterschiedlichen Wassertiefen wie eine gemalte Landkarte vor ihm abzeichneten, Palmen, die aus einem Wald von Nadelbäumen stolz herausragten und deren Wedel sich zart und elegant im Wind hin und her bewegten, in der Ferne ein einsames Schiff, das vor Anker lag. Es war ein strahlender, mediterraner Wintertag wie aus dem Bilderbuch: Die Januarsonne war hell genug, um die Küste in ein atmosphärisches Licht zu tauchen, aber nicht so stark, dass sie wärmte. Es war ruhig, nur das leise Plätschern eines Gebirgsbaches und das Knirschen der kleinen Schottersteine, die unter ihren Fußsohlen wegrutschten, unterbrachen die Stille.
Henri Valeri und sein Freund Stéphane Roux, der monegassische Tierarzt, den er schon seit Ewigkeiten kannte, waren ganz alleine unterwegs in den Bergen der Seealpen. Es gab keine lästigen Touristen wie in der Hauptsaison, die ihnen mit ihrem aufgeregten Geschnatter die Laune verdarben. Sie hatten sich für einen leichten Wanderweg entschieden, den Sentier Friedrich Nietzsche, der vom berühmten Hotel Château de la Chèvre d’Or, hoch oben in dem winzigen Örtchen Èze Village, hinab in den Küstenort Èze-Bord de Mer führte. Angeblich war Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph, dem der Wanderweg seinen Namen verdankte, die Strecke in den Jahren 1883/84, als er hier Teile seines Werkes Also sprach Zarathustra schrieb, regelmäßig entlanggelaufen. Der etwa halbstündige Spazierweg war nicht besonders anspruchsvoll, aber genau das Richtige für ein wenig Bewegung an einem solchen Wintertag. Valeri liebte das Bergdörfchen Èze Village mit all seinen mittelalterlichen Gässchen, den steinernen Torbögen, der historischen Kirche und dem Kakteengarten, von dem aus man mindestens bis zum Cap Ferrat, an einem klaren Wintertag wie diesem sogar bis nach Korsika hinüberblicken konnte. Es war ein friedlicher Ort, still, weise, erhaben, zumindest in den Monaten außerhalb der Sommersaison. Er war oft mit Inés, seiner Ehefrau, hierhergekommen: Gemeinsam hatten sie am frühen Abend oder am Wochenende bei einem Glas Wein im Schatten auf einer der kleinen Terrassen gesessen. Inés, mittlerweile eine erfolgreiche Schriftstellerin, die an ihrem neuen Roman schrieb, und er, seit Ewigkeiten Hauptkommissar bei der Sûreté publique, der monegassischen Polizei, vertieft in eine seiner geliebten Tageszeitungen, den Monaco-Matin oder Nice-Matin, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch an diesem Morgen hatte er die Zeitung studiert, aber da sein Freund Stéphane ihn nicht lange hatte warten lassen, nur die Kurzmeldungen überflogen: Touristen mussten in Nizza zukünftig in vielen Museen wieder Eintritt bezahlen, in den Seealpen war ein 47-jähriger Mann bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen, im Fürstentum gab es anlässlich des berühmten Zirkusfestivals von Monte Carlo Proteste von Tierschützern gegen die Haltung und Dressur von Wildtieren. Außerdem war in Nizza eine Frau vor den Augen ihrer Kinder mitten auf der Straße erschossen worden, der mutmaßliche Täter war flüchtig – Motiv unklar.
Da war sie wieder: die Existenz des Bösen. Valeri war froh, dass er von ähnlichen Ereignissen, die sich am Abend häufig in den Boulevardnachrichten wiederfanden, im Fürstentum in der Regel verschont blieb. Unmöglich, in Monaco auf offener Straße jemanden zu erschießen angesichts der elektronischen Augen von über sechshundert installierten Überwachungskameras. Der Täter würde innerhalb von Minuten gefasst werden und im Knast landen. Aber würde das etwas ändern? War der Drang zum Lügen, Betrügen oder gar Töten nicht so fest eingebrannt in manche menschliche Seele, dass sich selbst hinter den dicken Mauern eines Gefängnisses keine Reue zeigen und die Täter zwangsläufig rückfällig werden würden? Immer und immer wieder?
Valeri strich sich mit der Hand über seinen mittlerweile etwas zu lang gewordenen, graumelierten Bart und blickte in die Ferne. Stéphane war ebenfalls stehengeblieben, schob mit der für ihn so typischen Bewegung seine Brille mit dem rechten Zeigefinger ein Stück auf der Nase nach oben und warf einen Blick auf das Schild, das hier am Wegesrand aufgestellt war, um Besuchern den Zusammenhang zwischen Wanderweg und Dichter zu erklären.
»Angeblich ist Nietzsche den Weg im Sommer täglich rauf und runter gegangen. Ihm soll die Mittagshitze so zu Kopf gestiegen sein, dass er halluziniert hat und dadurch zu seinen berühmtesten Werken inspiriert wurde. Wusstest du das?«, fragte er schmunzelnd.
»Nein. An seiner Stelle hätte ich mich lieber von ein paar Flaschen Rosé inspirieren lassen«, entgegnete Valeri trocken. »In der prallen Sommersonne wandern, das kann auch nur so einem völlig vergeistigten Dichter einfallen!«
»Ein bisschen verschwurbelt sind seine Thesen in der Tat. Wobei … Apropos: Hast du was von Inés gehört?«
»Wieso apropos? Wie kommst du denn jetzt von Nietzsche auf Inés?«, antwortete Valeri mit einer Gegenfrage und setzte sich wieder in Bewegung. Er hatte wenig Lust, sich über seine von ihm getrennt lebende Ehefrau zu unterhalten. Und im Grunde wollte er auch gar nicht wissen, wie es ihr ging. Zumindest dann nicht, wenn es ihr ohne ihn besser ging als zuvor mit ihm. Wenn er nur an sie dachte, stieg wieder eine Wut in ihm auf, die er zuvor so noch nicht gekannt hatte. Gleichzeitig vermisste er sie, ihre offene und positive Art, die lautstarken, aber inspirierenden Diskussionen mit ihr, den eigensinnigen, aufregenden Blick ihrer katzengrünen Augen, das Streichen durch ihre rotbraunen Locken, die ihr wild und ungebändigt in alle Richtungen vom Kopf abstanden. Aber das würde er hier und heute niemals zugeben. Ärgerlich strebte er vorwärts und geriet ins Stolpern, in diesem einen Moment der Unaufmerksamkeit, in dem er nicht auf die Unebenheiten des Wanderweges geachtet, sondern seinen düsteren Gedanken freien Lauf gelassen hatte.
»Jetzt warte doch mal!«, rief ihm Stéphane hinterher, der ihn schnellen Schrittes eingeholt hatte.
»Ist das der Grund, warum du plötzlich diese Leidenschaft fürs Wandern entdeckt hast? Weil du wusstest, dass ich deiner Fragerei hier oben nicht entgehen kann?«, schnaufte Valeri unwirsch.
»Ach was! Und jetzt sei nicht so empfindlich! Nietzsches Thesen aus Zarathustra haben mich nur gerade an dich erinnert: Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes …«, zitierte Stéphane grinsend. »Wie der Geist zum Kameele wird, und zum Löwen das Kameel, und zum Kinde zuletzt der Löwe. Und weißt du, wofür das Kamel steht? Für Leidensfähigkeit. Der Löwe für die Macht des Stärkeren. Allerdings agiert der Löwe nicht besonders konstruktiv, im Gegenteil, er ist destruktiv, deshalb braucht es eine dritte Verwandlung, die Neuerschaffung einer moralischen Wertewelt in Gestalt des Kindes. Du befindest dich leider noch auf der Ebene des Löwen!«
»Also, ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll: dass du Nietzsche zitieren kannst oder dass du mich in diesem Unsinn wiederfindest.« Valeri schüttelte den Kopf und stapfte weiter.
»Ist doch logisch: Erst hast du wegen Inés’ Fehltritt gelitten, dann hast du deinem Kontrahenten gezeigt, wer, zumindest dem Anschein nach, der Stärkere ist, und jetzt musst du ihr nur noch verzeihen und …«
»Pah!«, unterbrach Valeri seinen Freund. Er musste dringend das Thema wechseln. Er tat sich immer noch mehr als schwer damit, dass Inés und er eines der Ehepaare sein sollten, die es wie im allerschlechtesten Hollywoodstreifen nicht geschafft hatten, zusammenzubleiben. Dass er, Henri Valeri, ein gehörnter Ehemann sein sollte, der von seiner Frau mit einem Jüngeren betrogen worden war. Und doch hatte es sich genauso abgespielt: Als er mit seinem letzten Fall beschäftigt war, dem gewaltsamen Tod der Ehefrau und des Sohnes eines berühmten Formel-1-Fahrers, hatte er seiner Frau an diesem so schicksalhaften Abend hinterherspionieren müssen, weil sie als Zeugin in diesem Mordfall gebraucht wurde. Es war um Leben oder Tod seiner neuen Kollegin Coco Dupont gegangen, so dass er damals, nachdem er Inés nicht hatte erreichen können, ihr Mobiltelefon geortet und sie in einem Restaurant im nahegelegenen Roquebrune-Cap-Martin gefunden und gleichzeitig erwischt hatte: bei einem Tête-à-Tête mit ihrem jungen Lover! Es hatte sich zwar, so versicherte ihm seine Frau mehrfach, nur um eine kurze Romanze gehandelt, nichts Ernstes, doch für Valeri war eine Welt zusammengebrochen. Sicher, er wusste, nach einer so langen Zeit konnte es in der besten Ehe Probleme geben, und er hatte sicher auch seinen Teil dazu beigetragen, Inés zu wenig unterstützt, als sie es nach jahrelanger mühevoller Arbeit als Schriftstellerin endlich geschafft hatte, einen Bestseller zu landen. Doch war das Grund genug, gleich ihre langjährige Ehe aufs Spiel zu setzen? Davonzulaufen? Und dann auch noch mit diesem jungen, angestrengt dynamischen und übereifrigen Lektor aus Paris? Genaugenommen war sie gar nicht mit ihm durchgebrannt, hatte sogar versucht, um ihre Ehe und um ihn zu kämpfen, doch seine Gefühle waren zu sehr verletzt worden, er war zu schwer in seinem Stolz gekränkt. So war Inés, nachdem er – entgegen seinem sonst eher friedfertigen Naturell – diesem jungen Schnösel in aller Öffentlichkeit einen kräftigen Kinnhaken verpasst hatte, zumindest übergangsweise zu einer Freundin in Monaco gezogen. Das war nun mittlerweile gut sechs Monate her, doch ihm war, als wäre es gestern gewesen: Da stand dieser elende Wicht in Valeris Lieblingslokal, im Les Perles de Monte Carlo im beschaulichen Hafen des neueren monegassischen Viertels Fontvieille. Das Les Perles war ein kleines, auf den ersten Blick unscheinbares Restaurant ganz am Ende des schmalen Hafenstegs, wo man an einfachen Stehtischen, mit Blick auf das Wasser, meeresfrische Austern zu einem anständigen Preis bekommen konnte, die, da war Valeri sich sicher, dieser Idiot bestimmt nicht geordert hatte, weil er deren Geschmack und besondere Qualität zu schätzen wusste, sondern weil er es wohl schick fand, sich bei einem Glas Champagner in Monaco zu zeigen und seine wichtigtuerischen Plattitüden unter die Leute zu bringen. Valeri war von einer Sekunde zur anderen die Wut zu Kopf gestiegen, und er hatte seinen Kontrahenten niedergestreckt, mit einem einzigen Schlag. Stéphane, der mit ihm unterwegs gewesen war, hatte ihn mit einem beherzten Griff und einem knappen »Zeit zu gehen, mein Freund!« zur Seite gezogen und ihn aus der Schusslinie befördert. Inés hatte wenig später ihre Sachen gepackt, Valeri selbst war in ihrem gemeinsamen Zuhause, einem kleinen Haus in dem an Monaco angrenzenden französischen Örtchen Cap-d’Ail, zurückgeblieben und wurde nun jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass Inés nicht mehr Teil seines Lebens war. Aber das war nicht seine Schuld. Und er wollte nicht darüber diskutieren.
»Ein Kamel war ich mit Sicherheit«, brummte er. »Weil ich nicht gemerkt habe, dass meine Frau mir Hörner aufsetzt.«
»Ach, nun hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Solche Geschichten passieren. Meine Güte, Henri, ihr kennt euch seit der Studienzeit! Über die Jahre hat sich Inés ein bisschen vernachlässigt gefühlt, wollte mehr Aufmerksamkeit, und als du sie ihr nicht gegeben hast, da hat sie halt …«
»Ach, jetzt bin ich auch noch schuld!?«, unterbrach Valeri Stéphane ärgerlich.
»So habe ich das doch gar nicht gemeint! Aber wenn du nicht so stur wärst … Du solltest wirklich mal mit ihr reden.« Stéphane hielt inne und biss sich auf die Lippe.
»Wieso? Was meinst du?«
»Ich hab versprochen, nichts zu sagen, aber ich weiß mir oder besser ihr doch auch nicht mehr zu helfen.« Valeri sah seinen Freund fragend an. Der schob erneut die Nickelbrille hoch und blickte ihn ernst an. »Ach, Henri. Sie war so oft bei uns oben in Èze, verzweifelt, wollte reden. Aber so langsam habe ich das Gefühl, sie findet sich mit eurer Trennung ab.«
»Hat sie etwa einen Neuen?«, brach es aus Valeri heraus.
»Nein! Um Gottes willen, nein! Jedenfalls weiß ich nichts davon. Aber Henri! Du liebst sie doch! Wirf doch nicht alles hin, nur weil du gekränkt bist! Du musst dein Ego überwinden! Sonst ist sie weg!«
»Ego? Schluss jetzt damit!« Valeri hatte sich wieder in Bewegung gesetzt und folgte dem Weg, der sich in unregelmäßigen Windungen, hier und da von ein paar Treppenstufen unterbrochen, bergab schlängelte. Stéphane marschierte schweigend hinterher. Als er Valeri eingeholt hatte, legte er ihm kurz eine Hand auf die Schulter. Er kannte seinen Freund, wusste, wann es besser war, eine Diskussion zu beenden.
»Ich musste gestern einen bekifften Hund behandeln«, sagte er, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Stell dir das vor! Ein Hund im Cannabis-Rausch!« Valeri schüttelte den Kopf und schmunzelte. Er wusste es zu schätzen, dass sein Freund sofort erkannte, wann es Zeit für einen Themenwechsel war.
»Wie konnte das denn passieren?« Valeri war immer wieder überrascht von den verrückten Geschichten aus dem Alltag eines Tierarztes. Es war nicht nur der Hund des verstorbenen Fürsten Rainier, den Stéphane behandelt und der ihn über die Grenzen des Fürstentums hinaus bekannt gemacht hatte. Mittlerweile war sein Freund sogar regelmäßig in einer Radioshow zu Gast, in der er Haustierbesitzern Ratschläge gab und ihnen Hilfestellung bei der Erziehung ihrer Lieblinge leistete.
»Das Übliche halt. Die jungen Leute haben sich zugedröhnt, die Reste vom Dope auf dem Couchtisch liegen lassen, und der Hund muss es gefressen haben.«
»Und wie verhält sich ein Hund auf Droge?«, fragte Valeri interessiert.
»Ist unterschiedlich, je nach Menge. Manche sind überaktiv, andere produzieren übermäßig viel Speichel, es gibt aber auch Fälle, in denen die Tiere erbrechen oder Kreislaufprobleme bekommen.«
»Klingt so, als käme das öfter vor.«
»Na ja, seit in den USA Cannabis-Cookies für Hunde auf den Markt gekommen sind, die bei älteren Tieren schmerzlindernd wirken sollen, spielen sich die Leute als Hobby-Tierärzte auf und verabreichen ihren Hausgenossen gerne mal hier und da so ein Hunde-Leckerli. Sozusagen als Dessert, so wie sich manch Zweibeiner einen Joint nach dem Dinner gönnt.«
Valeri konnte es nicht fassen. »Das ist nicht dein Ernst!« »Doch. Ich hatte neulich einen …« Ehe Stéphane seine Geschichte weitererzählen konnte, griff Valeri in seine Hosentasche, in der sein Mobiltelefon vibrierte. Es war seine Kollegin Coco Dupont, wie er überrascht feststellte. Um diese Uhrzeit und dann auch noch am Wochenende? Das war kein gutes Zeichen. Er machte eine entschuldigende Geste in Stéphanes Richtung und nahm den Anruf an.
»Coco? Das ist jetzt wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Ich hätte mein Telefon längst ausgeschaltet, aber diese Geschichte mit dem bekifften Hund …«, setzte er an, dann unterbrach er sich. »Vergessen Sie’s!«
»Haben Sie jetzt einen Hund?«, fragte Coco verwirrt. Das passte so gar nicht zu ihrem Kollegen. »Und wieso bekifft? Haben Sie denn …?«
»Mais non! Natürlich nicht! Was kann ich für Sie tun? Ich bin beim Wandern und daher beschäftigt.«
»Tut mir leid. Aber ich glaube, das sollten Sie wissen: Im Hafen schwimmt eine Leiche. Weiblich. Und ich denke nicht, dass es sich um einen Unfall handelt.«
»Sacre bleu!«, entfuhr es Valeri. »Port Hercule? Vielleicht ist da jemand im Vollrausch von einer der Yachten gefallen und ertrunken?« Der Port Hercule war der zentral gelegene Hafen von Monaco, der Ort, an dem die Yachten der Reichen und der Schönen anlegten und von dem aus die Skipper und ihre Damen zu Fuß zum Shoppen oder Dinieren gehen konnten. Direkt im Business-Viertel La Condamine gelegen, bot der Hafen Platz für bis zu siebenhundert Boote. Da konnte schon mal jemand über Bord gehen, wenn er zu viel Champagner intus hatte.
»Nein«, entgegnete Coco. »Im Hafen von Fontvieille. Und es sieht so aus, als wäre die Leiche angeschwemmt worden. Möglicherweise ist die Frau schon länger tot.«
»Ich bin auf dem Weg.« Hektisch beendete Valeri das Gespräch. »Stéphane, es tut mir leid, wir haben eine Tote im Hafen. Wir müssen zurück.«
2
Die frühmorgendliche Sonne tauchte den kleinen Hafen von Fontvieille, dem jüngsten Stadtbezirk des Fürstentums von Monaco, in ein glitzerndes Licht. Es war still, noch waren nur wenige Menschen unterwegs. Das kleine Austernrestaurant Les Perles de Monte Carlo war noch geschlossen, so dass lediglich das leise Plätschern des Wassers zu hören war, das in leichten Wellen auf den steinigen Strand vor dem Bistro auflief. Das Wasser schimmerte glasklar, das helle Sonnenlicht spiegelte sich auf der Oberfläche. Ein idyllischer Anblick, auf groteske Weise gestört durch die Leiche einer Frau, die am Rande des Hafenbeckens im Wasser trieb.
Nikolai Schweizer ging unruhig den Steg vor seiner kleinen Yacht auf und ab und wartete darauf, dass endlich die Polizei anrücken und ihn aus der Verantwortung entlassen würde. Der Steg, an dem sein Boot festgemacht hatte, war zu Fuß nicht zu erreichen. Er lag direkt gegenüber dem Hauptanleger des kleinen Hafens, vielleicht zweihundert Meter entfernt, so dass die Bootseigner entweder mit dem eigenen Tender hinüberfahren oder den Shuttle-Service des Hafens nutzen mussten, um zu ihren Yachten zu gelangen. Nikolai hatte auf seinem Boot übernachtet und war frühmorgens um kurz vor halb acht eben mal schnell mit seinem Tender auf die andere Seite hinübergefahren, um in einer kleinen Konditorei ein paar noch lauwarme Croissants, zwei Becher frisch gepressten Orangensaft und Kaffee zu holen.
Warum er die Tote auf der Hinfahrt nicht gesehen hatte, war ihm schleierhaft. Vermutlich lag es an seiner Müdigkeit nach einer langen Nacht, und er wünschte sich, der Anblick der Leiche wäre ihm auch auf der Rückfahrt zu seiner Yacht erspart geblieben. Doch als er langsam auf den Anleger zugesteuert war, hatte er aus den Augenwinkeln heraus etwas im Wasser gesehen, das dort nicht hingehörte. Er hatte den Motor gedrosselt und für einen Moment mit zusammengekniffenen Augen hinübergestarrt. War das tatsächlich ein Mensch, der dort im Wasser trieb? Er hatte gerufen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht jemand einen Scherz mit ihm erlauben wollte, doch es kam keine Antwort. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch hatte Nikolai den Tender gewendet und war langsam auf die im Wasser dümpelnde Gestalt zugefahren. Je näher er kam, desto klarer war ihm geworden, dass er tatsächlich einen Menschen vor sich hatte, und aller Wahrscheinlichkeit nach war dieser Mensch tot. Soweit er es erkennen konnte, handelte es sich um eine Frau. Sie trieb mit dem Gesicht nach unten im Meer, und der Stoff ihres langen, grün-goldenen Abendkleides wogte sanft in den Wellen hin und her. Fast wie in Zeitlupe schwebte das zarte Gewebe auf dem Wasser, die nackten Arme der Frau schaukelten langsam auf und ab, und das durch das Wasser gebrochene Sonnenlicht zauberte ein wildes Schattenmuster auf die blasse Haut ihres Rückens, ein Funkeln, das Nikolai sofort in seinen Bann gezogen hatte. Durch den leichten Wellengang wirkte es so, als würde die Tote einem anderen, geheimnisvollen Wesen in der Tiefe des Meeres zuwinken. Ihr langes rotes Haar hatte sich wie ein Fächer um ihren Kopf ausgebreitet. Sie sah aus wie eine Nixe, eine Meerjungfrau, verstörend schön.
Nikolai hatte noch niemals einen toten Menschen aus der Nähe gesehen, und es graute ihm davor, die Frau anzufassen, doch falls es noch einen letzten Funken Hoffnung auf Rettung gab, blieb ihm keine andere Wahl. Er fröstelte, zögerte einen Moment, dann griff er vorsichtig nach der linken Hand der Frau. Sie war eiskalt und erstaunlich schwer. Wie erwartet fühlte er keinen Pulsschlag, nicht ein winziges Anzeichen dafür, dass hier ein Herz noch Blut durch einen lebendigen Körper pumpte. Schnell ließ er den Arm wieder ins Wasser gleiten. Um ganz sicher zu sein, dass die Frau tatsächlich tot war, entschied er, auch noch einen Blick in ihr Gesicht zu werfen. Es kostete ihn die größte Überwindung, ihren Kopf an den Haaren nach oben zu ziehen, aber er wusste sich einfach nicht anders zu helfen und blickte der Frau nun ins Gesicht: Ihre Augen waren weit geöffnet und starrten blicklos ins Leere. Schnell ließ er den Kopf los, dessen Anblick er nun nicht mehr ertragen konnte. Innerhalb von wenigen Sekunden überkam ihn eine heftige Übelkeit, und er erbrach sich ins Hafenbecken. Diese Frau war mit Sicherheit tot.
Auch jetzt, eine Viertelstunde später, kehrte die Übelkeit sofort zurück, wenn er an diese stumpfen, toten Augen dachte. Er sah hinüber zu der Stelle, an der die Tote noch immer im Wasser trieb. Was für ein Albtraum! Als er Geräusche aus dem Inneren seines Bootes vernahm, wandte er den Blick ab und sah zur Yacht hinauf. Das Mädchen vom vergangenen Abend, eine dralle Blondine aus Amsterdam, war offenbar aufgewacht und trat, nur mit einem Handtuch bekleidet, an Deck. Es war ein Fehler gewesen, sie auf dem Boot übernachten zu lassen, dachte er genervt und wollte nur eines: sie so schnell wie möglich wieder loswerden. Seine morgendliche Euphorie, die dazu geführt hatte, sie mit einem Frühstück überraschen zu wollen, war verflogen. Es hatte ihn sowieso gewundert, dass er am Abend zuvor das Bedürfnis gehabt hatte, neben ihr einzuschlafen. In den meisten Fällen suchte er sofort nach dem Sex das Weite. Seit der Scheidung von seiner Frau, einer amerikanischen Country-Sängerin, die ihn schon nach kurzer Zeit betrogen und ihn mit ihrer gemeinsamen Tochter alleingelassen hatte, war der Wunsch nach Verbindlichkeit, nach einer Beziehung von Bedeutung, endgültig verflogen. Hier und da ein kleines Abenteuer, ein wenig Ablenkung, Spaß für eine Nacht, das reichte ihm. Doch nun musste er sich mit der Frau vom Abend zuvor beschäftigen, mit ihr und mit der Toten im Wasser, ob er wollte oder nicht.
»Guten Morgen!«, rief die Blonde ihm munter zu und fasste ihre langen Haare mit einem Gummiband zusammen. »Kommst du wieder ins Bett? Es ist doch noch so früh!«
»Nein, danke! Mein Bedarf an Frauen ist für heute gedeckt!« Etwas irritiert kam die Blonde barfuß über die Gangway zu ihm hinab auf den Steg und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Langsam strich sie ihm über die Brust, dann wanderte ihre Hand etwas tiefer. Nikolai wich zurück und schnauzte:
»Lass das! Da drüben schwimmt eine Leiche!«
3
Als Kommissar Henri Valeri den Hafen von Fontvieille erreichte, herrschte dort schon reges Treiben. Die Wasserwacht war angerückt, und der Wagen eines Rettungsdienstes stand mit rotierendem Blaulicht am Ende des Stegs, zwei Polizeiwagen daneben, ein Hubschrauber schwebte in der Luft. Zwei Beamte standen vor dem Hauptanleger bis zum Bauch im Wasser. Vor ihnen dümpelte ein kleines Boot, von dem aus ein weiterer Beamter offensichtlich versuchte, die angeschwemmte Leiche in Richtung des Stegs und zu seinen Kollegen zu schieben, um so eine Bergung zu ermöglichen. Auf der schräg gegenüberliegenden Seite, einem schmaleren Steg, an dem ein paar kleinere Yachten lagen, konnte Valeri zwei Rettungssanitäter sehen. Einer der beiden beugte sich über eine Person, die auf den Holzplanken lag, der andere stand zu ihren Füßen und hielt ihre Beine im Dreißig-Grad-Winkel nach oben. Daneben ging ein Mann mit einem Handy am Ohr auf und ab und gestikulierte mit ausholenden Bewegungen. Hatte dort ein Kampf stattgefunden, oder war da einfach jemand umgekippt? Valeris Blick kehrte zurück zu den Beamten, die mit der Bergung der Leiche beschäftigt waren. War das dort drüben seine neue Kollegin Coco Dupont? Skeptisch kniff er die Augen zusammen. Und wie sah die Dame heute aus? Sie trug eine enganliegende, kniekurze Hose, ein rotes Achselhemd und Sportschuhe, um den Kopf ein Stirnband, die Sonnenbrille steckte im Hemdausschnitt. Er beobachtete Coco noch einen Moment und musste sich eingestehen, dass er sie eigentlich kaum kannte. Sie arbeiteten zwar schon ein gutes halbes Jahr lang gemeinsam bei der Sûreté publique de Monaco, doch insgeheim nahm er es ihr immer noch ein wenig übel, dass sie die Stelle angetreten hatte, die eigentlich für seinen Kollegen Frédéric hätte freigehalten werden müssen. Sein langjähriger Partner und Freund war bei einem Skiunfall schwer am Kopf verletzt worden und lag seitdem im Wachkoma. Über Monate war er im monegassischen Krankenhaus in Behandlung gewesen, aber offenbar hatten die Ärzte aufgegeben und ihn nach Hause entlassen, wo er nun von seiner Ehefrau und einer Pflegekraft versorgt wurde. Ein Warten auf den Tod? Es war furchtbar! Valeri besuchte ihn regelmäßig und hoffte immer noch auf ein Wunder, eine Heilung, die ihm seinen Kollegen zurückbringen würde. Er ahnte natürlich, dass dies wohl ein Wunschtraum bleiben würde, und im Grunde hatte er nichts gegen seine neue Kollegin, obwohl sie überhaupt nicht seinem Naturell entsprach: Coco Dupont entstammte einer deutsch-französischen vermögenden Familie, die seit Jahrzehnten ein schickes Appartement in Monaco besaß, das sie nun bewohnte. Für ihn hatte es manchmal den Anschein, als betrachte sie die Polizeiarbeit nur als Hobby, auch wenn das natürlich Unsinn war und sie das auch vehement bestritt. Allerdings ließ Coco sich zu Alleingängen hinreißen, das hatte der letzte Fall rund um den Mord im Formel-1-Milieu gezeigt, eine Eigenart, die er von seinem Expartner Frédéric überhaupt nicht kannte und mit der er nur schwer umgehen konnte. Seine Frau Inés hatte ihn immer wieder ermuntert, Coco doch mal zum Abendessen in ihr Häuschen nach Cap-d’Ail einzuladen, als Zeichen der Gastfreundschaft und des Entgegenkommens, doch nachdem Inés nun das Haus verlassen hatte, war das natürlich kein Thema mehr.
Valeri seufzte und war froh, von weitem nun auch seinen Kollegen Niki zu erkennen, den Rechtsmediziner aus Nizza, der immer dann hinzugezogen wurde, wenn es Anlass dazu gab, von einem unnatürlichen Tod auszugehen – und offenbar hatte Coco Dupont ihn sofort zum Fundort der Leiche gerufen. Niki hieß eigentlich Louis-Stéphane Marchand, verdankte seinen Spitznamen aber der Tatsache, dass er sich bei einem früheren Motorradunfall ähnliche Verletzungen zugezogen hatte wie der ehemalige Formel-1-Fahrer Niki Lauda 1976 auf dem Nürburgring. Sein knallrotes Basecap, sein Markenzeichen, das einen Teil der Narben am Kopf verdeckte, stach zwischen den dunkel gekleideten Beamten hervor. Valeri ging zügig den Steg entlang und blieb vor seiner Kollegin stehen.
»Guten Morgen«, sagte er knapp und wies auf Cocos Outfit. »Sieht ja fast so aus, als hätten wir etwas gemeinsam.«
»Ich war joggen, als mein alter Freund mich angerufen hat. Er hat die Leiche gefunden.« Sie wies mit dem Kinn auf die gegenüberliegende Seite.
»Wir sollten beide lernen, unsere Mobiltelefone auszuschalten, wenn wir sportlichen Aktivitäten nachgehen«, entgegnete Valeri. »Das hätte uns eine Leiche zum Frühstück erspart.« Er warf einen kurzen Blick auf die Frau, die von den Kollegen mittlerweile aus dem Meer gezogen und auf den Steg gelegt worden war. Die Tote sah nicht so aus, als hätte sie besonders lange im Wasser gelegen. Ihr Gesicht war noch deutlich zu erkennen, zeigte keine Fäulnisspuren, und sie war auch nicht besonders aufgedunsen. »Lassen wir Niki erst mal seine Arbeit machen und befassen uns mit dem Mann, der die Leiche gefunden hat.« Valeri winkte einen Kollegen von der Wasserrettung heran. »Können Sie uns mal eben zur anderen Seite fahren?« Ohne eine Antwort abzuwarten, stieg er in das kleine Boot und forderte Coco mit einer knappen Kopfbewegung dazu auf, ihm zu folgen.
Nachdem Coco auf dem Bootsrand Platz genommen hatte, warf der Beamte den Außenbordmotor an und setzte den Tender in Bewegung. Geschickt manövrierte er rückwärts vom Anleger weg, drehte dann das Boot und fuhr zielstrebig auf die andere Hafenseite zu.
»Was ist denn da drüben los?«, wunderte sich Valeri.
»Seine …« Coco hielt einen Moment inne. »… seine Freundin hat wohl einen Schock erlitten und ist zusammengeklappt. Nichts Ernstes. Wird schon wieder.«
Valeri nickte und stieg, auf der anderen Seite angekommen, mit einem großen Schritt aus dem Boot, noch bevor der Bootsmann den Tender vertäut hatte. Coco folgte Valeri, und gemeinsam blieben sie vor der jungen Frau stehen, die immer noch am Boden lag.
»Geht es wieder?«, fragte Coco mit Blick auf das immer noch leichenblasse Gesicht des Mädchens. Der Sanitäter nickte.
»Wir haben ihr ein Kreislaufmittel gegeben.«
»Gut.« Coco warf Nikolai, der immer noch das Handy am Ohr hatte, einen mahnenden Blick zu, der ihn dazu aufforderte, das Gespräch zu beenden. Valeri und Coco traten ein paar Schritte zu Seite, außer Hörweite der blonden Frau und der Sanitäter, als Nikolai zu ihnen herüberkam. Valeri hielt ihm seine Hand entgegen.
»Henri Valeri, Sûreté publique.«
»Nikolai Schweizer. Mir gehört das Boot hier.«
»Schweizer?« Valeri zog eine Augenbraue hoch. »Waren Sie nicht schon in unseren letzten Fall verwickelt?«
»Verwickelt ist wohl das falsche Wort. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich Ihnen einen entscheidenden Hinweis gegeben«, erwiderte Nikolai. »Und daraufhin haben Sie den Täter doch wohl geschnappt.«
»Sie haben also die Leiche entdeckt?«, fragte Valeri, den überheblichen Kommentar ignorierend, und fuhr sich mit der Hand über seinen Bart.
»Das ist richtig. Ich war mit meinem Tender unterwegs, als ich sie im Wasser treiben sah.«
»Und wie kam sie dahin?«
»Woher soll ich das wissen?! Hierher geschwommen ist sie bestimmt nicht.«
»Ach nein?«
»Gehen Sie vielleicht in Abendkleidung schwimmen?« Nikolai lächelte süffisant. Valeri sparte sich eine Antwort.
»Kennst du die Frau?«, mischte sich Coco, an Nikolai Schweizer gewandt, in das Gespräch ein.
»Bevor du gleich wieder sauer wirst: Nein, kann mich nicht erinnern, sie jemals gesehen zu haben. Und nein, ich hatte demzufolge auch nichts mit ihr.«
Valeri schaute irritiert zwischen den beiden hin und her. Die Spannung, die hier herrschte, gefiel ihm ganz und gar nicht. Zu viel Privates für seinen Geschmack.
»Also: Sie haben die Frau vorher noch nie gesehen?«, hakte er daher nach.
»Nein. Ich denke nicht. Ich habe sie aber nur kurz angesehen, um mich davon zu überzeugen, dass sie wirklich tot ist. Puls, Gesicht, was man eben so macht, wenn man sich nicht auskennt. Kein schöner Anblick am Morgen. Ich hab noch nie ’ne Tote angefasst. Also nageln Sie mich nicht darauf fest.«
»Was haben Sie denn um die Zeit hier zu tun gehabt?«, fragte Valeri.
»Wird das ein Verhör?«
»Nein, reine Routine. Also beantworten Sie bitte meine Frage!«
»Ich habe auf meinem Boot übernachtet.« Er wies mit dem Kinn auf die junge Frau, die sich mittlerweile aufgesetzt hatte. »Sie wissen schon …«, fügte er mit einem Grinsen hinzu.
»Nein. Weiß ich nicht. Kann die Dame das bestätigen?«
»Natürlich!«
»Gut.« Valeri seufzte. »Haben Sie heute Nacht etwas Auffälliges bemerkt?«
»Nein. Nichts. Wir waren zu beschäftigt. Und heute Morgen wollte ich nur eben ein paar Croissants holen.«
»In Ordnung. Falls wir noch Fragen haben, melden wir uns. Vielen Dank!« Dann wandte er sich an Coco: »Ich nehme an, Sie haben die Telefonnummer von Herrn Schweizer? Lassen Sie uns wieder rüberfahren. Vielleicht hat Niki schon erste Erkenntnisse.« Er nickte Nikolai noch einmal zu, setzte sich in Bewegung und lief zum Tender hinüber. »Wahnsinnig sympathisch, dein Kollege«, knurrte Nikolai.
»Ja. Und seit seine Frau ihn verlassen hat, ist er noch viel öfter schlecht gelaunt.« Coco schwieg einen Moment und pustete sich ihren goldblonden Pony aus dem Gesicht. Dann wies sie auf die beiden Becher mit Orangensaft, den Kaffee und die Tüte mit den Croissants, die vor der Gangway auf dem Boden standen. »Immerhin: Es gibt Frauen, denen du Frühstück bringst.« Nikolai mit einer anderen Frau zu sehen, versetzte Coco einen Stich, auch wenn ihr eigenes Privatleben so kompliziert war, dass sie sich sowieso nicht ernsthaft mit einem Mann einlassen konnte. Coco hatte sich von ihrem Ehemann getrennt, bevor sie die Stelle als Kommissarin in Monaco angetreten hatte. Und obwohl sie wusste, dass diese Entscheidung richtig gewesen war, hatte die Trennung Wunden hinterlassen, die immer noch nicht verheilt waren. Ihr Lebensplan schien gescheitert, die Gegenwart überschattet von gegenseitigen Schuldzuweisungen, Versagensängsten und immer wiederkehrendem Streit. Daher war das Letzte, was sie jetzt wollte, eine neue Beziehung. Und dennoch ließ sie dieses unverhoffte Wiedersehen mit Nikolai nicht kalt. Nikolai war einst ihre erste große Liebe gewesen. Kennengelernt hatten sie sich mit Anfang zwanzig, als Coco mit ihren Eltern häufig in Monaco den Sommer verbracht hatte. Sie erinnerte sich noch ganz genau an ihre erste Begegnung: Mit zwei Koffern in den Händen hatte er Coco nach dem Weg zu einer ganz bestimmten Bank gefragt. Ihre scherzhafte Frage, ob er sein Schwarzgeld etwa in Koffern mit sich herumschleppe, hatte er tatsächlich mit einem Ja beantwortet. So waren sie darüber ins Gespräch gekommen, dass das Klischee vom koffertragenden Millionär hier tatsächlich der Realität entsprach. An den Namen des Geldhauses konnte sich Coco beim besten Willen nicht mehr erinnern, wohl aber daran, dass im selben Moment ein deutscher Reisebus mit Touristen aus Nikolais Heimat, einem kleinen Kaff bei München, an ihnen vorbeigefahren war und er sich unglaublich darüber echauffierte, dass ihn seine schnöde Vergangenheit anscheinend sogar noch im elitären Monaco wieder einholte. Coco hatte das damals arrogant gefunden, sich aber dennoch in den jungen Selfmade-Millionär verguckt. Ein kurzes, intensives Abenteuer, das sie nicht vergessen hatte. Als sie nun ein gutes halbes Jahr zuvor ihre neue Stelle bei der Sûreté publique angetreten hatte, war Nikolai einer der ersten alten Freunde gewesen, die sie wiedergetroffen hatte. Und die Faszination von damals war noch immer da. Nach dem Abschluss ihres ersten Falls hatte sich ein kurzes Tête-à-Tête ergeben. Doch Nikolai war bekanntlich kein Mann für eine ernsthafte Beziehung. Und obwohl auch auf ihrer Seite keine tiefergehenden Gefühle im Spiel gewesen waren, hatte Coco sich über das Ende dieser Affäre geärgert. Seitdem waren sie sich nur hier und da zufällig über den Weg gelaufen.
»Coco, wir haben uns viel zu lange nicht gesehen! Lass uns doch mal wieder etwas essen gehen!«
»Danke, keine Zeit!«
»Ach komm. Bist du etwa immer noch sauer? Meine Güte, warum müsst ihr Frauen immer gleich den ganzen Kuchen haben? Auch ein Stückchen von der Torte kann doch lecker sein!«
»Super Spruch!«, entgegnete Coco und imitierte ein Gähnen. »Ich entscheide nur gerne selbst, wann und wie viel Torte ich esse!«
»Torte ist ein gutes Stichwort.« Nikolai grinste. »Ich habe einen Tisch im Cipriani heute Abend, und der Laden ist für seine Törtchen bekannt. Als Dessert, im doppelten Wortsinne!« Coco verdrehte die Augen. »Cécile kommt auch mit. Und die würde sich sicher freuen, dich wiederzusehen.« Cécile war eine gemeinsame Freundin, und Coco musste zugeben, dass sie sich wochenlang nicht mehr getroffen hatten. Coco hatte fast den Eindruck, Cécile ginge ihr aus dem Weg. Cécile kannte sie ebenfalls schon seit langer Zeit, und nach ihrer Rückkehr nach Monaco war sie erneut zu einer guten Freundin geworden.
»Ich sehe, was ich machen kann. Ich muss los«, antwortete Coco knapp, winkte kurz und wies auf die blonde Frau, die immer noch am Boden saß. »Du hast dich wirklich nicht verändert. Kümmere du dich lieber mal um dieses Törtchen hier!« Coco lief eilig davon und folgte Valeri, der ihr einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. Er wartete nicht gerne, das wusste sie.
»Dann wollen wir mal«, sagte er knapp. Zurück auf der anderen Hafenseite gingen sie zu Niki, der immer noch über die Leiche gebeugt am Boden kniete.
»Haben wir schon was?«, fragte Coco.
»Die Frau ist tot, da kann man nichts machen«, konstatierte Niki trocken. »Also lasst uns doch lieber da drüben ein paar Austern schlürfen!«
»Was du nicht sagst«, erwiderte Coco. »Aber, wie du weißt, mag ich die glibberigen Dinger nicht besonders!«
»Banausin!«, knurrte Niki.
Valeri warf einen bedauernden Blick in Richtung der Austernbar, und ihm lief bei der Vorstellung, bei einem Glas Rosé ein Dutzend Austern zu verspeisen, das Wasser im Mund zusammen. Zu schade, dass ihnen die Tote einen Strich durch die Rechnung machte.
»Nun sag schon: Woran ist die Dame hier gestorben? Und vor allem, wann?«, hakte er nach.
»Im Moment kann ich nur Vermutungen anstellen. Grün ist sie noch nicht, keine Fäulnis, das heißt: Besonders lange ist sie noch nicht tot. Werfen wir mal einen Blick auf die deutlich sichtbaren Fakten: Die Waschhautbildung hat gerade erst begonnen, Nägel haben sich noch nicht abgelöst, wenig Fischfraß, also lag sie nicht besonders lange im Wasser.«
»Aber wie lange denn?«, fragte Valeri ungeduldig.
»Wir haben eine Wassertemperatur von vierzehn Grad, die Körpertemperatur ist noch nicht ganz angepasst – das geschieht spätestens nach zwei Tagen. Ich tippe, dass sie nicht länger als zwölf Stunden tot ist.«
»Und weiter?«
»Sie trägt ein Abendkleid, beim Baden ertrunken ist sie jedenfalls nicht!«
»Ja, danke. Das habe ich heute schon mal gehört«, murrte Valeri und warf erneut einen verärgerten Blick auf die andere Seite des Hafens in Richtung Nikolai Schweizer. Dann wandte er sich wieder Niki zu. »Hast du noch mehr?«
»Ich gehe nicht davon aus, dass sie ertrunken ist. Kein Schaumpilz vor Mund und Nase. Es geht um die sogenannten Vitalzeichen, also darum, ob der Betreffende bei suffizienter Kreislauffunktion im Wasser ums Leben gekommen ist«, dozierte er. »Oder einfach gesagt: Hat derjenige noch gelebt, als er ins Wasser gefallen ist? In diesem Fall würde ich sagen: Nein.«
»Du meinst, die Frau war schon tot, bevor sie im Wasser gelandet ist?«, fragte Coco.
»Jein! Eine andere Person muss hier nicht zwingend involviert gewesen sein. Keine Würgemale, keine Schusswunden.« Niki zeigte auf das Gesicht der Toten. »Diese oberflächlichen Hautabschürfungen kommen vermutlich von den Steinen hier. Da ist sie durch die Bewegung des Wassers dran entlanggeschrammt. Aber – und jetzt wird es interessant: Die spärlichen Totenflecken sprechen für einen großen Blutverlust. Es gibt aber wenig äußerliche Verletzungen, daher gehe ich von inneren Blutungen aus, Stichwort Polytrauma! Genau kann ich das aber noch nicht sagen, wir brauchen eine gerichtlich angeordnete Leichenöffnung. Aber wenn ihr mich fragt: Die ist irgendwo runtergefallen, hart aufgeschlagen und dann ins Wasser gerutscht.« Niki stand auf. »So viel fürs Erste.«
»Wo soll sie denn runtergefallen sein?«
»Wie gesagt, sie ist nicht lange im Wasser gewesen, also irgendwo hier in der Nähe.« Niki wies mit dem Kinn auf den großen Fürstenfelsen, auf dem der Palast und das Ozeanographische Museum thronten. »Von da oben? Vielleicht ist sie ja auch gar nicht gefallen, sondern gesprungen.«
»Du tippst auf Selbstmord?«
»Möglich. Auf den ersten Blick sieht es jedenfalls nicht nach Fremdeinwirkung aus.« Coco nickte, blickte nach oben und kniff die Augen zusammen. »Springt da freiwillig jemand runter?«
»Da kannst du jedenfalls sicher sein, dass du anschließend tot bist. Kennst du nicht die Geschichten von all den verschuldeten Zockern, die sich nach einem Casino-Besuch vom Felsen gestürzt haben, nachdem sie in einer einzigen Nacht ihren gesamten Besitz verspielt hatten?« Coco schüttelte den Kopf, aber Valeri nickte wissend.
»In Monaco ist bekanntlich alles möglich. Und Probleme gibt es hier wahrhaftig genug!«
4
Er wusste, sie wollten ihm an den Kragen. Es war jedes Jahr das Gleiche. Und mit jedem Schritt, den er vor den anderen setzte, kochte die Wut mehr in ihm hoch. Er würde nicht klein beigeben, nicht aufgeben, selbst wenn er dabei kaputtginge! In seinem Alter wäre das noch nicht einmal besonders tragisch. Die anonymen E-Mails in seinem Posteingang, die wüsten Beschimpfungen und die unangemessenen Vorwürfe, weil er immer noch als Mit-Organisator für das Zirkusfestival von Monte Carlo verantwortlich war, ärgerten ihn maßlos. Das würde er sich nicht mehr bieten lassen! Nicht so! Nicht nach alldem, was er für das Festival getan hatte.
Alexandre Denaux hatte gerade das Marriott-Hotel im Hafen von Cap-d’Ail verlassen, in dessen Räumen während des Festivals eine Ausstellung rund um die Geschichte des Zirkus zu sehen sein sollte und die er sich vorab angeschaut hatte, als er erneut von diesen ärgerlichen Gedanken heimgesucht wurde. Er wollte sich sein liebstes Hobby, und im Grunde war es ja viel mehr als das, auf keinen Fall vermiesen lassen. Vor ihm lagen zwei anstrengende Wochen: Zehn Tage lang würden sich die besten Artisten der Welt in der Manege messen und um eine der begehrten Auszeichnungen, den bronzenen, silbernen oder goldenen Clown, kämpfen. Es waren nur noch wenige Tage, bis die erste Vorstellung beginnen sollte, Ausnahmezustand rund um das berühmte Chapiteau de Fontvieille, das fest installierte Zirkuszelt, das zwischen dem Heli-Airport und dem Rosengarten von Prinzessin Grace gelegen war. Er liebte den Zirkus mehr als alles andere, er war seine größte Leidenschaft. Und hätte es in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als er noch ein junger Mann gewesen war, schon Zirkusschulen gegeben, wäre er selbst als Artist in der Manege gelandet. Doch damals musste man schon in eine Artistenfamilie hineingeboren werden, um ein solches Abenteuerleben führen zu können. Er musste lächeln bei der Erinnerung an den Tag, an dem Fürst Rainier, zu dem Denaux’ Zirkusleidenschaft damals durchgedrungen war, ihn gefragt hatte, ob er ihn bei der Gründung und Organisation eines Zirkusfestivals unterstützen wolle. Und seit mehr als vierzig Jahren war er nun als künstlerischer Berater für das Festival tätig, so dass die Leute in ihm so eine Art Zirkusdirektor sahen. Es war so viel passiert seit damals: Er hatte Artisten kommen und gehen sehen, Karrieren, die nach der Auszeichnung mit dem Goldenen Clown richtig in Fahrt gekommen waren, wieder andere Künstler, die nach einem großen Erfolg mächtig abstürzten, Familien, die gegründet wurden, Beziehungen, die in die Brüche gingen. Doch was auch immer passierte, es blieb das Gefühl, dass sie alle eine große Familie waren. Eine Familie von Künstlern, die sich trennten und wiedertrafen, immer und immer wieder. Er liebte seine Aufgabe noch so wie an seinem ersten Tag. Jedes Jahr entdeckte er neue Talente, junge Künstler, oft von einer erfrischenden Naivität. Wie sie so vor ihm standen, voller Ehrfurcht, hier in Monte Carlo einmal auftreten zu dürfen. Er konnte sich darüber kaputtlachen, wie er erst am Tag zuvor einen von ihnen sprichwörtlich in den April geschickt hatte: ein junger Bursche, ein talentierter Diabolo-Künstler aus der Schweiz, der mit seinen neunzehn Jahren beeindruckend gut im Umgang mit dem Doppelkegel war, der auf ein Seil gesetzt und hochgeschleudert wurde. Alexandre hatte ihm eine Weile dabei zugesehen, wie er geschickt mit vier Diabolos gleichzeitig auf dem Seil spielte. Doch als er ihn dann nach dem Chapiteau-Schlüssel gefragt hatte, war der Junge völlig aus dem Konzept geraten. Denaux musste erneut lachen. Es war ein alter Scherz unter Zirkusleuten, junge Artisten zu fragen, ob sie den Chapiteau-Schlüssel hätten, um zu sehen, wie grün sie noch hinter den Ohren waren. Ein Schlüssel für ein Zelt! Dass doch immer wieder junge Hüpfer darauf hereinfielen, fand er zum Bersten komisch. Der Gedanke an dieses amüsante Erlebnis verbesserte seine Laune schlagartig. Er beschloss, an diesem strahlenden Wintertag nicht den direkten Weg über die Avenue des Guelfes zum Festivalgelände zu nehmen, sondern lieber durch den kleinen Hafen von Cap-d’Ail zu spazieren, vorbei an den Booten, die still im Wasser lagen, ein kleiner Marsch, auch wenn er in seinem Alter nicht mehr besonders gut zu Fuß war. Vom Hotel bis zu dem von außen eher unscheinbaren kleinen Bistro La Cambuse, das sich direkt in einer Ecke des kleinen Hafens befand, von der aus man über eine Treppe mit wenigen Stufen hinauf nach Monaco gehen konnte, waren es nur wenige Meter, und er beschloss, bevor er gleich bei der offiziellen Pressekonferenz des Festivals auftreten und einige der diesjährigen Teilnehmer vorstellen würde, noch einen kurzen Stopp an der Bar des Bistrots einzulegen und einen Kaffee zu trinken. Es war ein kleiner Laden, der nur draußen über Tische verfügte. Der Innenraum, in dem sich eine Bar mit drei oder vier Hockern befand, war winzig, hatte aber seinen ganz eigenen Charme: An den Wänden standen diverse hölzerne Weinkisten übereinander, darin die unterschiedlichsten feinen Tropfen, dazwischen thronte zur Dekoration eine riesige Glasflasche, die mit alten Korken gefüllt war. Hinter der Theke an der Wand hingen einfache Holzregale, auf denen Spirituosen und Gläser standen, daneben eine gigantische Uhr. Vergnügt lehnte Denaux sich auf den Tresen und hob die Hand.
»Alexandre!«, begrüßte ihn Fabio, sein alter Freund hinter der Bar. »Wie immer?« Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er eine der weißen Tassen von der Conti-Espressomaschine und bereitete den Kaffee zu. Denaux nickte nur, ließ sich auf einem der Holzhocker nieder und warf einen Blick in Richtung Hafenbecken. Es war noch nicht viel los um diese Uhrzeit, er konnte nur einen einzigen Yachtbesitzer entdecken, der schon an Deck hantierte, und auch das Bistrot, an dessen braunem Holztresen er nun saß, war noch leer.
»Tut mir leid, das mit dem Festival«, sagte Fabio. »Ich weiß ja, wie wichtig dir das ist. Was ist denn bloß passiert?« Verwundert blickte Alexandre Denaux seinen alten Freund an, während er die Kaffeetasse in die Hand nahm und vorsichtig einen Schluck der heißen, dampfenden Flüssigkeit trank.
»Worauf willst du hinaus?« Er konnte sich keinen Reim darauf machen, was Fabio soeben gesagt hatte.
»Na, das Festival! Es ist doch abgesagt!«
»Wie bitte?« Denaux stellte die Tasse ab und warf seinem Freund einen belustigten Blick zu. »Was redest du da?«
»Ihr habt doch die ganzen Plakate überklebt. Wozu denn sonst der ganze Aufwand?«
»Überklebte Plakate? Was meinst du denn bloß?« Denaux runzelte die Stirn.
»Na, die Ankündigungen für das Festival! Ich bin vorhin noch an der Werbung in Fontvieille vorbeigelaufen. Abgesagt stand da drauf!« Jetzt war es Fabio, der seinen Freund verwundert anblickte. »Weißt du denn gar nichts davon?«
»Hör mal, mein Alter, es ist noch zu früh für solche Scherze«, murmelte Denaux und nahm einen weiteren Schluck Kaffee.
»Das meine ich ernst, Alexandre. Das Festival ist abgesagt, alle Plakate sind überklebt. Parbleu, hast du das denn nicht gewusst?«
»Gewusst? Zut! Was redest du denn da? Natürlich wüsste ich davon, wenn dem so wäre! Das ist doch Schwachsinn!« Nun wurde er doch etwas nervös und zog sein Mobiltelefon aus der Tasche seines dunkelgrauen Jacketts. Der Blick auf das Display zeigte ihm bevorstehenden Ärger an. »Merde!«, entfuhr es ihm. Siebenundzwanzig Anrufe in Abwesenheit! Er hatte vergessen, den Ton wieder anzustellen, als er am Morgen das Haus verlassen hatte. Das durfte doch nicht wahr sein! Eine Nachricht war von der Prinzessin. Geschwind checkte er seine Mailbox, um zu hören, was sie zu sagen hatte. Die Tochter des verstorbenen Fürsten klang ziemlich aufgebracht. Auch sie konnte sich nicht erklären, warum sämtliche Plakate, die das berühmte Zirkusfestival in Monaco ankündigten, mit einer Absage überklebt worden waren.
»Das gibt es doch gar nicht!«, platzte er heraus. »Du hast recht!« Grimmig blickte er seinen Freund an.
»Habt ihr das Festival tatsächlich abgesagt?«, fragte Fabio verwundert.
»Natürlich nicht! Da stecken bestimmt diese verfluchten Tierschützer dahinter!«