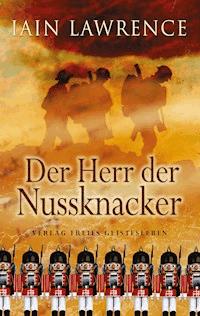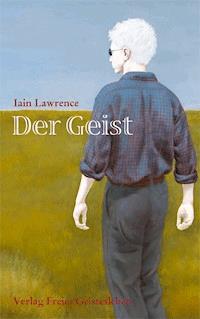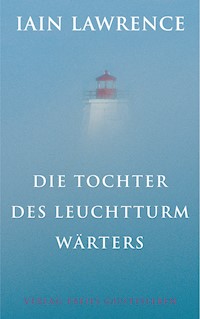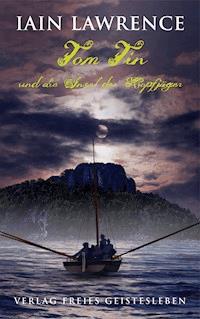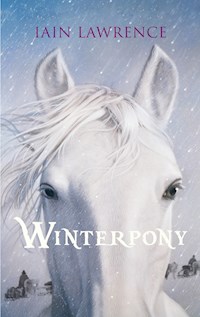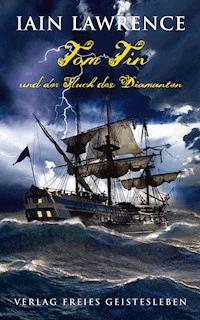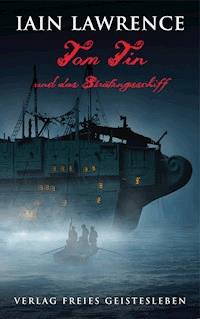
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Tom Tin
- Sprache: Deutsch
London um 1825. Als sein Vater ins Schuldgefängnis kommt, beschließt Tom Tin, sich an dem Mann zu rächen, der seine Familie ins Unglück gestürzt hat. Doch in den nebligen Straßen der Großstadt wimmelt es von finsteren Gestalten: Tom stößt auf einen Blinden, der den Uferschlamm der Themse nach Schätzen absucht - und ihn bedroht, als er selbst einen aufregenden Fund macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iain Lawrence
Tom Tinund das Sträflingsschiff
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst
Für Donald –meinen kleinen Bruder, meine große Inspiration
Inhalt
1. Mein Abenteuer beginnt
2. Ich begebe mich in Gefahr und finde einen Schatz
3. Der Lumpensammler und sein dreibeiniger Gaul
4. Im Grab
5. Die Straßenkinder
6. Darkeys Entscheidung
7. Mr. Meel stattet mir einen Besuch ab
8. Ich stehe vor Gericht
9. Ich begegne einem gelben Mann
10. An Bord des Sträflingsschiffes
11. Ein kleiner König in einem kleinen Königreich
12. Die Untaten des Walter Weedle
13. Eine seltsame, schweigende Gestalt
14. Der Bauernjunge wird untergepflügt
15. Midgely hat Zweifel
16. Ein raffinierter Plan
17. Oten riecht die Felder
18. Ich bin in großen Schwierigkeiten
19. Mit Midgely im Moor
20. Einsame Weihnacht
21. Jenseits des Ozeans
22. Ich kämpfe mit einem Riesen
23. Auge in Auge mit König Neptun
Anmerkung des Autors
Danksagung
Glossar
Erstes Kapitel
Mein Abenteuer beginnt
Als sie sechs Jahre alt war und ich acht, starb Kitty, meine kleine Schwester. Sie fiel von einer Brücke in die Themse und ertrank, bevor ihr jemand zu Hilfe eilen konnte. Meine Mutter war dabei, als es geschah. Sie hörte einen Schrei, drehte sich um und sah meine Schwester durch die Luft wirbeln. Sie schaute zu, wie Kitty in den Strudeln braunen Wassers verschwand. In diesem Moment verlor meine Mutter den Verstand.
Sie zog Trauerkleidung aus dem schwärzesten Stoff an und verbarg sich darin vom Kopf bis zu den Fußspitzen, wie ein Käfer in seinem Panzer. Bei Sonnenaufgang stand sie an Kittys Grab, und wenn die Sonne unterging, stand sie immer noch da. Mit ihrem im Wind wehenden Schleier und dem vom Regen tropfnassen Schal wurde sie selbst zu einem Geist, der den Friedhof heimsuchte und vor dem sich die Kinder fürchteten. Selbst ich, der ich sie mein ganzes Leben lang gekannt hatte, wagte mich nicht in die Nähe des Totenackers, wenn der gelbe Herbstnebel die Grabsteine umwaberte.
Es war solch ein Tag, ein Tag im Herbst, als mein Vater sie schließlich vom Grab meiner Schwester wegzerren musste. Der Nebel war dicht und roch faulig, sah aus wie verdorbene Vanillesoße, die man zwischen die Gräber gegossen hatte. Vor dem Eisengatter an der Straße stehend, konnte ich nicht bis zur Kirche sehen, aber ich erkannte die Kreuze und die Marmorengel, manche davon deutlich, andere schemenhaft. Und mittendrin meinen Vater, der mit einem Dämon kämpfte. Ich hörte das Heulen meiner Mutter.
Ihre Schuhe waren schwarz, ihre Haube war schwarz und in ihren flatternden Kleidern sah sie mehr wie ein Tier aus als wie ein Mensch. Sie kreischte und wehrte sich, klammerte sich an die Grabsteine und bohrte ihre Finger in die Erde. Als mein Vater sie endlich durch das Gatter zog, jaulte sie wie ein Hund. In ihren Fäusten hielt sie Erdklumpen. Sie schaute sie an und wurde ohnmächtig.
Wir hoben sie auf den Karren, legten sie zwischen die Bündel und die Truhen, in denen unsere Habseligkeiten steckten. Der Kärrner kletterte auf seinen Sitz. Er ließ die Peitsche knallen und warf dem Pferd einen Fluch zu, dann zuckelten wir los in Richtung Camden Town.
Ich ging neben meinem Vater, als wir an unserem leeren Haus vorbeikamen und auf die Brücke zuliefen. Zufällig wählte der Kärrner dieselbe Strecke, die mein Vater jeden Morgen hinter sich brachte, wenn er – vergeblich – bei der Admiralität vorsprach. Ich sah, wie mein Vater das Haus betrachtete und dann zu Boden schaute. Schweigend gingen wir weiter. Der Karren, der nur ein paar Schritte vor mir über das Pflaster holperte, war nichts weiter als ein grauer Schemen. Er schien von einem unsichtbaren Lasttier gezogen zu werden, das schnaubte und nieste, während es vorantrottete. Meine Mutter erwachte und setzte sich jammernd im Karren auf.
Wir waren beinahe am Fluss, als mein Vater sagte: «Es ist zu ihrem eigenen Besten. Das weißt du, Tom.»
«Ja», erwiderte ich, obwohl es nicht die Wahrheit war. Wir verließen Surrey nicht um meiner Mutter willen, sondern um die zwei Pennys zu sparen, die mein Vater Tag für Tag beim Überqueren der Brücke entrichten musste. Wir verließen unser Heim, weil Mr. Goodfellow uns daraus vertrieben hatte, genauso wie er uns vor einem knappen Jahr schon aus unserem größeren Haus fortgejagt hatte. Ich glaubte, er würde uns auf ewig heimsuchen, würde uns von einem ins nächste Heim jagen – eins kleiner als das vorherige –, bis er erreicht hätte, dass wir mit den Bettlern und den Blinden auf der Straße lebten. Wir verließen Surrey, weil mein Vater ein Seemann ohne Schiff war.
Sein Gang war nicht mehr der eines Seemanns. Er sah nicht mehr aus wie einer und roch auch nicht mehr so, und ich hätte nie vermutet, dass er jemals zur See gefahren war, wären da nicht die fadenscheinige Uniform gewesen, die er jeden Morgen anlegte, und die vielen Utensilien und Erinnerungsstücke, die ein Seemann von seinen Reisen mitbringt. Früher hatten sie überall herumgestanden, jetzt waren nur noch wenige davon übrig. In meinem ganzen Leben hatte ich ihn bisher erst einmal auf See ausfahren sehen, und das in einem jämmerlichen Kahn, der sank, bevor er den Fluss Medway erreichte. Auch das hatten wir Mr. Goodfellow zu verdanken; dieser Augenblick war der Anfang vom Ende gewesen.
Als wir die hölzernen Anleger am Fuß der Brücke erreichten, konnte ich die Nähe der Themse fühlen. Nebelhörner tuteten klagend, und auch das Klopfen der Maschinen eines Dampfers war zu hören, der sich durch den Fluss schaufelte. Aber das Wasser konnte ich nicht riechen; der Gestank des Nebels überdeckte alles.
Wir bezahlten die Maut und gingen über die Brücke. Vater lief ganz am Rand. Sein Hemdsärmel wurde schwarz vor Ruß, der sich auf dem Geländer angesammelt hatte. Pferde und Kutschen tauchten vor uns auf, und von hinten ratterte ein offener Wagen heran. Ich musste Menschen ausweichen und sprang gerade noch rechtzeitig einem Karriol aus dem Weg. Mein Vater aber ging stur geradeaus, richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf den Fluss unter uns. Damen, die auf Bänken saßen, zogen ihre Füße ein, als er vorbeiging. Eine hob hastig einen kleinen weißen Hund hoch. Ein Mann brüllte: «Passen Sie auf, wo Sie hingehen!» Aber mein Vater stapfte achtlos an ihnen vorbei.
Ich stellte mir vor, dass er das Wasser irgendwie sehen konnte, und auch das Leben und das bunte Treiben, das sich darauf abspielte. Geräusche, die als bloßes Stöhnen und Ächzen und nichts sagendes Platschen an mein Ohr drangen, mussten vor seinen Augen als Ruderer und Flussschiffer bei ihrer Arbeit an Riemen und Segeln erscheinen. Sein Kopf ruckte nach oben und einen Moment lang strafften sich seine Schultern.
Ich hatte kein Verlangen danach, seine Welt kennen zu lernen, obwohl ich an der Mündung der Themse geboren worden war, dort wo der Fluss auf das Meer traf. Wir zogen aus dem Dorf fort, bevor ich zwei Jahre alt war, weil meine Mutter es so wünschte. Der Fluss hatte ihr den Vater genommen und die See die Brüder, und seit dem Tod meiner Schwester lehrte sie mich, beides zu fürchten. Ich dachte oft, wenn ich die Themse vorbeiwirbeln sah, dass eins von beiden nur darauf wartete, auch mich an sich zu reißen.
Mein Vater war enttäuscht, dass ich kein Interesse am Seemannsleben hatte. Als er jetzt wie ein grauer Schatten im Nebel vor mir herging, musste ich daran denken, wie weit wir uns voneinander entfernt hatten. Er war der Meinung, dass ich seit dem Tod meiner Schwester verhätschelt und verwöhnt worden war, und möglicherweise stimmte das auch. Er war nicht stolz auf mich, und ich nicht auf ihn.
Meile für Meile liefen wir hinter dem knarrenden Karren her. Wir entfernten uns vom Fluss und durchquerten Covent Garden mit seinen belebten Buden, dann trotteten wir durch ein Labyrinth aus engen Gassen. Als wir Tottenham Court hinaufstiegen, begann sich der Nebel um uns zu lichten, bis wir schließlich hinaus in den Sonnenschein traten. Immer noch hatten wir eine Meile Weges vor uns. Hinter uns lag der Nebel wie schmutzig gelber Schlamm über der Stadt, nur die hohe Kuppel der St. Paul’s Kathedrale und ihr glitzerndes Kreuz ragten in die Helligkeit und den blauen Himmel empor.
Der Tag war fast vorbei, als wir in unserem neuen Zuhause ankamen. Es war ein erbärmliches kleines Haus, eingezwängt zwischen vielen anderen, die alle in einer Reihe standen. Aus weiter Ferne, im Herzen Londons, schlug ein ganzer Chor von Glocken die Stunde an. Der Kärrner warf unsere Sachen vom Karren und eilte davon, als ob er sich davor fürchtete, in der anbrechenden Nacht so weit von der Stadt entfernt zu sein. Meine Mutter kletterte ohne Hilfe herab und stand schweigend am Straßenrand. Sie war selbst eine Gestalt der Nacht. Es war keine Menschenseele zu sehen, und niemand kam, um uns willkommen zu heißen.
Ich hob eine Truhe auf und trug sie ins Haus. Dabei warf ich meiner Mutter einen wütenden Blick zu, weil sie keinen Finger rührte, um uns zu helfen. Als ich durch den Türrahmen trat, marschierte gerade eine Horde Kakerlaken durch die Diele. Einen Moment stand ich stocksteif vor Verblüffung und Ekel, dann trampelte ich wild entschlossen in meinen Stiefeln hinterher. Aber mein Vater, der hinter mir ins Haus gekommen war, rief: «Hör auf damit, Tom! Auch sie sind Gottes Geschöpfe!»
«Das sind Kakerlaken», sagte ich.
«Dann eben Gottes Kakerlaken», gab er zurück. Er trug einen Stuhl, der so groß war, dass er beinahe nicht durch die Tür gepasst hätte. Alles, was ich von ihm sehen konnte, waren sein Gesicht über der Rückenlehne und seine Stiefel unter den Stuhlbeinen. «Wie würde es dir gefallen, wenn ein riesiges Etwas versuchen würde, dich zu zertrampeln, Tom?», fragte er mich. «Sie versuchen nur zu fliehen. Sie versuchen, sich zu verstecken. Würdest du nicht dasselbe tun?»
«Es sind Kakerlaken!», beharrte ich.
«Spielt keine Rolle.» Er stellte den Stuhl in das winzige Wohnzimmer und verrenkte sich fast den Hals in dem Bemühen zu sehen, wohin er seine Füße setzte. «Hol die Lampen und zünde sie an. Das Licht allein wird sie schon vertreiben.»
Ich schaute zu, wie die schwarzen Viecher weghasteten, und war dankbar, dass es wenigstens keine Ratten waren. Sie krabbelten in die dunkle Feuchtigkeit der Spülküche, und ich bekam vom Anblick und schabenden Geräusch der Käfer eine Gänsehaut. Mir war klar, dass sie jede Nacht durch die Zimmer wandern und ich sie in einem dichten Teppich auf dem Boden liegen sehen würde, wenn ich morgens vor Sonnenaufgang erwachte.
«Ich hasse ihn», sagte ich.
«Wen?»
«Mr. Goodfellow.»
Vater stellte den Stuhl ab. «Oh, wir geben uns noch nicht geschlagen, Tom», sagte er, «noch lange nicht.»
«Es ist einfach nicht gerecht», sagte ich.
«Aus Gegenwind wird eine günstige Brise, wenn man über Stag geht.»
Seine Seemannssprache verunsicherte mich immer. Ich wusste nie, was er meinte.
«Mach die Leinen los, Tom», sagte er. «Wir steuern einen neuen Kurs, das ist alles. Ich sage, wir setzen das Hauptsegel und machen das Beste daraus.»
Ich kramte unsere Truhen und Taschen und die eilig zusammengezimmerten Kisten durch, bis ich die Lampen und das Öl fand. Ich stellte sie so auf, dass jede Ecke ausgeleuchtet wurde, und dann half ich, unsere wenigen Möbel hereinzutragen. Als Erstes nahmen wir uns das lange Sofa vor, damit meine Mutter sich hinlegen konnte, während wir arbeiteten. Meinem Vater machte es nichts aus, dass sie so unfähig war, mir aber dafür umso mehr. Ich schleppte und schleppte, bis meine Arme taub waren, und hasste das, was ich tat. Eines Tages, so stellte ich mir vor, würde ich einen Mann einstellen, dessen einzige Pflicht darin bestünde, meine Möbel herumzutragen. «Ich möchte die Ottomane gerne hier drüben haben, James», würde ich dann sagen und auf den Platz im Zimmer deuten. Und er würde das Möbelstück mit einem Nicken anheben und sagen: «Sehr wohl, Mr. Tin.» Ich hätte eine ganze Horde von Dienstboten und auch einen Lakai für meine Kutsche. Ich würde in dem elegantesten Karriol durch London rasen, gezogen von den edelsten Pferden. Ich wäre in allen Dingen Mr. Goodfellow überlegen.
Der Traum nahm am nächsten Morgen eine unerwartete Wendung, als mein erster Tag in der neuen Schule anbrach. Mein Vater würde sagen: «Mich hätte fast der Schlag getroffen.»
Die Schule schmückte sich mit einem wohlklingenden Namen: Mr. Popperys Akademie für Jungen. Aber sie bestand lediglich aus dem zur Straße hin gelegenen Zimmer im Haus der Popperys, mit einer Tafel an der Wand mit blutroter Tapete und sechs kleinen Stühlen für sechs dicke Jungen. Sie alle schienen aus Teig und Schweineschmalz zu bestehen, und keiner von ihnen bot das Bild eines wahren jungen Gentleman. Mr. Poppery selbst wirkte wie ein kleiner, herrenloser Hund. Er war dünn und ging gebeugt. Nur in seinem rechten Arm, der etwa den Umfang des Arms eines Schmieds hatte, steckten Bärenkräfte, was wir jedes Mal zu spüren bekamen, wenn er uns die Lektionen mit Schlägen auf unsere Hintern einprügelte. Wir mussten jeden Tag unseren Unterricht bezahlen und die Pennys in eine Holzkiste stecken. Mr. Poppery tat so, als würde er nicht hinschauen. Aber an meinem ersten Morgen hatte ich keine Münze dabei, und so blieb ich zurück und wurde immer verlegener, je mehr Pennys in die Kiste klapperten. Ich wollte schon vorgeben, einen hineinzuwerfen, als Mr. Poppery den Schlitz mit der Hand bedeckte und mir mit einem Zwinkern zuflüsterte: «Das ist schon erledigt, Master Tin.»
Es war eine trostlose Schule und ich verabscheute sie. Aber als mein Vater an diesem Abend nach Hause kam, nachdem er wie jeden Tag von morgens bis abends in der Admiralität gewartet und um das Schiff gebettelt hatte, das er nie bekam, als er den Ruß von seinen Schultern fegte und mich fragte, wie mein erster Tag gelaufen war, da log ich. «Mr. Poppery ist ein netter Mann», sagte ich. «Und er hat eine ganz famose Schule.» Ich hatte dabei nicht im Sinn, die Gefühle meines Vaters zu schonen. Ich hatte bloß Angst, dass er mich wegschicken würde, damit ich mir eine Arbeit suchte, oder – schlimmer noch – damit ich zur See fahren sollte.
Er nickte nur und zog seinen Mantel aus. Er hob ihn hoch und wollte ihn an den Haken an der Tür hängen, als ein Stift aus seiner Tasche fiel. Ich bückte mich, um ihn aufzuheben, aber Vater schob mich zur Seite und griff selbst danach. «Geh und schau nach deiner Mutter», fuhr er mich an.
Er war selten wütend auf mich. Ich verstand nicht, warum er sich so benahm. Aber ich war verletzt und ging daher nicht zu meiner Mutter. Stattdessen trat ich aus dem Haus und setzte mich auf unsere kleine schiefe Veranda.
Es war schon dunkel. Im Oktober war es immer dunkel, wenn Vater nach Hause kam. Ich schaute auf und war überrascht, wie viele Sterne da oben waren. Es schien so, als ob plötzlich tausende dort aufgetaucht waren, wo vorher überhaupt keine gewesen waren. Sie überzogen den Himmel mit einer schaumigen Gischt aus Licht, doch über der Stadt schimmerte der Nebel dicht und bleich, kauerte über allen Lampen und Lichtern, die dort unten brannten. Während ich noch hinschaute, wurde der Nebel sogar noch dichter und breitete sich aus. Er rollte über die Gassen hinweg, über die Friedhöfe und über das alte Arbeitshaus von St. Pancras. Er wallte die Camden Street entlang und floss hinüber zur Archer Street. Er bedeckte mich und verschluckte die Sterne.
Und in der Fäulnis seines gelben Umhangs hörte ich eine Glocke läuten.
Es war ein sonderbares Geräusch in diesem Nebel, gedämpft und gleichzeitig doch deutlich zu hören, sowohl weit weg als auch ganz nah. Es war ein so ungewöhnlicher Klang, dass es Vater aus der Tür hinaus zu mir trieb, und er sagte: «Guter Gott!», als er sah, wie dicht der Nebel geworden war. Er lauschte mit zur Seite geneigtem Kopf dem Läuten der Glocke. «Das ist eine Totenglocke», sagte er.
Ich wusste, was das war. Irgendwo, vielleicht Meilen entfernt, lag ein armer Kerl im Sterben. Die Glocke begleitete seine Seele ins Jenseits.
«Ein Kind», sagte Vater, der der Melodie des Geläuts lauschte.
Dann setzten die viel sagenden Schläge ein, einer für jedes Jahr, das dieser junge Mensch auf Erden verbracht hatte.
Im Innern des Hauses erhob sich die Stimme meiner Mutter zu einem schrillen Trällern. «Es bringt kein Glück, wenn man eine Totenglocke hört», sagte sie.
«Aber auch kein Unglück», murmelte Vater neben mir. Doch ich verspürte eine Kälte, während die Glocke weiter schlug – elf, zwölf, und dann nur noch zwei weitere Schläge. Das Kind, das starb, war genauso alt wie ich.
«Unglück!», kreischte meine Mutter. «Das bringt Unglück!»
Und sie sollte Recht behalten.
Zweites KapitelIch begebe mich in Gefahr undfinde einen Schatz
Am Morgen kamen sie meinen Vater holen. Zwei bullige Männer, so dick wie Baumstümpfe, hielten ihn in ihrer Mitte, marschierten mit ihm die Stufen hinunter und in den Nebel hinein. Seine Ellbogen fest im Griff, so führten sie ihn ins Schuldgefängnis.
Meine Mutter jammerte. Sie versuchte, die Männer an der Tür aufzuhalten, bebte in ihren schwarzen Gewändern. Doch die Männer stießen sie so grob zur Seite, dass mein Vater vor Zorn aufbrüllte: «Nehmt eure dreckigen Finger weg von ihr!» Er kämpfte einen Moment lang gegen ihren Griff an, bis er merkte, dass es sinnlos war. Dann schaute er zurück, während ihn die Männer auf die Straße führten.
«Wir sind noch nicht geschlagen», sagte er. «Wir werden diesen Sturm überstehen, wie wir alle anderen überstanden haben.»
«Sag mir, was ich tun soll», bat ich.
Er verrenkte seinen Hals so sehr, dass sein Kinn auf seiner Schulter lag. «Du musst Geld auftreiben, Tom», sagte er zu mir.
«Aber wie?», rief ich. «Wie, Vater?»
Schon wurde er grau im Nebel. Er hatte keine Antwort. Meine Mutter klammerte sich schluchzend an mich. «Es war die Totenglocke!», schrie sie. «Es war die Totenglocke!»
«Nein!», rief mein Vater, kaum mehr zu sehen, uns zu. «Du siehst jetzt, Tom – so weit kommt es, wenn man Kakerlaken zertrampelt.»
Ich dachte, er machte einen Scherz. Ich dachte, er war so tapfer, dass er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Gefängnis ging. Aber in Wahrheit sprach er von sich selbst, wie ich gleich erfahren sollte. Denn sobald er gänzlich in jenem schrecklichen Nebel verschwunden war – mit einer letzten Schimpftirade von den beiden Männern und dem schwächer werdenden Hufgeklapper des Lastpferdes –, tauchte ein anderer Mann auf.
Zuerst kam seine Stimme – «Ahoi im Haus!» – und mehr war nicht nötig, um uns wissen zu lassen, wer es war. Nur einer sprach diese Worte mit solch einer Stimme.
Aus dem Nebel trat Mr. Goodfellow. Er war makellos gekleidet, trug einen hohen Hut und einen Umhang. Ersteren schob er keck nach oben und letzteren schwang er nach hinten, während er die Stufen zu unserer Haustür emporkam. «Guten Tag, Mrs. Tin», sagte er und nickte ihr zu. Mich beachtete er gar nicht.
«Was haben Sie uns nun angetan?», fragte meine Mutter.
«Aber, aber, Madam, ist das nicht ein bisschen voreilig?», gab er zurück. «Ich bin nur hier, um zu helfen.»
Sie sprang ihn an. Mit gekrümmten Fingern und einem Knurren in der Kehle war sie über ihm wie ein Panther. Aber Mr. Goodfellow erwehrte sich ihrer mit Leichtigkeit. Er war ein starker Mann. Er war größer und stärker und reicher als ich oder mein Vater. Er war uns in allen Dingen überlegen.
«Hören Sie mir jetzt zu», sagte Mr. Goodfellow. Er hielt meine Mutter an ihren Handgelenken fest und sie sank zu seinen Füßen zusammen, sank mit den Knien auf den Boden. «Ich habe es auf mich genommen, Mr. Tins Schulden zu konsolidieren. Ich bin nun sein einziger Gläubiger, und es ist eine unbedeutende Summe, die er mir schuldet.»
«Wie viel?», wollte ich wissen. Er gab keine Antwort.
«Wie viel?», fragte meine Mutter.
«Neununddreißig Pfund», erwiderte er. «Neununddreißig Pfund und einen halben Penny, um genau zu sein. Aber das Kleingeld werde ich Ihnen erlassen.»
Die «unbedeutende Summe», von der er sprach, kam mir wie das Lösegeld für einen König vor. Allein der halbe Penny würde mir eine Pastete oder ein Glas kalte Limonade bescheren. Neununddreißig Pfund war eine Summe, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte.
«Eine Kleinigkeit», sagte Mr. Goodfellow wegwerfend. «Wie auch immer, ich bin bereit, den gesamten Betrag zu erlassen, wenn Mr. Tin zustimmt, für Goodfellow & Co. zu arbeiten.»
«Ist es das, was Sie wollen?», fragte ich ihn. «Ist das der Grund, warum Sie uns seit Jahren wie ein Bluthund auf den Fersen sind? Damit Sie meinen Vater dazu bewegen können, auf einem Ihrer Seelenverkäufer anzuheuern?»
Er schaute mich an und dann wieder weg. Ich war ihm keinen zweiten Blick wert.
Immer noch auf den Knien liegend, schaute meine Mutter zu ihm hoch. Ihr Gesicht war einmal hübsch gewesen, aber seit Kittys Tod hatte es nicht mehr die Sonne gesehen, und nun schimmerte es grau wie Asche. «Wie können Sie es wagen, Sir?», flüsterte sie. «Hatten Sie nicht den Mut, herzukommen, als er noch hier war?»
«Madam …», sagte er.
«Wir können Sie es wagen?», sagte meine Mutter noch einmal, doch ihrer Stimme fehlte jegliches Feuer. Sie schaffte es, etwas von ihrer Würde zusammenzuraffen, und stand auf. Neben ihm wirkte sie klein und schmächtig. «Sie haben uns ruiniert, Sir», sagte sie. «Und nur aus Rache, aus verletztem Stolz.»
«Das Warum und Weshalb geht nur mich und Mr. Tin etwas an», gab er zurück. «Aber lassen Sie mich eins sagen, Madam: Sie werden wahrhaftig ruiniert sein, falls Ihr Mann nicht auf meine Bedingungen eingeht.»
Wieder tippte er sich an den Hut und schob sich zur Tür hinaus. Ich schluckte und schaute ihn direkt an. «Ich werde gehen», sagte ich.
«Nein!», schrie meine Mutter.
Aber ich beachtete sie nicht. «Ich werde an meines Vaters Stelle gehen», sagte ich zu ihm und zitterte angesichts meines Muts. Ich hatte Angst, ich würde ohnmächtig werden, falls er mein Angebot annehmen würde. Als er mich anschaute, fand ich mich innerlich bereits mit einem kurzen Leben und einem frühen Tod auf See ab.
Aber seine einzige Antwort war Gelächter, ein herzhaftes Gelächter, das seinen ganzen Körper schüttelte und diese kalten Augen zum Zwinkern brachte.
Es war schlimmer, als wenn er rundheraus abgelehnt hätte. Ich hatte ihm mein Leben angeboten, und es versetzte mich in Zorn, dass er es so gering schätzte.
«Ich bestehe darauf», sagte ich.
Er lachte noch lauter. «Oh, du bestehst darauf», sagte er und kicherte. «Ich brauche einen Mann, mein junger Freund. Du meine Güte, du würdest keinen Tag auf See überstehen, nicht einmal eine Stunde. Du gehörst zu Mr. Poppery, Junge. Ich habe dafür gesorgt, dass dein Unterricht dort für ein Jahr bezahlt ist. Der Betrag ist bereits zu den Schulden deines Vaters addiert.»
Ich drehte mich um und lief davon. Aufgefressen von Scham und Hass, konnte ich es nicht ertragen, dem Mann noch eine Sekunde länger ins Gesicht zu schauen. Ich zog mich ins Wohnzimmer zurück, kroch durch die Diele wie eine von den Kakerlaken, die ich von hier vertrieben hatte. Ich vernahm Mr. Goodfellows Lachen und dann seine Stimme, als er meiner Mutter sagte: «Ich erwarte, umgehend von Ihnen zu hören.» Die Tür schloss sich, und ich hörte seine eleganten Lederstiefel leise auf das Pflaster klatschen, während sie ihn durch den Nebel trugen.
Meine Mutter folgte mir ins Wohnzimmer. Ich betrachtete die wenigen Kleinigkeiten, die wir besaßen, aber in Wahrheit sah ich jene, die nicht mehr da waren. Das Schwert, das mein Vater von einem sich ergebenden Franzosen entgegengenommen hatte; wo war das geblieben? Seine Orden waren weg und auch sein bester Hut mit der Borte. Seine Seekarten, seine Gerätschaften, seine Seehandbücher – alles war verschwunden. Zum ersten Mal fragte ich mich, woher die Pennys für die Brückenmaut gekommen waren. Und dann dachte ich an meine Schulausbildung. Ich stöhnte auf. Warum hatte ich nicht bemerkt, was vor sich ging? Mein Vater hatte zusammen mit fast allem, was er besaß, auch sich selbst verkauft.
«Es ist jeden Preis wert, wenn du nur nicht zur See fahren musst», sagte meine Mutter, als hätte sie meine Gedanken gelesen. «Ich hätte niemals einen Seemann heiraten sollen, und ich werde nicht dulden, dass mein Sohn einer wird. Du sollst ein Gentleman werden, Tom.»
Ich erkannte, wie groß die Verzweiflung war, die uns ein solches Schicksal beschert hatte, und ich schwor mir, dass ich die Dinge in Ordnung bringen würde. Ich marschierte in die Diele. Ich zog meine Schuhe an, meine guten, glänzenden Schuhe, für die mein Vater womöglich seinen Sextanten hergegeben hatte.
«Wohin gehst du?», wollte meine Mutter wissen.
Ich bückte mich, um die Schnürsenkel zu binden. Sie waren ausgefranst und dort, wo sie gerissen waren, verknotet, und in solch schönen Schuhen boten sie einen erbärmlichen und schäbigen Anblick. Das Geld, mit dem ich neue Schnürsenkel hätte kaufen sollen, hatte ich für Süßigkeiten ausgegeben.
«Sag mir, wohin du gehst», verlangte sie. «Zur See? Tom, du wirst doch nicht weglaufen und zur See fahren, nicht wahr?» Meine Mutter packte mich am Arm. «Dort gibt es für dich keine Zukunft; nur der Tod erwartet dich auf See.»
«Lass mich los», sagte ich und entwand mich mühelos ihrem Griff. «Ich muss eine Rechnung begleichen.»
Ich hatte keine Ahnung, was ich tun oder wohin ich gehen sollte. Aber ich war entschlossen, meinen Vater nicht im Schuldgefängnis hocken zu lassen. Ich nahm meinen Mantel vom Haken. Dann – ich weiß nicht, warum – hängte ich ihn wieder hin und nahm stattdessen den meines Vaters. Vielleicht dachte ich, dass mich sein Mantel zum Mann machen würde. Vielleicht wollte ich, dass er mich festhielt, und da seine wirklichen Arme nicht da waren, würde ich mich in die wollenen Ärmel wickeln müssen, die so sehr nach ihm rochen.
Ich zog den Mantel über; ich öffnete die Tür.
Meine Mutter versuchte, sie mir vor der Nase zuzuschlagen. «Tom, geh nicht», sagte sie.
«Mutter, bitte.» Ich schob sie zur Seite und trat hinaus auf die Veranda.
«Mein Sohn wird nicht zur See fahren», sagte sie. «Tom, wenn du jetzt weggehst, dann habe ich keinen Sohn mehr.»
«Bitte mach dir keine Sorgen», sagte ich zu ihr. Ich küsste sie auf die Wange und ging dann eilig weg, bevor mich mein Mut verlassen und ich meine Meinung ändern würde. Ich rannte in den Nebel hinein und ihre Schreie begleiteten mich.
«Ich habe keinen Sohn!», kreischte sie mit der Stimme einer Wahnsinnigen. «Hörst du mich? Ich habe keinen Sohn!»
Ich rannte so schnell und so weit ich konnte. Ich rannte, obwohl sich meine Rippen anfühlten, als wären sie zusammengenäht, und obwohl meine Lunge pfiff. Von einer Straße in die nächste, durch einen Kirchhof und ein Feld rannte ich, immer weiter. Ich kam an geisterhaften Häusern vorbei, geisterhaften Bäumen, keuchte und hustete Schleim aus meiner Kehle, dick und gelb, als ob es kleine Nebelbrocken wären, die ich da aus meinem Körper würgte.
Ich kannte den Weg nach London nur von Surrey aus, kannte das Panorama von Türmen und Kuppeln am weiten Bogen der Themse. Von Norden her kommend, so blind, dass ich kaum dreißig Schritte weit sehen konnte, hatte ich keine Ahnung, wohin ich lief.
Die Straßen schlängelten sich, machten Kehrtwendungen oder hörten einfach ganz auf. Überall waren Menschen und Karren und Kutschen, und es wurden immer mehr, je weiter ich kam. Manchmal war die Straße über die gesamte Breite völlig verstopft. Alles um mich herum tauchte langsam auf und verblasste langsam wieder, als ob ich in eine Stadt voller Geister geraten wäre, ein versunkenes Atlantis, eingehüllt in einen wässrigen Nebel. Aus dem Dämmerlicht und den Schatten streckten sich mir die Hände von unzähligen, unheimlich wirkenden Hausierern entgegen, die ihre Waren verkaufen wollten. Kneifer wurden mir angeboten und Muscheln, Vogelnester und Kohle, Schwämme, Löffel und eine Klarinette. Ich stolperte durch einen Markt voller Straßenverkäufer, von denen jeder lautstark anpries, was er unter die Leute bringen wollte. Es war solch ein sinnloses Gebrabbel und Getöse aus «Fisch!» und «Kartoffeln!» und «Schnecken!» und «Heißer Aal!», dass mir die Ohren davon dröhnten.
Aber der Geruch von Essen war überwältigend und verführerisch. Ich blieb mitten in der Menge stehen und tastete in den Taschen von meines Vaters Mantel, in der Hoffnung, eine Münze darin zu finden. Aber alles, was ich herauszog, war eine Hand voll Kohlestifte, die mit den spitzen Enden nach unten in einer kleinen Blechdose steckten. Ich starrte meinen Fund einen Moment lang an, und plötzlich merkte ich, wie mir die Tränen in den Augen brannten. Ein Bild stieg vor mir auf, so klar wie ein Sonnentag. Mein Vater, der genau auf dieser Straße stand und seine kostbaren Stifte verkaufte, damit ich zur Schule gehen konnte.
Etwa eine Minute, oder sogar noch länger, stand ich in der wirbelnden Masse aus Menschen und Wagen. Beinahe hätte mich die Trauer niedergedrückt, und wenn Mr. Goodfellow in dieser Sekunde neben mir aufgetaucht wäre, hätte ich ihm diese Kohlestifte durch seinen Mantel gestoßen, direkt in die Brust und in sein schwarzes Herz hinein. Und dann zuckte eine Hand vor und stahl die Stifte. Eine andere, vielleicht auch dieselbe, bemächtigte sich der Blechdose.
Das wäre beinahe mein Ende gewesen. Ich hätte mich umgehend auf den Weg nach Hause gemacht, wenn ich gewusst hätte, wohin ich gehen musste. Aber in dem Getümmel hatte ich mich ein paar Mal um die eigene Achse gedreht, und ich wusste Westen nicht mehr von Osten zu unterscheiden und kaum noch oben von unten. Ich versuchte, einen Händler aufzuhalten, der an mir vorbeiging, und fragte ihn nach dem Weg, aber er klapperte unbeirrt mit seinem kleinen Karren und seinem winzigen Esel weiter und rief: «Kauft! Kauft! Kauft! Kauft Hauben! Kauft Schnürsenkel!»
Ich versuchte es mit einem anderen Labyrinth aus Straßen, vorbei an einer anderen Ladenzeile. Dann erreichte ich plötzlich ein paar Stufen und an ihrem Fuß war das schlammige Ufer der Themse. Wie ein Blinder umhertappend, hatte ich die Innenstadt hinter mir gelassen.
Ich setzte mich auf die oberste Steinstufe. Mir war kalt, ich hatte Hunger und fühlte mich furchtbar allein. Ich beschloss, darauf zu warten, dass der Nebel sich lichten würde. Ich zog mir den Mantelkragen eng um den Hals, ballte die Hände unter den Ärmelaufschlägen zusammen und schaute einem alten Mann zu, der unter mir durch den Schlamm watete. Sein Haar war grau, seine Haut faltig, und er war blind. Seine Augen waren mit einem schwarzen Tuch verbunden, das hinter seinem Kopf zusammengeknotet war. Die langen Enden hingen auf seine Schultern hinab. Auf seinem Rücken hatte er eine zerbeulte und zerschlissene Tasche, die unten mit Schlamm verkrustet war, als hätte er sie wohl hunderttausend Mal abgesetzt und wieder hochgehoben. Er hatte einen Stab mit einem Haken am Ende bei sich, mit dem er im Schlamm herumstocherte. Ich hörte das schlürfende, saugende Geräusch, wenn er den Stab herauszog.
Ich war an den Anblick der Schlammplantscher gewöhnt, die die Ufer nach Knochenresten, Glas und Eisen durchkämmten, nach allem, was man verkaufen konnte. Aber es waren immer nur Kinder gewesen. Ich hatte noch nie einen alten, blinden Mann dieses Spiel spielen sehen.
Und er beherrschte das Spiel ausgezeichnet. Er ging einen Schritt vor und stocherte, ging vor und stocherte, wie ein riesiger, zerzauster Reiher. Seine Füße waren nackt und seine Hosenbeine hatte er bis zu den Knien hochgerollt. Sein langer Mantel schleifte auf dem Schlick, strich hinter ihm den durch seinen Stab aufgerissenen Boden wieder glatt.
Plötzlich bückte er sich. Die Tasche fiel von seinem Rücken. Seine Hände gruben sich in den Schlamm, bis zu den Handgelenken, dann bis zu den Ellbogen. Er buddelte wie ein Hund, warf sich den Dreck gegen die Beine und den Mantel. Er zog einen schwarzen Klumpen heraus, der kleiner und kleiner wurde, je mehr Schlamm der Blinde abschüttelte, bis nichts weiter als eine kleine Scheibe übrig geblieben war – eine Münze, die er zwischen die Zähne schob und mit einem festen Biss prüfte. Dann wanderte das Geldstück in den Sack und er stand auf, um von neuem zu beginnen.
Da beneidete ich ihn, auch wenn er alt und blind war. Ich zog meine Schuhe aus, wobei ich an den verknoteten Schnürsenkeln herumfummelte. Ich schälte meine Socken von den Füßen und stopfte sie in die Schuhe. Ich band beide Schuhe an den Schnürsenkeln zusammen, hängte sie mir um den Nacken und stieg dann die Stufen hinab.
Die Steine waren bitterkalt und der Schlamm sogar noch kälter. Er war so dick wie Sirup und scheinbar bodenlos. Mein Fuß verschwand völlig. Jeder Schritt war ein einziger Kampf, und ich schaffte nur etwa ein halbes Dutzend, dann hatte mich der Schlick gepackt und hielt mich fest wie Kleister. Ich wäre beinahe vornübergefallen, schrie auf und versuchte, mein Gleichgewicht zu halten.
Der Kopf des blinden Mannes ruckte nach oben. «Wer ist da?», fragte er mit einer rauen, krächzenden Stimme, die ihn noch mehr wie einen Vogel wirken ließ – aber nun ähnelte er eher einer Krähe, und nicht mehr einem staksenden Reiher.
Sein scharfes Gehör und seine zerlumpten Kleider, die Art, wie er den Kopf von rechts nach links schwang, um zu lauschen – das alles ängstigte mich. Umgeben vom Nebel, mit den Füßen im Schlamm, den Fluss neben mir, befand ich mich an dem einsamsten Ort der ganzen Welt. Die Stadt war nur noch ein gedämpftes Brummen aus Stimmen, eine Ansammlung von verschwommenen Formen und Konturen, die sich über den mit Unkraut bedeckten Steinen und Stufen erhob. Der Fluss lag da wie ein dunkles Band, das ins Gelbliche verblasste. Er kroch auf mich zu, ich sah es genau, während ich mit angehaltenem Atem da stand. Er leckte über den Schlamm, um die flachen Erhebungen der Muscheln herum. Er streckte sich, schob Krallenfinger vor, die mit erstaunlicher Geschwindigkeit durch die Rillen und Vertiefungen im Schlick auf mich zugerast kamen.
Das Wasser ängstigte mich noch mehr als der blinde Mann. Ich stellte mir vor, dass ich hier feststecken würde, im Schlamm gefangen wie ein Käfer auf frischer Farbe, während der Fluss stieg und stieg und über meinem Kopf zusammenschlug. Ich sah mich selbst unter Wasser, sah mich in der Strömung hin und her wiegen, die Arme sich windend über dem Kopf.
Die Angst gewann die Oberhand. Ich beschloss, dass nichts, was sich in dem Schlamm verbergen mochte, es wert war, hier zu stehen und zuzusehen, wie das Wasser meine Füße umspülte. Mit der verzweifelten Anstrengung, wieder zum Ufer zu gelangen, drehte ich mich unbeholfen um und stand dem blinden Mann gegenüber. In diesem dicken Schlamm konnte man nicht rennen, daher versuchte ich, mich so leise wie möglich zu bewegen. Aber der schwarze Schlick küsste schmatzend meine Schienbeine und meine Fußgelenke. Meine Schuhe, die an den Schnürsenkeln um meinen Nacken hingen, schlugen gegen meinen Mantel.
«Wer ist da?», fragte der blinde Mann wieder. «Das hier ist mein Teil des Flusses. Was hier liegt, gehört mir.»
Sein Gesicht war mir nun direkt zugewandt. Er schob den Stock in den Boden, hob sein Knie und fing dann an zu laufen, so geschickt wie ein schlüpfriger Aal. Mit klatschenden und saugenden Geräuschen kam er auf mich zu, glitt so flink wie ein Rinnsal am Ufer entlang.
Ich machte noch einen Schritt. Plötzlich packte mich die Furcht, dass der Nebel sich verdichten und die Stufen verbergen könnte, die mir Rettung versprachen. Ich versuchte, mich vorwärts zu kämpfen, fiel aber lediglich nach hinten. Und der blinde Mann kam näher.
Mit den Händen hob ich meine Beine an, zerrte mit den Fingern an den hochgeschobenen Falten meiner Hosenbeine. Ich zog und machte einen Schritt, dann schrie ich vor Überraschung und Schmerz auf, denn ich war auf etwas getreten, das so scharf war wie ein Messer. Ich taumelte zur Seite und brach in die Knie.
«Raus aus meinem Fluss!», rief der Mann mit seiner krächzenden Stimme. Er kam weiter durch den Schlamm gelaufen.
Mein Knöchel war schmerzhaft verdreht. Ich tastete am Beinknochen entlang, über die Haut, die jetzt dreckverkrustet war, bis zu meinem Fußgelenk. Dann fühlte ich nach dem Ding, auf das ich getreten war, etwas Hartes und Scharfkantiges. Es füllte beinahe meine Faust aus, als sich meine Hand darum schloss und es herauszog.
Ich traute meinen Augen nicht. Halb umschlossen von meinen Fingern, bedeckt von Dreckbrocken, lag ein Diamant. Es war womöglich der größte Diamant, den die Welt je gesehen hatte. Das gelbliche Licht des Nebels verfing sich in dem Stein und er fing an, golden zu glühen. Mein Herz hüpfte vor Freude bei dem Anblick.
Und dann war der Blinde über mir.
Drittes KapitelDer Lumpensammler und seindreibeiniger Gaul
Der blinde Mann warf mich nieder. Ich fiel flach auf den Rücken, und er sprang auf meinen Brustkorb, umklammerte ihn mit seinen Knien. Wir rangen im Uferschlamm, während das Wasser immer näher kam. Die Finger des blinden Mannes grabschten nach meinem Bein, dann nach meinem Arm.
«Was hast du genommen?», krächzte er. «Gib es mir! Es gehört mir!»
Ich versuchte, mich unter ihm hervorzuwinden. Ich trat mit beiden Beinen um mich und schlug mit einer Hand zu, aber mit der anderen hielt ich den Diamanten umklammert, so fest ich nur konnte.
«Du Teufel», sagte er. «Du Dieb.»
Ich legte all meine Kraft in einen einzigen Schlag. Ich warf mich dem Blinden entgegen und er kippte zur Seite. Er ließ meinen Arm los, fiel aber nicht hin. Stattdessen fuhren mir seine Hände an die Kehle. Er bekam die Schuhe zu fassen und dann die Schnürsenkel, und schon im nächsten Moment zog er sie um meinen Hals zusammen.
Die Schnüre schnitten in meine Haut, die kleinen Knoten drückten sich in meine Sehnen, zwängten meine Kehle ein. Ich schaute in das Gesicht des blinden Mannes, in einen Mund voller verfaulter Zähne, der mich unter der Bandage vor seinen Augen anknurrte. Ich sah meine eigene Hand auf seine Schulter eindreschen, als ob sie nicht mir, sondern einem Fremden gehörte. Mir war so, als ob der Nebel sich rot verfärbte, als ob helle Sterne und schwarze Flecken darin herumwirbeln würden. Aber immer noch hielt ich den Diamanten fest.
Der Blinde zog die Schnüre fester und fester. Ich konnte nicht einatmen und ich konnte nicht ausatmen. Ich konnte mich auch nicht mehr wehren. Der ansteigende Fluss leckte an meinen Füßen und ergoss sich dann in den ausgehöhlten Schlamm und umspülte meinen ganzen Körper. Er kühlte meine Beine, meinen Rücken, meine Schultern, und mit einem Mal verwandelte sich meine Angst in reine Panik.
Alles vor meinen Augen verwandelte sich in Rot und Grau und dann in Schwarz. Ich fühlte, wie meine Hände an meinen Seiten herabfielen. Dann hörte ich ein knackendes Geräusch, das mir so laut wie ein Schuss vorkam. Ich war sicher, dass in meinem Körper eine Ader geplatzt war, und ich war fast froh, dass alles gleich vorbei sein würde.
Aber der Blinde stieß ein paar der übelsten Flüche aus. Ich sah, wie die Welt wieder hell wurde, und fühlte meinen Atem wieder in meinen Körper und aus ihm heraus strömen. Meine Lungen pumpten wie der Blasebalg eines Schmieds. Ich konnte auch den blinden Mann wieder erkennen, hässlicher und schlammbespritzter als zuvor. In seinen Händen hielt er meine Schuhe, von denen die zerrissenen Enden der Schnürsenkel herabhingen. Unzählige Male verknotet und ausgefranst, hatten sie das Zerren und Ziehen nicht ausgehalten.
Ich hob den Diamanten in meiner Hand, ließ ihn so kraftvoll und schnell herabsausen, wie ich nur konnte, und schlug damit dem blinden Mann auf den Hinterkopf. Schwarzer Speichel spritzte aus seinem Mund.