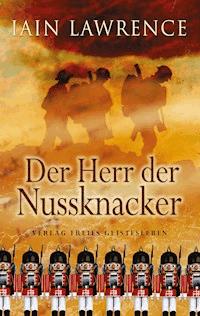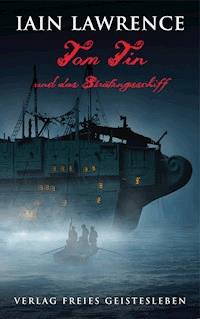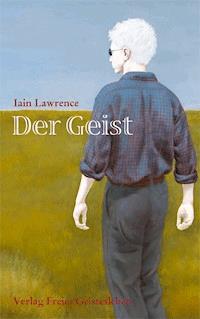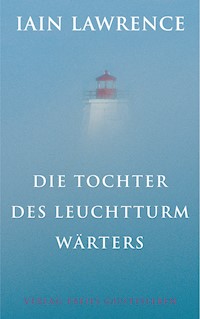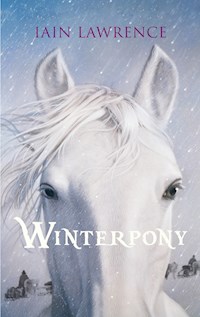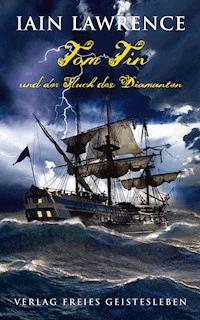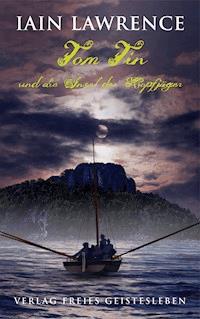
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Tom Tin
- Sprache: Deutsch
Tom Tin und sein Freund Midge wagen die Flucht in die Inselwelt Neuguineas. Was sie dort erwartet, ist alles andere als das Paradies, das Midgeaus den Schilderungen des Pfarrers in seinem Lieblingsbuch kennt. Und alles deutet darauf hin, dass der Fluch des Jolly-Diamanten seine Finder Tom Tin in weitere grausige Abenteuer stürzen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iain Lawrence
Tom Tinund die Insel der Kopfjäger
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst
Für meinen großen Bruder Hamishund seine Familie: Danielle, Andrew, Iain und Lisa.
Ich wünschte, ihr wärt nicht so weit weg.
Inhalt
1. Das Kap der Stürme
2. Wir planen unsere Flucht
3. Ein gespenstischer Besuch
4. Im Meer
5. Das Langboot erleidet Schiffbruch
6. Eine Gestalt in Grün
7. Mr. Mullocks Gerechtigkeit
8. Die Geschichte eines toten Mannes
9. Ich erforsche die Höhlen
10. Mr. Mullocks größte Angst
11. Earlys Erinnerung kehrt zurück
12. Eine Meinungsverschiedenheit
13. Etwas Schreckliches passiert
14. Im Reich der Drachen
15. Das Schicksal von Croc Adams
16. Die Kopfjäger greifen an
17. Wir sitzen in der Falle
18. Die Dame in den Bäumen
19. Nachricht von Redman Tin
20. Unsere Begegnung mit den Eingeborenen
21. Mr. Mullocks geheimnisvolle Vergangenheit
22. Wir nehmen Abschied
23. Eine schicksalhafte Entscheidung
24. «Sie sind alle tot, oder?»
25. Der Festschmaus der Kannibalen
26. Die dritte Gefahr
Epilog
Anmerkung des Autors
Danksagung
Glossar
Erstes Kapitel
Das Kap der Stürme
Während wir nach Australien segelten, lernte ich meinen Vater kennen. Zunächst schien er mir ein anderer Mann zu sein. Sein Gesicht war sonnenverbrannt und strahlte, und stets waren die kleinen Lachfältchen um seine Augen zu sehen. Verschwunden waren Müdigkeit und Trübsinn, und er kam mir viel jünger vor. Aber in Wirklichkeit hatte er sich nicht verändert. Ich hatte nur vergessen, wie er früher gewesen war. Mit dem Kommando über dieses Schiff hatte er auch wieder sein altes Ich angenommen und war zu dem Mann geworden, den ich in meiner Kindheit gekannt hatte.
Ich gewann ihn wieder so lieb wie früher und ich sah, dass er meine Zuneigung erwiderte, allerdings nicht so, wie ich es mir wünschte. Mein Vater bemerkte zwar, dass ich auf dem Sträflingsschiff dünn und blass geworden war; dass ich durch diese Zeit auch innerlich stärker geworden war, entging ihm dagegen. Und so nahm er sich vor, mich zu beschützen, und seine Sorge um mich ging so weit, dass sie uns schließlich ins Verderben führte.
Fünf Monate, nachdem wir England hinter uns gelassen hatten, umrundeten wir das Kap der Guten Hoffnung. Besser gesagt, wir umstürmten es, inmitten von rasenden Winden und mannshohen Wellenklippen. Aber ich sah nichts davon außer einem kleinen Flecken Himmel und schemenhaften Segeln durch die ausgefransten Löcher in einer alten Persenning.
Die Wirren des Schicksals hatten dafür gesorgt, dass mein Vater zu meinem Kerkermeister geworden war, und nun segelte er mit mir über die Meere, in einem Schiff, das einstmals Sklaven verschleppt hatte. Er war der Kapitän, und ich war ein Sträfling.
Mit sechzig Leidensgenossen war ich in dem dunklen, bebenden Bauch des Schiffes eingepfercht. Der Wind heulte und zerrte an der Persenning, die die Luke abdeckte. Ganze Wellenberge kamen durch die Gräting geschossen, und für jeden Tropfen Wasser, der durch die Decknähte sickerte, strömte ein ganzer Eimer voll durch die Planken.
Mir wurde klar, dass ich meine alte Furcht vor dem Meer noch nicht niedergerungen hatte. Neun Tage lang lag ich sterbenskrank – so schien es mir – auf meiner hölzernen Pritsche und wünschte mir beinahe, das Schiff würde untergehen, hatte aber gleichzeitig Todesangst davor. Ich klammerte mich an die Eisenringe, an denen die Sklaven angekettet gewesen waren, und lauschte dem Ozean, der auf den Rumpf einhämmerte. Wenn Midgely nicht gewesen wäre, wäre ich so wahnsinnig geworden wie meine arme Mutter. Er war klein – jung und schmächtig – und auf beiden Augen blind. Aber er wich mir nicht von der Seite, der liebe Midge.
Nachdem wir das Kap hinter uns gelassen hatten, klarte das Wetter auf. Die Luken wurden geöffnet und wir stiegen zu einem sonnigen Morgen empor.
Mein Vater war viel zu weichherzig für einen Kerkermeister. Vielleicht hatte ihm die Zeit, die er selbst im Schuldgefängnis verbracht hatte, verdeutlicht, welches Elend es bedeutete, seiner Freiheit beraubt zu sein. Bei schönem Wetter erlaubte er uns stets, uns ungehindert an Deck zu bewegen. Er ließ es zu, dass uns die Mannschaft mit Geschichten von dem Leben auf See unterhielt, und von Zeit zu Zeit durfte der Fiedler zum Tanz aufspielen. Unser Gefängnis war nicht das Schiff, sondern das Meer.
An diesem Tag drängelten wir uns so dicht wie Vieh auf dem engen Raum zwischen den zwei Masten. Die Seeleute zurrten die Taue um die Haufen aus Planken und Latten wieder fest. Andere arbeiteten hoch oben in der Takelage, aber mir wurde schon schwindelig, wenn ich nur in die Höhe blickte, um ihnen zuzuschauen. Jedes verfügbare Stück Leinwand war gesetzt und die Brigg machte unter ihren Türmen aus Segeln gute Fahrt. Die Luft war heiß. Dampf stieg von den nassen Deckplanken auf, von den Segeln und der Takelung.
Ein Seemann holte Midge und mich, scheuchte uns das Achterdeck hinauf und dann hinunter in die Kabine, wo mein Vater uns erwartete. Er stand vor den großen Fenstern, die dorthin blickten, wo das Schiff eben noch gewesen war. Unser silbriges Kielwasser schlängelte sich über die Wellen wie eine Schneckenspur.
«Guten Morgen, Captain Tin», rief Midgely.
Mein Vater drehte sich um und begrüßte uns mit einem breiten Lächeln. «Guten Morgen, William», sagte er. Er war der Einzige, der Midgely mit seinem Vornamen ansprach. Seine Hand fiel auf meine Schulter. «Geht’s dir gut, Tom?», fragte er.
Ich nickte.
«Du hast den Sturm überstanden, wie ich sehe.»
«Oh ja, Sir», sagte Midge. «Das war ein ganz schön wilder Sturm, was?»
Mein Vater lächelte weiter. «Setzt euch, Jungs», sagte er und deutete auf seine Koje.
Ich nahm Midge bei der Hand und führte ihn hin. Er konnte kaum etwas sehen, besonders dann nicht, wenn er vom hellen Sonnenlicht in den Schatten kam. Aber trotzdem schüttelte er mich ab und ging geradewegs zu meines Vaters Koje, wobei er sowohl dem Tisch als auch dem Stuhl auswich. Während der etwa ein Dutzend Besuche hier hatte er die Kajüte gut kennengelernt. Als ich neben ihm auf die Bettstatt kletterte, kam mir die Weichheit der Matratze wie der Gipfel an Luxus vor.
«Was möchtet ihr haben?», fragte mein Vater. «Käse? Brot und Marmelade?» Er bot uns immer etwas an, und immer lehnten wir ab.
Ich kam gleich zur Sache. «Vater, wir haben einen Plan», sagte ich.
Er stand da und hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt. Die See neigte sich und klatschte an den Fenstern vorbei, und er wiegte sich im Rhythmus des Schiffs von einer Seite zur anderen. Die Bewegungen drehten mir den Magen um.
«Wir wollen fliehen», sagte ich.
Mein Vater schaute uns überrascht an. Einen Moment lang stand ihm der Mund weit offen. Dann drang ein herzliches Lachen daraus hervor. «Fliehen?», fragte er. Er deutete auf die unendliche Weite des Ozeans. «Wohin denn?»
Midgely antwortete ihm. «Zu einer Insel in der Nähe von Tetakari, Sir.»
«Wo zum Teufel ist das denn?»
«Südöstlich von Borneo», erklärte Midge, «aber nicht so weit wie Java.»
Mein Vater runzelte die Stirn. Er ging quer durch die Kajüte zu seinem Tisch und griff dann hinauf zum obersten Regalbrett. Dort bewahrte er seine Seekarten auf, zu Röhren zusammengerollt, und während er sie durchsah, sagte er zu uns: «Ich habe noch nie von einer Insel dieses Namens gehört.»
«Nun, da gibt es eine Insel in der Nähe, die so aussieht wie ein Elefant», sagte Midge. «Die Klippen und die Bäume, die sehen so aus wie der Kopf des Elefanten. Da gibt es einen Sandstrand und Kokosnüsse und Brotfrüchte. Das stand alles in dem Buch. Fragen Sie Tom, Sir. Fragen Sie ihn und Sie werden sehen, dass es stimmt.»
Mein Vater kramte durch seine Seekarten. «Nun, manchmal stehen in Büchern auch einfach nur Geschichten, die sich der Schriftsteller ausgedacht hat. Nichts als Unsinn.»
«Aber dieses Buch hat ein Pfarrer geschrieben», sagte Midge.
Mein Vater schenkte ihm ein Lächeln. Wie jeder Mann an Bord, so vergötterte auch er den kleinen Midge. Mein Freund hätte genauso gut die Schiffskatze sein können, gemessen an den zahlreichen Tätscheleien und Streicheleinheiten und an den Süßigkeiten, die ihm zugesteckt wurden. «Dann lass uns mal sehen, ob wir deine Elefanteninsel finden», sagte er.
Er zog eine Karte aus dem Stapel, rollte sie auf und legte kleine Gewichte auf die vier Ecken. Dann stützte er seine Hände auf die Tischkante und beugte sich vor.
Ich stand neben ihm. Meine Beine waren immer noch nicht seefest geworden, und das Schiff versuchte, mich wie einen Kegel umzuwerfen. Es stieß mich vom Tisch weg und schob mich dann wieder darauf zu. In meinem Kopf drehte sich alles, während ich auf die Karte starrte.
Dort waren Hunderte von Inseln eingezeichnet, und die meisten waren so klein wie Pfefferkörner. Mit einem Mal kam mir unser Vorhaben völlig idiotisch vor. Ich weiß nicht, wie lange wir zwischen den Seiten von Midgelys Buch verbracht hatten und mit dem Verfasser von Insel zu Insel gereist waren. Besonders Midgely hatte sich während unseres Aufenthalts auf dem Sträflingsschiff immer wieder in seine Schilderungen geflüchtet. Irgendwie hatte er mich mitgenommen, weg von dem Wrack und hinein in die Zeichnungen und die Worte, auf die Inseln der Südsee. Als er geblendet worden war – als der bösartige Benjamin Penny ihm die Augen durchstochen hatte –, war Midge auf mich angewiesen gewesen. Ich musste ihm die Geschichten vorlesen und ihm die Bilder schildern. Ich hatte gedacht, ich könnte nur einen Blick auf jede beliebige Seekarte werfen und würde auf Anhieb all die Orte finden, über die wir gelesen hatten.
Aber nun schien es hoffnungslos. Wie sollten wir eine Route durch diese vielen Hundert Inseln finden, wenn ich eine nicht von der andern unterscheiden konnte?
«Hier ist Borneo», sagte mein Vater und deutete auf die Karte. Seine Finger legten sich auf eine große Insel und glitten dann über das Papier. «Und hier ist Java. Also, wenn dein Buch recht hat – und ich glaube nicht einen Augenblick daran –, dann müsste sich deine Insel irgendwo hier befinden.» Seine Hand bewegte sich spiralförmig über einer Ansammlung von Inseln. «Nun, wie ihr seht …» Plötzlich beugte er sich dichter über den Tisch. «Bei meiner Seele!», hauchte er. «Da ist es. Tetakari.»
«Sehen Sie? Ich wusste, dass es die Wahrheit ist», rief Midge. «Tom und ich können dorthin segeln. Wenn Sie uns ein Boot überlassen, können wir von Insel zu Insel segeln.»
Mein Vater schaute auf. Er wandte sich nicht zu Midge, der noch auf der Koje saß, sondern starrte mich an. «Das ist euer Plan?», fragte er. «Das habt ihr euch überlegt?»
«Ja, Sir», sagte ich so zuversichtlich, wie ich konnte.
«Nun, das ist närrisch.» Er schüttelte den Kopf. «Ich werde mich keinesfalls darauf einlassen.»
«Aber Vater, wir müssen fliehen», sagte ich zu ihm. «Alles ist verloren, wenn wir erst mal Australien erreicht haben. Man wird uns in Ketten legen und wir werden nie wieder nach Hause kommen.»
«Oh, du wirst nicht in Australien bleiben, Tom», sagte er. «Darauf kannst du dich verlassen. Glaub ja nicht, dass ich mir nicht auch Gedanken darüber gemacht habe.»
Das Schiff schlingerte über einen Wellenkamm. Ein Schatten huschte über den Tisch, und ich schaute auf zu den Fenstern und sah einen Albatross vorbeigleiten.
«Ich werde dich nach Australien bringen», sagte mein Vater, «aber ich werde dich nicht an Land gehen lassen. Ich werde rundheraus erklären, dass Mr. Goodfellow uns hereingelegt hat, dass er uns seit Jahren mit seinem Zorn verfolgt. Ich werde unseren Fall dem Gouverneur vortragen oder wer immer dafür zuständig ist, und ich werde ihm die ganze Sache erzählen.»
«Und er wird dir kein Wort glauben», sagte ich.
«Aber, aber», sagte mein Vater. «Es ist eine verzwickte Geschichte, das gebe ich zu, doch wir müssen uns darauf verlassen, dass man uns die Wahrheit abnimmt. Haben wir denn eine andere Wahl?»
«Hatten wir jemals eine Wahl?», fragte ich, woraufhin er verwirrt die Stirn runzelte.
Ich hatte am eigenen Leib erfahren, dass das Leben der Menschen allein vom Zufall bestimmt wurde. Wir alle waren nicht mehr als Zweige in einem reißenden Strom, unfähig, unseren Kurs selbst zu bestimmen, herumgewirbelt und gestoßen von den Strömungen und Strudeln des Schicksals. Den größten Teil meines Lebens war mir das Glück hold gewesen. Der Zufall wollte es, dass ich mit einem Zwilling zur Welt kam, zusammengewachsen in Fleisch und Blut an einem kleinen Stück Haut an der Schulter, so dünn, dass mein Vater uns mühelos auseinanderschneiden konnte. Ohne dass ich darauf einen Einfluss gehabt hätte, wurden wir inmitten eines Orkans geboren, und dieser Umstand bescherte mir eine immerwährende Furcht vor dem Meer. Aber derselbe Zufall sorgte dafür, dass mein Vater mich festhielt, während mein Zwilling vom Sturm weggerissen wurde. Und so ging ich zur Schule, während mein Zwilling von einem Fischer aus dem Wasser gezogen wurde und später als Gesetzloser in den Straßen von London lebte. Er wurde bekannt unter dem Namen Smasher, war Mitglied einer Bande von Straßenkindern, die von Darkey angeführt worden war, einer geheimnisvollen Frau, deren eigenes Schicksal es so gewollt hatte, dass sie am Galgen endete.
Es war mir wie der glücklichste Tag meines Lebens vorgekommen, als mich das Schicksal ans Ufer der Themse geführt hatte, wo ich den herrlichsten und größten Diamanten der Welt fand. Damals hatte ich mich wie auf dem Dach der Welt gefühlt, obwohl mein Schicksal mich in Wahrheit am Rande eines gähnenden Abgrunds balancieren ließ.
Noch am selben Tag stürzte ich ab, fiel in einen rasenden Mahlstrom. Und seitdem hatte mich diese Strömung nicht mehr losgelassen. In ihr gefangen, begegnete ich meinem Zwilling wieder. Ich lernte den alten Worms kennen, einen Leichenräuber, der mich zum Grab meines Zwillings führte, hinunter in die Erde, wo sein verwesender Körper lag, und als ich wieder aus der Grube stieg, war ich er geworden. Immer im Kreis herum wirbelte mich der Mahlstrom, immer rundherum. Mein Diamant blieb in dem leeren Grab liegen, während ich in Darkeys Hände geriet und in die Hände derjenigen, die Smasher gekannt hatten – Benjamin Penny und Gaskin Boggis. Und dann traf ich Weedle, der von Smasher so grausam entstellt worden war. Daher wusste ich genau, dass man mit dem Zufall keinen Handel treiben konnte. Aber ich hatte auch etwas anderes begriffen: Ein Mann konnte so reich und mächtig werden, dass er in der Lage war, den Verlauf des langen Schicksalsflusses umzulenken. Ein solcher Mann war Mr. Goodfellow, der dafür gesorgt hatte, dass mein Vater im Schuldgefängnis landete, und der ihn dann mit einem üblen Trick auf dieses abgetakelte Schiff gelockt hatte.
Wie seine Augen vor Gier geglitzert hatten, als er von meinem Diamanten erfuhr! Er bot mir einen Handel an: meine Freiheit für den Stein. Aber ich begehrte den Reichtum, den mir das Juwel versprach, und wollte es nicht hergeben. Und so bewahrte ich mein Geheimnis, und es war Mr. Goodfellow – nicht das Schicksal –, der mich nach Australien schickte.
Jetzt war der Diamant mein einziger Weg in die Freiheit. Ich musste den Stein aus seinem Grab auf dem Friedhof holen und dann seine Macht dazu benutzen, Mr. Goodfellows Schicksalsweg eine neue Wendung zu geben. Aber dazu musste ich erst einmal nach Hause kommen, ansonsten würden weder mein Vater noch ich jemals wieder frei sein.
Zweites Kapitel
Wir planen unsere Flucht
Nicht alle Mitglieder der Mannschaft waren vertrauenswürdig. Wir waren uns ganz sicher, dass es einen Mann an Bord gab, der uns im Auftrag des Schiffseigners, Mr. Goodfellow, ausspionierte, der uns ständig im Auge behielt. Mein Vater verdächtigte abwechselnd den Bootsmann, den Maat und den Koch, aber ich hätte mein letztes Hemd verwettet, dass es der Steward war. Der Kerl hatte Ohren so groß wie Scheuklappen und immer, wenn ich meinen Vater besuchte, trieb er sich in der Nähe der Kajüte herum.
Auch an diesem Tag, als wir uns jenseits des großen Kaps durch die Wellen pflügten, fiel sein Schatten immer wieder durch den Türrahmen. Mein Vater, Midgely und ich erörterten flüsternd unsere Möglichkeiten zur Flucht. Midgely hatte die Koje verlassen, und wir alle standen um den Tisch herum, wo die ausgebreitete Seekarte mit jedem Rollen des Schiffs raschelnd hin und her rutschte.
«Euer Plan gefällt mir ganz und gar nicht», sagte mein Vater. «Glaubt ihr wirklich, dass ich euch in ein Boot setzen und euch zu den Inseln fahren lassen kann?»
In den großen Heckfenstern neigte sich der Ozean zur Seite. Das Schiff knarrte und stöhnte, während es die Wellenberge erklomm.
«Wir werden uns schon nicht verirren», behauptete Midge. «Wir kennen ja das Buch.»
«Darum geht es gar nicht», erwiderte mein Vater. «Es geht um die Frage nach dem Wie, William.» Er wölbte seine Hände, als ob das Wort ein Gegenstand wäre, den er festhielt. «Das Wie. Wenn wir dabei beobachtet werden, wie ich Sträflingen zur Flucht verhelfen will, legt man uns alle in Ketten, sobald wir Australien erreichen.»
«Daran haben wir gedacht», sagte ich.
Midgely nickte. «Ich weiß, dass wir alle in einem Boot sitzen, Sir.»
Unwillkürlich verzog sich das Gesicht meines Vaters bei dieser Bemerkung zu einem Grinsen. Ich sagte: «Niemand wird erfahren, dass du uns geholfen hast. Wir machen das Langboot selbst flott und …»
Mein Vater schaute entgeistert. «Das Langboot? Wie denn? Wollt ihr es einfach über Bord schubsen und dann reinhüpfen?» Er kratzte sich am Kopf. «Habt ihr eine Ahnung, wie viel ein Langboot wiegt?»
«Wie viel, Sir?», wollte Midge wissen.
Wie ein Geysir schoss der Atem aus meines Vaters Mund. Seine Hände flogen in die Höhe. «Ich weiß es nicht», sagte er. «Man braucht vier Mann mit Flaschenzügen, um es in die Höhe zu hieven und dann ins Wasser abzulassen. So viel wiegt es.»
«Aber es wäre doch einen Versuch wert, oder?», meinte Midge.
Das Schiff taumelte durch ein Wellental. Die Masten bebten und das Ruder krachte und von der Tür erklang ein Klappern. Der Steward trat ein und brachte ein Tablett. «Tee und Kekse, Captain Tin», sagte er. «Werden Ihnen die jungen Sträflinge Gesellschaft leisten, Sir?»
«Nein», erwiderte mein Vater, obwohl der Mann die Antwort bereits im Voraus kannte. Midge und ich aßen nie etwas in der Kajüte. Wir wollten keine Jammerlappen sein. «Stellen Sie es da hin. Das wäre alles», sagte mein Vater.
Der Steward brachte das Tablett zu dem kleineren Tisch, der an Kardanringen hing. Er musste an mir vorbeigehen, wobei er das Tablett neigte, um sich der Bewegung des Schiffes anzupassen. Ich schaute nicht hin, als er seine Last absetzte. Der Anblick des Tischs, der still in den Kardanringen verharrte, während die Kajüte darum herum schwankte und schlingerte, hatte mich bei früheren Besuchen bereits schwindelig gemacht.
«Sie studieren wohl wieder die Inseln, nicht wahr, Sir?», fragte der Steward. «Bringen Sie den jungen Sträflingen Geografie bei, Sir?»
«Das wäre alles, Bede», sagte mein Vater.
«Es wäre besser, Sie würden ihnen Gottesfurcht beibringen, wenn Sie mich fragen.»
«Ich frage Sie aber nicht.»
«Das ist es, was sie in Australien brauchen werden, Sir. Eine anständige, heilige Gottesfurcht. Und die Furcht vor dem Riemen natürlich auch.»
«Ich sagte, das wäre alles», bellte mein Vater.
Er mochte den Steward nicht, aber er misstraute ihm auch nicht. In seinen Augen war Willy Bede ein loyaler Diener, der kein Wort darüber verlieren würde, was er in der Kapitänskajüte sah oder hörte. Aber meiner Meinung nach war der Steward der perfekte Spion für den abwesenden Schiffseigner, genau der Mann, auf den Mr. Goodfellows Wahl fallen würde. Ich sagte nichts mehr, bis er zur Tür hinaus war und seine Ohren, die wie die Henkel eines Krugs von seinem Kopf abstanden, außer Hörweite geschafft hatte. Dann schaute ich wieder auf die Seekarte und auf die Linie aus Kreuzen, die unsere bisherige Reise nach Australien markierte. Die Linie war gebogen und kurvenreich. Sie bestand aus mehr als hundertachtzig Kreuzen, eins für jeden Tag auf See, und es schien mir so, als ob nur etwa ein Dutzend weiterer Kreuze nötig waren, um die Linie bis zu unserem Ziel, nach New South Wales zu führen.
«Vater, bitte», sagte ich. «Wirst du uns wenigstens versprechen, dass du uns hilfst, so gut es geht?»
Er beantwortete meine Frage mit einer Gegenfrage: «Glaubst du wirklich, dass du dem gewachsen bist, Tom?»
«Ja, Sir», sagte ich.
«Ein Junge aus der Stadt? Ein Schuljunge?» Er seufzte. «Du hast keine Ahnung von den Gefahren auf diesen Inseln.»
«Doch!», rief Midge. «Der Pfarrer schreibt doch davon. Er sagt, dass es da Krodile un Schlangn gib.» Seine Stimme wurde schleppend, wie jedes Mal, wenn er erregt war. «Aale un Spinnen. Wissn wir doch alles.»
«Das ist noch gar nichts», sagte mein Vater. «Ihr wisst nicht mal die Hälfte. Es gibt auch noch andere Gefahren, und zwar solche, die von Menschen ausgehen.»
Er hielt eine Hand hoch, die Finger weit abgespreizt. «Von der Marine wollen wir mal gar nicht reden, obwohl man euch jagen wird wie Füchse. Tag und Nacht.»
Mein Vater tippte sich auf den Zeigefinger, um uns die erste Gefahr aufzuzählen. «Kopfjäger, Tom. Sie paddeln in Kanus, die länger sind als dieses Schiff. Sie schneiden dir den Kopf als Trophäe ab.» Er berührte den nächsten Finger. «Dann sind da noch die Kannibalen, noch schlimmer als die Kopfjäger. Sie leben hier und … hier», sagte er und klopfte auf die Inseln auf der Karte. «Hier und hier, und vielleicht auch noch hier. Man kann den Inselbewohnern nicht ansehen, ob sie Kannibalen sind oder nicht. Bei jedem Menschen, dem ihr begegnet, werdet ihr euch fragen: Wird er mir helfen, oder wird er mich in den Kochtopf stecken?»
In Midgelys Buch gab es keine Kannibalen. Allein schon das Wort versetzte mich in Angst.
«Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre», fuhr mein Vater fort und tippte auf seinen dritten Finger, «werden die Gewässer auch noch von Piraten heimgesucht. Von den Piraten aus Borneo.»
Wieder legte er seine Hand auf die Karte, bedeckte damit die Ausdehnung der großen Insel in der Mitte. «Sie durchkämmen die Meere, Tom. Schwarze Schiffe mit schwarzen Segeln. Eine Fregatte wäre eine willkommene Beute für sie. Entweder schlachten sie die Mannschaft ab wie Lämmer oder verkaufen sie als Sklaven. Ich persönlich wäre allerdings lieber tot.»
Ich schluckte. Es war so, als ob wir von zwei unterschiedlichen Welten sprechen würden. Nichts an seiner Erzählung erinnerte an die Inseln aus Midgelys Buch. Der Pfarrer hatte von freundlichen Ureinwohnern gesprochen, von Dörfern, wo Fremde von allen Bewohnern willkommen geheißen wurden und man ihnen zu Ehren üppige Festmäler mit Gesang und Tanz veranstaltete.
«Haben Sie jemals einen Kannibalen gesehen, Captain Tin?», fragte Midgely.
Mein Vater schüttelte den Kopf.
«Haben Sie schon einen Kopfjäger gesehen? Oder einen Piraten?»
«Nein, William, aber …»
«Dann gibt es sie vielleicht gar nicht», sagte Midge. «Vielleicht sind das nur Märchen, und das, was der Pfarrer erzählt, ist die Wahrheit. Er würde doch nicht lügen, oder, Captain Tin?»
«Würdest du dein Leben darauf verwetten?», fragte mein Vater.
Zu meiner Überraschung nickte Midgely. «Wir würden lieber das Risiko eingehen, als in Ketten gelegt zu werden, stimmt doch, Tom, oder?»
Mir blieb keine Wahl. Sieben Jahre in Ketten würden mich mit Sicherheit umbringen. Es wäre nur ein langsamerer, elenderer Tod.
«Ich bewundere euren Mut», sagte mein Vater. «Aber damit ist das Problem noch nicht aus der Welt geschafft. Wie kann ich euch zu einem Boot verhelfen, ohne dass jemand etwas davon merkt?» Er wandte sich vom Tisch ab und stellte sich vor die Fenster. Vom Heck aus brodelte das Wasser empor und zog sich in wirbelnden weißen Streifen in die Ferne, die breiter und flacher wurden, während wir voransegelten. «Das ist der Haken bei der Sache, Jungs. Wenn ihr eine Lösung gefunden habt, kommt zu mir und ich werde euch helfen.»
Midge und ich gingen wieder an Deck zu den anderen Sträflingen. Wie immer, wenn wir die Kajüte verließen, wimmerte und stöhnte Midgely und humpelte einher, in der Hoffnung, die anderen würden denken, er sei geschlagen worden. Er hielt sich für schrecklich raffiniert, aber kein Mensch nahm ihm seine Nummer ab. Es wusste zwar niemand, warum wir alle vierzehn Tage in die Kapitänskajüte gerufen wurden, doch kein Einziger hätte es für möglich gehalten, dass Redman Tin je Hand an die Sträflinge legen würde, am allerwenigsten an Midgely.
Die Seeleute trieben uns alle zusammen und brachten uns wieder nach unten. Ich stieg mit dem üblichen Gefühl von Angst und Verzweiflung die Luke hinab. Obwohl mein Vater alles tat, um uns die Reise so angenehm wie möglich zu machen – mit reichlich Essen und Trinken und dem Fiedler, der uns dann und wann aufspielte –, blieb das Schiff dennoch ein schwimmendes Gefängnis, glühend heiß an manchen Tagen, eiskalt an anderen. Es stank nach Schweiß und Abfall, und unterschwellig war stets eine siedende Aggression zu spüren, wie in einem Käfig, in dem sich wilde Tiere aneinanderdrängten. Unter den sechzig Jungen hatte ich keinen Freund außer Midgely.
Als wir unsere üblichen Plätze einnahmen, sah ich, wie Walter Weedle einen Jungen von seinem eigenen Platz in der Nähe der Luke verscheuchte. Die quer über sein Gesicht verlaufende Narbe ließ sein Grinsen noch breiter wirken. Er saß da wie ein kleiner König, flankiert von den anderen Wölfen, die seine Muskeln und seine Tapferkeit waren. Der schreckliche Benjamin Penny saß zu seiner Rechten und der dümmliche Riese Gaskin Boggis zu seiner Linken. Hinter ihm hockten Carrots und ein anderer Junge namens Early Discall.
Penny, Boggis und Carrots hatten zu Darkeys Bande gehört. Sie waren zusammen mit meinem Zwillingsbruder durch die Straßen von London gestreift. Nach all den Monaten, die wir auf See verbracht hatten, musste ihnen mittlerweile klar sein, dass ich nicht der Smasher war, den sie gekannt hatten, egal wie groß die Ähnlichkeit in Aussehen und Sprache auch war. Unsere Charaktere waren so unterschiedlich, dass man glauben konnte, mein Vater hätte Gut von Böse getrennt, als er uns bei unserer Geburt auseinanderschnitt. Und doch hockte ausgerechnet Benjamin Penny oft da und starrte mich an, mit einem Blick voller Verwirrung, als ob er immer noch versuchte herauszufinden, wieso ein Junge, der ihn einst geliebt hatte, ihn jetzt so abgrundtief hasste. Er war hässlich und missgestaltet, aber manchmal empfand ich beinahe Mitleid mit ihm. Dann wieder sah ich, wie er auf die anderen Jungen losging, ohne jede Vorwarnung, mit Füßen, Fäusten und Zähnen. Ich hörte die Schreie seiner Opfer und die dumpfen Schläge, die Weedle feige hinterherschickte, und dann versetzte das helle Strahlen in Benjamin Pennys Augen mein Herz in Eiseskälte.
Ich beobachtete sie, so wie sie mich beobachteten, während die Brigg stetig nach Osten steuerte. Gejagt von Wind und Wetter, hissten wir drei oder vier Tage lang nur die Toppsegel, und dann nicht einmal mehr die. Mit blanken Masten jagten wir durch den wütenden Ozean und ich zitterte in der Dunkelheit. Ich hasste Stürme genauso, wie Midgely sie liebte, und ich war froh, dass ich mich mit Gedanken an unsere Flucht von dem Stöhnen des Schiffsrumpfs und dem Knarren der Masten ablenken konnte.
Als wir noch neun Tagesreisen von Australien entfernt waren, hatte ich immer noch keine Lösung für unser Problem gefunden. Dann nahm das Schicksal, das mich unentwegt gebeutelt hatte, eine unerwartete Wendung.
Wieder blies ein Sturm, wütender und heftiger als jeder zuvor. Er heulte von früh bis spät, und unten im Bauch des Schiffs hörten wir, wie die festgezurrten Haufen an Deck sich lösten und hin und her rutschten. Der Besanmast brach und wurde über Bord gespült. Das Deck war in einem so fürchterlichen Zustand, dass wir einen ganzen Tag, eine ganze Nacht und noch den folgenden Morgen unten bleiben mussten. Als wir endlich wieder nach oben durften, waren die Matrosen immer noch mit Reparaturen beschäftigt.
Weedle und Carrots kletterten auf einen Haufen aus Holzbalken. Benjamin Penny versuchte, zu ihnen zu gelangen, aber seine verdrehte Wirbelsäule und seine verwachsenen Arme erlaubten es ihm nicht, den Hügel zu erklimmen. Er riss Stücke aus der alten, durch Sonne und Wind brüchig gewordenen Persenning, während er zwischen und unter den Haufen hindurchhuschte, hier verschwand und dort wieder auftauchte.
Midgely und ich gingen zum Heck. Dort war ein neuer Mast eingesetzt worden und die Matrosen verspleißten gerade die Takelage. Der Zimmermann bearbeitete mit dem Hammer das Langboot, und so setzten wir uns hin und schauten ihm zu. Kurz darauf begrüßte uns mein Vater, der mit seinem Sextanten an Deck kam. Es war das allererste Mal, dass er sich hier blicken ließ, wenn die Sträflinge aus ihrem Loch gelassen wurden, und er vermied es nach Kräften, vom Achterdeck zu ihnen nach unten zu schauen. Der Anblick der Jungen, so meinte er, bräche ihm das Herz.
Aber er freute sich, Midgely und mich zu sehen. «Was für ein Sturm, nicht wahr?», sagte er. «Hätte beinahe das Schiff auseinandergenommen, so wahr ich hier stehe.» Er hantierte mit seinem Sextanten und hielt ihn dann an sein Auge. «Wir sind etliche Meilen nach Norden abgetrieben worden. Seht ihr die Wolken dort am Horizont?»
Ich schaute hinaus nach Norden und sah dort flache Wolken auf der Himmelslinie treiben.
«Unter solchen Wolken liegt immer Land», sagte mein Vater. «Vielleicht bekommt ihr eure Inseln doch noch zu sehen.»
Er kniff die Augen zusammen und schaute durch das Okular, während er die Alhidade betätigte. «Hört mal, ich dachte, ein Tänzchen wäre nicht schlecht», sagte er. «Was meint ihr, die Jungs tanzen doch gerne, oder?»
«Sehr gerne», sagte ich.
Wir schauten ihm weiter zu, wie er mit dem Sextanten arbeitete. Dann ging er nach unten, um die Position zu berechnen, und wir blieben bei dem Zimmermann. Er war Deutscher und ziemlich alt und er murmelte vor sich hin, während er Stränge aus Baumwollseil zwischen die Planken des Langboots hämmerte.
«Hat einiges abgekriegt», sagte er. «Und die ganze Arbeit, die man reinstecken muss. Aber was soll’s?» Er klopfte gegen den Rumpf. «Schaut her, Jungs, so gut wie neu. Wir legen’s ins Wasser und dann werden wir ja sehen.»
«Das Langboot wird jetzt zu Wasser gelassen?», fragte ich.
«Wie sonst soll man die Planken abdichten?», gab der Zimmermann zurück. «Holz muss trinken, Jungs. Holz und Männer, ach, die sind beide gleich.»
Er rief ein paar Leute zusammen. Die Flaschenzüge wurden befestigt und die Schlepptrosse angebracht. Dann wurde das Langboot – mit zwei Paar Rudern, die auf den Sitzbänken festgebunden waren – über die Seite gehievt.
Midge kniff die Augen zusammen in dem Bemühen, etwas zu sehen. Dann grinste er mich an. «Jetzt ist alles klar», sagte er. «Stimmt’s, Tom?»
An diesem Tag legten wir meinem Vater unseren Plan vor. Er würde den Sträflingen ein Tanzvergnügen zum Geschenk machen, und zwar dann, wenn wir noch näher an die Inseln gesegelt waren. Und in dieser Nacht würden Midge und ich uns auf dem Deck verstecken, anstatt nach unten zu gehen. «Die Matrosen zählen die Jungen schon lange nicht mehr durch», sagte ich. «Wir verstecken uns in den Holzhaufen, bis du uns in deine Kajüte bringen kannst. Am nächsten Morgen wird jemand melden, dass wir vermisst werden, und du wirst behaupten, dass wir bestimmt ertrunken sind.»
«Tom, sie werden das Schiff durchsuchen», sagte mein Vater.
Midgely kicherte. «Von oben bis unten, aber nicht hier drin, denn hier werden Sie selbst nachsehen. Unser Plan ist wasserdicht, Captain Tin.»
«Wir können durch die Fenster rausklettern», fuhr ich fort. «In der darauf folgenden Nacht oder vielleicht in der danach. Wir steigen ins Langboot, und du kannst uns Proviant und die Karten für die Inseln herunterreichen. Dann lösen wir das Tau, und alle werden glauben, dass sich das Boot losgerissen hat.»
Mein Vater schaute durch die Fenster nach draußen, wo das Langboot durch das Kielwasser der Brigg schoss. «Bei meiner Seele, das ist ziemlich clever gedacht», sagte er. «Ich könnte dafür sorgen, dass ihr geradewegs nach Norden steuert. Dort stoßt ihr unweigerlich auf Land.»
«Und von da aus fahren wir zur Elefanteninsel», sagte Midge. «Dort werden wir auf Sie warten.»
«Ja.» Mein Vater lächelte. «Was für ein glücklicher Zufall, nicht wahr? Ich werde dort an Land gehen und Wasser aufnehmen und – gütiger Gott! – da seid ihr ja! Natürlich werde ich euch in Ketten an Bord nehmen müssen.»
«Das macht nichts», sagte Midgely.
«Ihr werdet in Ketten bleiben, bis wir in England sind», fuhr mein Vater fort. «Und dann werden wir aller Welt beweisen, was für ein Teufel Mr. Goodfellow ist.»
Unser Plan wurde beschlossen. Doch in letzter Minute änderte Midgely ein wichtiges Detail. «Wäre es nicht sicherer, wenn wir uns im Rigg verstecken würden?», fragte er. «Anstatt im Holzhaufen, meine ich.»
Ich hatte Höhenangst. Ich wollte nicht die Takelage hinaufklettern, schon gar nicht in der Nacht. Aber mein Vater stimmte Midge zu. «Du hast recht, William. Der Großmast ist ein besseres Versteck.»
Und damit nahm das Schicksal eine neue Wendung.
Drittes Kapitel
Ein gespenstischer Besuch
Es gab Zeiten, da glaubte ich, ich sei verflucht. Es schien mir, als hätte ich mit dem herrlichen Diamanten gleichzeitig auch einen Teufel aus der Themse gezogen. Midgely hatte mir einmal gesagt, dass mein Juwel möglicherweise der berühmte Jolly-Stein war, der alle Menschen ins Verderben gestürzt hatte, die ihn in Händen gehalten hatten. Ich war von einem entsetzlichen Pech heimgesucht und all meine Pläne waren durchkreuzt worden, sodass ich die begründete Furcht hegte, es könnte so weitergehen.
Aber am Morgen sah es so aus, als hätte ich nichts zu befürchten. Mein Vater ließ verlauten, dass heute Abend ein Tanz veranstaltet würde, und die Jungen warfen ihre Mützen in die Luft und jubelten.
Den ganzen Vormittag lang war die See spiegelglatt. Eine warme Brise wehte. Dann tauchte hinter dem Bugspriet ein Felsenturm auf, als ob wir das Ende der Welt erreicht hätten. Er sah aus, als wäre er einem Zauberland entsprungen oder als wäre er die Spitze einer geheimnisvollen Burg, die im Ozean versunken war. Er schimmerte im Sonnenlicht.
Dann fiel er langsam in sich zusammen. Er glitt ins Wasser und mir wurde klar, dass wir Zeugen eines seltsamen Phänomens geworden waren, ein Trick, erschaffen durch die Laune des Sonnenlichts, der uns das Abbild einer Insel hatte erblicken lassen, die noch jenseits des Horizonts lag.
Ich fragte mich, ob dies ein Omen war – und wenn ja, was für eins.
Die Brise legte sich und das Schiff suhlte sich mit schlaffen Segeln und stöhnenden Leinen in der hellen, heißen See. Das Langboot lag bewegungslos hinter uns. Ohne den Wind unter ihren Schwingen hatten sich die Albatrosse auf dem Wasser niedergelassen. Sie wirkten wie Hühner, die man auf einem weiß glühenden Grill zum Braten ausgelegt hatte. Die Jungen hatten sich lang auf den Rücken ausgestreckt und spielten Toter Mann, starrten hinauf in die ausgebleichten Segel.
Gegen Mittag erhoben sich im Osten Wolken. In lang gezogenen Bannern und dicht gedrängten Haufen rückten sie näher, wie eine Horde riesiger gelber Pferde. Ein Matrose kam und brachte Midgely und mich in die Kapitänskajüte.
Wir dachten, mein Vater wollte die letzten Einzelheiten unseres Plans besprechen, aber als wir eintraten, lief er vor den großen Fenstern auf und ab. Rundheraus sagte er: «Ich habe meine Meinung geändert.»
Ein Grund dafür war das Wetter. Die stille See und die Wolken konnten ihn nicht täuschen. «Da braut sich ein Sturm zusammen», sagte er. «Wenn er uns bis Sonnenuntergang nicht erreicht hat, haben wir nichts zu befürchten. Aber wenn der Wind vor der Nacht auffrischt, werden wir unser blaues Wunder erleben.»
«Wir haben keine Angst», sagte Midgely.
«Natürlich nicht, William», sagte mein Vater, «aber …» Er zögerte und seufzte dann. «Tom, ich hatte eine Erscheinung. Ich sah deine Mutter, so deutlich wie ich dich jetzt vor mir sehe.»
«Oh, Vater», sagte ich.
«Sie trug ihre Schleier und ihren Schal und sie war genau da.» Er hob den Arm und deutete auf seine Koje. Sein Finger zitterte. «Sie lag da, flach auf ihrem Rücken.»
«Ja, kein Zweifel, das war bestimmt Mutter», sagte ich trocken. Mein halbes Leben lang hatte ich sie nicht anders als in dieser Stellung erlebt. Sie hatte den Verstand verloren, als meine Schwester ertrank. Sie hatte sich ins Bett gelegt und war kaum noch aufgestanden.
«Während ich noch hinschaute, schlug sie ihren Schleier zurück», fuhr mein Vater fort. «‹Beschütze ihn›, sagte sie. ‹Beschütze den Jungen.› Und dann verblasste sie und verschwand.»
«Heiliger Strohsack. Da kriegt man ja eine Gänsehaut», sagte Midgely. «Sie liegt auf dem Totenlager, nicht wahr, Captain Tin? Sie ruft nach Ihnen in der Stunde ihres Todes, kein Zweifel.»
Ich sah, wie er etwas tat, was ich noch nie zuvor bei ihm erlebt hatte. Er hob seine kleine Hand und bekreuzigte sich, berührte seine Stirn, seine Lippen, seine Brust und seine Schultern.
Ich setzte mich hin, allerdings nicht auf das Bett. Ich ließ mich in einen Stuhl neben dem Tisch fallen und hatte dabei das Gefühl, als würde ich ins Bodenlose sinken. Ich spürte, dass mir meine Mutter mehr bedeutete, als ich je für möglich gehalten hatte, und dass mich der Gedanke, dass sie sterbend in ihrem Bett im weit entfernten England lag, im Innersten erzittern ließ.
«Tom!», rief mein Vater. «Hör mir zu, Tom.» Er trat neben mich und hob mein Kinn hoch. «Sie ist nicht hier, weder ihr Körper noch ihr Geist. Ich habe an sie gedacht, das ist alles. Ich weiß genau, was sie davon halten würde, dass du das Schiff verlassen willst. Wir beide wissen es. Tom, ich habe sie nicht gesehen. Ich sah meine eigenen Gedanken.»
«Sie werden uns nicht fliehen lassen, stimmt’s?», fragte Midgely.
«Nein», erwiderte mein Vater. «Das werde ich nicht. Ich werde euch nach Australien bringen, wie ich es vorhatte. Ich werde dem Gouverneur alles erklären und euch wieder nach Hause bringen. So lautet meine Entscheidung.»
«Wegen dem, was du gesehen hast?», wollte ich wissen.
«Wegen dem, was ich weiß», gab er zurück. «Du hast es nicht in dir, Tom. Du bist zu … ach, verdammt! – es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber du bist einfach zu weich.»
Er wandte sich ab. Er ging nicht wieder zum Fenster, sondern setzte sich auf das Bett. Er stützte die Ellbogen auf seine Oberschenkel und legte dann den Kopf in die Hände. «Es ist nicht deine Schuld, Tom; du wurdest verwöhnt. Deine Mutter hat dich immer zu sehr beschützt. Sie hat dich verweichlicht.»
Seine Worte schmerzten mehr, als er ahnen konnte. Es stimmte, dass ich so gewesen war. Ich war verwöhnt und selbstsüchtig gewesen. Aber ich glaubte, dass ich mich geändert hatte, und die Gewissheit, dass mein Vater das nicht erkannte, tat weh.
Schatten ergossen sich durch die Türöffnung. Herein kroch der alte Bede, mit der langen Nase voran. «Möchten die jungen Sträflinge …», fing er an.
Aber meines Vaters Kopf ruckte hoch und er brüllte: «Raus, Mann! Lassen Sie uns allein, Sie Frosch fressender Narr!»
Eine solche Wut hatte ich bei ihm noch nie erlebt. Ich sah die Bestürzung auf Bedes langem Gesicht und – nur einen Moment lang – glaubte ich nicht mehr, dass er Mr. Goodfellows Spion war. Er hätte nicht verletzter wirken können, wenn mein Vater die Peitsche auf seinem Rücken hätte tanzen lassen. Er ging, genauso verstohlen, wie er gekommen war.
«Ach, Bede», rief mein Vater ihm nach. «Es tut mir leid.»
Aber es war zu spät. Der Mann hörte ihn nicht mehr. Oder er wollte ihn nicht hören.
Mein Vater stand auf. Er trat hinter mich und legte mir die Hände auf die Schultern. «Gütiger Gott, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe das Gefühl, dass ich heute vor Topp und Takel liege, ein Spielball für die trügerischen Winde. Aber lieber Tom, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich.»