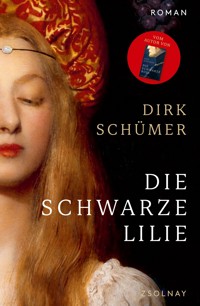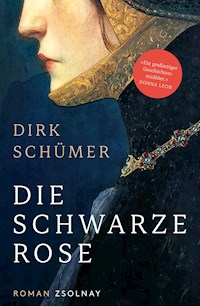Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Als hätte der Mensch das Nomadentum nicht längst überwunden, muss er jedes Jahr mindestens eine Reise unternehmen, auch wenn er sich daheim viel wohler fühlt. Dirk Schümer, Kulturkorrespondent und erfahrener Reisender, hat sich als teilnehmender Beobachter intensiv mit den Eigenarten des „Homo Touristicus“ beschäftigt. Er beobachtet unsere Verrenkungen, wenn wir das Gepäck im Flugzeug verstauen, erklärt Hoteliers, wie ein Badezimmer aussehen soll, und hat für uns schon einmal Lammhirn und einen Schnaps mit dem Namen „Schwarzer Tod“ vorgekostet. Und wer noch nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, kann sich mit dieser Reportage auf dem heimischen Sofa entspannen. Denn nicht nur Reisen, auch Lesen bildet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Dirk Schümer
TOURISTENSIND IMMER DIE ANDEREN
Carl Hanser Verlag
ISBN: 978-3-446-24546-4
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2014
Schutzumschlaggestaltung und Fotografie: Peter-Andreas Hassiepen, München
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
INHALT
Ich reise, also bin ich
Planen und Packen – Vom Aufbrechen
Der Traum vom Fliegen
Zu Gast bei Feinden – Im Hotel
Speisen auf Reisen
Die Menschendeponie am Meer – Strandfreuden
Kopfüber ins Tal – Schneekanonen und Pistenblitze
In der Kampfzone: Ein Hoch auf den Massentourismus
Warum in die Nähe schweifen, wenn das Ferne so nah liegt?
Die innere Landkarte – Eine Philosophie fürs Handgepäck
ICH REISE, ALSO BIN ICH
Ein Eimer, eine Schaufel und jede Menge Sand und Meer. Der kleine Junge auf dem alten Foto bin ich, gerade mal zwei Jahre alt. Ganz selbstverständlich im Sommerurlaub an der Nordsee, über dreihundert Kilometer von zu Hause. Was mache ich da? Warum buddle ich in diesem Riesensandkasten bei Cuxhaven und beschäftige mich nicht vor der Haustür? Wie bin ich dort hingekommen? Für geübte Reisende, also eigentlich jeden von uns, dürften diese Fragen seltsam klingen. Wir sind ins Zeitalter des Tourismus hereingewachsen, hereingeboren, haben den Rhythmus von Ortswechseln als den Herzschlag unseres Lebens als Selbstverständlichkeit akzeptiert. Ein kleines deutsches Kind am Strand, das könnte heute genauso gut auf den Malediven fotografiert werden oder in Florida. Der Junge der sechziger Jahre würde sich heute, vielleicht ganz alleine mit einem Schild um den Hals, in einem Düsenjet wiederfinden, der ihn nach Asien oder Afrika bringt. Warum auch nicht? Unterwegs sein, in Hotels abzusteigen, sich in alle verfügbaren Verkehrsmittel zu stürzen, ist das normalste von der Welt. Allerdings erst seit ein paar Jahren, ziemlich genau seit einer Generation.
Noch mein Großvater ist sein ganzes Leben nicht aus dem kleinen westfälischen Städtchen herausgekommen, in dem er geboren wurde. Genauso wenig wie seine Nachbarn oder seine Verwandten kannte er den Tourismus aus eigener Erfahrung. Wenn Leute zu seiner Zeit verreisten, Bildungs-, Erholungs- oder Kuraufenthalte in ihrer Biografie unterbringen konnten, dann gehörten sie zum Adel oder zum sehr wohlhabenden Bürgertum. Die Masse blieb lebenslang daheim. Genau wie mein Großvater hätten sich wohl die meisten seiner Generationsgenossen gefragt, warum ein Kleinkind an die Meeresküste verfrachtet werden muss. Das ist doch alles aufwendig und als Lebenserfahrung nutzlos. In der Tat habe ich keinerlei Erinnerungen an meine erste Urlaubsreise, mit der meine persönliche Laufbahn als Homo touristicus begonnen hat. Heute kenne ich etliche Kinder so um die zehn Jahre, die von New York bis Peking, von der Südsee bis zu den Museen von London und Paris schon mehr von der Welt gesehen haben als Captain Cook, von schüchternen Erwachsenenurlaubern ganz zu schweigen.
Die Beschleunigung des Lebens, von der so viel die Rede ist, meint vor allem die hektischen Bilder auf Fernsehschirmen, Personalcomputern und Mobiltelefonen, die unser aller Alltag einen immer hurtigeren Pulsschlag vorgeben. Der Transport der körperlichen Hardware von einem mehr oder weniger beliebigen Fleck der Welt zum anderen gehört aber auch dazu. Doch ging es früher wirklich ruhiger zu, waren die Menschen allesamt sesshafter? Interessant ist es, sich das Itinerar eines römischen Kaisers, eines Papstes oder Monarchen des Mittelalters anzusehen, also den Atlas seiner Reisebiografie mit allen Linien quer durch Mitteleuropa. Da kommen in der Tat meist ein paar mühselige Touren zu Pferd über die Alpen zusammen, und den Rest der meist kurzen Lebensreise ging es über Stock und Stein, Floß und Kahn von einer Versammlung, von einer Burg, von einer Jagd zur anderen. Doch das freilich war die absolute Ausnahme, während fast die gesamte Restbevölkerung brav daheimblieb und von Aussaat bis Ernte die Kalorien für die wenigen Touristen – Krieger, Händler, Politiker – erzeugten. Die Ferien-Völkerwanderung unserer Zeit ist eine ganz andere als die in der Spätantike, da ganze Stämme mit hunderttausend Menschen, Ochsenwagen und Grillgeschirr quer durch Europa zogen, um eine neue Heimat zu suchen und sich notfalls mit Gewalt zu erkämpfen. Menschen waren immer mal staunenswert mobil auf der erzwungenen Suche nach einem neuen Lebensraum, nach Kriegsbeute, nach seltenen Handschriften so wie neugierige Mönche oder nach Edelsteinen auf der Seidenstraße wie Marco Polo. Das Ausmaß an Mut oder an Verzweiflung, das sich ansammeln musste, damit einer als Auswanderer, Vertriebener, Abenteurer alles hinter sich ließ und sich für immer auf den Pfad begab, können wir kaum ermessen. Und doch sind solche Schicksale immer noch Alltag, etwa wenn sich in Afrika verarmte Glückssucher zu vielen Tausenden zu Fuß durch die Sahara ins vermeintliche Paradies Europa aufmachen und dabei das eigene Leben riskieren. Noch vor ein paar Jahrzehnten gab es nach dem von Deutschen angezettelten und verlorenen Zweiten Weltkrieg die größte Vertreibungswelle der Geschichte mit gut fünfzehn Millionen Menschen, zumeist deutschstämmigen, aus Mittel- und Osteuropa.
Und mächtige Nationen wie die Vereinigten Staaten, Australien, Argentinien rekrutierten ihre Bevölkerung anfangs aus mutigen Auswanderern, die ihre Heimatscholle hinter sich ließen. Dennoch hat diese Form der Ausreise wenig mit unserem All-Inclusive-Ferienspaß gemein; sie lehrt uns einzig, dass Menschen keineswegs zur Sesshaftigkeit neigen. Wenn schon Kimbern und Teutonen und Hunnen über tausende Kilometer ihr Ziel erreichten, dann sollten wir Pauschaltouristen uns auf unser persönliches Itinerar, das immer wieder an den Ausgangspunkt zurückführt, nicht allzu viel einbilden.
Machen wir einmal die Probe und versuchen, unsere eigene Lebensreise auf eine Landkarte zu bekommen. Nehmen wir ruhig die regelmäßigen Verwandtenbesuche bei der Tante in Bayern, die Klassenreisen zum Kölner Dom und zum Hamburger Hafen dazu, dann den Schüleraustausch nach England, dazu bauen wir die Familienferien ein. Schon vor der Volljährigkeit wird alles komplett unübersichtlich, ein Knäuel aus Reisefäden quer durch unseren Kontinent und darüber hinaus. Wann war ich das erste Mal an der Adria? Gab es da nicht diesen Ausflug mit der Fähre nach Dänemark? Und immer wieder diese Wandertouren mit den Großeltern im Kleinwalsertal, die ich damals so gehasst habe. Wenn man dann noch heroische Fahrradtouren mitrechnet, kommt schnell einiges zusammen.
Seit sich dieser Rhythmus der Ferienreisen beschleunigt hat, wäre es viel leichter, sich die seltenen Jahre in Erinnerung zu rufen, in denen man tatsächlich im Urlaub nirgendwo hingefahren ist. Die Bewegung, ob ins Hotel oder die Jugendherberge, ob mit dem Schiff nach Skandinavien oder per Flieger an die Costa del Sol, ist jetzt die Regel – und längst nicht nur für den Hochadel und Fernhändler. Tourismus ist Menschenrecht. Die DDR ist auch und vor allem an der Absperrung zusammengebrochen, denn Sachsen und Brandenburger wollten auch endlich nach Paris und Rom und Mallorca und weiter, immer weiter in die Welt hinaus. Dieses Recht haben sie eingeklagt, und sie machen seither reichlich davon Gebrauch. Heutige Gesellschaftsdebatten über Armut berichten von unterprivilegierten Kindern, deren Familien dem Nachwuchs kaum Auslauf gönnen: kein Strand im Sommer, keine Skipisten im Winter, kein Kurztrip nach London. Welch ein trauriges, ja fast schon unzumutbares Dasein. Wer gar freiwillig nirgendwo hinfährt und im Urlaub im Stadtviertel spazierengeht oder im Hobbykeller den Kölner Dom aus Streichhölzern zusammenbastelt, gilt als Fall für den Psychologen. Gibt man Menschen die ökonomischen, zeitlichen und technischen Möglichkeiten zum Reisen, dann ist kein Winkel der Welt vor ihnen sicher. Das ist der Unterschied zu früher, als Zwänge und Nöte die Bewegung anschoben. Heute läuft – das gehört geradezu zur Definition von Tourismus – das Gros unserer Reisen ohne Lebensnotwendigkeit: Tourist ist, wer zum Vergnügen und mit Rückfahrkarte keineswegs länger als ein paar Monate den Ort wechselt und sich einfach mal in der Welt umschaut.
Solches Reisen ist, allen Pilgerfahrten und Kreuzzügen zum Trotz, ein recht neues Phänomen. Europas, vor allem Britanniens Adel pflegte zwar seit der Renaissance den Nachwuchs zur Grand Tour gen Italien auszusenden, doch solche jahrelangen Ausbildungs- und Vergnügungstouren in Begleitung von Hofmeistern und Sprachlehrern waren aufwendiger und sicher lehrreicher als ein Hochschulstudium. Erst im neunzehnten Jahrhundert lassen sich nennenswerte touristische Wanderungen nachweisen, die mit heutigen Urlaubsreisen vergleichbar sind. Wohlhabende fuhren in die Sommerfrische in die Berge oder als durchaus Gesunde in die boomenden Kurorte wie Spa, Baden-Baden, Bath, wo in Hotels, Badehäusern, Pferderennbahnen, Casinos, Operettentheatern für das angemessene Unterhaltungsprogramm gesorgt wurde. Vor allem das weltumspannende britische Empire hat mit seinen Inlandreisen von Glasgow nach Sydney per königlichem Dampfschiff für die Elite des Empire ein touristisches Leben für viele ermöglicht. Man hatte Familie in Indien, alte Geschäftsbeziehungen zum Niagarafall, wollte die viktorianischen Schafe auf Falkland genauso kennenlernen wie die raren Großwildtrophäen im britischen Afrika. Also bitte, der Tourismuspionier Thomas Cook bot das alles und noch viel mehr als Pauschalurlaub an, wenn diese Reisen auch per Schiff und Bahn etwas länger dauerten als die heutigen Pfingstferien. Für die wachsende Zahl von Reisenden entstand eine Infrastruktur von Bimmelbahnen an den Himalaya, luxuriösen Lodges in Kenia, Fahrplänen für Dampfschiffe entlang der Burgen des Rheins oder feinen Hotels an den Stränden von Deauville und der steinigen Küste der Riviera. Schon im neunzehnten Jahrhundert entwickelte sich der Tourismus für die »happy few« zu einem kleinen, aber feinen Wirtschaftszweig. An klassischen Destinationen wie Florenz, den Loireschlössern, in Wien oder Blackpool sah es vor hundert Jahren schon fast so touristisch überfüllt aus wie heute. Autoren beschweren sich bereits vor 1900 über die lästigen Reisegruppen auf dem Markusplatz von Venedig während der Hochsaison.
Doch heute ist immer Hochsaison, voll ist es fast überall, Hotels finden sich noch auf eisigen Bergeshöhen und mitten in der Wüste. Das Produkt Tourismus hat sich die ganze Welt gefügig gemacht und bietet etwas für jede Preisklasse. Dank höherer Einkommen und günstiger Reisen gehören so gut wie alle zu den Privilegierten. Den gesunden Wachstumsraten der Reisebranche haben keine Kriege und Wirtschaftskrisen der letzten hundert Jahre etwas anhaben können. Kaum sind, wie im Irak, in Afghanistan, die Kriegskanonen etwas verstummt, fallen schon die ersten Individualtouristen in ein noch so armes, noch so zerstörtes Land ein und schauen nach dem Rechten – oft sicher, um mit dem Recht der ersten Nacht bei der Heimkehr protzen zu können. Gefahren und Krankheiten können vielleicht Warenströme und Baufirmen vor verseuchten Gegenden abschrecken, aber sicher keine Touristen, die sich über jede Warnung vor Flecktyphus und Beulenpest hinwegsetzen. Die junge, dynamische Reisecommunity der Generation Lonely Planet tauscht sich übers Internet über die ersten Rohbaubars und Gästebetten in Somalia und im Südsudan bereits aus, bevor die entsprechenden Lokale überhaupt eröffnet haben. In Nahost – etwa in Syrien, aber auch im Libanon – stoßen nicht zum ersten Mal bei blutigen Bürgerkriegen die Soldaten auf unerschütterliche Reisende, die manche Kulturschätze noch Sekunden vor dem Bombardement fotografieren wollen und dafür locker ihr Leben aufs Spiel setzen. Und wenn man einmal seine Mitmenschen richtig kennenlernen möchte, die man in Heidenheim an der Brenz, Offenburg oder Salzgitter nicht einmal in der Nachbarschaft träfe, dann sollte man sich im Reisebüro für eine sündteure Kreuzfahrt in die Antarktis, eine Extremklettertour im Himalaya oder einen Tauchurlaub beim weißen Hai an den Küsten Südafrikas anmelden. Da trifft man sie dann, die unerschrockenen Kleinbürger, die daheim einen Bausparvertrag abschließen, brav die Einbauküche abzahlen, ihre späteren Rentenansprüche ausrechnen und konservativ ein kleines Börsendepot verwalten. So kommt dann genug zusammen, um sich tollkühn in die Feuerwerkskörper eines brasilianischen Dorffestes schmeißen zu können oder endlich einmal einen Kurs für Freeclimber in Kanada zu buchen. Frühpensionierte Schwerkranke sammeln da vor Toresschluss mit Eifer griechische Inseln wie Briefmarken. Vorteilhaft geschiedene Damen schließen ihre Bungalows ab und treten mit achtzig noch einmal monatelange Kreuzfahrten an. In den Kaffeeküchen der Büros tauschen sich schon die Hospitanten über die coolsten Clubs in London, die wildesten Strände von Bali, die eindrucksvollsten Highways quer durch Amerika aus. Wer kennt sie nicht, die Urlauber aus Passion und mit übermenschlicher Kondition.
Gehören wir nicht alle irgendwie dazu? Ich reise, also bin ich – so würde es wohl der notorisch sesshafte Philosoph René Descartes heute auf den Punkt bringen.
Warum sind wir nur so umtriebig geworden? Können wir nicht mehr ruhig an einem Ort bleiben? Hat eine kollektive Nervosität unsere Tierart erfasst? Die Unfähigkeit, im selben Raum auszuharren – das hat Descartes vor über dreihundert Jahren als Keimzelle unseres Unglücks identifiziert. Er selber saß lieber wochenlang rauchend im Bett in Holland und dachte nach, und als er irgendwann die verlockende Einladung als Staatsberater an den schwedischen Königshof erhielt, wurde sogar dieser Stoiker zum Touristen und brach auf. Ein paar Wochen später war er tot, vergiftet von Neidern, die keinen Philosophietouristen bei Hofe haben wollten.
Der Tod unterwegs ist sicher die schlimmste anzunehmende Wendung einer Urlaubsreise. Nicht so sehr wegen der behördlichen Komplikationen, die mit einem Sargtransport verbunden sind. Nein, die schlimmste Niederlage des Touristen besteht darin, hinterher nichts von seinen Abenteuern und Triumphen erzählen zu können. Treffen heute beliebige Mitmenschen aus entwickelten Ländern zusammen, darf man sicher sein, dass nach wenigen Minuten nicht mehr über Familie und Geschäft, ja auch nicht über Sport und Hochkultur geredet wird, sondern übers Reisen. Wo waren Sie denn zuletzt im Urlaub? Entgegnet man dann, womöglich auch noch wahrheitsgemäß, man fahre nun mal seit Jahrzehnten zum Wandern und Wassertreten in die Lüneburger Heide, dann ist mancher gesellschaftliche Kontakt, manche Freundschaft gar bereits zu Ende, bevor sie überhaupt anfangen konnte. Wenigstens einige touristische Basics werden für einen zivilisierten Menschen vorausgesetzt. Da reicht es nicht immer, von einer Parisreise zu schwärmen, vielleicht in ferner Jugendzeit. Das könnte erst recht als Ausweis von Biederkeit, Armut, Provinzialismus gelten. Besser steht man da, wenn man touristische Kennerschaft nach Art des Feinschmeckers vorweisen kann: Immer, wenn wir in Paris sind, gehen wir abends in die Coupole, die kennen Sie ja sicher. Da fährt man bei der sonstigen Abfütterei für Touristen immer noch am sichersten. Dass man vielleicht nur zweimal auf einer Dienstreise in Paris war und dabei nur kurz in La Coupole eine Vorspeise abbekam, das braucht man ja niemandem auf die Nase zu binden. Also, wir müssen einfach einmal im Jahr in Rom vorbeischauen, schon allein wegen der Kultur – das ist noch so ein Hammersatz, dessen Wahrheitsgehalt sich schwer überprüfen lässt und der daher tiefen Eindruck hinterlassen dürfte.
Hartgesottene Touristen kennen keine Angst vor Oberflächlichkeit. Zur Not lassen sich riesige Erdgegenden wie Skandinavien bei einem Zwischenstopp am Flughafen abhaken, und eine Kaffeefahrt nach Stade reicht locker für Hamburg en gros und détail. Kenn ich gut, hab ich drauf, bin ich schon gewesen – solche Schnellurteile weisen heute die weltkundigen und souveränen Zeitgenossen aus. Ich hörte neulich von einer Damenrunde, die mit einem Billigflieger für einen Nachmittag von Frankfurt-Hahn nach London und zurück unterwegs war. Es reichte immerhin für einen Besuch im Kaufhaus Harrods inklusive der Lady-Diana-Gedenkstätte. Das allein ist, wenn man sich solch einen Tempotourismus denn leisten und antun möchte, keineswegs verwerflich. Richtig gelungen ist eine Reise freilich erst, wenn hinterher das adäquate Urteil gefällt werden kann. In diesem Fall einigte man sich, weil das Gedränge, die Hektik und die schlechte Luft in London niemandem so recht imponiert hatten, auf die Formel: Also England, das kannst du mir schenken.
Geschmäcklerische Kennerschaft ganzer Nationen und Kontinente ergänzen oder ersetzen heute die simple und handfeste Prahlerei mit Schmuck und dicken Autos. Wer nichts über die Strände am Roten Meer zu sagen weiß oder bei der Erwähnung von Kalifornien nur vage lächelnd mit dem Kopf wackelt, wer gar Tübingen mit Thüringen verwechselt und immer noch »Burma« sagt statt »Myanmar«, der entlarvt sich als armer Schlucker und rettungsloser Banause. »Ich war noch niemals in New York« – dieses Bekenntnis wirkt sogar noch unter Kegelbrüdern derart peinlich, dass Udo Jürgens daraus ein trotziges Lied und sogar noch ein ganzes Musical schmieden konnte. Einer von tausend dürfte sich verschämt angesprochen fühlen, der Rest lächelt weitgereist und wissend über so viel putzige Hinterwäldlerei.
Den Wettbewerb um die weiteste, originellste Reise, den souveränsten Überblick über die Ferienregionen kann man leichter mit kluger Gesprächstaktik gewinnen. Eine ganz perfide Methode besteht im Abwarten und eiskalten Zuschlagen. Dann lässt man das Gegenüber beispielsweise ewig über die Leidenschaft zur Bildungsreise nach Bella Italia schwadronieren, fragt höflich nach Impressionen aus Capri oder Pisa, nickt stumm, wenn es um rare Etruskerstätten in Latium oder romanische Kirchen in den Abruzzen geht. Dann glashart die Frage: Und waren Sie schon einmal in Sizilien? Gibt sich der Gesprächspartner dann die Blöße zu sagen: Das fehlt mir noch, ich bin noch in der Planungsphase – dann kann man die ganze Reisekarriere mit einem Gnadenstoß erledigen: Wenn Sie Sizilien nicht kennen, dann kennen Sie Italien nicht!
In diesem Sinne empfiehlt es sich, immer ein paar nebensächliche, unauffällige Reiseziele in der Hinterhand zu haben, damit niemand mit Prag oder Istanbul die große Show abziehen kann. Eine kurze, hinterhältige Zwischenfrage nach der Luxemburgischen Schweiz oder den Färöern, selbst wenn sich da kaum etwas sehen und erleben lässt, gibt erfahrungsgemäß allen Angebern den Rest. Man muss nur steif und fest behaupten, dass gerade dort die größten Wunder verborgen, die größten Überraschungen zu erleben sind. Was – Sie kennen Helsinki nicht? Oder besser: Haben Sie es noch nicht bis Ljubljana geschafft? Mit solcher möglichst erstaunt-herablassenden Kennerschaft kann man viel Geld sparen, denn ein Kurztrip nach Ljubljana kommt allemal günstiger als die große, alljährliche Tour de France im Campingwagen, die aber plötzlich kaum mehr etwas wert ist neben so viel Reisespürnase. Wer noch nicht die thrakischen Gräber in Bulgarien gesehen hat, der muss mir nichts vom Metropolitan in New York erzählen – das ist die Redewendung, die ich momentan mit guten Ergebnissen auf ihre Wirksamkeit überprüfe. Dabei bin ich noch nie in Bulgarien gewesen …
Die Erde ist nun einmal größer als ein Menschenleben, daher ist die Chance riesengroß, dass man selber Maßgebliches vom touristischen Kanon nie gesehen hat und auch niemals im Leben zu sehen bekommt. Das eigentlich Interessante am Reisen kommt beim Prunken mit und Abhaken von Standards sowieso nie zur Sprache: Was genau wäre es denn, das eine bereiste Stadt, eine betrachtete Landschaft der eigenen Lebenserfahrung beglückend hinzufügen? Schließlich ist es etwas anderes, ob jemand in Madrid einen Sprachkurs absolviert, eine Ferienwohnung gefunden und täglich auf dem Markt eingekauft und für spanische Freunde gekocht hat oder ob es gerade für eine Stadtrundfahrt im Bus reichte. Bin ich Dutzende Male nach Amsterdam gefahren, bis ich die Stadt und auch ihre abseitigen Ecken wie im Schlaf kenne? Oder reicht der Blick vom Deck des Kreuzfahrtschiffes? Eigentlich sollten das alle Reisende für sich selbst entscheiden. Es hängt eben vom Interesse ab, ob mir persönlich die pompejianischen Ausgrabungen im Archäologischen Museum von Neapel so wichtig sind, dass ich mir stundenlang Zeit zur eingehenden Betrachtung nehme. Andere Touristen fahren in jeder Metropole schnurstracks zum Hardrock Café, erwerben ein T-Shirt und nehmen dort mit dem Mobiltelefon ein Selbstporträt auf, um in die Heimat einen Beweis ihrer Reise zu senden. Auch so lässt sich die weite Welt begreifen, ihre Komplexität reduzieren und ein Haken an legendäre touristische Ziele machen.
Worin überhaupt besteht die bleibende Bereicherung durch eine Reise? Für die weitaus meisten Touristen ist das Ziel eines Besuchs im Louvre der Satz: Ich bin im Louvre gewesen. Denn die weitaus meisten Louvre-Besucher werden in riesigen Gruppen durch die Gänge getrieben, bis sie die Mona Lisa aus dreißig Metern Entfernung vage an der Wand hinter getöntem Panzerglas erahnen können, es könnte auch eine billige Reproduktion sein, so wenig sieht man. Dann fotografieren die meisten trotz des Verbotes die Rücken der Vorderleute und den Mona-Lisa-Schatten, traben in der Gruppe wieder durch die Gänge und werden zum Mittagessen gekarrt. Es ist leicht, sich über diese Form des Reisens lustig zu machen oder aufzuregen. Dennoch muss das Erlebnis dieser Stunde so existentiell sein, dass täglich tausende Menschen das Ritual auf sich nehmen und oft auch lange dafür gespart haben werden: ein Lebenshöhepunkt, einmal vor der Mona Lisa. Und ist jemand, der fünf Minuten vor einem Gemälde Vermeers im Haager Mauritshuis meditiert hat, nun partout der kultiviertere, der klügere, der bessere Mensch als die Massen aus dem Louvre oder die gedrängten Kreuzfahrer in der Ermitage? Fünf Minuten sind gegenüber fünf Sekunden auch nicht gerade eindrucksvoll und machen niemanden zum Experten.
Doch gerade darum scheint es beim Tourismus zu gehen: Die Kunden in lächerlich kurzer Zeit zu beeindruckend gewappneten Fachleuten zu machen. Ein Blick in einen beliebigen Reiseband genügt: Auf einen Blick werden hier die Highlights zusammengefasst. Wer nur anderthalb Stunden in Barcelona hat, eilt über die Ramblas und durchs Barrio Gotico, schaut sich Gaudís Tropfsteinkirche von außen an, macht ein Panoramafoto vom Montjuic und verliert sich vielleicht sogar für zwanzig Minuten im Picassomuseum, bevor der Bus weiterfährt nach Valencia. Das klingt furchtbar oberflächlich gegenüber der normalen Bildungsreise von fünf Tagen. Aber fünf Tage sind gegenüber einem ganzen Leben auch nicht viel mehr Zeit als anderthalb Stunden. Für Kennerschaft von Sitten und Mentalitäten, für Sprache und Küche reichen sie nie und nimmer. Umgekehrt sind anderthalb Stunden Barcelona für einen Menschen, der siebzig Wochenstunden in einer Fabrik in Taiwan abdient, vielleicht eine ganz wertvolle Lebenserfahrung. Ich kenne einen alten Mann, der sein Leben in Leningrad verbrachte, und als er mit der Familie irgendwann nach Deutschland ausreisen durfte, hat er von seiner Sozialhilfe so lange gespart, bis es für eine Bustour über Nacht nach Mailand reichte; er hat sich eine Eintrittskarte für Leonardos Abendmahl in der Kirche Santa Maria delle Grazie gekauft, sich vor das Gemälde gestellt und geweint. Wer immer über die Oberflächlichkeit und Beliebigkeit des Massentourismus die Nase rümpft und sich für etwas Besseres hält, der sollte sich fragen, ob er für eine Reise schon einmal ein vergleichbares Opfer gebracht hat.
Der Tourismus ist einer der größten Zweige der globalen Wirtschaft. Anders als beim Ölfördern, beim Kaffeehandel oder der Computerbranche lässt sich das Volumen nur schwer ermitteln. Denn wie hält man in London die Übernachtungen von Geschäftsreisenden und von Touristen auseinander? Welcher Tankwart weiß, ob er da für einen Pendler oder einen Reisenden die Quittung ausdruckt? Rechnet man internationalen Tourismus als klassisches Hin und Her von Im- und Export, fällt die Branche der Inlandsreise unter den Tisch. Und wie stellt man fest, wie viele Restaurants, wie viele Boutiquen und Ärzte nun von Reisenden frequentiert werden und deshalb als Kollateralerträge des Reisens berechnet werden müssten? Doch schon die Näherungszahlen von rund sechshundert Milliarden Euro jährlich, die von der Menschheit für Tourismus ausgegeben werden, ist imposant. Mindestens hundert Millionen Menschen auf der Welt verdienen ihren Lebensunterhalt durch die Reisen der anderen. Fast dreißig Prozent des Welthandels an Dienstleistungen sind Tourismus. Man könnte meinen, dass ohne das Reisen, für das es ja gar keinen existentiellen Grund zu geben scheint, die globale Ökonomie komplett zum Erliegen käme. Würden wir alle plötzlich dieses Hobby aufgeben, dann stürzte der ganze Planet auf einen Schlag in eine nie gekannte Rezession.
Anders als Menschen, die wirklich in einer anderen Kultur leben, sich womöglich für immer dort niedergelassen haben, ist auch der gründlichste und langsamste Tourist unterwegs auf seiner persönlichen Stadtrundfahrt durch die Welt. Nie wird er das dicke Glas seines klimatisierten Busses zur anderen Seite der Wirklichkeit durchbrechen. Wir können alle leicht den Test machen: So oft wir an unserem liebsten Reiseziel waren, sagen wir einmal: Südfrankreich. Reicht diese Erfahrung aus, sich einen Südfranzosen mit allen Fasern zu nennen? Wer ein Häuschen in der Toskana sein Eigen nennt, sollte sich fragen, ob Sprache und Dialekt, katholische Prägung und Großfamilie der Landleute wirklich in seine Mentalität übergegangen sind. Geht man, wenn man New York rasend liebt, in New York auch zum Zahnarzt oder zum Steuerberater? Und am wichtigsten: Würden mich die Menschen in meinem liebsten Urlaubsland als einen der Ihren betrachten? Natürlich nicht. Im Grunde wird dem Tourismus zu viel zugetraut und zu viel aufgebürdet. Würden wir alle akzeptieren, dass wir unterwegs einfach keine Hausmannskost, sondern ganz kleine Häppchen Welt zu uns nehmen, dann wirkte der Tourismus nicht mehr so existentiell. Keiner könnte mehr mit Reisen prunken, sondern müsste kleinlaut zugeben, dass man immer nur an der Oberfläche kratzt – was ja auch schon eine Leistung sein kann. Vor allem würde der Tourismus, als Globalkonsum begriffen, nicht mehr als Statussymbol zählen, sondern wir müssten ihn nach dem Spaß bewerten, den er uns macht – oder auch nicht. Warum tue ich mir das an? Diese Frage haben sich wohl alle Reisenden in mühseligen, unangenehmen Situationen immer wieder gestellt. Dabei ist die Antwort gar nicht so schwer. Reisen erlöst uns ein bisschen aus dem Einerlei des Daheimseins, des Arbeitens und der festgefahrenen Abläufe – ohne diese aber dauerhaft in Frage zu stellen. Das Entscheidende am Reisen ist das Zurückkommen, sonst würden die meisten von uns gar nicht abfahren. Im Grunde bestärkt das Reisen unser Einverständnis mit den vielen Wochen des Jahres, in denen wir keine Ferien haben. Wir wollen vom Kuchen der Welt naschen und doch den Kuchen Heimat behalten, was mit einer Existenz als Reisende trefflich gelingt. Wir wollen die Welt kennenlernen, aber auch nicht zu sehr, denn sonst würden wir uns in ihr verlieren. Würde uns das Reisen vorführen, wie durcheinander, unüberschaubar, zerstritten und kompliziert die Welt ist, würden wir verrückt. Darum suchen wir auf Reisen Authentizität, Überschaubarkeit, Idylle und Verdaulichkeit.
Wir wollen ein bisschen Abenteuer, aber bitte mit zertifiziertem Fremdenführer, Krankenversicherung und Rückholgarantie. Wir wollen dazulernen, aber unser So-Sein bloß nicht in Frage stellen. Wir wollen weit weg, aber diese Erfahrung am liebsten mit unseren Liebsten teilen und uns in der Fremde gemütlich einrichten wie zu Hause. Schon die alten Römer prägten den weisen Satz: Wer mit dem Schiff fährt, verändert zwar den Himmel über sich, aber nicht die eigene Seele. Anders gesagt: Es ist eigentlich egal, wohin man fährt, man reist ja selber immer mit. Diese schlechte Gesellschaft werden wir selbst als Individualabenteurer niemals los.
Der Tourismus ist nach dem Ableben von Faschismus, Kommunismus und in der Krise des Kapitalismus zur weltumspannenden Ideologie geworden, die Araber und Israeli ebenso eint wie Chinesen und Europäer. Während immer neue Mittelschichten in Indien und Brasilien das nötige Restgeld erwirtschaften, um auch endlich losreisen zu können, entwickelt sich der Tourismus zum Spiegelkabinett. Denn eigentlich setzt das Reisen als Lebensform die Sesshaftigkeit der anderen voraus. Der Urlauber, der die Fellachen in ihren Hütten am Nil fotografieren will, würde ziemlich dumm dreinschauen, wenn am Dorfeingang ein Schild hinge: Wegen Urlaubs verwaist. Ein deutscher Steuerberater, ein belgischer Beamter haben naturgemäß das Bürgerrecht (und die nötige Freizeit), den Planeten zu durchqueren. Doch darf das auch der Massaikrieger, der plötzlich Lust bekäme, endlich einmal die Rüdesheimer Drosselgasse oder das Oktoberfest kennenzulernen? Theoretisch wäre das natürlich möglich, doch müssen wir uns erst daran gewöhnen, dass auch die Bereisten mit ihrem Ersparten ebenfalls zu Reisenden werden.
Heute hier, morgen dort, niemals da, immer fort – das ist ein Menschenrecht, das wir vorderhand doch erst einmal uns selbst, aber nicht allen anderen zusprechen möchten. Reisen ist unsere Lebensform geworden, genau wie Internet, Fernsehen, Mode, Sport, und das ähnlich fix, zappend, teuer, konkurrenzhaft. Wer ist schneller und öfter unterwegs? Wer hat seinen Fuß in mehr Länder gesetzt? Welcher Erdteil fehlt noch auf der Liste? Während wir zu Hobby-Ethnologen werden und unsere Nasen in die Gebräuche aller möglichen Völkerschaften stecken, müsste ein Ethnologe den Tourismus als entscheidenden Brauch unserer westlichen Fluchtkultur klassifizieren: Sie gehen nicht mehr alle in die Kirche, sie singen nicht mehr gemeinsame Lieder, sie schauen nicht einmal mehr ein einheitliches Fernsehprogramm – aber verreisen tun sie alle. Und dabei entwickeln wir, die wir uns mit den Reisen vor uns und den anderen ja abheben und auszeichnen möchten, Gebräuche, die sich verdächtig ähneln. Wir schleppen ähnliche Koffer zu denselben Zielen über immer gleich aussehende Flughäfen, stehen zusammen im Stau. Wir liegen in den gleichen Hotelbetten wie unsere Mitmenschen, regen uns über das gleiche schlechte Frühstück auf und schießen dann die gleichen Fotos. Ob wir auch genau dasselbe denken und empfinden?
Als Reisende an die unterschiedlichsten Orte werden wir einander immer ähnlicher. Was das Internet mit den Bildern auf unseren Mattscheiben und auf unserer Netzhaut macht, das tut der Tourismus mit unseren Körpern: Er macht den Erdball zu einem Ameisenhaufen, auf dem wir auf festen Pfaden als kleine Module herumhüpfen und -krabbeln. Wir werden so zum Teil einer globalen Entropie, in der wir individuell verreisen, aber kollektiv auf der Stelle treten.
Und noch magischer: Die Hotspots des Tourismus werden einander dabei immer ähnlicher. Die Unterschiede der Kulturen verwischen sich, wo die Reisekultur sich durchsetzt. Die Souvenirs aus Venedig, Peking und Rio werden in denselben Werkstätten nach denselben Mustern für dieselben Preise gefertigt, nur die Bildsymbole auf den Plastikdosen und Vasen, Tellern und Fächern sind noch unterscheidbar. Wo Touristen sind, wird früher oder später dasselbe Einheitsessen serviert und dieselbe Einheitsmusik gespielt. Das Reisen rechnet die Menschheit auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunter und macht die Welt, um mit Adorno zu sprechen, immer mehr mit sich selbst identisch. War der Sand, in dem ich als Kleinkind an der Nordsee gebuddelt habe, nicht letztlich genau derselbe, in dem ich auch im Sandkasten gespielt hätte?
Dieses Unbehagen am Tourismus, rasend auf der Stelle zu treten, spüren wir unterschwellig. Darum gibt es für Touristen keinen größeren Feind als andere Touristen. Alle wollen abseits der ausgetretenen Pfade marschieren, obwohl sie doch auf dem breiten Trampelpfad unterwegs sind. Alle rümpfen die Nase über die aufdringlichen, dummen Touristen, zu denen man selbst natürlich auch auf einer Pauschalreise keineswegs gehört. Jeder möchte hinterher vom Geheimtipp erzählen, von der exklusiven Anteilnahme an einem authentischen Alltag Eingeborener. Typisch und unverbraucht soll das sein, was wir als untypische Besucher lustvoll verbrauchen. Es ist genau wie mit dem Alter: Alle wollen alt werden, niemand will alt sein. Nach demselben Muster will jeder reisen, aber niemand will Tourist sein. Touristen – das sind immer die anderen. Das muss so sein, denn das Massenphänomen Tourismus verspricht uns Exklusivität, Einzigartigkeit. Wenn wir reisen, kaufen wir das kostbarste Gut: die Illusion, etwas Besonderes zu erleben und dadurch etwas Besonderes zu sein. Es ist dieses Versprechen, das uns zur immensen Aktivität rund ums Reisen anspornt und uns immer wieder aufbrechen lässt. Aber kommen wir so ans Ziel?
PLANEN UND PACKEN – VOM AUFBRECHEN
Wohin soll die Reise gehen? Glücklich sind Zeitgenossen, die sich diese Frage nicht stellen müssen, weil sie sowieso immer an denselben Ort fahren. Wie schon Großeltern und Eltern immer ins selbe Hotel an der Ostsee, dieselbe Strecke an denselben Ort, selber Strandkorb, abends im selben Imbiss dieselben Fischbrötchen und dieselbe Biermarke. Solches Reisen beruhigt manche Leute im unergründlichen Wandel von Jahreszeiten und Geschichte, gibt ihnen die Sicherheit, dass sich der Planet zwar dreht, aber dabei immerhin im Urlaub niemals vom Fleck kommt. Aber wer ist schon so philosophisch oder so bequem, die weite Welt auf den immergleichen Ort zu reduzieren und niemals Lust zu bekommen, sich woanders umzusehen? Menschen, die ihre Urlaubsneugier abgelegt haben, vielleicht weil sie im Beruf schon genug auf Langstrecken herumhecheln, schwärmen von der Stressreduktion: Man kennt das Zimmer, weiß nachts im Halbschlaf den Weg aufs Klo, findet am Frühstücksbuffet sofort die versteckten Leckereien und wird vom Personal wie ein Familienmitglied empfangen. Da gerät das Leben zwischen den Urlauben – etwa in einem Clubhotel auf den immer frühlingshaften Kanaren – zum Reisen, wohingegen das Verreisen sich wie ein wohliges Nachhausekommen anfühlt. Es sind nicht einmal so wenige Menschen, die irgendwann nach dem fünfzigsten Aufenthalt reif sind für die goldene Treuenadel des örtlichen Tourismusvereins – und die Durchreisende und Neuankömmlinge gewöhnlich nerven mit der Besserwisserei: Vor vierzig Jahren gab es hier ja noch nicht einmal ein Schwimmbad. Oder: Seit die Umgehungsstraße fertig ist, da waren Sie noch gar nicht geboren, ist hier endlich abends Ruhe. Oder: Zu meiner Zeit musste man sich die Handtücher noch selber mitbringen. Gewöhnlich dient die gründliche Ortskenntnis anderen Reisenden zu nichts, will man doch schließlich selber die Welt erschließen und nicht in den Fußstapfen von Menschen unterwegs sein, die allzeit nur in den eigenen Fußstapfen laufen. Kurzerhand: Mir ist das Urlaubsabonnement ein wenig unheimlich, schon weil daraus so viel Sicherheit spricht, den passenden, den wahren, den endgültigen Ort für immer gefunden zu haben. Dann bis nächstes Jahr! – das ist die Lieblingsverabschiedung im Herbergsgewerbe, weil dann die künftige Buchung – ob Wirtschaftskrise, Schlechtwetter oder Krankheit – quasi wie ein Naturgesetz vorausgesetzt wird. Es ist wie in der Liebe: Die glücklichsten und längsten Beziehungen sind auch im Urlaub die monogamen. Denn wer immer mal woanders bucht und gerne wechselt, der kehrt womöglich nie mehr zurück.
Wer zu dieser Spezies gehört, dem winkt immerhin das nicht unwesentliche Vergnügen, den nächsten Urlaub detailliert vorzubereiten. Obwohl ich solche Pedanterie im Alltag nicht mag, versorge ich mich vor jeder Reise gewöhnlich mit Fachbüchern, Kartenmaterial, womöglich literarischen und musikalischen Einstimmungen. Nicht, weil der Ablauf des Urlaubs exakt vorbestimmt werden soll; da besteht keine Gefahr, denn es kommt am Ende glücklicherweise ohnehin immer ganz anders. Doch möchte man vorher wenigstens die gröbsten Missgriffe vermeiden, möchte die verlockendsten Ziele nicht übersehen und schlimmstenfalls erst hinterher mitbekommen, dass diese wunderschöne ausgemalte romanische Kathedrale nur ein paar Kilometer nebenan gewesen wäre und bestens in einen freien Nachmittag gepasst hätte. Oder dass der Sonnenschein stets nur auf der Südhälfte der Insel zu erwarten ist. Wenn man dann erst einmal drei Wochen im Wolkenniesel auf der Nordseite vor sich hin grimmt, ist es nämlich gewöhnlich zu spät.
Was die Reiseliteratur angeht, so tut es manchmal gut, dem Rat eines weitgereisten Kollegen zu folgen: Er fraß vor der Tour immer alles Greifbare über sein Ziel in sich hinein, nahm dann aber nie ein Geschichtsbuch oder eine Landschaftsbeschreibung mit, weil er sich die direkten Eindrücke nicht durch die Erfahrungen und Formulierungen anderer überdecken wollte: gut vorbereitet, um dann improvisieren zu können.
Zum Glück gibt es vor dem Reisen die Möglichkeit, das Paralleluniversum des Internets auszuschöpfen. Gerade bei der Urlaubsplanung kommt einem da die unheimliche Eigenschaft des Internets, einen Erfahrungsraum zu simulieren, durchaus zugute: Für jeden Flecken der Welt gibt es Satellitenaufnahmen, Straßenbilder, Youtube-Filmchen, Webcams mit Klimadiagramm. Da kommt man seinem Ziel gewöhnlich mit etwas gutem Willen schon im Wohnzimmersessel angenehm nahe. Hotels und Ferienhäuser lassen sich digital fast schon detektivisch ausforschen, indem man die Verkehrswege der Umgebung checkt und die Distanz zum Strand auf den Zentimeter berechnen kann. Wird es nachts laut? Brauche ich für den Meerblick ein Teleskop? Früher war man da den Versprechungen der Gastgeber und Veranstalter viel schicksalhafter ausgeliefert.
Wenngleich es natürlich keine Garantie gibt, über ein Reiseziel durchs Internet komplett Bescheid zu wissen. Besser so, denn sonst könnte man ja auch getrost daheimbleiben. Auch hier ist ein gewisses Maß an Lockerheit zu empfehlen. Will ich zu viel herausbekommen, verliere ich am Ende die Lust, überhaupt aufzubrechen.