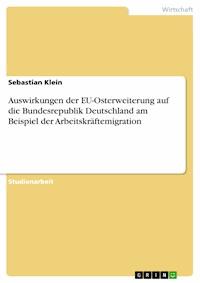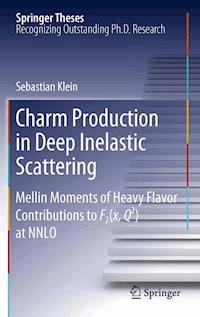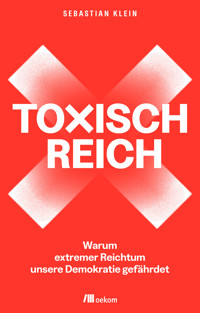
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Extremer Reichtum ist eines der größten Übel unserer Zeit.« Sebastian Klein Sebastian Klein ist durch den Verkauf der App Blinkist über Nacht Multimillionär geworden – und hat daraufhin 90 Prozent seines Vermögens abgegeben. Denn er ist überzeugt, dass großer Reichtum unserer Gesellschaft schadet. In seinem Buch erklärt er, warum große Vermögen in den Händen von Einzelpersonen zutiefst undemokratisch sind, den Klimawandel befeuern und soziale Ungleichheit antreiben. Damit wirft er ein Schlaglicht auf ein Thema, das die Politik gerne in einen Mantel des Schweigens hüllt: die Superreichen und ihre Rolle in dieser Gesellschaft. Warum werden ausgerechnet diese Menschen von der Erbschaftssteuer befreit? Warum wird Arbeit höher besteuert als Vermögen? Und warum können manche Menschen mit dem Privatjet zu Taylor Swift jetten, während andere in Armut leben und ihre Heizrechnung nicht bezahlen können? Kleins Analysen sind nicht nur augenöffnend, sondern auch ein leidenschaftlicher Appell für mehr soziale Gerechtigkeit, für die er konkrete Ideen liefert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SEBASTIAN KLEIN
TOXISCH REICH
Warum extremer Reichtumunsere Demokratie gefährdet
Unter Mitarbeit von Svenja Behrens
https://www.oekom.de/verlag/natuerlich-oekom/c-37
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025, oekom verlag, Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mit beschränkter HaftungGoethestraße 28, 80336 München+49 89 544184 – [email protected]
Umschlag- und Innengestaltung: Linda Rammes, Dominik WagnerSatz: Ines Swoboda, oekom verlagMitarbeit: Svenja BehrensLektorat: Ludger IkasKorrektorat: Katharina Simon
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-98726-405-4
https://doi.org/10.14512/9783987264047
INHALT
Wie ich lernte, dass Geld toxisch sein kann
Wann ist eine Gesellschaft ungleich?
Eine kurze Geschichte der Ungleichheit
HEUTEExtremer Reichtum gefährdet unsere Demokratie
Ungleichheit ist undemokratisch
Vermögen hat immer eine dunkle Vergangenheit
Nicht Leistung macht reich, sondern Erbe
Reiche sind verantwortlich für die Klimakrise
Ungleichheit ist schlecht für die Wirtschaft
Ungleichheit macht politikverdrossen und spaltet
Vermögen schützt vor Strafe
Philanthropie ist undemokratisch
Ungleiche Gesellschaften sind schlechtere Gesellschaften
MORGENReichtum in Wohlstand für alle verwandeln
Eine neue »Leistungsgesellschaft«
Maximale Transparenz
Ein Steuersystem, das der Gesellschaft dient
Chancengerechtigkeit
Neue Eigentumsformen und eine gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft
Regeneratives Kapital
Ein optimistischer Ausblick
Anmerkungen
Empfohlene Lektüre
Dank
WIE ICH LERNTE, DASS GELD TOXISCH SEIN KANN
Klimakrise, Biodiversitätskrise, Demokratiekrise, Hungerkrise, Wirtschaftskrise – während meine Generation noch in dem Glauben aufwuchs, dass alles immer besser werden würde, befindet sich die Welt heute in einem dauerhaften Krisenzustand.
Parallel dazu passiert noch etwas anderes: Die Reichen werden immer reicher. Niemals zuvor in der Weltgeschichte gab es so viel Privatvermögen wie heute. Nur kommt bei den allermeisten Menschen nichts von diesem Wohlstand an.
Dass die Reichsten immer reicher werden und unsere Probleme gleichzeitig immer größer, ist kein Zufall. Die Ungleichheitskrise ist das, was allen anderen Krisen zugrunde liegt und diese wie ein Brandbeschleuniger weiter verstärkt. Der unglaubliche Reichtum in der Hand weniger Menschen wirkt wie ein Gift, das alles zerstört, was unser Leben lebenswert macht. Die Dystopie ist längst Realität geworden: Eine Handvoll Männer ist bereits auf der Suche nach einem anderen Planeten, auf dem sie ihren Wettbewerb um den höchsten Kontostand fortführen kann, wenn sie unseren zugrunde gewirtschaftet hat.
Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Wir haben als Gesellschaft einen unfassbaren Reichtum geschaffen, wir sind so produktiv wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte und wir Menschen sind lern- und anpassungsfähig. Damit sollte sich doch arbeiten lassen! Zunächst müssen wir jedoch verstehen, dass die extreme Konzentration von Reichtum toxisch ist, dass dieser Reichtum auf der Ausbeutung anderer Menschen und unseres Planeten beruht und unsere Demokratie zersetzt.
Ich war selbst einmal Teil dieses Problems: Ich gehörte zum reichsten Prozent der Deutschen. Dabei habe ich hautnah erlebt, was Geld mit Menschen macht und welche Möglichkeiten es eröffnet, sich die Welt so zu formen, wie man sie gerne hätte.
Wer ist hier privilegiert?
Ich bin in einer bayerischen Kleinstadt aufgewachsen, im Einfamilienhaus meiner Eltern, mit großem Garten und Blick auf die Alpen. Privilegiert oder gar reich kam ich mir damals nicht vor.
Reich waren die Kinder, die sich zu Hause 20 Mark aus einer Geldschatulle nehmen konnten, ohne jemanden zu fragen. Die nicht nur einen eigenen Fernseher im Zimmer hatten, sondern auch noch eine Nintendo-Konsole. Deren Eltern nicht VW fuhren, sondern Mercedes. Reich war auch mein Mitschüler, dessen Familie in einer Villa lebte, in der man sich verlaufen konnte.
Ich hingegen war immer pleite. Als mein jüngerer Bruder und ich zu Beginn der Gymnasialzeit jeweils ein Sparbuch mit 2.000 Mark von den Großeltern geschenkt bekamen, zahlte mein Bruder Monat für Monat sein Taschengeld darauf ein, sodass der Kontostand stetig wuchs. Ich gab das Geld nach und nach aus. War es nicht gerade dafür da, sich schöne Sachen zu kaufen?
Erst viel später verstand ich, wie privilegiert ich aufgewachsen war. Ich konnte es mir leisten, mein Geld auszugeben, und falls ich wirklich mal etwas benötigte, könnte ich meine Familie danach fragen. Gewiss, bei uns gab es keine Geldschatulle, an der ich mich einfach bedienen konnte. Doch ich wuchs mit dem sicheren Gefühl auf, dass Geld da war, wenn es gebraucht wurde. Wir fuhren jedes Jahr in den Urlaub, an Weihnachten und für gute Noten bekam ich Geldgeschenke. Ich konnte Freizeitaktivitäten nachgehen und auf Klassenfahrt fahren, ohne befürchten zu müssen, meine Eltern könnten diese Ausgaben nicht stemmen.
Vom Dorf in die Business-Class
Nach dem Abitur zog ich nach Marburg an der Lahn, um Psychologie zu studieren. Aus einer Postkartenidylle in die nächste. Meine Eltern finanzierten mich mit 700 Euro im Monat. Das war deutlich mehr als der damalige Bafög-Höchstsatz, doch mir reichte es vorne und hinten nicht. Mit dem Umzug in eine größere Stadt waren schließlich ganz neue Möglichkeiten entstanden, Geld auszugeben: Ich konnte nun nicht mehr nur ein- oder zweimal pro Woche abends ausgehen, sondern jeden Abend. Auf einmal lebte ich mitten in einer lebendigen Studentenstadt mit all ihren Unterhaltungsangeboten. Um möglichst alles mitnehmen zu können, arbeitete ich in den Semesterferien auf Baustellen und später als Werkstudent an der Universität.
Als im fünften Semester das Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums anstand, machten die meisten meiner Kommiliton:innen unbezahlte Praktika. Das wäre mir nicht eingefallen – um ein unbezahltes Praktikum zu finanzieren, hätte ich meine Eltern um weiteres Geld bitten müssen. Ich informierte mich also, wo ich als angehender Psychologe ein – natürlich möglichst gut – bezahltes Praktikum machen könnte. Das Angebot war überschaubar – und so landete ich bei einer Unternehmensberatung.
2.500 Euro monatlich zahlte mir die Boston Consulting Group, während meine Kommiliton:innen für 300 Euro in Personalabteilungen oder unbezahlt in Kliniken arbeiteten. Ich wohnte kostenlos in einer Firmenwohnung am Münchener Viktualienmarkt, ging auf Firmenkosten in Sternerestaurants essen, und am Flughafen holte mich ein Chauffeur ab, um mich zum Kunden zu bringen. Mit Mitte zwanzig kam ich mir ziemlich wichtig und wertgeschätzt vor.
Meine Kommiliton:innen erzählten mir Horrorgeschichten aus ihren Praktika: Einer hatte die Rolle eines Vollzeit-Therapeuten ausfüllen müssen – ohne einen Cent Gehalt zu bekommen. Am Ende des Praktikums wurde ihm dann für seine Leistung mit einem Büchergutschein gedankt, den er sich doch bitte im Sekretariat abholen sollte. Ich hingegen bekam nach meinem Praktikum ein brandeins-Abo, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke und wurde regelmäßig zu luxuriösen Firmenevents eingeladen.
Zum Abschluss meines Psychologiestudiums 2009 erhielt ich von der Unternehmensberatung ein ausgezeichnetes Angebot für den Jobeinstieg. Ich wurde also Managementberater.
Schmerzensgeld
In meinem Studium war es nie um Geld gegangen, alles hatte sich um Menschen gedreht: Wie tickt die menschliche Psyche? Unter welchen Bedingungen geht es Menschen gut? Wie funktioniert ein so komplexes soziales Gebilde wie ein Unternehmen? In meinem Job spielte nichts davon eine Rolle. Hier ging es nur um Geld. Ich hatte gehofft, dort von erfahrenen Führungskräften lernen zu können und inspirierende Einsichten in die Wirtschaftswelt zu erhalten. Doch die Männer, für die ich arbeitete, interessierten sich ausschließlich dafür, wie hoch ihr Jahresbonus ausfiel.
Ich arbeitete bis spätabends an PowerPoint-Folien und Excel-Tabellen, flog jede Woche in eine interessante Stadt, von der ich dann nur den Flughafen, Taxis, Hotels und Büroräume sah. Aber ich verdiente zum ersten Mal mehr Geld, als ich ausgeben konnte. Neben dem festen Gehalt von etwa 70.000 Euro1 erhielt ich einen Jahresbonus und viele weitere finanzielle Annehmlichkeiten, wie etwa eine private Altersvorsorge, in die für mich eingezahlt wurde. Meine bayerische Kleinstadt-Sparkasse meldete sich und bot in einem persönlichen Gespräch an, mich bei der Vermögensbildung zu unterstützen.
Wie allen meinen Kolleg:innen wurde auch mir schnell klar, dass das viele Geld dazu diente, uns an das Unternehmen zu binden. Mit jedem Jahr winkten satte Gehaltserhöhungen. Die private Altersvorsorge durfte ich nur behalten, wenn ich fünf Jahre blieb. Andernfalls verlöre ich einen Großteil der Ansprüche wieder.
Das Geld fühlte sich an wie Schmerzensgeld. Denn der Job tat mir überhaupt nicht gut. Ich merkte, wie ich mich im Privaten veränderte, ungeduldiger und aggressiver wurde, weil ich mich den Sitten im Unternehmen anpasste. Ich versuchte, die innere Leere, die durch den Job entstand, mit Konsum zu füllen. Ich kaufte Dinge, die ich eigentlich nicht brauchte, und fühlte mich danach nur noch schlechter, weil ich keine Zeit hatte, sie zu benutzen.
Die meisten meiner Kolleg:innen nahm ich als unfrei und unglücklich wahr. Als ich eines Abends mit meinem Chef im Taxi über die Hamburger Reeperbahn fuhr, sagte er aus dem Fenster sehend: »Die haben doch auch einen beschissenen Job.« Ich weiß bis heute nicht, ob ihm in diesem Moment bewusst war, dass er unsere Arbeit mit Prostitution verglich.
Schon nach wenigen Monaten wollte ich wieder kündigen. Am Ende hielt ich 15 Monate durch und verließ die Beratung erst, nachdem ich mich erfolgreich mit einer Idee für den Gründungszuschuss des Arbeitsamts beworben hatte.2
Wie schwer kann es sein, Millionär zu werden?
Gemeinsam mit einem Freund, der in einer ähnlichen Beratungsfirma gearbeitet hatte, gründete ich also mein erstes Unternehmen. Wir waren Ende zwanzig und hatten ein klares Ziel: so schnell wie möglich reich werden, um nie wieder arbeiten zu müssen. Ich hatte Psychologie studiert, er war Ingenieur. Aber was konnte so schwer daran sein, ein Unternehmen zu gründen und schnell reich zu werden? In unseren Beraterjobs hatten wir eingetrichtert bekommen, dass wir die Wirtschaftselite waren, und entsprechend selbstbewusst gingen wir zur Sache.
Wir suchten ein Produkt, das sich günstig herstellen und mit großer Marge verkaufen ließ. Unsere Wahl fiel auf kühlende Halstücher, die wir »Penguin Hug« tauften, zu Deutsch: Pinguin-Umarmung. Die Halstücher wurden mit den gleichen Kristallen gefüllt, die auch in Windeln zum Einsatz kommen. Sie nehmen Feuchtigkeit auf, und wenn das Wasser aus ihnen verdunstet, entsteht ein kühlender Effekt. Wir ließen 1.000 Stück in China herstellen, bauten ein Versandzentrum in meinem Schlafzimmer in Berlin auf und versuchten einen Sommer lang, so zu Millionären zu werden.
Von den Tausend Halstüchern liegen noch immer einige in meinem Keller. Am Ende des Sommers hatten wir nur ein paar Tausend Euro umgesetzt. Ich hatte meine Ersparnisse aus dem ersten Job fast aufgebraucht, und dazu lief der Gründungszuschuss des Arbeitsamts aus. Mein Freund ging zurück in die Beraterwelt, ich blieb etwas ratlos zurück und bewarb mich als Robben-Ranger an der Ostsee. Meine Bewerbung wurde abgelehnt, also musste ich mir was anderes überlegen.
Wer liest schon Bücher?
Schon während meines Studiums hatte ich – einer der Gründe für meine Geldprobleme – ständig Bücher gekauft, die ich jedoch meist nur zur Hälfte las. Wäre es nicht praktisch, wenn es zu all diesen Büchern gute Zusammenfassungen gäbe, die ich stattdessen lesen könnte? Ich traf einen alten Bekannten aus Marburger Studienzeiten wieder, bei dem sich ebenfalls halb gelesene Bücher stapelten. Gemeinsam bastelten wir den Prototypen einer App für Buchzusammenfassungen, die wir später »Blinkist« tauften. Das war 2011: Das iPhone war erst wenige Jahre zuvor auf den Markt gekommen und Apps waren der heißeste Scheiß in der Welt der Gründer:innen. Wir suchten uns zwei weitere Mitgründer sowie Investor:innen und gründeten eine GmbH.
Dafür musste ich mir Geld von meinem Vater leihen, was mir mit fast dreißig sehr unangenehm war. Die nächsten Jahre waren in finanzieller Hinsicht eine schwierige Zeit: Als Gehalt zahlten wir uns jeweils 2.000 Euro brutto aus, und die rund 1.400 Euro netto reichten bei mir gerade mal für Miete und Essen. Ich rutschte immer weiter in den Dispo, am Geldautomaten sah ich weg, wenn der Kontostand angezeigt wurde. Meine bayerische Sparkasse rief wieder an und bot mir einen Kredit an, um die hohen Dispozinsen zu reduzieren. Sorge, ich würde meine Schulden nicht begleichen können, schienen sie nicht zu haben. Schließlich war auch der Rest meiner Familie dort Kunde.
Wie die meisten Start-up-Gründer:innen waren wir überzeugt, mit unserem Angebot die Welt zu erobern. Eine Zeit lang müssten wir zwar von unserem kleinen Gehalt leben, doch, so unsere Vorstellung, wenn wir das Unternehmen nach ein paar Jahren verkauften und auf einen Schlag reich wären, würden wir mehr als entschädigt.
Mir fiel schnell auf, wie homogen die Berliner Start-up-Szene war: Die meisten Gründer:innen waren Männer aus wohlhabenden bis sehr reichen Familien. Viele waren ehemalige Berater-Kolleg:innen. Mir selbst öffnete meine Beratervergangenheit viele Türen, besonders zu Investor:innen. Auch unser Gründungsteam war – gemessen an der Gesamtgesellschaft – privilegiert, aber mit den Gründer:innen, die ihr Unternehmen jahrelang selbst finanzierten, konnten wir nicht mithalten. Weil uns die Ressourcen fehlten, mussten wir von Anfang an einen Teil des Unternehmens an Investor:innen verkaufen.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal, was ein Venture-Capital-Investor ist. Erst später wurde mir klar, dass wir uns schon bei der Gründung unseres Unternehmens in die Fänge des Finanzmarkt-Kapitalismus begeben und uns selbst im Grunde zu Angestellten der Investor:innen gemacht hatten.
Nach ein paar Jahren Start-up-Leben mit steigendem Frust und zunehmenden Konflikten mit meinen Mitgründern verließ ich mein eigenes Unternehmen. Meine Anteile an Blinkist behielt ich zwar, musste mir aber einen neuen Job suchen. Ich war Anfang dreißig und verschuldet.
Endlich keine Geldsorgen mehr
Also wurde ich wieder Unternehmensberater – diesmal aber selbstständig und mit einem Fokus, den ich wirklich interessant und wichtig fand: New Work, also die Frage danach, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Schon im zweiten Jahr verdiente ich damit doppelt so viel wie ein paar Jahre zuvor als fest angestellter Berater und ein Vielfaches meines Gründergehalts bei Blinkist.
Meine Blinkist-Unternehmensanteile wurden außerdem von Jahr zu Jahr wertvoller. Zwei Jahre nach meinem Ausstieg verkaufte ich zum ersten Mal einen kleinen Teil und hatte auf einmal zusätzlich zu meinem sehr guten Einkommen 400.000 Euro auf dem Konto. Weil das Geld aus Luxemburg überwiesen wurde, meldete sich meine Bank erneut – diesmal um herauszufinden, ob ich womöglich Geldwäsche betrieb.
Im Jahr darauf verkaufte ich weitere Anteile und wurde Millionär – den größten Teil meiner Unternehmensbeteiligung hielt ich weiterhin. Auf einmal hatte ich keine Geldsorgen mehr. Finanzielle Freiheit zu haben, war wirklich schön – vor allem, weil der Gedanke an Geld mir in den Jahren zuvor immer Beklemmung bereitet hatte. Nun checkte ich häufig meinen Kontostand, weil mir die große Zahl einen Dopamin-Kick gab. Mit der Zeit verlor sich der Effekt, aber was blieb, war ein Gefühl von Sicherheit.
Und weil ich vorher jahrelang so pleite gewesen war, dass ich mir nie irgendetwas kaufen konnte, was mehr als ein paar Hundert Euro kostete, erfüllte ich mir einige Wünsche: Ich kaufte mir ein Hifi-System, einen schönen Anzug und ein Rennrad. Außerdem ließ ich mir eine neue Küche in die Mietwohnung bauen. Mehr fiel mir dann aber auch schon nicht mehr ein. Den allergrößten Teil des Geldes investierte ich in Unternehmen, die ich selbst gründete. Und in andere Unternehmen, die ich unterstützenswert fand.
Mit der Zeit nahm das Thema Geld immer mehr Raum in meinem Leben ein: Wie investiert man eine so große Summe sinnvoll? Wie viel Geld sollte immer als Notreserve auf dem Konto liegen? Wie macht man aus einem einstelligen Millionenvermögen ein zweistelliges? Allein zu wissen, dass die von mir verkauften Anteile von Jahr zu Jahr weiter an Wert gewannen, während mein Geld auf dem Konto sich nicht von selbst vermehrte, verursachte Stress.
In der Zeit, als ich immer pleite gewesen war, hatte ich mich des Geldes wegen unfrei gefühlt. Und nun, als ich viel davon hatte, fühlte ich mich wieder unfrei. Ich dachte ständig über Geld nach, fragte mich, wie ich es möglichst sinnvoll einsetzen und dabei idealerweise weiter vermehren könnte. Gerade die Frage, wie mein Geld gleichzeitig etwas Positives bewirken und sich möglichst schnell weiter vermehren kann, bereitete mir große Kopfschmerzen. Heute weiß ich, dass sich diese beiden Ziele in unserem aktuellen System gegenseitig ausschließen – auch wenn viele der Bücher, die ich für Blinkist zusammengefasst habe, etwas anderes behaupten.
Kurz mal Multi-Millionär
Zu dieser Zeit las ich Thomas Pikettys Buch Kapital im 21. Jahrhundert. In diesem Monumentalwerk beschreibt der Autor sehr eindrücklich, wie ungleich die Vermögen in der Welt verteilt sind und welche Probleme daraus resultieren. Ich war schockiert: Wieso akzeptieren die Menschen ein so großes Maß an Ungleichheit? Warum gehen sie nicht auf die Barrikaden, und wieso fördern selbst Politiker:innen angeblich sozialer Parteien diese Verhältnisse noch?
Mir fiel diese Ungleichheit zunehmend auch in meinem eigenen Leben auf: Ich fühlte mich regelmäßig schlecht, wenn ich mich mit Freund:innen traf, die weniger Geld hatten als ich. Auch in Berlin jeden Tag Menschen zu sehen, die nicht einmal ein Dach über dem Kopf hatten und fremde Menschen nach etwas zu essen fragen mussten, während ich Angst hatte, dass sich mein Geld nicht schnell genug vermehrte, fühlte sich falsch an.
Als wir Blinkist dann an ein anderes Unternehmen verkauften, besaß ich auf einmal über fünf Millionen Euro – so viel waren meine restlichen Anteile inzwischen wert. Schon vorher war mir klar geworden: Ich bin nun selbst Teil des Ungleichheitsproblems. Weil ich lieber Teil der Lösung als Teil des Problems sein wollte, beschloss ich, 90 Prozent meines Privatvermögens aufzugeben. Mit den verbleibenden zehn Prozent, also rund einer halben Million Euro, zählte ich immer noch zu den reichsten fünf Prozent der Deutschen, aber nicht mehr zum reichsten einen Prozent. Warum ich diesen Betrag wählte? Weil er mir reichte, um die Sicherheit zu haben, die ich mir und möglichst vielen anderen wünsche. Für mich gibt es einen Vermögensbereich, in dem ich mich frei fühle: Wenn ich nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Geld habe. Ich persönlich wünsche mir eine Gesellschaft, in der möglichst alle Menschen in diesem Bereich leben können. Und wenn man sich ansieht, wie wohlhabend Deutschland eigentlich ist, wird klar: Genau das ließe sich problemlos realisieren – wären die Vermögen nicht so extrem ungleich verteilt.
Der Rest des Geldes, also die erwähnten 90 Prozent, floss in eine gemeinnützige Organisation, die ich mit meinem Bruder und einem kleinen Team gründete. Oberstes Ziel des Unternehmens: Wir wollen zeigen, wie Geld zu einer positiven Kraft in der Gesellschaft werden kann. Denn der unfassbare Wohlstand, den es in Ländern wie Deutschland gibt, kann auch ganz anders verteilt werden. So, dass die breite Masse etwas von dem Sicherheitsgefühl bekommt, das ich erleben darf. Und so, dass das eine Prozent, zu dem ich kurzzeitig gehörte, nicht mehr so viel Macht hat.
Die Sparkasse aus der bayerischen Kleinstadt ruft mich heute übrigens nicht mehr an. Vor einigen Jahren bin ich zu einer Ökobank gewechselt, weil ich nicht wollte, dass mit meinen Ersparnissen hinter den Kulissen fossile Industrien und Kohlekraftwerke finanziert werden.
Wir müssen endlich über Geld reden
Meine Entscheidung, aus dem einen Prozent auszusteigen, liegt bei Erscheinen dieses Buchs fast zwei Jahre zurück. Die Frage, wieso wir als Gesellschaft ein so großes Maß an Ungleichheit hinnehmen, begleitet mich weiter. Vieles, das ich auf meinem »Geldweg« erlebt habe, steht sinnbildlich für die Art, wie Geld unsere Gesellschaft formt und wie wir damit umgehen. Wir reden nicht darüber, woher Vermögen kommt und wie es verteilt ist, idealisieren Geschichten von Gründer:innen und fragen nicht, wie sie zustande gekommen sind. Wir akzeptieren, dass der ganze Wohlstand, den dieses Land besitzt, bei einer kleinen Gruppe landet, während ein großer Teil der Gesellschaft nichts vom Kuchen abbekommt. Woran das liegt? Zunächst mal hat das strukturelle Gründe: Unser Wirtschaftssystem gründet auf Konkurrenz – jede:r ist sich selbst der:die Nächste und für sich selbst verantwortlich. Und dann gibt es in unserer Gesellschaft einflussreiche, finanzstarke Kräfte, die die Ungleichheit aufrechterhalten. Die Gegenkräfte, die Tolles leisten, arbeiten dagegen mit viel weniger Geld im Rücken.
Ich persönlich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft dauerhaft mit einem solchen Ausmaß an Ungleichheit funktionieren kann. Demokratie und extreme Ungleichheit schließen sich gegenseitig aus. Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begonnen habe, war das eine Vermutung. Jetzt, wo das Buch geschrieben ist, weiß ich es. Und ich möchte es nicht hinnehmen.
Seitdem im mächtigsten Land der Erde die Milliardäre ganz offiziell auch die politische Macht übernommen haben, dämmert es vielen: Unsere Demokratie ist eine Errungenschaft, die wir schützen und verteidigen müssen. Genauer gesagt, müssen wir sie zurückerobern. Dafür müssen wir aber endlich lernen, über Geld zu sprechen. Wir müssen uns fragen, wie Vermögen zustande kommt und wie es verteilt sein sollte. Wie ein faires Steuersystem aussehen soll und wie sich Chancengerechtigkeit herstellen lässt.
Mit diesem Buch versuche ich, mir selbst alle Fragen zu beantworten, die ich rund um das Thema Ungleichheit hatte. Dafür habe ich mit Wissenschaftler:innen, Autor:innen und Sozialunternehmer:innen, mit Vermögenden und Hochvermögenden, aber auch mit Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, gesprochen. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die Glück hatten und mit allen nur denkbaren Privilegien ins Leben gestartet sind. Und mit anderen, die bei der Geburtenlotterie weniger Glück hatten. Das Buch basiert auf diesen Gesprächen und den vielen klugen Büchern, die ich in den letzten Jahren rund um das Thema Ungleichheit gelesen habe.
WANN IST EINE GESELLSCHAFT UNGLEICH?
Als ich angefangen habe, mich mit der Ungleichheit zu befassen, war ich wirklich geschockt: Wie konnte es sein, dass wir als Gesellschaft das alles mitmachen? Wieso akzeptierten wir, dass einige wenige so viel und viele so wenig besitzen? Wieso gingen nicht Millionen Menschen jeden Tag auf die Straße, um eine gerechtere Verteilung des Wohlstands zu fordern? Schließlich ist der Wohlstand im Land das Ergebnis der Arbeit vieler Menschen. Warum sollten sie akzeptieren, dass er nur so wenigen zugutekam?
Zunächst dachte ich, es läge schlicht an mangelndem Wissen: Die Informationen über das unfassbare Ausmaß der Ungleichheit seien einfach bei den meisten Menschen noch nicht angekommen. Also schrieb ich einen Artikel, der die Ungleichheit in ein paar Grafiken sichtbar machte. Für mich war mit diesen Grafiken im Grunde alles gesagt.
In den letzten Jahren haben immer mehr Autor:innen auf die zunehmende Ungleichheit hingewiesen. Neben dem französischen Ökonomen Thomas Piketty meldeten sich auch in Deutschland immer mehr Wissenschaftler:innen zu Wort. Selbst konservative Medien wie die FAZ schrieben regelmäßig über die zunehmende Ungleichheit und wie sie der deutschen Gesellschaft schade. Doch geändert hat sich seither wenig. Und was mich am meisten überrascht hat: Für meine Diagnose, die krasse und sich weiter verschärfende ökonomische Ungleichheit sei das größte gesellschaftliche Problem unserer Zeit, habe ich immer wieder auch Kritik und Widerspruch geerntet. Und zwar nicht nur von Menschen, die sehr reich sind, sondern aus allen Teilen der Gesellschaft.
Immer wieder bekam ich zu hören, Gleichheit sei doch eine Utopie oder gar ein gefährliches Vorhaben, das auf direktem Weg in die Diktatur führe. Ungleichheit sei schlicht eine Realität, mit der wir leben müssten, wenn wir eine freie, demokratische Gesellschaft wollen. Eine andere Kritik ging in die Richtung: Wie kann es sein, dass ein privilegierter weißer Mann sich zu Ungleichheit äußert, wo er doch auf der Gewinnerseite dieses unfairen Systems steht?
Das Thema scheint jedenfalls starke Emotionen, aber auch sehr unterschiedliche Assoziationen zu wecken. Wenn jemand Ungleichheit als Problem benennt, glauben einige Menschen offenbar sofort, dieser jemand wolle alle Menschen exakt gleich machen. Oder er maße sich an, zu wissen, was für alle gut sei. Ich will daher erst einmal das Feld abstecken, um das es mir tatsächlich geht, und das ist die ökonomische Ungleichheit. Genauer gesagt: Es geht mir um die extreme Konzentration der Vermögen bei einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Ebendiese Konzentration – so meine These, die sich während der Arbeit an diesem Buch immer wieder bestätigt hat – wird zunehmend zu einem Problem für die Demokratie. Ich möchte weder, dass alle Menschen exakt gleich sind, noch möchte ich Reichtum an sich verbieten. Es geht mir darum, extremen Reichtum als strukturelles Problem zu erkennen, an dem wir strukturell etwas ändern müssen.
Wenn es um ökonomische Ungleichheit geht, sprechen wir in der Regel über die Ungleichheit der Einkommen. Natürlich ist es problematisch, wenn ein:e Manager:in tausend Mal so viel verdient wie eine Pflegekraft, und auch ein Problem wie der Gender-Pay-Gap muss benannt und angegangen werden. Doch viel größer als beim Einkommen sind die Unterschiede beim Vermögen. Mancher Erbe bekommt nicht das Tausend-, sondern das Millionenfache des Pflegekraftgehalts geschenkt, und das nur, weil er in die »richtige« Familie geboren wurde. Das macht den Erben nicht zu einem schlechten Menschen, aber strukturell ist es ein Problem, das den Kitt unserer Gesellschaft zu zerstören droht. Wenn die einen etwas leisten, ohne dafür ein Stück vom Kuchen zu bekommen, den die anderen ohne Leistung geschenkt bekommen, dann kann das nicht auf Dauer funktionieren. In kaum einem anderen reichen Land gibt es so viele Besitzlose wie in Deutschland.3 In kaum einem anderen Land gibt es so viele Milliardär:innen. Wir sind ein reiches Land, aber der Reichtum kommt nur bei einer sehr kleinen Gruppe an.
Stell dir vor, Deutschland wäre ein Dorf
Stellen wir uns die deutsche Gesellschaft als ein Dorf mit 1.000 Einwohner:innen vor: Das durchschnittliche Nettovermögen in diesem Dorf liegt bei rund 250.000 Euro pro Person. Alle Schulden und Verbindlichkeiten sind von diesem Wert schon abgezogen: Wer beispielsweise eine Immobilie im Wert von 300.000 Euro besitzt, aber noch einen Kredit von 100.000 Euro zur Finanzierung dieser Immobilie abbezahlen muss, der hat ein Nettovermögen von 200.000 Euro. Falls die Person neben der Immobilie weitere Vermögenswerte besitzt, ist ihr Vermögen entsprechend größer.
Klingt zunächst, als ginge es den allermeisten Dorfbewohner:innen gut. Doch die Vermögen sind sehr ungleich verteilt:4 Die ärmere Hälfte der Bevölkerung, die Unterschicht, besitzt praktisch nichts. 100 von ihnen sind sogar verschuldet. Insgesamt sind nur circa 3 Prozent des gesamten Dorfvermögens im Besitz dieser ärmeren 500 Menschen.
Die nächsten 400 Personen bilden die Mittelschicht, die insgesamt rund ein Drittel von allem besitzt. Die reichste Person dieser Gruppe hat ein Vermögen im Wert von 280.000 Euro, besitzt also vielleicht eine eigene Immobilie, möglicherweise auch ein Aktiendepot.
Die reichsten 100 Menschen im Dorf bilden die Oberschicht, allerdings sind die Vermögen auch in dieser Gruppe sehr ungleich verteilt. Die »ärmeren« 90 Personen der Oberschicht besitzen 280.000 bis 1,3 Millionen Euro. Hier treffen wir also Menschen, die neben einer selbst genutzten Immobilie vielleicht noch eine zweite besitzen, eine private Altersvorsorge, Aktien- oder Fonds-Anlagen.
Nun haben wir bereits 99 Prozent der Dorfbewohner:innen kennengelernt – nur das oberste Prozent, die zehn reichsten Personen also, kennen wir noch nicht. Von diesen zehn Personen sind neun reich: Sie besitzen zwischen 1,3 und 5,7 Millionen Euro. Stell dir einen Chefarzt oder Unternehmensberater vor, mit Villa und Porsche und einem üppigen Aktienportfolio.
Ganz am oberen Ende der Verteilung ist eine Person, die extrem reich ist: Ihr gehören über 20 Prozent des gesamten Dorfvermögens. Diese Person besitzt fast so viel wie die ganze Unter- und Mittelschicht zusammen, also 900 Personen. Sie besitzt sogar mehr als die zweit- bis neuntreichste Person zusammengenommen. Diese Person muss nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sie lebt bequem aus den Erträgen der Immobilien, Unternehmen und anderen Vermögenswerte, die ihr gehören. Wie ist diese Person so reich geworden? Ganz einfach: Sie hat ihr großes Vermögen geerbt.
Was die Sache besonders brenzlig macht: Niemand weiß genau, wie reich diese Person ist. Das Dorf führt nämlich kein Register darüber, und da das Vermögen in der Steuererklärung nicht angegeben werden muss, wird es von keiner offiziellen Stelle erhoben. Eine Forscherin, die ermitteln will, wie genau das Vermögen in unserem Dorf verteilt ist, müsste also bei den Menschen anrufen, um sie zu fragen, wie groß ihr Vermögen ist. Dafür würde sie nach dem Zufallsprinzip einzelne Dorfbewohner:innen aussuchen. Das mag nach Fiktion klingen, doch Forscher:innen, die für Studien die Vermögensverteilung Deutschlands ermitteln, müssen dazu tatsächlich zum Telefonhörer greifen. Sie sprechen mit Tausenden von Personen und fragen sie, wie groß ihr Vermögen ist. Da es aber nur wenige extrem reiche Menschen gibt, ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie diese gar nicht erreichen – die Schätzung der Vermögen wird dadurch zum oberen Ende hin immer schwieriger und schlechter. Doch selbst wenn sie den reichsten Dorfbewohner zufällig ans Telefon bekämen: Er redet nicht gern über sein Vermögen. Im Gegenteil: Er tut alles, damit die anderen Dorfbewohner:innen nicht rausfinden, wie gut es ihm im Vergleich zu ihnen geht.5 Wenn die Dorfzeitung über sein Vermögen schreiben will, droht er mit seinem Anwalt.
Die 1.000 Einwohner:innen in unserem fiktiven Dorf entsprechen den ca. 68 Millionen erwachsenen Einwohner:innen Deutschlands. Die eine extrem reiche Person aus dem Dorf, die reichsten 0,1 Prozent, ist in Deutschland eine Gruppe von rund 68.000 Menschen. Ihnen gehört mindestens ein Fünftel von allem, obwohl sie nur ein Tausendstel der Bevölkerung ausmachen.
Wenn ich vor ein paar Jahren gehört habe, in Deutschland gebe es Schichten unterschiedlich vermögender Menschen, habe ich mir das immer wie eine Art Normalverteilung vorgestellt: In der Mitte gibt es eine große Mittelschicht, in der das meiste Vermögen liegt, und an beiden Enden der Verteilung ein paar arme und ein paar sehr reiche Menschen. Tatsache ist jedoch, dass 40 Prozent der deutschen Haushalte so gut wie nichts besitzen und ein paar Tausend Haushalte ein Fünftel von allem.
Weil es keine wirksamen Umverteilungsmechanismen gibt, werden die Vermögensunterschiede außerdem von Jahr zu Jahr größer. Die Vermögen des reichsten Prozents der Deutschen wachsen nämlich auch überdurchschnittlich stark an – und zwar ganz ohne sein Zutun. Das Geld wirft Renditen ab, die die unvermögenden Dorfbewohner:innen durch Arbeit niemals erwirtschaften könnten.
Global gesehen ist die Lage sogar noch krasser: Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verfügt über gut 45 Prozent des gesamten Vermögens. Und während dieses reichste Prozent in den letzten zehn Jahren durchschnittlich die Hälfte des neuen Vermögens auf seinen Konten verbuchen konnte, sind es seit 2020 schon zwei Drittel des Neuvermögens – das ist sechsmal so viel wie der Anteil, der bei den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung gelandet ist. Ganz konkret heißt das: Für jeden Dollar neu entstandenen globalen Wohlstands, den ein Mitglied der ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung erhält, wird ein:e Milliardär:in um 1,7 Millionen Dollar reicher.6 Das führt dazu, dass die Ungleichheit immer weiter zunimmt.
Wann ist eine Gesellschaft ungleich?