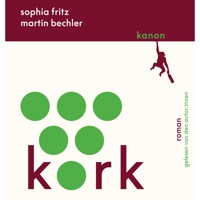Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Dauernd nehme ich Ambivalenzen wahr zwischen dem, was ich will, und dem, was ich tue.“ Sophia Fritz analysiert Weiblichkeit in all ihren Facetten und eröffnet uns dadurch „einen Diskursraum, der spannende Impulse zur feministischen Zukunft liefert.“ Der Spiegel Etwas fühlt sich falsch an: Wenn wir lächeln, obwohl wir eigentlich streiten möchten. Wenn wir unsere Freundinnen ghosten, weil wir Konfrontation fürchten und Konflikte vermeiden wollen. Wenn wir uns für Feminismus einsetzen, aber anderen Frauen* nicht vertrauen und instinktiv nach ihren Fehlern und Schwächen suchen. Was lauert da in uns weiblich sozialisierten Menschen, dass wir uns immer wieder gegen uns selbst und andere richten? In mutiger Selbstbefragung führt uns Sophia Fritz dorthin, wo es weh tut, und zeigt uns ein Phänomen, von dem wir gerade erst begreifen, wie sehr es unsere Lebenswelt bestimmt: Toxische Weiblichkeit. Der Essay der Stunde für alle, die sich nach einem neuen feministischen Miteinander sehnen, von einer der kreativsten und klarsten Denkerinnen der neuen Generation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Sophia Fritz analysiert Weiblichkeit in all ihren Facetten. »Man lernt als Powerfrau so vieles aus diesem Buch — u. a., wieso genau es womöglich kein schlimmeres Wort gibt als Powerfrau.« (Sophie Passmann)Etwas fühlt sich falsch an: Wenn wir lächeln, obwohl wir eigentlich streiten möchten. Wenn wir unsere Freundinnen ghosten, weil wir Konfrontation fürchten und Konflikte vermeiden wollen. Wenn wir uns für Feminismus einsetzen, aber anderen Frauen* nicht vertrauen und instinktiv nach ihren Fehlern und Schwächen suchen. Was lauert da in uns weiblich sozialisierten Menschen, dass wir uns immer wieder gegen uns selbst und andere richten? In mutiger Selbstbefragung führt uns Sophia Fritz dorthin, wo es weh tut, und zeigt uns ein Phänomen, von dem wir gerade erst begreifen, wie sehr es unsere Lebenswelt bestimmt: Toxische Weiblichkeit. Der Essay der Stunde für alle, die sich nach einem neuen feministischen Miteinander sehnen, von einer der kreativsten und klarsten Denkerinnen der neuen Generation.
Sophia Fritz
Toxische Weiblichkeit
Hanser Berlin
feminism begins with sensation
Sara Ahmed
PROLOG
Die ersten sechzehn Jahre bin ich hinter einem Lärmschutzwall aufgewachsen. Ich wusste, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, und hörte, dass der Feminismus deshalb wichtig gewesen, aber jetzt auch überflüssig war. Ich hatte zwei Brüder und ging auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium, das an einen Acker grenzte. Hier gab es keine Queerness, »schwul« war eine Beleidigung, der Bravo lag ein Lipgloss bei. Meine Freundinnen und ich reposteten traurige Filmzitate auf unseren Tumblr-Blogs, und ich legte einen Filter über die Bilder, auf denen ich mich ritzte.
Damals fühlte sich so gut wie alles anstrengend an. Das Dazugehörenwollen, das Beweisenmüssen, die Erstenmale, die Trennung von zu Hause, das Noch-nirgendwo-anders-Sein. Wir zitierten die Betrunkenheit aus amerikanischen Coming-of-Age-Filmen, wir versuchten, die Küsse und Gespräche der Romcoms nachzuspielen, in denen über lange Umwege die große Liebe gefunden wird. Vieles, was heute problematisch wäre, war damals noch romantisch. Edward Cullen zum Beispiel, der sagt, ich liebe dich, aber ich will dich umbringen, und Bella, die sagt, das macht mir nichts aus. Heute wäre das eine Red Flag, vor zehn Jahren war Obsession noch ein anderes Wort für Liebe.
Schon da hatte ich die leise Ahnung, dass sich hier etwas falsch anfühlte, beim Beinerasieren und Rauchen, beim Tragen von H&M-Dessous, beim ersten Sex mit älteren Männern. Ich wusste genau, wie ich Freundlichkeit spielen, wie ich meine Sexualität performen musste, dass ich aushalten und abliefern konnte, was die Welt der Erwachsenen von mir zu erwarten schien. Aus diesem Wissen generierte ich ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Ich machte mit Freundinnen Witze über meinen Nachhilfelehrer, der sich auf einen Flirt mit mir eingelassen hatte, und über meinen Boxlehrer, der nach dem Training seine Hand auf mein Knie legte. Wir ließen uns lachend zu Küssen oder Drinks überreden, zogen an Bongs, kotzten ins Gebüsch. Wir hatten die ersten Dates mit zittrigen Knien, wir wollten alles ausprobieren, nur ja nicht schüchtern, ja nicht langweilig sein. Die Bösartigkeiten der anderen ertrugen wir mit Verwunderung. Ein Junge aus der Oberstufe trennte sich direkt nach ihrem ersten Mal von meiner Freundin. Einer aus meiner Klasse fand mich zu dick. Ich fand, er hatte recht. Sobald ich die Bravo aufschlug und auf die nackten Körper im Bodycheck starrte, war ich irritiert und überfordert und leitete daraus ab, wie sexuelle Erfahrungen zu sein hatten: irritierend und überfordernd. In meiner Schulzeit war »Nein« kein ganzer Satz. Nein war nicht mal eine potenzielle Antwort, außer in der Situation, in der ein fremder Mann einem im Park Süßigkeiten anbietet. Das tat aber niemand, und so konnte ich mein Nein nicht austesten. Stattdessen setzte ich es versteckt ein, getarnt als Migräneanfall, Schule schwänzen und Lügen, später dann in Form von Drogen und Alkohol. Nein war kein Wort, das sich aussprechen ließ. Nein bedeutete Probleme, die ich nicht haben wollte. Mit sechzehn wollte ich nicht bei mir bleiben. Ich wollte mich loswerden und von jemand anderem gehalten und behalten werden.
Ich dachte, die innere Spannung, die sich daraus ergab, war der Ernst des Lebens, auf den man mich seit meiner Einschulung vorbereitet hatte. Ich kannte die Spannung von den schwäbisch-protestantischen Einfamilienhäusern um mich herum, von den müden Eltern und den gestressten Lehrer:innen. Und weil ich sonst nichts kannte, blieb auch ich einfach darin verhaftet. Das fühlt sich gerade nicht richtig an, wäre damals kein Grund gewesen, eine unangenehme Erfahrung abzubrechen. Das Dorf war schweigsam, niemand sprach über das Nicht-Alltägliche. Doch hinter dem Schweigen hörte ich ein Rauschen und wollte es erforschen, ich wollte es ausleuchten, wie man ein fremdes Zimmer ausleuchtet, um sicher zu sein, dass man darin schlafen kann.
Unbehagen
In meiner Kindheit und Jugend habe ich im Internet Bilder von dünnen Frauen rebloggt, die rauchten und dabei wunderschön traurig aussahen. Heute erklären mir Sechzehnjährige auf TikTok, wie ich sanfter mit mir umgehen und meine Bedürfnisse priorisieren kann, wie ich Grenzen setze, meinen Körper liebe, übergriffiges Verhalten erkenne und mir selbst nicht die Schuld für systemisches Versagen gebe.
Es hat sich viel getan. Dank sozialer Bewegungen wie #MeToo und #BLM habe ich gelernt, misogynes oder rassistisches Verhalten an mir und meinen Mitmenschen zu erkennen. Ob sich hinter den Lärmschutzwällen wirklich etwas verändert hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber zumindest verfügen wir inzwischen über einige Begriffe, die Ungerechtigkeiten aufdecken und klar benennen können. Das Schweigen meiner Jugend wird allmählich abgelöst von Begriffen wie catcalling, male gaze oder alte weiße Männer. Noch 2006 schrieb Virginie Despentes in King Kong Theorie, dass zwar eine feministische Revolution im Gange sei, sich an den Konzepten von Männlichkeit bisher aber nichts geändert habe. Doch seit einigen Jahren wird die patriarchale Prägung von Männern kollektiv als egozentriert und dysfunktional enttarnt. Meine Freund:innen und ich nennen es jetzt nicht mehr Weltfrauentag, sondern Feministischer Kampftag, wir lehnen TERFs ab und finden es gut, dass der Paragraf 219a StGB gestrichen wurde. Die Männer in meinem Umfeld korrigieren mich heute beim Gendern und schreiben sich he/him in die Insta-Bio, und die Journalisten-Väter benutzen in ihren Artikeln die Worte Care-Arbeit und Mental Load. Wir erklären unserer Freundesgruppe, warum ein Date toxisch war oder warum sich ein Kommilitone problematisch verhalten hat, wir unterschreiben Petitionen für genderneutrale Sprache an den Hochschulen, wir schaffen Awareness, wir trösten unser Inneres Kind, lästern nur ungern, analysieren lieber mitfühlend mögliche Ursachen für problematisches Verhalten und freuen uns füreinander, wenn wir einen Therapieplatz bekommen haben.
Einer der Begriffe, die für mich und meine Freund:innen in den letzten Jahren besonders hilfreich waren, ist der der toxischen Männlichkeit. Ich nutze ihn, um die Verhaltensweisen von Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen und Partnern schneller einsortieren zu können. Als ich noch kein Verständnis für die Verhaltensmuster hatte, sondern nur das konkrete Verhalten Einzelner erlebte, habe ich mich mit Dingen, die ich heute als Gaslighting, Mansplaining oder männliches Entitlement erkenne und somit als Symptome toxischer Männlichkeit identifizieren kann, länger beschäftigt. Sie ließen mich vernebelt und überfordert zurück, weil ich in diesen Augenblicken auf mich allein gestellt war und den Fehler im Nachhinein bei mir suchte. War ich zu nett gewesen, um das Gespräch zu unterbrechen? Hatte ich ihn provoziert, ihm falsche Signale gesendet? Ist das eigentliche Problem meine Unsicherheit?
Es ist gut, dass wir durch die sozialen Medien die Möglichkeit haben, uns zu vernetzen, uns über unsere Erfahrungen auszutauschen, still mitzulesen und die Auswirkungen des Patriarchats global zu erkennen. Doch obwohl sich diese diffuse Unsicherheit bei der Deutung von maskulin geprägtem Verhalten etwas gelichtet hat, ist sie bei feminin konnotiertem Verhalten nicht kleiner geworden. Wo es vor ein paar Jahren zumindest noch eindeutig feministische und auch eindeutig unfeministische Haltungen gab, kann heute alles feministisch sein: Hausfrau und Girlboss, Waxing und Achselhaare, laszive TikTok-Choreografien, Selbstobjektivierung und traditionelle Hochzeiten. Das einzige Kriterium für den Stempel feministisch scheint die autarke Entscheidungsmacht zu sein. Das ist sehr befreiend — und gleichzeitig hält mich diese einfache Lösung davon ab, einen längeren Blick auf die unversprachlichten Dissonanzen zu werfen, die ich in mir, aber auch in meiner Umgebung wahrnehme, wenn ich auf meine weibliche Prägung schaue: Ich rasiere mich fuckable, ich lüge Männer an, spiele ihnen Lust, Interesse und Mitgefühl vor; ich gratuliere anderen Frauen in meinen Insta-Storys und beneide sie heimlich; ich bemuttere meinen gleichberechtigten Partner; ich bin nicht sicher, ob meine Freundinnen mich wirklich mögen oder ob wir uns nur aus Gewohnheit und Höflichkeit den ganzen Weißweinabend lang anlächeln; ich bin nett zu Kolleginnen und lästere dann über sie; ich reposte empowernde Texte und verbringe anschließend Zeit mit Typen, die mich schlecht behandeln. In unserem Freundinnenkreis machen wir uns darüber lustig, wie emotional unfähig Männer sind, und ghosten uns dann gegenseitig, wenn wir auch bei uns Differenzen bemerken. Dauernd nehme ich Ambivalenzen wahr zwischen dem, was ich will, und dem, was ich tatsächlich tue.
Diese Dissonanzen waren und sind mir immer noch unangenehm. Lange habe ich versucht, sie auszublenden, ich bestellte mir noch ein Glas Weißwein, hörte auf dem Heimweg Musik auf voller Lautstärke, um mir die selbstkritischen Gedanken, das Gefühl der Entfremdung zu verbieten. Ich dachte, dass ich vielleicht einfach kein guter Mensch bin. Ich dachte, dass die anderen das bis jetzt nur noch nicht herausgefunden haben. Doch was ist, wenn wir dieses Unbehagen alle kennen? Wenn es nicht an mir, nicht an dir liegt, sondern etwas viel Größeres dahintersteckt?
Seit einiger Zeit kursiert im Internet ein Begriff, der vielleicht genau das zu fassen versucht, wofür ich bisher keine Sprache habe: toxische Weiblichkeit. Ich möchte über dieses Phänomen schreiben, weil es mich, als ich zum ersten Mal davon hörte, sofort in Aufruhr versetzt hat. Toxische Weiblichkeit — allein die Kombination dieser beiden Wörter triggerte sofort etwas in mir. Da war zum einen die Wut, in meiner Weiblichkeit angegriffen zu werden, zum anderen aber das Unbehagen, eventuell selbst davon betroffen zu sein. Die Reaktionen von Freund:innen und Bekannten bestärkten mich darin, tiefer in das Thema einzutauchen. Nicht weil sie so positiv waren, im Gegenteil. Einige reagierten verärgert und abweisend: Auf keinen Fall lasse ich mir unter dem Deckmantel des Feminismus noch mehr misogyne Konzepte unterjubeln. Andere fragten mich ängstlich, was genau denn jetzt die Symptome für toxische Weiblichkeit seien. Die meisten winkten einfach nur müde ab, genug davon, an Selbstkritik mangelt es uns Frauen ja nun wirklich nicht.
Niemand sagte: Langweilig. Oder: Toxische Weiblichkeit gibt es nicht. Oder: Ich habe mich eingehend damit beschäftigt und das Thema für mich verarbeitet. Oder: Natürlich habe ich toxisch weibliche Eigenschaften, aber das ist doch völlig in Ordnung so. Niemand, inklusive mir, hatte wirklich Klarheit darüber, was genau wir mit dem Begriff meinen. Doch Sprache bedeutet Macht — und Sprachlosigkeit auch Machtlosigkeit. Wir sollten uns den Begriff genau anschauen, um schließlich selbstbewusst sagen zu können, ob es toxisch weibliche Eigenschaften gibt oder nicht.
Toxische Weiblichkeit wird bislang im feministischen Diskurs kaum thematisiert. Männlichkeit galt über Jahrhunderte als ideale menschliche Norm, von der die Frau mit ihrer Hysterie, Einfältigkeit und Sensibilität abweicht. »Eine weibliche Person ist ein fehlgebildeter Mann, somit ist diese Person ein Monster« zitiert Lauren Elkin in Art Monsters Aristoteles. Das Bewusstsein und die öffentliche Rede über eine schlechte, schädliche Weiblichkeit sind in misogynen Gesellschaftsstrukturen seit jeher präsent und werden von Kritiker:innen bislang schlicht unter Frauenfeindlichkeit oder Konservatismus verhandelt. Natürlich werden auch bei der weiblichen Prägung im Patriarchat geschlechterspezifische Verhaltensweisen gefördert, die fernab von Empathie oder Integrität liegen. Es gibt manipulative Partnerinnen, flaky Freundinnen und bitchige Arbeitskolleginnen. Diese Eigenschaften sind aber weder weiblich noch männlich gelesenen Menschen per se zu eigen. Wir alle haben sie übernommen und kultiviert, um in einer patriarchalen Gesellschaft vermeintlich bestmöglich zu überleben. Was bedeutet es also, einen Text über toxische Weiblichkeit zu schreiben, in dem es nicht darum gehen soll, misogyne Konzepte zu reproduzieren, sondern vielmehr darum, sie zu dekonstruieren? Wie lässt sich die Aufzählung und Analyse verschiedener Symptome toxischer Weiblichkeit von frauenfeindlichen Unterstellungen unterscheiden?
Für mich liegt der Unterschied in der Selbst- und Fremdbezeichnung. In patriarchalen Strukturen geht es bei frauenfeindlichen Aussagen häufig darum, Frauen ihre Daseinsberechtigung abzusprechen. Die Frau darf existieren, doch sobald sie die ihr zugewiesenen Grenzen übertritt, muss sie mit Sanktionen rechnen — Diffamierung, Beschämung und Ausgrenzung lassen sich mithilfe eines umfangreichen sexistischen Glossars eindrücklich versprachlichen. Schnell wird aus der hilfsbereiten Mutter eine Glucke, aus der leidenschaftlichen Liebhaberin eine Schlampe, aus der selbstbewussten Chefin eine Diva. Frauen wird durch Fremdbezeichnungen ihre Individualität abgesprochen, sie sind dann plötzlich nur noch ein Prototyp von Weiblichkeit. Von Frau zu Furie zu Fotze verliert sie zunehmend an Menschlichkeit, was unmenschliche Behandlung erleichtert. Es gibt so viele dieser Begriffe, es wäre unmöglich, sie alle aus unserem Sprachgebrauch zu streichen. Fakt ist, wir kommen nicht gegen sie an, also müssen wir sie uns greifen. Sara Ahmed schreibt in Feministisch leben: »Wir müssen uns Worte aneignen, um Dinge zu beschreiben, denen wir begegnen. Feminist*in zu werden, bedeutet, die Worte zu finden.« Dieses Buch ist ein feministisches Projekt. Statt gegen einzelne misogyne Begriffe anzukämpfen, will ich mich der Gesamtheit des frauenfeindlichen Vokabulars annehmen und es als das erkennen, was es ist: keine wahre Aussage über weiblich sozialisierte Menschen, sondern ein Zeugnis unserer misogynen Gesellschaft.
Für eine frauenfreundliche Selbstkritik möchte ich mich in diesem Text den misogynen Fremdbezeichnungen des guten Mädchens, der Powerfrau, der Mutti, des Opfers und der Bitch widmen und verstehen, auf welchen stereotypen Grundlagen sie beruhen. Ich will den Raum öffnen für ein Nachdenken über toxisch weibliche Eigenschaften und nachvollziehen, wie sie uns und unseren Beziehungen schaden. Gleichzeitig werde ich genau dort all das Positive, all die wertvollen, kreativen Ressourcen weiblicher Prägung aufzeigen, die von misogyner Sprache bisher unterdrückt, dämonisiert und unsichtbar gemacht werden.
Erst wenn wir unsere eigene Prägung verstehen, können wir bewusst entscheiden, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen wir beibehalten und welche wir zugunsten größerer Empathie und eines Mehr an Gelassenheit und echter Nähe ablegen wollen. Es gelingt mir dabei nicht immer, meine eigene internalisierte Misogynie sauber von den Analysen zu trennen. Besonders im Kapitel über den Prototypen der Bitch bin ich auf das erschreckende Ausmaß meiner eigenen Verachtung gegenüber Frauen gestoßen. Trotzdem werde ich mich auch und ausdrücklich mit den dunklen Seiten meiner Prägung auseinandersetzen, denn ich halte es für den ersten Schritt in einem idealerweise gemeinschaftlichen Prozess der unerschrockenen Selbstkenntnis. Wahrscheinlich sprechen wir in einigen Jahren schon ganz anders über diesen Begriff, ich jedenfalls bin sehr gespannt auf die kollektive, intersektionale Sicht auf ein Thema, welches bisher lieber gemieden wird.
Um nicht von meiner individuellen Erfahrung einer weißen, christlich erzogenen, mittelständisch privilegierten Cis-Frau auf die Gesamtheit aller weiblich sozialisierten Menschen innerhalb dieses kulturellen Kontextes zu schließen, habe ich getan, was ich immer tue, wenn ich an meine Grenzen stoße: Ich habe gefragt und gelesen und gefragt und diskutiert und noch einmal nachgefragt. Die Fragestellungen und Erkenntnisse dieses Buches beruhen auf unzähligen Gesprächen mit Müttern, Freund:innen und Kolleg:innen, Interviews mit Expert:innen aus den Bereichen der Sexarbeit, der Psychotherapie, der Pädagogik und der traumasensitiven Körperarbeit, der Lektüre zeitgenössischer feministischer Literatur (ich bin eine Zwergin auf den Schultern von Riesinnen) — und circa 20 Jahren engagiertem Konsum westlicher Popkultur.
Besonders im Vorfeld des eigentlichen Schreibens habe ich lange mit Freund:innen über meine Bedenken gesprochen. Wir fragten uns, ob wir uns nicht vielleicht erst in ein paar Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten über toxische Weiblichkeit unterhalten sollten, erst wenn wirkliche und nachhaltige Gleichberechtigung erkämpft wurde. Denn: Ist es wirklich immer nur an uns, zu korrigieren und zu wachsen? Wir fragten uns auch, ob die Diskursverschiebung hin zur toxischen Weiblichkeit dem feministischen Kampf schaden könne, da die Wortdopplung eine Gleichsetzung der Bedrohung nahelegt, die von toxisch männlichem Verhalten ausgeht. Toxische Weiblichkeit ist aber nicht tödlich und sie gilt nicht dem Erhalt einer Machtposition. Im Gegensatz zur toxischen Männlichkeit ist sie eine Notlösung, eine Strategie für das Fortbestehen in einem patriarchalen Gesellschaftssystem.
Ich persönlich fragte mich, ob mir meine Haltung als frauenfeindlich ausgelegt werden wird, weil mein Sprechen über toxische Weiblichkeit als Gegenvorwurf an die Feminist:innen, als Whataboutism missverstanden werden könnte, der sich auf der politisch konservativen Seite verortet. Doch meine Sorgen und Ängste kommen mir vor wie ein Echo, ich kenne sie aus den Büchern anderer Frauen. Und ich kenne auch ihre Antworten. Die Philosophin und Autorin Amia Srinivasan sagt: »Im Feminismus dürfen wir nicht der Illusion verfallen, dass sich Interessen grundsätzlich einander annähern; dass unsere Pläne keine unerwarteten, unerwünschten Folgen haben, dass die Politik eine Wohlfühlzone wäre.« So habe ich mich allen persönlichen Risiken zum Trotz dafür entschieden, dieses Buch zu schreiben, was nicht heroisch ist, sondern notwendig, allein, um diesem ängstlichen Unterton, der immer mitschwingt, wenn mich Freundinnen fragen, was denn jetzt die Symptome toxischer Weiblichkeit seien, selbstbewusst begegnen zu können. Ich habe keine Deutungshoheit über den Begriff und will sie auch nicht haben, stattdessen wage ich lieber einen ersten Anstoß, in der Hoffnung, dass es uns auf diesem bisher unbetretenen Pfad endlich gelingt, dem Selbstzweifel, den hohen Standards, der schnellen Verurteilung, die dem Frau-Sein innewohnen, den Stachel zu ziehen.
männlich, weiblich, toxisch
Inzwischen sind wir geübt darin, bestimmte Formen von Gewalt und Ungerechtigkeit zu benennen, die Systematik dahinter zu erkennen und uns auch fern der persönlichen Betroffenheit über sie auszutauschen. Sexuelle und körperliche Gewalt sind klar greifbar und verurteilbar und werden statistisch häufiger von Männern ausgeübt. Psychische Gewalt hingegen ist nicht so gut erforscht wie sexuelle oder körperliche Gewalt, obwohl sie nach neuesten Forschungsergebnissen die häufigste Form von Kindesmisshandlung darstellt und die stärksten Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. Genau wie körperliche und sexuelle Gewalt kann psychische Gewalt keinem Geschlecht zugeordnet werden. Doch im Gegensatz zu den anderen beiden Formen ist für sie keine körperliche Überlegenheit, keine physische Kraft notwendig. Psychische Gewalt wird von Menschen ausgeübt, die eine soziale Machtposition innehaben und von denen andere Menschen (emotional) abhängig sind. Frauen, die in patriarchalen Familienkonstruktionen die Kontrolle über emotionale Bindungen haben, tragen beispielsweise ein erhöhtes Risiko, diese Gewaltform auszuüben, wissentlich oder nicht. Das gilt vor allem in einer Gesellschaft, die diese Form von Gewalt und ihre Auswirkungen noch gar nicht als solche anerkennt. Der negative Einfluss von weiblicher Prägung auf Familie, Freundschaften, Partnerschaften und Arbeitsbeziehungen ist heute noch tabuisiert und kaum erforscht.
Während dominanzgeprägtes Auftreten und gewaltlegitimierende Weltanschauungen als toxisch maskulin gelten, werden emotional übergriffige Verhaltensweisen nicht systemisch problematisiert und schon gar nicht als toxisch weiblich bezeichnet. So beschreibt beispielsweise der Ausdruck »alte weiße Männer« inzwischen ein bestimmtes Stereotyp, doch alte weiße Frauen werden weiterhin als Individuen gesehen, deren Eigenschaften und Denkweisen sich scheinbar zufällig überschneiden. Selbst während des Schreibens ist mir unbehaglich zumute, Frauen Toxizität zu unterstellen oder zu behaupten, dass dieses oder jenes Verhalten »typisch weiblich« sei. Umgekehrt bereitet mir das bei männlich konnotiertem Verhalten keine Gewissenskonflikte. Meine parteiische Hemmung liegt darin begründet, dass ich mich bisher im Protest gegen toxische Maskulinität und das Patriarchat — die böse, schuldige Seite — auf der Gegenseite positioniert habe: Ich war stets Teil des betroffenen, unschuldigen Lagers. Sobald ich zugebe, dass auch innerhalb meines Lagers Widersprüche und Schattenseiten existieren, dass auch wir unseren Teil zum Fehlen von Gleichberechtigung beitragen, verlieren wir unsere Opfer-Identität — und innerhalb dieser Logik auch das Recht, moralische Ansprüche an die Gegenseite zu stellen. Wir wollen uns unsere Verantwortung nicht eingestehen, weil wir befürchten, die mühsam erkämpften Fortschritte wieder zu verlieren, wenn wir als Folge davon zumindest für mitschuldig erklärt werden.
Wenn ich von toxischer Männlichkeit oder toxischer Weiblichkeit spreche, dann meine ich mit Männlichkeit oder Weiblichkeit nicht Männer oder Frauen. Sowohl Männer als auch Frauen als auch nicht-binäre Menschen können toxisch männliche und toxisch weibliche Anteile in sich tragen — wie Andrea Long Chu sagt: »Alle sind weiblich.« An den Begriffen männlich und weiblich bzw. maskulin und feminin möchte ich deshalb festhalten, weil an ihnen die Binarität unserer soziokulturellen Prägung deutlich wird. Wenn ich ignorant, aggressiv oder empathielos meine Interessen durchsetze, dann ist das ein toxisch maskulines Verhalten, weil es auf den überlieferten Erwartungshaltungen an Männer aufbaut, unabhängig davon, ob ich mich selbst als Mann identifiziere. Andersherum kann ein kalkulierendes oder hinterlistiges Verhalten als toxisch feminin bezeichnet werden, da es sich an den überlieferten Erwartungshaltungen an Frauen orientiert. Beiderlei Verhaltensweisen können und werden unabhängig vom Geschlecht ausgelebt. Jeder Mensch trägt das Potenzial für toxisch feminine und toxisch maskuline Qualitäten in sich, egal, als was sich die Person selbst identifiziert. Wichtig ist, ob die Person als männlich oder weiblich gelesener Mensch geprägt wurde und dementsprechende Umgangsformen und Verhaltensmuster verinnerlicht hat.
Wie gefährlich toxische Männlichkeit sein kann, beweisen andere Bücher als dieses. Männer begehen häufiger Suizid, sterben früher, sind suchtgefährdeter und werden im Falle einer unnatürlichen Todesursache häufiger von anderen Männern umgebracht. Doch während Männer ausschließlich unter ihrer eigenen Prägung leiden, leiden Frauen unter Männern und unter sich selbst. Toxische Weiblichkeit schadet in erster Linie den Frauen. Sie provoziert Manipulierbarkeit, Illoyalität, Verlogenheit, selbstausbeutendes Verhalten und Machtlosigkeit. Der Kapitalismus profitiert von Arbeitsbienchen mit geringem Selbstwertgefühl, von netten Mädchen, die anderen stets zur Seite springen, von unabhängigen Powerfrauen, fürsorglichen Müttern und kostenlosen Care-Arbeiterinnen. Sie fördern die Produktivität, die Konkurrenz, den Konsum und ermöglichen es Männern außerdem, an ihren Machtpositionen festzuhalten, da Frauen, die sich durch selbstverletzendes Verhalten selbst schwächen, weniger Energie und Fokus für den emanzipatorischen Kampf haben.
Soll es in diesem Kampf aber nicht um eine Angleichung der weiblichen Privilegien an die der Männer gehen, nicht nur darum, uns zu er- und andere zu entmächtigen, sondern um ein grundlegend neues gesellschaftliches Miteinander, das auf essenziellen zwischenmenschlichen Werten wie Liebe und Vertrauen beruht, dann müssen wir uns alle toxischen Seiten gleichzeitig anschauen. Das gesellschaftliche Misstrauen gegenüber Frauen wird nicht abnehmen, indem wir jede Form der Verantwortung von uns weisen und das eigene Selbstverständnis unreflektiert auf dem Mythos der immer unschuldigen, weil strukturell benachteiligten Frau aufbauen. Wir müssen jetzt Verantwortung für die Assoziationen mit dem Begriff toxische Weiblichkeit übernehmen, sodass er in Zukunft nicht von konservativen Gruppierungen oder antifeministischen Männerrechtsbewegungen geprägt werden kann, die sich von der woken Bewegung angegriffen fühlen. Sara Ahmed hat recht, wenn sie sagt: »Kein Wunder, dass Feminismus Angst macht; gemeinsam sind wir gefährlich.«
Wer das Wort toxisch als »vergiftet« versteht, erwartet am Ende des Prozesses vielleicht ein Detox, eine Reinigung, eine Heilung. In meiner Vorstellung sind wir aber nicht hier, um reine, unfehlbare Menschen zu werden und makellose Beziehungen zu führen. Ich denke, dass Konflikte und Irritationen unvermeidbar und auch nicht notwendigerweise toxisch sind. Was wir als toxisch, als schädlich wahrnehmen, ist abhängig davon, was unser übergeordnetes Ziel ist. Als toxisch bewerten wir dann die Verhaltensmuster, die uns davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen, oder uns dazu bringen, es nur auf Kosten anderer zu erreichen. Mein Ziel ist Begegnung auf Augenhöhe. Und um auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, dürfen wir beispielsweise Mansplainer nicht nur anklagen, sondern müssen selbst damit aufhören, unserem Gegenüber stundenlang aufmerksames Interesse vorzuheucheln. Wenn wir echte Solidarität unter Frauen anstreben, wäre es hilfreich, Konflikte sofort anzusprechen, anstatt sie drei Monate mit chronischen Bauchschmerzen herumzutragen und immer wieder zu versichern, dass »alles okay« sei. Statt zwei Jahre lang unglücklich in einer toxischen Situationship festzuhängen und unsere Zweifel sogar vor den besten Freund:innen zu zensieren, wäre es erstrebenswert, wir hätten genug Selbstwertgefühle, uns zu trennen.
Wenn das Ziel echte Gleichberechtigung ist, müssen wir erst mal einsehen, dass wir diese bisher nicht kennen. Als Menschen sind wir es gewohnt, unsere Umwelt auszubeuten, zu kultivieren, zu domestizieren, zu objektivieren. Wir denken hierarchisch und haben ein unbedingtes Bewusstsein für unseren Status und den der anderen. Dieses hierarchische Denken ist die Grundvoraussetzung für toxisches Verhalten, weil es unser Gegenüber auf seine Stellung uns gegenüber reduziert: besser oder schlechter als ich, dünner oder dicker, dümmer oder schlauer, reicher oder ärmer. Mehr oder weniger wert. In unserer patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft bedeutet der Kampf um Macht das Ringen um die Überordnung. Auf den ersten Blick klingt Überordnung nach männlicher Dominanz, nach physischer, ökonomischer und psychologischer Überlegenheit, doch das verkennt die Macht weiblicher Strategien. Je nach Prägung berufen wir uns auf stereotyp männliche oder stereotyp weibliche Verhaltensweisen, um uns zu unserem Gegenüber zu positionieren — innerhalb unserer binären Strukturen ist das jeweils gegenteilige Verhalten nicht akzeptiert. Als Frau greife ich statt auf Machogehabe daher eher auf die Rolle der fürsorglichen Mutter oder des netten Mädchens von nebenan zurück, um meine Interessen durchzusetzen. Toxische Weiblichkeit ist also die Performance einer Unterordnung, hinter der sich doch der Versuch, Macht und Kontrolle zu erringen, verbirgt. Wie gesagt, es handelt sich um eine Notlösung.
DAS GUTE MÄDCHEN
Vor drei Sommern wurde mit mir Schluss gemacht, und zwar ausgerechnet über einem Bananensplit. Es war warm, wir saßen draußen, mir lief der Schweiß, er druckste herum. Es waren Worte, die eigentlich gar nicht mehr hätten ausgesprochen werden müssen, die nur noch aus Anstand im Raum zwischen uns abgelegt wurden, wie ein Paket ohne Anschrift und Absender.
Ich sagte, es lief doch gut.
Er sagte, du warst einfach zu nett.
Ich starrte auf die Banane und dachte, ist das dein Ernst. Zu nett. Ich zeige dir mal, was zu nett heißt, und das tat ich dann auch und blieb noch drei weitere Stunden bei ihm sitzen und hörte aufmerksam zu, während er mir von der Frau erzählte, in die er eigentlich verliebt war.
Später saß ich frisch verlassen am Küchentisch, lackierte mir die Nägel und wollte nicht darüber reden. Konzentriert blickte ich auf meine linke Hand und antwortete meiner Mitbewohnerin nur mit einer Gegenfrage, warum es diesen Basecoat, also die Schicht, die man auftragen kann, damit der richtige Lack den Nagel nicht beschädigt, nicht auch für Beziehungen gibt. Während der Lack trocknete, bewegte ich mich nicht. Ich blieb lange sitzen und wartete darauf, dass irgendwas in mir gleich mit trocknete. Ich fühlte mich wie betäubt. Ich saß so lange still, bis meine Mitbewohnerin fragte, sag mal, brauchst du gerade eine Hand irgendwo?
Der Ursprung meiner Starre war Scham, und die Scham saß im Bauch. Ich streckte mich auf einer Matte aus, und meine Mitbewohnerin legte ihre Hand auf die Stelle, auf die ich gedeutet hatte. Sie war einfach Zeugin, leise und tröstend. Ich lag still da und fühlte mich beschämt. Als hätte mich ein Vogel angeschissen, und alle hätten es gesehen. Nach einiger Zeit breitete sich die Scham aus, sie schwoll an, wurde heiß, wurde zur Wut. Das ist so ungerecht, dachte ich. Schau, sagte meine Mitbewohnerin, du bewegst deine Füße wieder.
Meine Füße spannten sich an, zuckten. Sie wollten treten.
Super, sagte sie. Mit dieser Wut im Bauch konnte ich wieder tiefer atmen. Irgendwann aufstehen und mich bewegen, aufstampfen und weinen. Später löffelten wir Tiramisu, und ich sagte, danke für die Hand, das tat gut, alles rauszulassen, und meine Mitbewohnerin sagte, jederzeit.
zu nett
Manchmal habe ich das Gefühl, von keiner Beziehung so beschädigt worden zu sein wie von der Konditionierung, ein gutes Mädchen sein zu müssen. Der Anspruch, immer verständnisvoll, nett, aufmerksam, sanft und zuvorkommend zu sein, ist so tief in mir verwurzelt, dass ich ihn unmöglich von meinem Charakter trennen kann. Im Grunde geht es für weiblich sozialisierte Personen immer noch darum, »unter die Haube« zu kommen und niemandem Probleme zu bereiten. Dafür braucht es vor allem soziale Kompetenzen, die ich wirklich in vollem Umfang mitbekommen habe. Ich war so stolz, als einmal die Mutter einer Schulkameradin nach ihrer Geburtstagsfeier bei meiner Mutter anrief und meinte, sie hätte noch nie so ein gut erzogenes Kind erlebt. Ich dachte, wenn ich nur nett genug wäre, würden mir alle Türen offenstehen, und ich will gar nicht bestreiten, dass Nettigkeit Türen öffnet, aber sie kann keine Türen schließen. Als gutes Mädchen bin ich mein Leben lang auf die Kulanz anderer angewiesen. Ich brauche die Niedlichkeit als Camouflage, die Höflichkeit als Schild, die Dankbarkeit als Brücke. Meine Konditionierung als gutes Mädchen verbietet mir, laut oder wütend zu werden, verspielt, frech, stolz oder bestimmend. Sie verbietet mir, die Scheiße beim Namen zu nennen, ohne sie vorher mit vollstem Verständnis und ganz ohne Umstände in wohlriechende Watte zu verpacken.
In ihrem Buch Lieb und teuer: Was ich im Puff über das Leben gelernt habe berichtet die Autorin Ilan Stephani von ihren Erfahrungen als Sexarbeiterin. Stephani erzählt, dass ihr als Tochter einer »anständigen Familie« nach einem sehr guten Abitur praktisch alle Wege offenstanden. Als sie neben dem Studium anfing, im Bordell zu arbeiten, wunderte sie sich erst, warum es ihr ohne jede Vorerfahrung so leichtfiel, die Wünsche ihrer Kunden zu befriedigen. Klaus entspannte sich sofort, als sie erwähnte, dass sie »vor allem Studentin« sei. Sie spürte, dass sie von Michael keine Erektion erwarten durfte, weil ihn das unter Druck setzte. Warum wusste sie all das so intuitiv, obwohl sie bis zu diesem Zeitpunkt nie etwas mit Sexarbeit zu tun hatte? Schnell wird Stephani klar, dass ihre Erziehung zum guten Mädchen verantwortlich ist für diese ungeahnte Expertise. Sie schreibt: