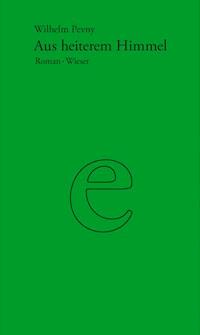Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herbst 1980. Ein junger österreichischer Pianist nimmt am Mozart-Wettbewerb in Turin teil. Der Siebzehnjährige, der sein Gesicht bemalt und sich die Haare färbt, widerspricht in jeglicher Hinsicht den Vorstellungen des Institutsvorstands: "Spielt vor zwei Menschen anders als vor zehn!" – Die Lehrerin, vom großen Talent ihres Schülers überzeugt, hat ihn gegen alle Widerstände als Kandidaten des Konservatoriums durchgesetzt. In dieser einen Woche – "an diesem Donnerstag, an dem die Welt untergehen hätte können" – entscheidet sich Erich Demmlers Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PEVNY • TRANCE
In alter Rechtschreibung ohne ß.
Wilhelm Pevny
Trance
Roman
Die Herausgabe dieses Buches erfolgte mit freundlicher Unterstützung durch die Stadt Wien, das Land Kärnten und das Land Niederösterreich
Gesamtausgabe Wilhelm Pevny Band 2.1
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12 Tel. +43(0)463 37036, Fax +43(0)463 [email protected]
Copyright © dieser Ausgabe 2016 bei Wieser Verlag GmbH, Klagenfurt/Celovec Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-99047-045-9
Inhalt
Allegro moderato.
Solo Klavier, Takt 42–128
Takt 129–246 – Klavier, Orchester.
Kadenz.
2. Satz. Andante.
Allegretto. Takt 71–247
Andante. Takt 247–316
3. Satz. Allegro.
Finale.
Allegro moderato.
Das Licht trüb, wie in einer glasbedeckten Halle. Die Schablonen vor der Sonne hin- und hergezogen, prescht es grell durch die Fenster.
Der mit dem weissgeschminkten Gesicht, bunte Haare, blaue Lippen – Klavierkonzert in Es-Dur, Köchelverzeichnis Nr. 482, von W. A. Mozart. – Am Flügel gegenüber, die zirka Fünfunddreissigjährige: hochgeschlossenes Kleid, mitternachtsblaue Tupfen – ihre Fingerspitzen über den Tasten. Hebt sie den Kopf, lässt er die Hände sinken; die schwarzumrandeten Augen auf das Notenheft gerichtet, aus den Gelenken geschüttelte Akkorde. Reckt er den Nacken, taucht die Hand einer Zwölfjährigen neben seiner Wange auf, erfasst das Notenblatt an der oberen Kante.
Saugt die Wolke das Helle aus dem Raum, sacken die Lichtbalken in sich zusammen. – Die Messingklinke an der weisslackierten Doppeltür: Ein schmaler, schlanker Rücken, randlose Brille, glatte, schwarze Haare. Professor Gerber hebt – entschuldigend, zum Gruss? – die Arme.
Der Blick der Zwölfjährigen, die Augen weit geöffnet, hängt sie in der Musik, vermag sie nicht – das Notenblatt zwischen Daumen und Zeigefinger – dem Institutsvorstand sich zuzuwenden. Noch sechs, noch fünf, noch vier Takte. Der vor dem Klavier neben ihr, hennarote Haare, violette Strähne darin, er nickt. – »Der Bursche passt nicht in diese Stadt«, Monikas Vater hatte den Tabak aus der Pfeife geklopft, war aus seinem Fauteuil gekrochen. – Das Albumblatt, rasch gewendet, federt zurück. Ihre Hand – die Finger fest aneinander – streift es behutsam glatt.
Der zweite der fünf Stühle neben der Tür. Professor Gerber, die Beine übereinander, das grosse gelbe Kuvert neben sich. Klavierkonzert in Es-Dur, zweiter Satz. An die tausend Mal habe er dieses Konzert bereits gespielt, allerdings nicht so wie dieser Kerl dort, Demmler.
»Er spielt laut, wo leise gespielt werden muss, setzt unsinnige Akzentuierungen, die das Taktmass nahezu zerstören. Das Ganze klingt wie Schlagermusik. Ich verstehe nicht, Frau Kollegin, wie Sie diesen Akt der Verrohung gutheissen können.« – Ihre Antwort ärgert ihn noch heute: »Er verändert keine Note, keinen Takt, spielt exakt, was am Blatt steht. Aber was macht er daraus!« – Weshalb blättert heute die Schülerin Weinpert um, nicht sein Adlatus, der anhängliche Zurbriggen. Die Schülerin hat nicht gegrüsst, als er den Raum betrat. Die Wände, soweit er es von hier beobachten kann, tadellos bemalt. Das Parkett einwandfrei geschliffen, glatt versiegelt, alles so, wie er es angeordnet hatte, nur an der Stange des einen Lusters ein schwarzer Striemen, als würde er von der Flamme einer Kerze herrühren, seltsam. Dem muss nachgegangen werden.
Der Anschlag, der Anschlag viel zu grob! Herrgott, hört sie das denn nicht, die Winkler! Unterbrechen. Unterbrechen sollte sie ihn. Nun, mir soll’s recht sein. – Der grelle Balken auf dem Karton des Kuverts leuchtet auf, erlischt wieder. – Um Bach zu spielen, müsse man weise sein, bei Mozart komme es auf die Anmut an. Für die eine Eigenschaft, ein Siebzehnjähriger zu jung, für die andere noch nicht alt genug. Er sage es immer wieder: Liszt. Rachmaninoff, seinetwegen Schumann, Tschaikowsky, Chopin sollen sie spielen, aber doch nicht um Himmels willen Mozart. Egal. In Turin, nächste Woche, ist Demmler sowieso chancenlos. Die roten Haare, das Sakko. Ausserdem gewinnt heuer ein Pole, so lässt es sich verschmerzen, dass zum ersten Mal seit Bestehen des Agnelli-Bewerbes dieser mit keinem Schüler aus der Klasse des Institutsvorstandes … – Die Triole. Weshalb paraphrasiert er die Triole wie eine Quadrill! Die Kollegin scheint zufrieden zu sein. Oh, Gott. –
– Der Mensch in seinem Rücken. Als könnte er ihn riechen, vermöge er den neben der Tür zu spüren, rasen seine Finger über die Tasten. Ein grosser Schatten hat die Stille aus dem Gleichgewicht gebracht. Es ist nicht er, der spielt, es spielt durch ihn hindurch. Er kann sich nicht raushalten, davonstehlen – der Seiltänzer, aus der Balance geraten … Sätze seines alten Klavierlehrers. Der Wind, den man gegen die Wellen bläst, schlägt einem als Flut entgegen. –
»Spielt vor zwei Menschen anders als vor vieren, und vor zehn anders als vor hundert«, Professor Gerber, die Gabel mit dem Fleischstück in der Hand. »Ein Pianist, der keine konstante Leistung zu bringen vermag, kann kein brauchbarer Pianist sein.« Die Augen starr auf den schweigsamen Fünfundsechzigjährigen gegenüber gerichtet: Die Präzision eines Künstlers müsse heutzutage einer Digitalanzeige gleichen. »Nicht, einmal Äpfel, dann Birnen.« Der Happen samt Gabelspitze, zum Mund. »Dieser Demmler lässt sich vom geringsten Hauch umblasen.« Als wäre der geschminkte Kerl mit dem absichtlich verschmutzten Sakko nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Gummi, oder schlimmer noch Papier! Falls man wolle, dass er schlecht spiele, brauche man nur eine unwillkommene Person im Raum platzieren – er lachte, während er das Zerkaute hinunterschluckte. – »Aber manchmal« – Professor Zynefsky, als würde er plötzlich erwachen, stiess die Gabel in die Richtung des Institutsvorstandes –, manchmal spiele Demmler gerade dann eben »so ganz besonders ausserordentlich hervorragend«.
Granatsplitter an der Kopfhaut. Er schlägt den Kragen hoch. Die Ärmel weiss, kreidebeschmiert. Passanten starren auf seinen Rücken – Buchstaben aus durchsichtigem Tixo: »Alle..es.. Scheis..se..«, jubelt ein Zehnjähriger und läuft zu seiner Mutter zurück. Psst, wispert die im grauen Mantel, zerrt an der schmalen Hand. – UHU blinkt es gelb überm Haussims an der Ecke. – Hinein in die Fussgeherzone!
Zieht er den Bug vor seinem Brustbein hoch, gilt es den Anprall der Wellen zu ertragen. Wesen aus verschiedenen Epochen, ineinander verkeilt: Neandertaler, vermurkst mit Marsmenschen, mühsam verbrämte Tiermenschen neben solchen voll aufgeblähter Sachlichkeit. Schleppen dort einige grölend ihre Keulen, piepsen hier andere unentwegt SOS, Weltraum!, stossen hie und dort aneinander, Geknatter, Funken sprühen. – Hat er sich angewöhnt schnell zu gehen, weiss er, dass er in einer Stadt lebt, in der man gelegentlich mit Rempeleien auf ihn reagiert. – »Jetzt überlegen Sie einmal«, Helga Winkler neben dem Klavier, drischt flüchtig den Akkord. »Warum einmal so, und dann wieder so?«
»Bravo!« – der Institutsvorstand war aufgesprungen, »Bravo!« Das grosse gelbe Kuvert in der Hand, schritt er feierlich auf ihn zu. »Wir erwarten von Ihnen einiges, Demmler. Ich bringe Ihnen die Unterlagen für Turin. Hier die Fahrkarten, die Billets Ihrer Begleiter, Stadtpläne, Adresse des Hotels. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Sie persönlich zu verabschieden und Ihnen alles Gute für den Concorso zu wünschen, bei dem wir grosse Hoffnungen hegen …«
Weshalb diese Freundlichkeiten. Hat er Angst, ich könnte den Preis gewinnen und nachher über ihn herziehen? Fürchtet Gerber, ich könnte der Presse stecken, dass er vor einem Jahr Kopenhagen verhindert hat, und ein Jahr davor Bremen und Athen … Würde der Achtundvierzigjährige nicht als einer dastehen, der einem jungen Kollegen den Weg zur Karriere verstellen wollte, die ihm selbst nicht beschieden war. Ja, in den Augen der Stadt gilt Gerber als weltberühmt, bloss weiss die Welt nichts davon. Sein Spiel, das sich vorwiegend auf die brave Ausführung technischer Schwierigkeiten beschränke, habe für London keine Bedeutung. Wie gern hätte Erich nur ein einziges Mal einen solchen Satz in den hiesigen Zeitungen gelesen – das Gegenteil war der Fall: Alexander Gerber, breit angekündigt, die Säle voll … – Hörte denn keiner in dieser Stadt (und leider auch in einigen anderen), was da vorne vor sich ging? Vierzehnjährig wetzte er in der sechsten Reihe auf seinem Stuhl hin und her: Zum Verzweifeln. Wieder einmal einen Trapezakt mit einer biederen Stadtwanderung verwechselt!
Der Institutsvorstand über den Handrücken seiner Kollegin gebeugt, Alles Gute für die Reise! Die Mundwinkel nach oben, die Wangen zu einem Lächeln geballt, die Augen leer. Hatte sie denn nicht bemerkt, dass er alle Triolen, alle Triller falsch apostrophierte? Die Jury in Turin werde solches nicht verzeihen. Das Institut werde in Misskredit geraten, ihr Institut, für dessen Ruf er, Alexander Gerber, verantwortlich sei. Er wünschte, es könnte sich eine Gelegenheit ergeben, seine Kollegin vom Dienst zu suspendieren. Nun ja. Vielleicht war diese Gelegenheit nicht mehr allzufern.
»Warum einmal so, und dann wieder so.« Helga Winkler, am Klavier, Solopart vom siebenundzwanzigsten bis zum vierundsiebzigsten Takt. Wahnsinnig gut. – Fragte er sich, ob er wirklich das Talent habe, das ihm einige zusprachen – so auch seine Lehrerin. Weshalb tritt sie nicht in der Öffentlichkeit auf, sie ist viel besser als alle! – Sie wiederholte einige Triolen. »Warum. Warum einmal so, und dann wieder so. Es gibt keinen Grund.« – »Ich habe es eben so gespürt. Für den Moment war es richtig. Und nichts anderes zählt.« – »Wollen Sie sich bitte an das halten, was im Notenbild verzeichnet ist!« – Sie, die ihm stets grösste Freiheiten liess und falls sie anderer Auffassung war immer argumentierte, heute forderte sie! – Missmutig stapft er am Fischgeschäft an der Ecke vorbei. – Gerade jetzt lasse sie ihn im Stich! Sie habe Angst um ihren Ruf. Quatsch. Er hatte sie blossgestellt. Hatte sie denn nicht immer wieder versucht, das Tempo des dritten Satzes zu verlangsamen, habe er es aber nicht zugelassen. Hab’ ich denn eine andere Wahl gehabt!Versteht sie denn nicht? Gerber! Weshalb fällt sie mir gerade jetzt in den Rücken, verlässt sie ihr Mut? – Ist sie ihm denn in den Rücken gefallen? Sie hatte ihre Kritik erst geäussert, nachdem Gerber draussen war.
Das Ungetüm lässt ihm keinen Platz, bohrt sich den modrigen Gang entlang. Er stolpert, kämpft an gegen den Drall. Dichte Schwaden drücken gegen das Trommelfell. Die fahle Wolke, träge unter dem Gewölbe. Nackter roter Ziegelbogen: Mörtel hängt lose in den Fugen, kurz vor dem Fall. – Fäuste dreschen auf Gitarren ein (fleischige Mutterhände auf Kinderärsche in Gemeindebauten). Nicht auszuhalten. Hinaus! – Verflucht sei meine Empfindlichkeit! – Den Schmerz ertragen, koste es was es wolle; sich auf die Kiste setzen, Christian zunicken und warten, bis Stevies Blick den seinen trifft.
Du fährst auf der Autobahn
in ’nem heissen Ding
Du fährst auf der Autobahn
mit hundertsiebzig dahin
Du sitzt in deiner Kapsel
es ist wie im Film
Doch plötzlich geht das Licht an, und du siehst:
Du sitzt in der Scheisse!
Massen von Flüssigkeiten in ihm, droht er zu zerplatzen. Eine seltsame Erregung. Steigert sich zur Empörung. Glitzernde Gegenstände aus dem Dunkel. Blanke Klingen im Mondlicht. Verdammt, wie gut, wie gut konnte Christian spielen! Wäre er nicht in diesem Scheisskaff von Puffland, er wäre schon längst ganz oben. Ganz oben. Stevie verdrischt das Schlagzeug. Übt stundenlang den gleichen Takt, immer wieder, die Muskeln müssen sich stärken. Christian hackt täglich vier Stunden an der Gitarre herum, Barré, immer wieder den gleichen Griff, und er, Erich Demmler, sitzt die halbe Nacht am Klavier, fünfzigmal dieselbe Passage, hundertmal. Warum? Ist da was drin in ihnen, das raus muss! – Ja, man kann auch anders, denkt er, klein beigeben, mittrotten, aufgeben. Aber, verdammt nochmal, dafür war ihm sein Leben zu schade. Vor dem Abtritt, der Welt noch eins hinfurzen, und die da, die da vor ihm in ihre Instrumente hauen, die wollen dasselbe.
Durchkommen, durch die fette Mauer, die in dieser Stadt so ganz besonders dick ist; reizt es sie gerade deswegen, sich in dieser Stadt aufzuführen, oder ist es … ist es Bequemlichkeit, die sie hier festhält, hat sich der fette Arm schon längst um seinen Hals gelegt?
Stevie grinst. – Erich fühlt sich ertappt: blöder Gesichtsausdruck … bei den Gedanken, die er wälzt! Er versucht zu lächeln, lacht. Verärgert hebt Franz den Bass hoch, knallt ihn an die Wand, die Akkorde zerfallen, Katzengeheul. Dem Irokesen sind die Harmonien zu kompliziert – rücklings an der Ziegelwand, tritt er gegen den Stuhl. Christian fummelt am Verstärker ’rum: Kreischender U-Ton. Stevie reisst die Hände in die Höhe, endlich findet Chris den Regler: »Wir können nicht ewig so weitermachen, immer nur hämmern. Ich bin keine Maschine.« – »Alles ist Scheisse« – will Brian einen anderen Namen für die Band. Die Grifftechnik muss verbessert werden (Christian); die Texte anspruchsvoller sein (Stevie). Angeekelt lehnt Franz an der Mauer – weiss der Irokese ganz genau, wer dahintersteckt: sitzt da im Proberaum, glotzt schleimig vor sich hin, dieser Klavierspieler, Mod, Popper, da könne er noch so punkig tun. Sohn aus reichem Haus. Auch wenn mit dem Vater zerstritten, im Notfall stehe ja doch in Hietzing oder Döbling sein gemachtes Bett.
Oh, Franz kennt sie, die Brut. Nichts ist ihnen radikal genug, solange es nicht um den eigenen Sack geht. Klassische Musik! Hat ihn nicht schon der fette Doolittle seinerzeit mit Beethoven genervt? Mit Stinkbomben haben sie ihn aus dem Klassenzimmer gejagt. Punk rules. Sogar die Bullen haben gepasst. Hatte er doch tatsächlich die Schweine geholt, der Fette mit dem roten Parteibuch. Von Brüderlichkeit quatschen, und die Hä holen. Das ist ihre Kultur. Typisch. Alles Scheisse. Gehört weggeräumt. Scheiss Ruhm. Scheiss Geld. Ist ihm die Tournee wurscht. Um die Geräte geht’s. Ohne Chris keine Verstärker, ohne Stevie kein Schlagzeug. – Verbesserung derGrifftechnik, anspruchsvolle Texte, Bürgersöhnequatsch! Vier Griffe und Ausdauer, das einzige was zählt. Johnny Rotten, Sid Vicious, alles andere, Verrat. Power. Power. Scheiss Grifftechnik – Zieht der Indianer Erich die Kiste unterm Hintern weg, schleudert sie gegen die Wand. »Tastenklimperer« – der Tritt gegen die Kellertür, draussen ist er.
Neben Stevie die Mariahilferstrasse hinauf. Vor dem Musikhaus Bauer bleiben sie stehen: der weisse Petrov-Flügel in der Auslage. Was für eine Wohltat verglichen mit dem Ehrbar-Pianino seiner Tante. (An den Bösendorfer in der Villa seines Vaters will er gar nicht denken!) Stevie kriegt den Blick vom Schlagzeug nicht weg. Bei der Bank gegenüber zahlt er die Raten für seine Drums ab. Die Pneus eines Taxis klatschen schmutziges Wasser aus dem Rinnsal: Hosen und Jacken mit Spritzern übersät. Statt der geballten Faust, Gelächter. Als würde es ihnen jemand befehlen, wenden sie sich gleichzeitig von der Auslage weg, streben wortlos weiter.
Mondsicheln, triefende Pflastersteine. Die Schuhabsätze hallen durch den Innenhof. Hinten die braune morsche Holztür – das Glas über der Klinke zerbrochen, seit Jahren schon. Über dem Steinsims eine ehemals weissemaillierte Tafel: Stiege II. – Gelbgraues Licht explodiert, vertreibt blitzartig die Dunkelheit. Speckige Steinstufen drehen sich vor ihnen steil hinauf – abgetreten, wellig. Wie viele Tritte im Lauf der Jahre, Schuhe, bunte, dunkle, Leder, Stoff, Stiefel, Stöckelschuhe, Sandalen, mindestens hundertvierzig Jahre lang, Kinderfüsse, Sohlen alter Weiber, Hausfrauen, Ärzte, Postbeamte, Kontoristen, Polizisten, Leichenbeschauer, Gerichtsvollzieher, Finanzbeamte, Bauarbeiter, Frauen, immer wieder Frauen, Kinder, heute schon längst tot, treppauf, treppab. Überall Staub in den Fugen: Dünen für Spinnen. – Stevie greift zum Gangfenster hinein, fingert nach dem Schlüssel, hält ihn – eins, zwei, drei – triumphierend in der Hand, findet aber nicht sogleich das Schloss. Endlich knackt es. Grinsend dirigiert er ein paar Takte, dann sein Griff hinter den Türrahmen. – Abrakadabra: Voilà, der Kloschlüssel! Er reicht ihn Erich.
Klirrende Kacheln … Die braune abgeschabte Tür, darüber die schmutzige Scheibe hell. Jemand hat vergessen das Licht abzudrehen. – Drinnen der übliche Gestank. (Neben der Klorolle »Pospischil« – die Nachbarin markiert den Abriss. Sie hom scho wieda mei Klopapia vawendt!) – Die Brille auf der Muschel, ein Schock für die nackte Haut. Eiskalter Luftzug. Muss er warten. Viel zu lange. Scheiss’ schneller, Genosse! Die Kälte beisst. – Endlich der Griff zur Kette, es kracht, das Spülbecken zittert. Wassermassen schiessen den Abfluss hinab, reissen alles mit sich fort. Gut so, denkt Erich, während er die Hose hochzieht. Gut so.
In der Küche, die nackte Glühbirne. Die Kredenz – abgesplitterte Lackkrusten. Bekleckerte Pfannen, Speisereste auf gestapelten Tellern, grindig das Waschbecken; auf dem Linoleum trockene Brotkrümel, in der Ecke ein Papierknäuel. Für heute und die nächsten Tage wissen sie, wo sie die Nacht verbringen: Charly ist bei Gisela und kommt erst Anfang nächster Woche zurück. (Zu Stevie können sie nicht, seine Wohnung bis auf weiteres von der Schwester belegt.) – Die Matratzen am Boden feucht. Aus den Lautsprechern: Alles ist gut von DAF. Erich kriecht unter die Bettdecke, klammert sich an Stevie fest. Pressen sie ihre Körper aneinander, sieht Erich bunte Kreise in der Dunkelheit, ihn fröstelt. (Das warme Bett in der Villa seines Vaters!) Bleib’ stark!, tönt es aus der JBL-Box. Er dreht sich zum Bett hinaus, löscht das Licht.
Alles ist heute schiefgelaufen. Nicht Klavier geübt, auf den morgigen Schultag nicht vorbereitet. Jucken in der Nase, eine Erkältung kündigt sich an. Angst: Der Wettbewerb in Turin. Blöd, falls er jetzt krank würde. In Turin zum ersten Mal mit einem Orchester zusammen, einem richtigen Orchester! Was für ein Traum! Käme er in die Entscheidung, wäre ihm ein Vertrag mit einer Schallplattenfirma sicher. Geld verdienen, endgültig unabhängig sein. Vom Vater. Aber gerade jetzt, da alles einfach sein sollte, ist alles kompliziert. Das Klavier, in der Schule … oder bei seiner Tante üben, allerdings untertags, nicht wie gewohnt abends, in der Nacht. Alles durcheinander. Hätte er heute sechs Stunden üben müssen, dann wären seine Gedanken jetzt klar. Er braucht das. Muss den Schleim aus seinem Körper brennen. Sechs Stunden üben, an einem Tag wie heute. Hat er keine Möglichkeit dazu, wird er krank.
Sich auf Turin vorbereiten, sich sein Leben verdienen. Er hustet trocken. Könnte er es sich einfach machen, sich mit dem Vater versöhnen … – Er lässt Stevie los, dreht sich im Bett herum. Helga Winkler. Sie spielt den zweiten Satz zu langsam. Reagiert nicht, wird nicht schneller. – Franz Zurbriggen, heute früh beim Begräbnis seines Vaters. – Wie wäre es ihm ergangen, falls er mit zwölf, seinen Vater … Damals von einem Tag auf den anderen mit dem Klavierspielen aufgehört. Schluss. Das ratlose Gesicht seines Vaters. Immer wieder das ratlose Gesicht seines Vaters. Mit zwölf, mit acht, mit sechs, mit zwei. Ratlos. Im Fiebertraum. »Das ist deine Mutter« – »Das ist nicht meine Mutter!« – »Doch, das ist sie, deine Mutter.« – »Erkennst du mich nicht mehr, Erich, ich bin’s, deine Mutter!« – Was machen die mit mir … Sie legen mich lebendig in den Sarg. Mutter! Die Ärzte wispern: Er wird sterben. Noch nicht drei Jahre alt, schon sterben. Noch nicht gelebt.
»Das ist deine Mutter.« Das ist sie nicht, Mutter ist weg! Ratlose Gesichter. Der Vater. Die Ärzte. Ein halbes Jahr, ein dreiviertel Jahr, dann sagt er Mutter zur Frau seines Vaters. Alles nur ein verhängnisvoller Fieberwahn. Die Krankheit vorüber. Er steht auf, als wäre nichts gewesen. Spätfolgen? Doch – er macht alles mit der linken Hand. Wird Linkshänder. »Lass ihn Klavierspielen lernen. Ich habe da etwas gelesen von einem amerikanischen Psychologen« – der aus Wisconsin zurückgekehrte Bruder des Vaters, Onkel Ken. Durch das Erlernen oben angeführter Klavierwerke werde der Linkshänder gezwungen, den Organismus der rechten Hand zu verfeinern, gleichzeitig die von ihm bevorzugte Hand zu vernachlässigen. – Elisabettas Einwände – sie mochte Klaviermusik nicht – wurden mit Spässen abgetan. Noch heute erzählt es Onkel Ken prustend: Eine Woche später stand der prunkvolle Konzertflügel im Salon, und Elisabetta Demmler musste zugeben, dass das Klavier genau jenes Möbel war, das man so lange gesucht hatte, um die Seidentapeten zur Geltung zu bringen.
Fliegeralarm. Er schlägt nach dem Wecker, streift ihn, schlägt noch einmal, trifft das Schutzglas, fingert nach dem Knopf, fährt ins Leere, schlägt, drischt mit der Faust. Der Wecker hüpft, tanzt wie ein Bock. Der Verfolger springt auf die Knie, drischt auf die Beute ein. Endlich, endlich taumelt, fällt das Ding vom angeräumten Couchtisch, geht zu Boden. Stille. Endlich still. – Rücklings sinkt er auf die Matratze. Erschöpft. Er will alles, alles, nur eines nicht: Aufstehen.
Die ziegelrote Haarsträhne über der weissen Stirn, blaue Kreissegmente um die Pupillen – starrt er zu den Sprüngen der Zimmerdecke hinauf. Als er klein war, hatten sich die Linien zu Gesichtern verformt. Hexen, Kapitäne. Ganze Geschichten hatte er sich ausgedacht. – Es riecht nach Kaffee. Stevie, bereits angezogen, hebt den Wecker auf, wiegt respektvoll den Kopf, geht zum Plattenspieler, rüttelt am Cover. Talking Heads. »And you find yourself in a beautiful house, with a beautiful wife, and you ask yourself: How did I get here?« – Kein beautiful house, kein beautiful wife, but much ask: How did I get here. Gegenüber, die graue Hausfront – eine alte Frau am Fenster weicht zurück, lässt die Jalousien – wie ein Blitz – herunter. AUF!! Verwundert: Er ist nicht krank, im Gegenteil, fühlt sich gut, fühlt sich gar nicht so schlecht, ganz gut.
Die Brotschnitte zusammengerollt in Stevies Mund. Ein kleiner Fisch in einem grossen. MAMPF. Man versteht kein Wort, er kramt in der Lade. Zum Gerngross muss er, Flugzettel verteilen. Viertel nach sieben, also viertel acht! – Erich springt in die Hose, stülpt die Socken über, zwängt sich in die Schuhe, der Griff zum Hemd, das Sakko! Der Walkman, wo ist der Walkman? Noch eine Minute ohne Walkman, und er würde sterben. (Im Zimmer, auf dem Tisch!) Er knallt gegen den Türstock, die Schulter, er heult auf, dann ist er erleichtert: Batterien sind drin. – Kassette, a-moll-Konzert, Gulda. Er legt die Hörer an, Wollmütze drüber – die Hängetasche, wo ist die Hängetasche (unter den Zeitungen, nein, hinter der Jacke neben der Tür), er reisst sie vom Haken, ein Blick in den Spiegel, er steigt über das Hemd am Boden, hebt mit offenen Schuhbändern ab. »Fly to Sydney Number Ou, Ou, Seven, Two!« schreit Stevie, während er den Schlüssel sucht. »Ruhe«, hallt es vom anderen Ende des Ganges wider.
Solo Klavier, Takt 42–128
Eingezwängt zwischen Mänteln und Hosen kauert er im Triebwagen der Strassenbahnlinie Nr. 58. Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt, auf den Knien – Scheuklappen an den Ohren, Tarnkappe auf dem Kopf: sich vorbeimogeln an den Fussangeln des frühen Morgens. Zuoft an Blicken hängengeblieben, im Kopf zu Schicksalen ausgeweitet, spiessen ihn Empfindungen anderer auf, locken ihn weg, weg von sich selbst, schwört er, sich endlich gegen die Ausdehnungen der Mitlebewesen zu wappnen. Das Presto der Mozart-Sonate in den Ohren, Márquez vorm geschminkten Gesicht, greifen die Kommentare der Mitmenschen ihm durch die Brust: vertrackte Verwünschungen und Flüche, als Ergebnis einer enttäuschten Nacht; überhitzte Kunststoffwäsche, schlecht verdaute Nahrung – drängt ihn der Rücken im Pelzmantel immer heftiger gegen das frostige Fenster. Will die Sonne dahinter nicht aufgehen, an der schwarzen Scheibe sein weisses Gesicht, hinter ihm die neonbeleuchtete Menge. Welche Kraft treibt sie alle zur gleichen Zeit – freiwillig? – an diesen Ort. Ob dem Geschehen in diesem Strassenbahnwaggon ein geheimer Befehl zugrunde liege, den Betroffenen verborgen wie Kühen das Rohrsystem ihrer Melkmaschinen?
Die Fenster beschlagen – Büsche und Bäume draussen noch kaum zu erkennen –, beginnt er, sich an den Geruch des Kamelhaarmantels, vermischt mit der verschwitzten Unterhose neben sich, zu gewöhnen. Je höher der orange Streifen hinter dem reifbedeckten Dach des Technischen Museums hervorkriecht, umso mehr drückt sich der im kreideverschmierten Sakko weg vor dem Tag, der ihn draussen erwartet, bangt er – an seinen Sohlen die Wärme aus den Heizschlitzen – der einen Station entgegen, die seine Reise beenden wird. Frühmorgens, im Bett, hatte er gefleht, er würde niemals hierher müssen an diesen Ort, jetzt wünscht er, die Bahn möge ewig fahren – der Geruch der feuchten Mäntel und verschwitzten Leiber gar nicht mehr so unangenehm. Ellbogenstösse gegen seine Schulter, Ausdruck von verkappter Zärtlichkeit: Woran der Mensch sich doch gewöhnen könne und wie weit es bis zum Hund wohl sei, der die Hand lecke, die ihn schlägt.
Die pneumatischen Türen zischen auf. Fahle Gestalten fallen hinaus, andere, frische, saugt es herein. – Die Fracht, eng zusammengepfercht, ruckelt der Neonschlauch wieder los, rattert schlenkernd die Schienen entlang. Die Frau schräg gegenüber presst mit aufgedunsenen Fingern das illustrierte Thronfolgerpaar gegen ihren Schoss. Ihre Finger reiben am schimmernden Papier, als wollten sie die unsichtbare Grenze zwischen sich und den Abgebildeten durchdringen, während das strahlende Thronfolgerpaar anscheinend vor der drohenden Gefahr erstarrt – oder lechzt es danach, vom zerstochenen Finger endlich berührt zu werden? – Die Achtzehnjährige im vorderen Teil des Triebwagens, eiskalt neben der grauemaillierten Stange, der Lippenstift rasiermesserscharf, die Spitzen ihrer Stöckelschuhe tief in die Unterleiber der Männer gebohrt, schwer atmend sinken sie ihr zu Füssen; ohnmächtig grölend, gefangen in der süssen Qual, stemmen sie die, die eine Puppe aus sich zu machen versucht, mit ihren dicken Bäuchen zum Himmel, schreit die Hochgehievte hoffnungslos einsam um Hilfe. – Der Fremde im grünen Parker, ewig lang schon starrt er die beiden Frauen vor den Gummipuffern des Gelenkteils an. Schenkt die ältere ihm einen Blick nach dem anderen, fasst er die jüngere ins Auge, fährt die ältere ins Leere. Gleitet die Ertrinkende vom glatten Fels, bemerkt sie nicht, dass im Wageninneren ein Schmächtiger ihr im Fallen die Hand entgegenstreckt, greift sie stattdessen verzweifelt nach dem, der sie von sich stösst. – Die Mutter mit den feinen Gesichtszügen wiederum krallt neben ihrem gelockten Gatten die Fingernägel in den Unterarm des greinenden Dreijährigen, sagt die Sätze zu laut, als dass sie für den Kleinen bestimmt wären, ihr Blick über die Schulter zum Schmächtigen mit dem blassen Gesicht im Wageninneren hin, dessen Augenmerk der Älteren im Gelenkteil gilt. Schubst indessen der Blähhals neben der Glanzpapierreiberin sein Lachen wie Keuchhusten vor sich her, während seine Begleiterin weiterhin müde auf die Abgebildeten vor sich starrt, und im Mittelgang die Mutter hinter den Locken ihres Gatten den Schmächtigen sucht, der seinerseits nach der Ertrinkenden äugt, dieweilen der Bläher maulaffenfeil die zerstochenen Finger seiner dicken Begleiterin zerdrückt und gleichzeitig mit aufgerissenen Augen die Hochgehievte neben der Stange durchbohrt …
Ist es wahr, was er zu sehen glaubt: Menschen rund um sich in enge Vorstellungen verstrickt, errichten sie Mauern, als fürchteten sie, wie Wogen ineinanderzuschwappen, ziehen sie Grenzen – emsig bestrebt, sich voreinander zu schützen, gleichermassen ständig bemüht, einander aus der Balance zu bringen, sich gegenseitig auf den Leim zu kriegen, um im nächsten Moment wiederum gegen das Beengende anzurennen; verbarrikadieren sie sich, ziehen sie Zäune hoch, versuchen sie einander mit Masken, Requisiten, Posen und betörenden Gebärden zu blenden, werfen sie Fangnetze übereinander, an deren Enge sie dann zu ersticken, zu zerplatzen drohen, und streben sie, kaum befreit, sofort wieder danach, sich abermals im Garn zu verheddern? Ist es so, wie er es hier an diesem Freitagmorgen im überfüllten Strassenbahntriebwagen zu bemerken glaubt, dass Gefangenschaft – die Mauer – Kennzeichen dieses Lebens sei, oder ist die Enge, in der er sich und die anderen verfangen sieht, nichts anderes als Spiegelung seines eigenen beklommenen Zustands?
Vom Blick einer mit roten Haaren, in abgeschabter Lederjacke, zwei Sitze weiter erfasst, schlägt er das Buch zu, ohne zu wissen was er gelesen hat. Sich nach oben schleudernd drängt er, Mozart im Kopf, zum Ausgang hin. Die pneumatischen Türen klappen auf, gibt er dem Stossen in seinem Rücken nach, obwohl er im Moment nur eines wünscht: den Blick aus schwarzumrandeten Augen ein zweites Mal zu empfangen – mit einer Geschwindigkeit, die er nicht für möglich hielt, löschte es etwas in ihm aus, ein Lichtstrahl, der unvorbereitet aus heiterem Himmel durch ihn hindurchraste, durch Papiermaschee, und etwas in ihm von einem Augenblick zum anderen zu einem Haufen Asche werden liess: weit hinter ihren Augenpaaren hatte es sich kurz aneinandergeschmiegt, tanzte einmal um die eigene Achse und stob dann blitzartig auseinander. – Hinausgestossen, sehnt er sich jetzt nur nach einem: diesen Blick nochmals zu empfangen. Der Schmerz darüber, die Ersehnte fahren lassen zu müssen, beginnt sich in der Mitte seiner Brust, tief im Fleisch festzusetzen, mühsam auszudehnen, zu strahlen, eine kranke Sonne im Smog. Die Strassenbahn bereits in weiter Ferne. Es wäre sinnlos gewesen, sich umzudrehen.
Takt 129–246 – Klavier, Orchester.
X Quadrat P ist Y-mal grösser als E mal Sieben. Berechnen Sie den Quotienten von E. Für Ihre Antwort stehen Ihnen 55 Sekunden zur Verfügung … – Vor ihm – getöntes Glas – das kreisrunde Studio, Scheibe an Scheibe, dahinter die Kabinen der Kurskollegen, in der Mitte ein leerer Tisch. – X Quadrat P ist Y-mal grösser als E mal Sieben. Berechnen Sie den Quotienten von E. Es stehen Ihnen noch vierzig Sekunden zur Verfügung. Stellt er sich zu den jeweiligen Stimmen das dazu passende Gesicht vor. Heute, der Sanfte. – »Geben Sie Ihr Ergebnis bekannt.« – Rasches Gekritzel aufs Papier, am Ende steht eine Zahl. Sein Finger auf den Knopf unterhalb des Mikrofons. Mit lauter Stimme: »Zwölf.«
Das vielgliedrige Gebäude, von den Anrainern der Flughafen genannt – der zentrale Komplex zweiundzwanzig Stockwerke hoch, innen hohl: im achten bis zwölften Obergeschoss die New Vienna International School untergebracht. Sieht der Ankommende an den freischwebenden Aluminiumröhren vorbei bis zur charakteristischen Glaskuppe hinauf – jahrelanger Ausgangpunkt heftiger Auseinandersetzungen zwischen den politischen Parteien; jedesmal wenn er das Centre of Trade and Commerce betritt, drängt sich Erich der Eindruck auf, in eine Art Festung geraten zu sein, deren Satellitentrakte – durch Burggräben getrennt – den zentralen Komplex ringförmig umgeben: Terrassenförmig angelegte Grünanlagen, Bistros und Kaffeegärten dienen Schülern, Angestellten, Kaufkunden und Geschäftsleuten gleichermassen zur Erholung.
In der Aula vor den Aufzügen, wie immer Gedränge. Die rosarote Kurskarte – Mathematik – verschwindet im Kontrollschlitz der Alu-Säule. Auf dem Digitaldisplay, in leuchtend grüner Schrift: Stützpunkt 7, Kabine 4. FINISHED. Die rosarote Karte schnellt heraus, Erich steckt eine weisse in den Apparat, tippt den gewünschten Stützpunkt ins Schreibboard ein, die Digitalanzeige blinkt: R 1: besetzt, M 4: 2 Stunden frei.Er zieht die Karte aus dem Schlitz, legt sie zu den anderen ins Etui. Der Schüler hinter ihm drückt seine Yellow Card in den Computer. Stützpunkt 2, Kabine 24 …
Die Beleuchtungskörper an der Saaldecke, flattriges Licht – obwohl draussen die Sonne scheint. Am Ende des Saales, der schwarze Konzertflügel, schleudert er seine Mappe auf das Klavier, setzt sich hin, klappt den Tastendeckel auf, Steinway. Beginnt er mit Schmitt-Etude Nr.24 – rollende Oktaven aus dem Ärmel geschüttelt. Auf nichts anderes achten als auf die hängenden Schultern und luftigen Ellbogen. Schlaffes Kiefer. Das Gesicht eines Idioten (würde jemand eintreten). Zuerst die Gefühle im Körper herstellen, um sie danach im Zuschauer auszulösen (der alte Hanauer, die Pfeife im Mund). Lust. Freude. Gerber wollte davon nichts wissen. Zucht. Präzision. Ausdauer. »Akkuratesse«, der Lieblingsausdruck des Institutsvorstands. Angehaltener Atem, hochgezogene Schultern, die Arme in exakt 90-gradigem Winkel, zusammengekniffener Hintern, bügelbrettsteifes Rückgrat, angespannte Beinmuskulatur. Disziplin. Kein Wunder, dass sie alle über Rückenschmerzen klagten, Gerber, seine Assistenten. Bandscheibenschäden, erste Anzeichen von Gicht in den Fingern, panische Angst, dass die Gelenke eines Tages nicht mehr elastisch wären. – Spontan? Kreativ? Das mitleidige Lächeln in Dr. Fenz’ Gesicht. Mühselig, ihm zu widersprechen. Besser schweigen und sich dumm stellen. – »Ihr Sohn ist durch und durch verstockt!« –Die beiden Assistenten hatten ihr Opfer gefunden, und es schien sie beinahe in Erregung zu versetzen, eine negative Eigenschaft nach der anderen an diesem eigenartigen Elfjährigen zu entdecken. Nachdem Elisabetta vorgesprochen hatte, war Dr. Fenz dann aber wie verwandelt. Keine Rede mehr davon, nicht zur Kontrollprüfung antreten zu dürfen. Mit Gut und Bemerkenswertem Fortschritt