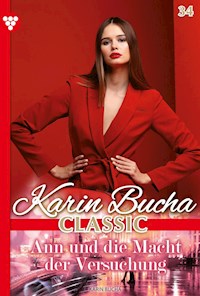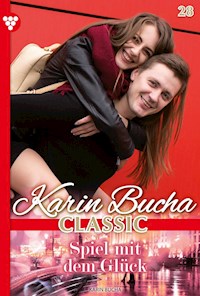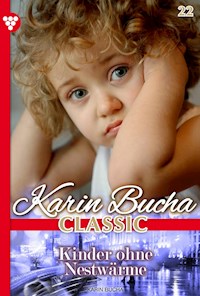Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Dr. Hartmut, Rechtsanwalt und Notar, ließ eine Pause eintreten, als wolle er das, was er soeben verkündet hatte, wirken lassen. Sein kühler Blick glitt über die Brillengläser hinweg reihum. Kein Laut war zu hören. Leontine Eckhardt, die Frau des verstorbenen Fabrikherrn, lehnte stolz und unnahbar in ihrem Sessel. Ihr Gesicht war dicht verschleiert. Also konnte der Notar nicht erkennen, welche Wirkung seine Erklärungen erzielt hatten. Zum Erben meiner Werke setze ich meinen ältesten Sohn, Jost Eckhardt, ein, mit der Bestimmung, daß er seinem Bruder Nikolaus weiterhin dieselben Rechte einräumt, die er bis zur Stunde innehatte. Sollte Nikolaus sich der Herrschaft seines Bruders nicht fügen wollen, kann er sich mit ihm in Güte einigen. Dann kann er sich sein Erbe, das genau die Hälfte aller Werke beträgt, in bar auszahlen lassen. Der Generaldirektor der Werke ist aber Jost Eckhardt. Falls er nicht mehr am Leben sein sollte, treten seine Hinterbliebenen an seine Stelle: seine Frau, seine Kinder – sofern nachgewiesen werden kann, daß sie einen makellosen Ruf genießen und wert sind, eine solche Erbschaft anzutreten. Mein Sohn Nikolaus wird mich voll und ganz verstehen, denn gerade über diesen Punkt waren wir uns stets einig. Meine Schwester Beate, die mir jederzeit ein guter Kamerad war, gehört das Rosenzimmer. Ihren Lebensabend habe ich bereits durch eine Rente sichergestellt. Meiner Frau Leontine erhält monatlich eine Summe, die ihr Notar Hartmut nennen wird. Sollte sie über diesen Betrag hinaus Wünsche haben, muß sie sich vorher mit meinem Sohn Jost besprechen. Von ihm allein hängt die Genehmigung ab. Er wird jederzeit das Rechte treffen und niemals vergessen, was er seiner Mutter schuldig ist. Nun bitte ich meinen Sohn Jost noch vielmals um Verzeihung für meine große Härte, an der allein unser schönes Verhältnis zerbrach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 2 –Tränen um Petra Eckhards Erbe
Karin Bucha
Dr. Hartmut, Rechtsanwalt und Notar, ließ eine Pause eintreten, als wolle er das, was er soeben verkündet hatte, wirken lassen.
Sein kühler Blick glitt über die Brillengläser hinweg reihum. Kein Laut war zu hören.
Leontine Eckhardt, die Frau des verstorbenen Fabrikherrn, lehnte stolz und unnahbar in ihrem Sessel. Ihr Gesicht war dicht verschleiert. Also konnte der Notar nicht erkennen, welche Wirkung seine Erklärungen erzielt hatten.
Er räusperte sich und neigte sich wieder über das Testament Eugen Eckhardts: »Ich komme nun zur Verlesung des eigentlichen Testaments:
Zum Erben meiner Werke setze ich meinen ältesten Sohn, Jost Eckhardt, ein, mit der Bestimmung, daß er seinem Bruder Nikolaus weiterhin dieselben Rechte einräumt, die er bis zur Stunde innehatte. Sollte Nikolaus sich der Herrschaft seines Bruders nicht fügen wollen, kann er sich mit ihm in Güte einigen. Dann kann er sich sein Erbe, das genau die Hälfte aller Werke beträgt, in bar auszahlen lassen.
Der Generaldirektor der Werke ist aber Jost Eckhardt. Falls er nicht mehr am Leben sein sollte, treten seine Hinterbliebenen an seine Stelle: seine Frau, seine Kinder – sofern nachgewiesen werden kann, daß sie einen makellosen Ruf genießen und wert sind, eine solche Erbschaft anzutreten.
Mein Sohn Nikolaus wird mich voll und ganz verstehen, denn gerade über diesen Punkt waren wir uns stets einig.
Meine Schwester Beate, die mir jederzeit ein guter Kamerad war, gehört das Rosenzimmer. Ihren Lebensabend habe ich bereits durch eine Rente sichergestellt.
Meiner Frau Leontine erhält monatlich eine Summe, die ihr Notar Hartmut nennen wird. Sollte sie über diesen Betrag hinaus Wünsche haben, muß sie sich vorher mit meinem Sohn Jost besprechen. Von ihm allein hängt die Genehmigung ab. Er wird jederzeit das Rechte treffen und niemals vergessen, was er seiner Mutter schuldig ist.
Nun bitte ich meinen Sohn Jost noch vielmals um Verzeihung für meine große Härte, an der allein unser schönes Verhältnis zerbrach. Wäre ich früher sehend geworden, hätte ich schon bei Lebzeiten alles wiedergutgemacht. Nun will ich es hiermit nachholen.
Ich lege meinem Sohn oder dessen Erbe dringend ans Herz, mein Lebenswerk in meinem Sinne weiterzuführen und jederzeit Gerechtigkeit walten zu lassen.
Eugen Eckhardt.
Totenstille herrschte in dem großen Konferenzsaal des Notars Hartmut.
Nikolaus Eckhardt schob den Stuhl zurück, stand auf und trat ans Fenster.
Ganz der Vater, dachte Dr. Hartmut. Er erhob sich leise und stellte sich neben ihn.
»Nikolaus!«
Der junge Mann fuhr zusammen. Auch der Notar drehte sich um und sah auf Leontine, die hochaufgerichtet in ihrem Sessel saß. Kalt fiel ihr Blick auf den Sohn.
»Was sagst du zu dem Testament?«
Nikolaus Eckhardt zuckte mit den Achseln. »Das Testament geht in Ordnung«, sagte er bestimmt.
»Niemals!« rief Leontine entsetzt. »Du hast dich jahrelang, seit Vaters Krankheit, um die Leitung der Werke bemüht. Du mußt das Testament anfechten!«
Ein kleines Lächeln huschte um Nikolaus’ Mund.
»Nein! Vater hat aus dem Grabe heraus zu uns gesprochen. Sein letzter Wille und, wie er selber sagt, sein heiligster Wunsch müssen erfüllt werden!«
Leontine Eckhardt stand auf. Groß und hager lehnte sie sekundenlang, nach Fassung ringend, am Tisch. Dann sagte sie kalt: »Ich… ich erkenne das Testament nicht an. Niemals!« Sie nickte kurz und rauschte aus dem Zimmer.
*
»Hilfe – Hilfe – Hilfe!«
Markerschütternd, immer dringlicher und immer verzweifelter wurde der Hilferuf des Ingenieurs Jost Eckhardt.
Vergebliche Mühe, sich von der Last des eisernen Trägers befreien zu wollen. Mit zermalmender Schwere preßte sich die ungeheure Last auf sein schwerverletztes, bis zur Unerträglichkeit schmerzendes Bein. »Hilfe – Hilfe!«
Dort vorn gingen sie. Seine Kameraden. Sie waren mit ihren Gedanken wohl bereits im Kreise ihrer Familien; denn es war Feierabend, und sie strebten schon dem Waschraum zu.
Wo war Detlef Sprenger, sein Freund? War er nicht mit ihm gegangen? Wo blieb er? Er mußte doch in der Nähe sein! Warum kam er nicht und half ihm aus der schrecklichen Lage?
»Hilfe!«
Es war der letzte, schwache Schrei nach Erlösung aus seiner Höllenpein, dann sank der Kopf Jost Eckhardts zur Seite – der Schmerz hatte ihm die Besinnung geraubt.
Wenige Minuten später wollte es der Zufall, daß der Ingenieur Detlef Sprenger, der seinen Freund Jost vermißt hatte, auf der Suche nach ihm endlich den Verunglückten entdeckte.
Gütiger Himmel – was war hier geschehen?
»Jost – Jost!« schrie er auf.
Detlef Sprenger ließ sich auf die Knie fallen, bettete den Kopf des Verletzten in seinen Schoß und erfaßte das Unglück in seiner ganzen Schrecklichkeit.
War Jost tot? War er nur verletzt? Blitzschnell tauchte ein anderes Gesicht vor ihm auf, ein schmales, liebliches Frauenantlitz mit großen, tiefgründigen Augen. Er sah einen blühenden Mund, aber dieser Mund lächelte nur Jost zu, nicht ihm, der Petra Eckhardt über alles liebte…
Mit einer geistesabwesenden Geste strich er sich über Stirn und Augen, als wolle er die unmögliche Gedankenverbindung, die in ihm aufgetaucht war, wieder auslöschen. Petra Eckhardt, die Frau seines Freundes, wie würde sie es aufnehmen?
Er sprang auf, denn inzwischen waren noch andere Arbeitskameraden herangekommen, von denen sofort einige davoneilten, um einen Arzt und einen Krankenwagen zu besorgen. Die anderen befreiten mit vereinten Kräften den Verunglückten.
Mit ernsten Mienen und mitfühlenden Herzen begleiteten die Männer bald darauf die Trage, die man behutsam in den bereitstehenden Krankenwagen geschoben hatte.
Detlef Sprenger sah dem Krankenwagen mit einem seltsamen Blick nach, dann wandte er sich an die Arbeiter.
»Ich bringe selbst die Unglücksnachricht Frau Petra Eckhardt«, sagte er – und fühlte dabei, wie ihm die Kehle vor innerer Erregung trocken wurde.
*
Im Wohnzimmer überprüfte Petra Eckhardt noch einmal den gedeckten Abendbrottisch und nickte befriedigt.
»Jost kann kommen.«
Sie schaute auf die Uhr und trat ans Fenster.
»Wo er nur bleibt?« flüsterte sie, und eine merkwürdige Unruhe überfiel sie. Es war nicht Josts Art, so spät zu kommen.
Petra nahm eine Handarbeit auf, aber ihr fehlte die rechte Sammlung. Bald legte sie die Arbeit wieder aus der Hand und starrte hinunter auf die Straße.
Autos rollten vorüber. Die Laternen übergossen die breite Straße mit einem hellen, fast schmerzenden Licht. Menschen hasteten vorüber.
Petra wandte sich zurück ins Zimmer. Hier war Ruhe, hier war Frieden. In ihrem Heim herrschte das Glück.
Aber – war es wirklich vollkommen, ihr Glück? Trug sie nicht genauso schwer wie Jost an dem Bruch mit den Schwiegereltern?
Warum konnten sie Jost niemals verzeihen, daß er sie, die mittellose Petra, geheiratet hatte? Ach, sie wollte nicht mehr daran denken. Sie wollte glücklich sein im Bewußtsein der Liebe ihres Mannes.
Da schellte die Flurglocke und riß Petra aus ihrer Versunkenheit. Seltsame Empfindungen überfluteten sie, als sie an der Tür stand und die Hand zum Öffnen ausstreckte. Jost pflegte nie zu klingeln, und wer sollte um diese Stunde noch zu ihr kommen?
Zaghaft öffnete sie – und sah sich Detlef Sprenger gegenüber.
»Frau Petra…, darf ich eintreten?«
Ein Frösteln kroch über Petras Rücken. Sie hatte eine tiefe Abneigung gegen Josts Chef, aber immerhin – er war der Chef, und sie hatte ihm dankbar zu sein, daß er Jost seinerzeit die gute Anstellung gab. Aber sie wäre noch weit unruhiger gewesen, hätte sie gewußt, daß sie allein der Grund war, weshalb Jost als Ingenieur bei Sprenger eingestellt worden war.
»Wo… wo bleibt Jost?« fragte sie bebend und lehnte zitternd an der Wand. Zögernd streckte sie die Hand zum Gruß aus, die Detlef Sprenger höflich an die Lippen zog.
»Jost… ist…« Sprenger brach wieder ab. Die angstgeweiteten Augen der jungen Frau ließen nicht über seine Lippen kommen, was unbedingt gesagt werden mußte.
Mit einer stummen Handbewegung lud Petra den Ingenieur zum Eintreten ein. Sie schritt dem Besucher voran und öffnete die Tür zum Wohnzimmer. Dort wandte sie sich erregt an Sprenger.
»Weshalb sprechen Sie nicht? Ich möchte doch wissen, warum Jost nicht heimkommt! Hat er Sie geschickt? So sprechen Sie doch endlich!« stieß sie in heller Aufregung hervor.
»Jost schickt mich nicht. Er ist… er liegt im Krankenhaus… Ein kleines Unglück… Sie brauchen sich nicht –«
Er sprang hinzu, um die wankende Petra zu stützen; doch mit einer nicht mißzuverstehenden Geste wies sie ihn zurück. Sie hatte sich schon wieder in der Gewalt.
»Jost… verunglückt? Er liegt im Krankenhaus?« Sie strich sich eine rostbraune Locke aus der Stirn.
»Dann muß ich sofort zu ihm – warten Sie!«
Sie hastete hinaus und ließ in der Eile die Tür hinter sich offen. Langsam ging Sprenger ihr nach. Er sah, wie sie den Mantel aus dem Schrank riß, eine Kappe hervorholte und dann vorsichtig eine Tür aufmachte. Er folgte ihr auf Zehenspitzen und schaute durch einen Spalt in das matterleuchtete Kinderzimmer.
Dort lag Petra auf den Knien vor dem Bett ihrer kleinen Tochter und drückte behutsam einen Kuß auf das Händchen der kleinen Lore.
»Schlaf schön…, mein Mädel. Ich komme bald wieder«, flüsterte sie dann.
Sprenger trat hastig zurück. Als Petra ihn bemerkte, stand er neben der Garderobe.
»Ich fahre Sie sofort in die Klinik, Petra!«
Sie nickte. Das Herz lag ihr schwer in der Brust, und im Halse spürte sie ein Würgen.
»Jost – Jost!« kam es verzweifelt über ihre Lippen, dann ließ sie sich aus dem Haus zum Wagen führen.
*
In tiefer Bewußtlosigkeit lag Jost Eckhardt im grellen Schein der OP-Lampen.
Kurz und knapp fielen die Befehle des operierenden Professors; sie waren abwechselnd an die ihm assistierenden Ärzte und Schwestern gerichtet.
»Fertig!« Der Professor legte die gebrauchten Instrumente auf das Tablett zurück, das ihm die Schwester entgegenreichte.
Mitfühlend neigte sich der Professor über das wächserne Gesicht.
»Armer Kerl, das Bein haben wir dir abnehmen müssen. Wollen sehen, daß wir dich durchbringen!«
Dann straffte er sich.
»Die Nachtwache bei dem Kranken übernehme ich heute zusammen mit Ihnen, Schwester Gertrud.«
Die Schwester schrieb sich gewissenhaft die Vorsichtsmaßnahmen auf, und der Professor ging in den Waschraum und ließ das warme Wasser über die Hände laufen.
»Herr Professor!«
Der Professor fuhr herum und sah fragend auf Schwester Hilde, die soeben eingetreten war.
»Die Frau des Verletzten ist gekommen. Sie wünscht ihren Mann zu sehen.«
»Es ist gut, Schwester Hilde! Ich werde selbst mit der Frau reden. Sieht böse aus mit dem Mann. Eine ganz dumme Geschichte. Haben Sie die Frau schon ins Sprechzimmer geführt?«
Die Schwester bejahte und half dem Professor in den Kittel. Unverzüglich suchte er das Sprechzimmer auf.
Petra Eckhardt lehnte an der Wand. Ihr Gesicht war totenblaß, und sie blickte starr geradeaus. Um ihren Schmerz und jeden Laut zu unterdrücken, hatte sie die Zähne in die blutleeren Lippen gepreßt.
Detlef Sprenger stand abseits. Er sah in das schmale, zuckende Gesicht Petras und spürte ihr Leid wie das seine.
Er zwang sich auch an den Freund zu denken; aber die Liebe zu der feingliedrigen jungen Frau war vorherrschend.
Als der Professor eintrat, fuhr Petra zusammen. Ihre schönen Augen hingen vertrauensvoll an seinem Mund, während er sich vorstellte und dann erst erklärte: »Wir haben Ihren Mann soeben operiert. Sie müssen tapfer sein, Frau Eckhardt. Es geht ihm nicht gut. Wir mußten ihm das Bein abnehmen. Sie werden nicht weinen, nicht wahr? Sie dürfen jetzt zehn Minuten zu ihm gehen.«
Gehetzt irrten Petras Blicke über die kahlen, nüchternen Wände des Zimmers.
»Führen Sie mich bitte zu meinem Mann – ganz gleich, wie alles wird – nur leben soll er! Hören Sie, er muß leben für – für unser – Kind –«
Petra brach ab, ihre Hände hoben sich in einer verzweifelten Gebärde und fielen dann herunter.
»Kommen Sie«, sagte der Professor gütig und ging voran. Detlef Sprenger folgte beiden in einiger Entfernung.
Jost Eckhardt lag noch in tiefer Bewußtlosigkeit. Er ahnte nichts von der Nähe und dem grenzenlosen Jammer seiner jungen Frau, die an seinem Bett stand.
Petra ließ sich erschöpft auf den Stuhl neben dem Lager nieder. Sie nahm die Hand ihres Mannes und gab sie nicht wieder frei.
»Jost – lieber, lieber Jost!« flüsterte sie erstickt.
Detlef Sprenger stand erschüttert dabei. Er wußte nicht, was ihn mehr ergriff: Die Tapferkeit Petras oder das stille schneebleiche Gesicht in den Kissen.
»Sie müssen nun gehen«, unterbrach der Professor nach einigen Minuten die lastende Stille.
Petra hob den Blick.
»Lassen Sie mich hier, bitte, schicken Sie mich nicht fort! Ich werde ganz… ganz tapfer sein, aber lassen Sie mich bei meinem Mann!« flüsterte sie leise.
Der Professor nickte, und Detlef Sprenger dachte: Sieht Petra denn nicht, daß sich schon der Schein des Todes über Josts Gesicht breitet? Sieht sie nicht, daß der Arzt ebenso wenig helfen kann wie alle ihre heißen Wünsche?
Er drehte sich hart um und nahm in der Ecke Platz.
Stunden um Stunden vergingen.
Plötzlich schrie Petra unterdrückt auf. Ihr war zumute, als würde eine eiskalte Faust ihr Herz zusammenpressen.
»Helfen Sie doch…, so helfen Sie doch! Sehen Sie denn nicht? Er stirbt ja… Jost stirbt!«
Sie preßte beide Hände vor den Mund. Es war, als hätte ihr verzweifelter Aufschrei die Lebensgeister des Sterbenden noch einmal aufgepeitscht. Es zuckte in den spitzen Zügen – nur sekundenlang, die Lider zitterten – dann wurden sie hart und starr.
Ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben, war Jost Eckhardt der Erbe der Eckhardtschen Werke, eingeschlafen – um nie mehr zu erwachen.
Tränenlos, mit bleichem Gesicht, starrte Petra auf ihren geliebten Mann. Sie konnte es einfach nicht fassen, daß sich sein Mund niemals mehr öffnen sollte, daß sein Arm sie nicht mehr umfangen – daß er niemals mehr sein Kind, seine Lore, auf den Knien schaukeln würde.
Eine Viertelstunde später verließ Petra Eckhardt am Arm Detlef Sprengers das Krankenhaus.
Unter dem Tor brach sie in Sprengers Arm zusammen. Mit beiden Armen umfing er die zarte Gestalt und schaute voll Angst in das bleiche, liebliche Gesicht.
Alles, was zwischen ihm und der heimlich geliebten Frau stand und sie trennte, war gefallen. Er war von diesem Gedanken so beherrscht, daß er jedes klare Denken verlor.
Er wußte nur, daß er die Frau niemals wieder von sich lassen würde, daß sie ihm gehören mußte, mit oder ohne ihren Willen. Ja, er vergaß in seiner wiedererwachten Leidenschaft, daß ein Kind sehnsüchtig auf seine Mutter wartete.
Mit einem unterdrückten Laut hob er die bewußtlose Frau auf seine Arme und trug sie hinüber zu seinem Wagen, bettete sie sorgsam auf die weiche Rückbank – und jagte davon, seiner Villa zu.
*
Leontine Eckhardt wurde an den Fernsprecher gerufen.
Sie erhob sich, legte aber erst die Handarbeit, mit der sie gerade beschäftigt war, mit peinlicher Sorgfalt zusammen – und folgte langsam der vorauseilenden Nichte zum Fernsprecher.
Leontine war ruhig wie immer, als sie sich meldete und die Nachricht entgegennahm.
Endlich legte sie den Hörer auf. Ihr Gesicht war um einen Schein blasser, aber ihre Stimme war tonlos wie immer.
»Jost ist tot… Er ist gestern an den Folgen eines Unfalls gestorben«, murmelte sie. »Dann tritt diese Frau oder seine Familie das Erbe an.«
Leontine begann erregt, hin und her zu wandern, mit kurzen, harten Schritten. Dabei überlegte sie fieberhaft.
Sollte sie Josts junge Frau einfach an die Wand drücken? Aber würde das gutgehen? Sie hatte scharfe Gegner, zum Beispiel Nikolaus! Niemals würde er sich daran beteiligen. Und – selber handeln?
Mit einem Ruck blieb sie stehen, sagte zu sich selbst: »Ich fahre in Josts Wohnung.«
*
Portier Lehmann riß das Fenster in die Höhe und blinzelte zu der eleganten Dame auf.
»Ich will zu Herrn Eckhardt – welches Stockwerk?«
»Erstes Stockwerk«, sagte Lehmann schnell und kam aus seiner Loge heraus.
»Sie finden aber niemanden in der Wohnung außer der kleinen Lore«, sagte er, von Herzen froh, seinen Redeschwall nun endlich loszuwerden. »Die junge Frau ist seit gestern verschwunden, und der Herr Eckhardt ist heute nacht im Krankenhaus gestorben –«
»Was heißt verschwunden?«
Von dem strengen Ton Leontine Eckhardts etwas eingeschüchtert, bemerkte er etwas kleinlauter: »Sie ist gestern mit einem Mann auf und davon gegangen.«
Leontine Eckhardt schwieg und preßte die Lippen fest zusammen. Ihrem unbewegten Gesicht war nicht anzumerken, wie sie die Nachricht des Portiers aufgenommen hatte.
Die Tür zur Wohnung war offen. Klägliches Kinderweinen empfing sie. Es kam aus einem der hintersten Zimmer.
Eine ältere Frau stand vor einem weißen Kinderbett und sprach tröstlich auf das bitterlich weinende Mädchen ein.
»Sei brav, mein Lorchen! Ich ziehe dich jetzt an und nehme dich mit zu mir. Mutti kommt bald wieder.«
»Mami soll kommen – Mami soll kommen«, jammerte die Kleine. »Ich will zu meiner Mami!«
Das süße Kindergesicht war vom Weinen dick verquollen. Lorchen war keinem Trost zugänglich.
Als sie Leontine erblickte, verstummte sie vorübergehend, und ein Strahlen ergoß sich über das liebliche Gesicht.
»Kommt meine Mami jetzt? Hast du meine Mami mitgebracht?«
Es sah aus, als würde Leontine zusammenzucken, als sie das Kind in seinem Nachtkittelchen mit den wirren Locken vor sich sah. Doch nur Sekunden dauerte diese weiche Regung, dann lag wieder Härte und Kälte auf ihren Zügen.
»Ziehen Sie das Kind an!« gebot sie, ohne sich von der Stelle zu rühren, ohne sich dem Kind auch nur einen Schritt zu nähern. »Ich bin die Mutter von Herrn Eckhardt. Ich nehme das Kind mit mir.«
»Nein! Nein!« weinte Lorchen auf. »Ich gehe nicht mit dir… Ich bleibe hier… Ich warte auf meine Mami. Meine Mami kommt gleich wieder… Sie vergißt doch ihr Lorchen nicht!«
Mit diesem Widerstand hatte Leontine nicht gerechnet.
»Machen Sie die Kleine fertig!« fuhr sie die Nachbarsfrau an. »Ich warte solange nebenan. Das Kind scheint sehr schlecht erzogen zu sein.«
Die Frau, die bei Petra stundenweise im Haushalt half und das innige Familienleben genau kannte, wollte heftig etwas erwidern, aber da ging Leontine schon aus dem Zimmer.
»Komm, Lorchen, sei schön artig! Die gute Frau bringt dich zu deiner Mami!« sagte die Frau gütig und griff nach den Kleidungsstücken, die sorglich zusammengelegt auf einem Hocker neben dem Bett lagen.
»Nein…, das ist eine böse Frau!« jammerte das Kind herzbrechend auf.
»Ich bleibe bei dir… Bitte, laß mich bei dir! Hier will ich warten, bis Mami kommt!«
Die Frau schüttelte den Kopf.
»Nein, Lorchen, das geht nicht.«
So redete sie immer wieder gütig auf das Kind ein, und da ließ es sich wenigstens anziehen; aber alles geschah unter wildem Schluchzen nach der geliebten Mami.
Als Leontine nach ihr griff, schlug sie wild um sich.
»Lorchen, Kind, das ist doch deine Großmutter!« mahnte die Frau.
»Mami – Mami!«
Da hob Leontine kurz entschlossen das Kind auf den Arm und preßte es fest an sich. Es war ein harter, zwingender Griff, unter dem die kleine Lore ängstlich aufschrie.
So trug Leontine das Kind davon, während die Wohnung förmlich widerhallte von dem Kinderjammern nach der Mami.
Als sie es zum Wagen trug, hing das braune Lockenköpfchen matt an ihrer Schulter. Lorchen hatte ihr kleines Herz verausgabt. Es konnte nicht mehr weinen. Der zarte Körper wurde nur dann und wann von einem wehen Aufschluchzen gestoßen.
So zog die kleine Lore in das Haus der Großmutter ein…
*
Die Sonne schien hell ins Zimmer, als Petra nach einem todähnlichen Erschöpfungsschlaf die Augen aufschlug und sich erstaunt umsah.
Sie richtete sich etwas in die Höhe und schaute sich in dem weiten, eleganten Raum um.
Wie kam sie in dieses Zimmer – und in diesem Aufzug? Sie sah an sich herunter.
Was war nur geschehen? Es war ihr so wirr und schwer im Kopf. Sie runzelte die Stirn und versuchte, Klarheit in ihre Gedanken zu bringen.
Da drang aus einer Ecke des Zimmers ein Geräusch zu ihr. Sofort flog ihr Kopf herum. Langsam kam Detlef Sprenger auf sie zu.
Mit großen, schreckgeweiteten Augen sah sie ihm entgegen.
Was wollte dieser Mann von ihr? Sie stieß einen kleinen Schrei aus.
Aber Sprenger lächelte nur und blieb dicht vor ihr stehen.
»Nun – ausgeschlafen?«
In Petra war alles Verwirrung. Wenn sie nur wüßte, was mit ihr geschehen war.
»Gehen Sie…! Bitte, gehen Sie!« hauchte sie.
»Warum schicken Sie mich weg?« sagte Sprenger traurig und doch irgendwie vertraulich. »Sie haben gerade jetzt einen Freund sehr nötig.«
Petra sann seinen Worten nach. Auf einmal wurde es hell und klar in ihr. Die Wucht der Geschehnisse drang erneut auf sie ein. Jeder Nerv an ihr begann zu beben.
»Wohin haben Sie mich denn gebracht? Wo bin ich eigentlich?«
Sprenger stieg langsam die Röte ins Gesicht.
»Ich habe Sie zu mir gebracht –«
Petra fuhr in die Höhe.
»Sie… Sie haben mich zu sich gebracht?« Ihre Augen irrten umher, kehrten wieder zu dem lächelnden Mann zurück.
Wo war Jost? Wo war Lorchen?
Ihre Hände tasteten nach den Schläfen. Wie das pochte und hämmerte!
»Mein Gott!« stieß sie hervor. »Jost… ist ja tot!«
Sekundenlang durchdrang sie ein weher, wilder Schmerz, aber dann füllten sich ihre Augen mit Tränen der Empörung.
»Sie haben mich zu sich gebracht? Oh, jetzt erinnere ich mich wieder an alles. Jost ist tot… Ich wurde ohnmächtig. Da haben Sie mich – zu sich gebracht.«
Eisiger Schauer durchrieselte sie.
»Sie haben meine Hilflosigkeit ausgenutzt. Bitte, verlassen Sie mich sofort! Ich muß zu meinem Kind!«
Sprenger wich nicht von der Stelle.