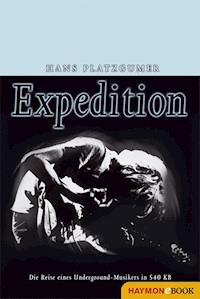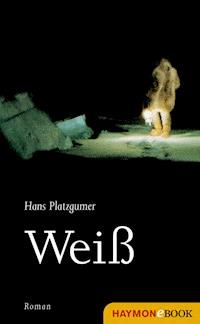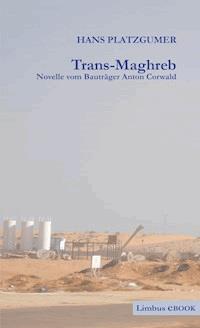
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Limbus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
März 2011. Ein österreichischer Ingenieur, der am Bau der prestigeträchtigen Bahnlinie Trans-Maghreb in der libyschen Wüste beteiligt ist, kann sich durch Flucht außer Landes retten, nachdem der Aufstand ausgebrochen ist. Zurück in Wien erkennt er auf Fernsehbildern die Leiche des Bauträgers - eine Spurensuche beginnt. "Trans-Maghreb" ist eine Erzählung zwischen Arabischem Frühling und westlicher Arroganz. Hans Platzgumer wählt die kompakte Form der Novelle, um das gegenseitige Unverständnis zwischen europäischer und arabischer Lebensweise exemplarisch zu skizzieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Platzgumer
Trans-Maghreb
Novelle vom Bauträger Anton Corwald
„Elections? What for? We have surpassed that stage that you are presently in. All the people are in power now. Do you want them to regress and let somebody replace them?“
Muammar al-Gaddafi, 2004
1
März 2011. Ich bin wieder daheim in Wien. Sitze in meiner Wohnung, Landstraße, weiß nicht recht, was tun. Ich rasiere mich nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Und im Moment gibt es keinen zwingenden Grund dafür. Ich warte. Das ist langweilig, aber wenigstens bin ich in Sicherheit. Keine Männer mit Maschinengewehren umzingeln mich. Keiner rät mir, einen Dolch griffbereit zu halten. Keine Kampfjets nähern sich der Stadt.
Wien ist kalt, aber in meiner Wohnung ist es stickig heiß. Ich sollte öfter das Fenster öffnen, um den Rauch abziehen zu lassen. Doch selbst dazu kann ich mich kaum aufraffen. Mein Leben verschnauft und ich belasse es dabei. Ich liege auf dem Sofa. Trinke Bier und kann immer noch nicht glauben, dass ich das darf. Jeder Schluck Ottakringer etwas herrlich Verbotenes. Was bin ich froh, der Dschamahiriyya entkommen zu sein! Wer weiß wie, lange ich es noch ausgehalten hätte. Jeden Tag dreißig Grad und dazu dieses süße alkoholfreie Biergetränk. Wenn ich seinen Geschmack nicht mehr ertragen konnte, wechselte ich zu noch süßeren Sarabs, die ich mit Wasser, das nach Plastik schmeckte, verdünnte, und dann bald wieder zurück zu dem Bierartigen. Wie halten das die Araber nur aus.
In diesem Sinn kam mir ihre Revolution durchaus gelegen. Aber trotzdem blicke ich jetzt in eine ungewisse Zukunft. Unser Planungsbüro verliert mit dem libyschen Umbruch einen seiner größten Aufträge. All das Geld, all unsere Arbeit ist in den saharischen Sand gesetzt. Jetzt wissen meine Vorgesetzten erstmal nicht, auf welche Baustelle ich als Nächstes soll. Nach Libyen werden sie mich nicht mehr zurückschicken, das steht fest. Aber wohin dann? Es gibt noch andere Baustellen in Nordafrika, oder vielleicht komme ich nach Osteuropa oder gar nach Sibirien, wenn ich Pech habe. Mit einem Junggesellen wie mir kann man das ja machen. Den schickt man an jene Orte, wo sonst niemand hinwill, zahlt ihm einen kleinen Zuschlag, damit er sich besser fühlt dabei, und ab geht’s in die nächste Einöde.
Den größten Wert, den ich für meine Firma habe, ist, dass ich ungebunden bin, mir kein Privatleben aufgebaut habe, an dem ich festhänge, weder in Österreich noch sonst wo. Mit 38 Jahren hänge ich noch in der Luft, jammert meine Mutter. Wo sie sich doch so sehr ein Enkerl wünschen würde. Ich lass’ sie jammern. Das tut sie eh am liebsten. Die Firma ist jedenfalls froh, dass es einen wie mich gibt, einen Tiefbauingenieur ohne Ansprüche (denken sie), ohne Bindungen (da muss ich ihnen recht geben).
Doch vorerst wissen sie nicht, was sie tun sollen mit mir und meiner Freiheit und ihrem libyschen Dilemma, aus dem ich in letzter Sekunde herausgefischt wurde. Ich sitze rum und koste Geld (auch wenn für März nun schon mein Zuschlag gestrichen wurde). Da unten sammeln sich die Rebellen, und hier oben liege ich auf meinem Sofa und trinke Bier, schon am Vormittag.
Der Fernseher läuft die ganze Zeit. Sportsendungen, Quizsendungen, Tierdokus, Fernsehserien. Ich zieh’ mir alles rein. Natürlich auch die Nachrichtensender. Ich versuche zu erfahren, wie es weitergeht mit den Revoluzzern aus dem Osten und ihrem Kampf gegen al-Gaddafi, für den wir die Eisenbahnstrecke bauen sollten. Die NATO unterstützt jetzt den Aufstand gegen ihn. Sie versuchen den Weg zu seinem Erdöl offenzuhalten und gleichzeitig den Spinner wegzubomben, nachdem er sie vier Jahrzehnte lang alle geärgert hat. Doch Näheres ist auch mit meiner Wiener Satellitenschüssel nicht herauszubekommen. In Japan hat die Erde gebebt. Gerade an dem Tag, an dem Gaddafi sich mit Kampfflugzeugen Zugang zu unserem von den Rebellen besetzten Ölhafen Ras Lanuf verschafft hat, ist ein Tsunami über Japan hergefallen und hat ein Kernkraftwerk lahmgelegt. Das ist der größere Medienerreger. Überall ist es zu sehen. Überall. Man kann den immergleichen Bildern aus Japan nicht entkommen. Wasserdampf steht über den Reaktoren Fukushimas und der Rest der Welt steht still. Die Fantasieschleusen der Mitteleuropäer sind geflutet. Sie befürchten, dass die Radioaktivität herüberweht über den halben Globus und dass sie bald kein Sushi mehr bekommen. Doch für die Kämpfe, die rund um unser Lager in Ras Lanuf toben, für das, was in Libyen gerade geschieht, direkt vor den Toren der Festung Europa, interessiert sich niemand.
Gleich wie 1986, da flogen die US-Bomber auch über al-Gaddafis Kopf und dann explodierte das Kernkraftwerk in Tschernobyl.
Das war dann wichtiger. Europa und Amerika sind immer wichtiger als Afrika und der Rest der Welt. Mit dem Tod einer Hollywood-Diva können in unseren Medien keine hunderttausend toten Afrikaner konkurrieren. Und Libyen – zwar fünfmal so groß wie Deutschland –, dieses ausgedörrte Ödland wäre, wenn Gaddafi nicht auf dem Erdöl säße, in unserer Wahrnehmung gleich inexistent wie sein südlicher Nachbar Tschad.
Bevor die erste libysche Ölquelle angezapft wurde, besaß das Land als einziges Exportmittel den Metallschrott, der vom zweiten Weltkrieg auf seinem zerfurchten Antlitz zurückgeblieben war. Sonst hatten sie nichts zu bieten, die paar Millionen Libyer, bettelarm und unsichtbar. Kein Wunder, dass unsere Fernsehsender auf sie vergessen. Ungestört können Sarkozy und Obama ihre Kampfjets nach Tripolis schicken und die Libyer sich gegenseitig massakrieren, denn in Japan steigt nach wie vor Rauch aus dem Reaktor. Das ist moderner, obwohl die Bilder aus Fukushima wenig hergeben; unscharfe, eingefrorene Satellitenaufnahmen von einem schmucklosen Kraftwerkskomplex.
Man könnte meinen, Zwentendorf sei reaktiviert worden und hochgegangen, so erregen sich die Österreicher. Angesteckt von ihrer Hysterie würde ich mein Fenster schließen wollen, wäre es nicht bereits geschlossen und in meiner Bude mehr Qualm als auf den Fernsehbildern. Die Welt geht unter, wird mir vermittelt. Fukushima brennt. Und Libyen, mein Lebensmittelpunkt der letzten Monate, zerbricht. Und ich chille auf der Couch und genieße mein Goldfassl.
Doch irgendwann beim Zappen durch die Kanäle, beim Versuch, dem ganzen japanischen Kernschmelz-TV zu entkommen, habe ich diese Aufnahmen gesehen, die mir seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich glaube, es war die BBC, die die Bilder zeigte. Einmal nur, eine Randnotiz, dann waren sie verschwunden. Die Medien haben keine Zeit, sich näher mit den paar Wasserleichen zu beschäftigen, die vor ein paar Tagen an die Kyrenaika gespült wurden, an die Küsten der östlichen Provinz Libyens.
Ein Schiff sei gekentert, hieß es. Etwas, das bei den Flüchtlingsbooten aus Afrika immer wieder passiert. Und im blutigen Krieg um die Rebellenhochburg Benghazi war das nur eines unter vielen Bildern von zivilen Todesopfern. Gut ein Dutzend Männerleichen lag am Strand, nasse Fleischsäcke, die Nasen in den Sand gebohrt.
Gesichter konnte ich keine sehen. Die Aufnahmen waren verschwommen und kurz geschnitten, als wollte die BBC ihren Zusehern den Anblick dieser Toten ersparen, brauchte aber kurz irgendein Bildmaterial, um die nächsten GAU-Meldungen aus Japan vorbereiten zu können.
Die dunklen Gestalten, die da von den Wellen des Mittelmeers zum Trocknen in die Morgensonne hingeworfen worden waren, sahen nicht aus wie Araber. Sie sahen auch nicht aus wie die ostafrikanischen Flüchtlinge, die alles dafür geben, um ihrem Elend zu entkommen, um Lampedusa zu erreichen, europäischen Boden unter den bloßen Füßen zu haben, sei es auch in einem überfüllten Auffanglager. Die afrikanischen Exilanten werden bereits in libyschen Lagern aufgehalten, zusammengepfercht. Um das durchzusetzen, schloss die EU einen Pakt mit Gaddafi. Auch in ihren Verhandlungen mit den Rebellen wird dieser libysche Grenzschutz für Europa neben dem Erdöl das Hauptanliegen der EU sein. Für die afrikanischen Flüchtlinge wird sich wenig ändern. Nur wenige von ihnen haben das Glück, die libyschen Grenzlager der EU zu überwinden und weiterzukommen. Nur wenige schaffen es, tiefer in die europäische Phalanx bis ins italienische Lager auf Lampedusa zu dringen, dorthin, wo dann spätestens ihr Glück endet. Dort kleben sie aufeinander im Limbus zwischen Himmel und Hölle, und jeden Tag ermatten ihre Körper mehr, geben sich der Erschöpfung hin, werden gezeichnet von den nicht enden wollenden Strapazen ihrer aussichtslosen Flucht.
Am Leben gehindert wie diese armen Teufel sahen die BBC-Wasserleichen nicht aus. Sie sahen aus wie wir. Sahen aus, wie ich noch vor zwei Wochen ausgesehen habe. Ein verstaubender Europäer, der, auch wenn er seelisch noch so ausgehungert sein mochte, wohlhabend wirkt, selbst nach Wochen der Entbehrung und frustriert vom Wüstensturm, dem Gibli, der ihm heißen Saharasand ins Gesicht schlägt. Ein Afrika-Reisender erster Klasse, auch wenn er zu Hause keineswegs der oberen Klasse angehört. Einer wie ich, der nicht recht weiß, was er tragen soll, wenn er in Libyen unterwegs ist. Weder zu warm noch zu kalt, zu billig noch zu teuer, zu lang noch zu kurz will er gekleidet sein. Er will weder den Eindruck erwecken, dass er vermögend und somit ein potentielles Entführungsopfer ist, noch will er schäbig und unseriös wirken. Er will nicht schwitzen und nicht frieren. Da landet er bei diesen Kompromissbekleidungen. Braune hochgestülpte Sweatshirts, Dreiviertel-Hosen, farblose Jacketts. Genau wie die BBC-Leichen am Strand irgendwo südlich von Benghazi. Genau wie Anton Corwald.
Ich kenne das ockerfarbene Blouson, das er immer trug, den Seidenschal mit dem nichtssagenden Muster, die Jeans, die nicht so aussahen, weder Jeans noch irgendetwas anderes waren, extravagant in ihrer Unauffälligkeit. Anton Corwald trat ständig in Kleidung auf, die einem peinlich sein müsste, würde sie bemerkt und wäre sie nicht einfach unsichtbar, ein unaufdringliches Relikt aus den 80er-Jahren, das einst für die Zeitlosigkeit konzipiert war und trotzdem nichts anderem als der Mode dieses Jahrzehnts geschuldet sein konnte.
Anton Corwald trug es mit einer Selbstverständlichkeit, nahezu mit einer Eleganz, möchte man sagen, auch wenn das ganz und gar unmöglich erscheint. Ein George Clooney für Blinde sozusagen. Und niemand nahm ihm sein Styling, das keines war, übel. Niemandem fiel es auf. Nur mir. Ich lümmle vor dem Fernseher und plötzlich sehe ich ihn. Er muss es gewesen sein da am Strand, seine Jacke fast schon Tarnkleidung im nassen Sand, über den die Gischt wanderte, sein Haar, weder schwarz noch grau, weder kurz noch lang, irgendwo dazwischen, jetzt triefend nass und tot.