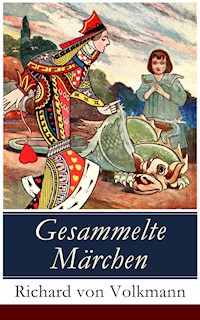Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nikol
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Richard von Volkmann, der sich als Schriftsteller Leander nannte, war Mediziner und zählte zu den bedeutendsten Chirurgen des 19. Jahrhunderts. Während des Krieges 1870/71 verfasste er seine 'Träumereien an französischen Kaminen', 22 Kunstmärchen, die ihren ganz eigenen Zauber haben. Die vorliegende Ausgabe beinhaltet die Original-Illustrationen, die der Sohn des Autors kongenial angefertigt hat. Ein wunderschönes Buch, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TRÄUMEREIENAN FRANZÖSISCHEN KAMINEN
Märchen vonRichard von Volkmann
mit Ilustrationen
Der Text folgt der Ausgabe:»Träumereien an französischen Kaminen«,Breitkopf & Härtel, Leipzig 1912.
© 2017 Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Hamburg
Alle Rechte, auch das der fotomechanischen Wiedergabe(einschließlich Fotokopie) oder der Speicherung aufelektronischen Systemen, vorbehalten.All rights reserved.
ISBN: 978-3-86820-935-8
www.nikol-verlag.de
Die künstliche Orgel
Die künstliche Orgel
V
or langen, langen Jahren lebte einmal ein sehr geschickter junger Orgelbauer, der hatte schon viele Orgeln gebaut, und die letzte war immer wieder besser als die vorhergehende. Zuletzt machte er eine Orgel, die war so künstlich, daß sie von selbst zu spielen anfing, wenn ein Brautpaar in die Kirche trat, an dem Gott sein Wohlgefallen hatte. Als er auch diese Orgel vollendet hatte, besah er sich die Mädchen des Landes, wählte sich die Frömmste und Schönste und ließ seine eigene Hochzeit zurichten. Wie er aber mit der Braut über die Kirchschwelle trat und Freunde und Verwandte in langem Zuge folgten, war sein Herz voller Stolzes und Ehrgeizes. Er dachte nicht an seine Braut und nicht an Gott, sondern nur daran, was er für ein geschickter Meister sei, dem niemand es gleichtun könne, und wie alle Leute staunten und ihn bewundern würden, wenn die Orgel von selbst zu spielen begönne. So trat er mit seiner schönen Braut in die Kirche ein – aber die Orgel blieb stumm. Das nahm sich der Orgelbaumeister sehr zu Herzen, denn er meinte in seinem stolzen Sinne, daß die Schuld nur an der Braut liegen könne und daß sie ihm nicht treu sei. Er sprach den ganzen Tag über kein Wort mit ihr, schnürte dann nachts heimlich sein Bündel und verließ sie. Nachdem er viele hundert Meilen weit gewandert war, ließ er sich endlich in einem fremden Land nieder, wo niemand ihn kannte und keiner nach ihm fragte. Dort lebte er still und einsam zehn Jahre lang; da überfiel ihn eine namenlose Angst nach der Heimat und nach der verlassenen Braut. Er mußte immer wieder daran denken, wie sie so fromm und schön gewesen sei und wie er sie so böslich verlassen. Nachdem er vergeblich alles getan, um seine Sehnsucht niederzukämpfen, entschloß er sich, zurückzukehren und sie um Verzeihung zu bitten. Er wanderte Tag und Nacht, daß ihm die Fußsohlen wund wurden, und je mehr er sich der Heimat näherte, desto stärker wurde seine Sehnsucht und desto größer wurde seine Angst, ob sie wohl wieder so gut und freundlich zu ihm sein werde wie in der Zeit, wo sie noch seine Braut war. Endlich sah er die Türme seiner Vaterstadt von fern in der Sonne blitzen. Da fing er an zu laufen, was er laufen konnte, so daß die Leute hinter ihm her den Kopf schüttelten und sagten: »Entweder ist’s ein Narr, oder er hat gestohlen.« Wie er aber in das Tor der Stadt eintrat, begegnete ihm ein langer Leichenzug. Hinter dem Sarge her gingen eine Menge Leute, welche weinten. »Wen begrabt ihr hier, ihr guten Leute, daß ihr so weint?« »Es ist die schöne Frau des Orgelbaumeisters, die ihr böser Mann verlassen hat. Sie hat uns allen so viel Gutes und Liebes getan, daß wir sie in der Kirche beisetzen wollen.« Als er dies hörte, entgegnete er kein Wort, sondern ging still gebeugten Hauptes neben dem Sarge her und half ihn tragen. Niemand erkannte ihn; weil sie ihn aber fortwährend schluchzen und weinen hörten, störte ihn keiner, denn sie dachten: Das wird wohl auch einer von den vielen armen Leuten sein, denen die Tote bei Lebzeiten Gutes erwiesen hat. So kam der Zug zur Kirche, und wie die Träger die Kirchschwelle überschritten, fing die Orgel von selbst zu spielen an, so herrlich, wie noch niemand eine Orgel spielen gehört. Sie setzten den Sarg vor dem Altare nieder, und der Orgelbaumeister lehnte sich still an eine Säule daneben und lauschte den Tönen, die immer gewaltiger anschwollen, so gewaltig, daß die Kirche in ihren Grundpfeilern bebte. Die Augen fielen ihm zu, denn er war sehr müde von der weiten Reise; aber sein Herz war freudig, denn er wußte, daß ihm Gott verziehen habe, und als der letzte Ton der Orgel verklang, fiel er tot auf das steinerne Pflaster nieder. Da hoben die Leute die Leiche auf, und wie sie inne wurden, wer es sei, öffneten sie den Sarg und legten ihn zu seiner Braut. Und wie sie den Sarg wieder schlossen, begann die Orgel noch einmal ganz leise zu tönen. Dann wurde sie still und hat seitdem nie wieder von selbst geklungen.
Goldtöchterchen
Goldtöchterchen
V
or dem Tor, gleich an der Wiese, stand ein Haus, darin wohnten zwei Leute, die hatten nur ein einziges Kind, ein ganz kleines Mädchen. Das nannten sie Goldtöchterchen. Es war ein liebes, kregles kleines Ding, flink wie ein Wiesel. Eines Morgens geht die Mutter früh in die Küche, Milch zu holen; da steigt das Ding aus dem Bett und stellt sich im Hemdchen in die Haustüre. Nun war ein wunderherrlicher Sommermorgen, und wie es so in der Haustüre steht, denkt es: Vielleicht regnet’s morgen; da ist’s besser, du gehst heute spazieren. Wie’s so denkt, geht’s auch schon; läuft hinters Haus auf die Wiese und von der Wiese bis an den Busch. Wie’s an den Busch kommt, wackeln die Haselbüsche ganz ernsthaft mit den Zweigen und rufen:
»Nacktfrosch im Hemde,
Was willst du in der Fremde?
Hast kein’ Schuh und hast kein’ Hos’,
Hast ein einzig Strümpfel bloß;
Wirst du noch den Strumpf verlier’n,
Mußt du dir ein Bein erfrier’n.
Geh nur wieder heime;
Mach dich auf die Beine!«
Aber es hört nicht, sondern läuft in den Busch, und wie es durch den Busch ist, kommt es an den Teich. Da steht die Ente am Ufer mit einer vollen Mandel Junger, alle goldgelb wie die Eidotter, und fängt entsetzlich an zu schnattern; dann läuft sie Goldtöchterchen entgegen, sperrt den Schnabel auf und tut, als wenn sie es fressen wollte. Aber Goldtöcherchen fürchtet sich nicht, geht gerade darauf los und sagt:
»Ente, du Schnatterlieschen,
Halt doch den Schnabel und schweig ein bißchen!«
»Ach«, sagt die Ente, »du bist’s, Goldtöchterchen! Ich hatte dich gar nicht erkannt; nimm’s nur nicht übel! Nein, du tust uns nichts. Wie geht es dir denn? Wie geht es denn deinem Herrn Vater und deiner Frau Mutter? Das ist ja recht schön, daß du uns einmal besuchst. Das ist ja eine große Ehre für uns. Da bist du wohl recht früh aufgestanden? Also, du willst dir wohl auch einmal unsern Teich besehen? Eine recht schöne Gegend! Nicht wahr?«
Wie sie ausgeschnattert hat, fragt Goldtöchterchen: »Sag einmal, Ente, wo hast du denn die vielen kleinen Kanarienvögel her?«
»Kanarienvögel?« wiederholt die Ente, »ich bitte dich, es sind ja bloß meine Jungen.«
»Aber sie singen ja so fein und haben keine Federn, sondern bloß Haare! Was bekommen denn deine kleinen Kanarienvögel zu essen?«
»Die trinken klares Wasser und essen feinen Sand.«
»Davon können sie ja aber unmöglich wachsen.«
»Doch, doch«, sagt die Ente; »der liebe Gott segnet’s ihnen; und dann ist auch zuweilen im Sand ein Würzelchen und im Wasser ein Wurm oder eine Schnecke.«
»Habt ihr denn keine Brücke?« fragt dann weiter Goldtöchterchen.
»Nein«, sagt die Ente, »eine Brücke haben wir nun allerdings leider nicht. Wenn du aber über den Teich willst, will ich dich gern hinüberfahren.«
Darauf geht die Ente ins Wasser, bricht ein großes Wasserrosenblatt ab, setzt Goldtöchterchen darauf, nimmt den langen Stengel in den Schnabel und fährt Goldtöchterchen hinüber. Und die kleinen Entchen schwimmen munter nebenher.
»Schönen Dank, Ente!« sagte Goldtöchterchen, als es drüben angekommen ist.
»Keine Ursache«, sagt die Ente. »Wenn du mich mal wieder brauchst, steh ich gern zu Diensten. Empfiehl mich deinen Eltern. Schön adje!«
Auf der anderen Seite des Teiches ist wieder eine große grüne Wiese, auf der geht Goldtöchterchen weiter spazieren. Nicht lange, so sieht es einen Storch, auf den läuft’s gerade zu: »Guten Morgen, Storch«, sagt’s; »was ißt du denn, was so grünscheckig aussieht und dabei quakt?«
»Zappelsalat«, antwortet der Storch, »Zappelsalat, Goldtöchterchen!«
»Gib mir auch was, ich bin hungrig!«
»Zappelsalat ist nichts für dich«, sagt der Storch; geht an den Bach, taucht mit seinem langen Schnabel tief unter und holt erst einen goldenen Becher mit Milch und dann eine Wecke heraus. Darauf hebt er den rechten Flügel und läßt eine Zuckertüte herunterfallen. Goldtöchterchen läßt sich’s nicht zweimal sagen, sondern setzt sich hin und ißt und trinkt. Wie’s satt ist, sagt’s:
»Ein’n schönen Dank,
Und gute Gesundheit dein Leben lang!«
Darauf läuft’s weiter. Nicht lange, so kommt ein kleiner blauer Schmetterling geflogen. »Kleines Blaues«, sagt Goldtöchterchen, »wollen wir uns ein wenig haschen?« »Ich bin’s zufrieden«, antwortet der Schmetterling, »aber du darfst mich nicht angreifen, damit nichts abgeht.«
Nun haschen sie sich lustig auf der Wiese herum, bis es Abend wird. Wie es anfängt zu dämmern, setzt sich Goldtöchterchen hin und denkt, jetzt willst du dich ausruhen; dann gehst du nach Hause. Wie’s so sitzt, merkt’s, daß die Blumen im Grase auch schon alle müde sind und einschlafen wollen. Das Gänseblümchen nickt ganz schläfrig mit dem Kopfe, richtet sich dann noch einmal auf, sieht sich mit gläsernen Augen um, und dann nickt’s noch einmal. Da steht eine weiße Aster daneben (und das war jedenfalls die Mutter) und sagt:
»Gänseblümchen, mein Engelchen,
Fall’ nicht vom Stengelchen!
Geh zu Bett, mein Kind.« Und das Gänseblümchen duckt sich hin und schläft ein. Dabei verschiebt sich’s weiße Mützchen, daß ihm die Spitzen gerade über’s Gesicht fallen. Darauf schläft auch die Aster ein.
Wie Goldtöchterchen sieht, daß alles schläft, fallen ihm die Augen auch zu. Da liegt es nun auf der Wiese und schläft, und mittlerweile läuft seine Mutter immer noch im ganzen Hause umher und sucht’s und weint. Sie geht in alle Kammern und sieht in alle Winkel, unter alle Betten und unter die Treppe. Dann geht sie auf die Wiese bis an den Busch und durch den Busch bis an den Teich. Über den Teich kann es nicht gekommen sein, denkt sie und geht wieder zurück, und durchsucht noch einmal alle Winkel und Ecken und sieht unter alle Betten und unter die Treppe. Wie sie damit fertig ist, geht sie wieder auf die Wiese, und wieder in den Busch, und wieder bis an den Teich. Das tut sie den ganzen Tag, und je länger sie es tut, desto mehr weint sie. Der Mann aber läuft unterdessen in der ganzen Stadt umher und fragt, ob niemand Goldtöchterchen gesehen hat.
Als es aber ganz dunkel geworden war, kam einer von den zwölf Engeln, die jeden Abend über die ganze Welt hinwegfliegen müssen, um nachzusehen, ob sich nicht irgendwo ein kleines Kind verlaufen hat, und es wieder zu seiner Mutter zu bringen, auch auf die grüne Wiese. Als er Goldtöchterchen hier liegen und schlafen sah, hob er es behutsam auf, ohne es zu wecken, flog bis über die Stadt und sah nach, in welchem Hause noch Licht war. »Das wird wohl das Haus sein, wo’s hingehört«, sagte er, als er das Haus von Goldtöchterchens Eltern sah, und das Licht im Wohnzimmer brannte immer noch. Heimlich sah er zum Fenster hinein: Da saßen Vater und Mutter sich an dem kleinen Tische gegenüber und weinten, und unter dem Tisch hielten sie sich die Hände. Da öffnete er ganz leise die Haustüre, legte das Kind unter die Treppe und flog fort.
Und die Eltern saßen immer noch am Tisch. Da stand die Frau auf, zündete noch ein Licht an und leuchtete noch einmal in alle Winkel und Ecken und unter die Betten.
»Frau«, sagte der Mann traurig, »du hast ja schon so oft vergeblich in alle Winkel und Ecken und unter die Treppe gesehen. Geh zu Bett. Unser Goldtöchterchen wird wohl in den Teich gefallen und ertrunken sein.«
Doch die Frau hörte nicht, sondern ging weiter, und wie sie unter die Treppe leuchtete, da lag das Kind da und schlief. Da schrie sie vor Freude so laut auf, daß der Mann eilends die Treppe herabgesprungen kam. Mit dem Kinde auf dem Arm kam sie ihm freudestrahlend entgegen. Es schlief ganz fest, so müde hatte es sich gelaufen.
»Wo war es denn? Wo war es denn?« rief er.
»Unter der Treppe lag’s und schlief«, erwiderte die Frau, »und ich habe doch heute schon so oft unter die Treppe gesehen.«
Da schüttelte der Mann mit dem Kopfe und sagte: »Mit rechten Dingen geht’s nicht zu, Mutter; wir wollen nur Gott danken, daß wir unser Goldtöchterchen wieder haben!«
Vom unsichtbaren Königreiche
Vom unsichtbaren Königreiche
I
n einem kleinen Hause, welches wohl eine Viertelstunde abseits von dem übrigen Dorfe auf der halben Berghöhe lag, wohnte mit seinem alten Vater ein junger Bauer, namens Jörg. Es gehörten zu dem Hause so viel Ackerfeld, daß beide eben keine Sorgen hatten. Gleich hinter dem Hause fing der Wald an, mit Eichen und Buchen, so alt, daß die Enkelkinder von denen, welche sie gepflanzt hatten, schon seit mehr als hundert Jahren tot waren; vor ihm aber lag ein alter zebrochener Mühlstein – wer weiß, wie der dahin gekommen war. Wer sich auf ihn setzte, der hatte eine wundervolle Aussicht hinab ins Tal, auf den Fluß, der das Tal durchströmte, und die Berge, die jenseits des Flusses aufstiegen. Hier saß der Jörg am Abend, wenn er seine Arbeit auf dem Feld getan hatte, den Kopf auf die Hände und die Ellenbogen auf die Knie gestützt, oft stundenlang und träumte, und weil er sich wenig um die Leute im Dorf bekümmerte und meist still und in sich gekehrt einherging wie einer, der an allerhand denkt, nannten ihn die Leute spottweise Traumjörge. Dies war ihm jedoch völlig gleichgültig.
Je älter er aber ward, desto stiller wurde er; und als sein alter Vater endlich starb und er ihn unter einer großen alten Eiche begraben hatte, wurde er ganz still. Wenn er dann auf dem alten zerbrochenen Mühlsteine saß, was er jetzt viel häufiger tat als zuvor, und hinab in das herrliche Tal sah, wie die Abendnebel an dem einen Ende hereintraten und langsam an den Bergen hinwandelten, wie es dann dunkler wurde und dunkler, bis zuletzt der Mond und die Sterne in ihrer ganzen Herrlichkeit am Himmel heraufzogen: dann wurde es ihm so recht wunderbar ums Herz. Denn dann fingen die Wellen im Fluß zu singen an, anfangs ganz leise, bald aber deutlich vernehmbar, und sie sangen von den Bergen, wo sie herkämen, vom Meer, wo sie hinwollten, und von den Nixen, die tief unten im Grunde des Flusses wohnten. Darauf begann auch der Wald zu rauschen, ganz anders wie ein gewöhnlicher Wald, und erzählte die wunderbarsten Sachen. Besonders der alte Eichbaum, der an seines Vaters Grabe stand, der wußte noch viel mehr wie alle die anderen Bäume. Die Sterne aber, die hoch am Himmel standen, bekamen die größte Lust, herabzufallen in den grünen Wald und in den blauen Strom, und flimmerten und zitterten wie jemand, der es gar nicht mehr aushalten kann. Doch die Engel, von denen hinter jedem Sterne einer steht, hielten sie jedesmal fest und sagten: »Sterne, Sterne, macht keine Torheiten! Ihr seid ja viel zu alt dazu, viele tausend Jahre und noch mehr! Bleibt im Lande und nährt euch redlich!« –
Es war ein wunderbares Tal! – Aber alles das sah und hörte bloß der Traumjörge. Die Leute, welche im Dorf wohnten, ahnten gar nichts davon; denn es waren ganz gewöhnliche Leute. Dann und wann schlugen sie einen von den alten Baumriesen um, zersägten und zerspellten ihn, und wenn sie eine hübsche Klafter aufgerichtet hatten, sprachen sie: »Nun können wir uns wieder eine Weile Kaffee kochen.« Und im Fluß wuschen sie ihre Wäsche; das war ihnen sehr bequem. Von den Sternen aber, wenn sie so recht funkelten, sagten sie weiter nichts als: »Es wird heute nacht recht kalt werden; wenn nur unsere Kartoffeln nicht erfrieren.« Versuchte es einmal der arme Traumjörge, ihnen eine andere Meinung beizubringen, so lachten sie ihn aus. Es waren eben ganz gewöhnliche Leute.
Wie er nun so eines Tages wieder auf dem alten Mühlsteine saß und bei sich bedachte, daß er doch auf der ganzen Welt mutterseelenallein sei, schlief er ein. Da träumte ihm, es hinge vom Himmel eine goldene Schaukel an zwei silbernen Seilen herab. Jedes Seil war an einem Sterne befestigt; auf der Schaukel aber saß eine reizende Prinzessin und schaukelte sich so hoch, daß sie vom Himmel zur Erde herab und von der Erde wieder zum Himmel hinauf flog. Jedesmal, wenn die Schaukel bis an die Erde kam, klatschte die Prinzessin vor Freude in ihre Hände und warf ihm eine Rose zu. Aber plötzlich rissen die Seile, und die Schaukel mit der Prinzessin flog weit in den Himmel hinein, immer weiter, immer weiter, bis er sie zuletzt nicht mehr sehen konnte.
Da wachte er auf, und als er sich umsah, lag neben ihm auf dem Mühlsteine ein großer Strauß von Rosen.
Am nächsten Tag schlief er wieder ein und träumte dasselbe. Beim Erwachen lagen richtig die Rosen wieder da.
So ging es die ganze Woche hindurch. Da sagte sich Traumjörge, daß doch irgend etwas Wahres an dem Traum sein müsse, weil er ihn immer wieder träumte. Er schloß sein Haus zu und machte sich auf, die Prinzessin zu suchen.
Nachdem er viele Tage gegangen war, erblickte er von weitem ein Land, wo die Wolken bis auf die Erde hingen. Er wanderte rüstig darauf zu, kam aber in einen großen Wald. Plötzlich hörte er hier ein ängstliches Stöhnen und Wimmern, und als er auf die Stelle zugegangen war, von welcher das Gestöhn und Gewimmer herkam, sah er einen ehrwürdigen Greis mit silbergrauem Barte auf der Erde liegen. Zwei widerlich häßliche, splitternackte Kerle knieten auf ihm und suchten ihn zu erwürgen. Da blickte er um sich, ob er nicht irgendeine Waffe fände, mit der er den beiden Kerlen zu Leibe gehen könnte, und da er nichts fand, riß er in seiner Todesangst einen großen Baumast ab. Kaum jedoch hatte er diesen erfaßt, als er sich in seinen Händen in eine mächtige Hellebarde verwandelte. Damit stürmte er auf die beiden Ungeheuer los und rannte sie ihnen durch den Leib, so daß sie mit Geheul den Alten losließen und fortsprangen.
Darauf hob er den ehrwürdigen Greis auf, tröstete ihn und fragte, warum ihn die beiden nackten Kerle hätten erwürgen wollen.
Da erzählte jener, er sei der König der Träume und aus Versehen etwas vom Wege ab in das Reich seines größten Feindes, des Königs der Wirklichkeit, gekommen. Sobald dies der König der Wirklichkeit bemerkt habe, hätte er ihm durch zwei seiner Diener auflauern lassen, damit sie ihm den Garaus machten.
»Hattest du denn dem König der Wirklichkeit etwas zuleide getan?« fragte Traumjörge.
»Behüte Gott!« versicherte jener. »Er wird aber überhaupt sehr leicht gegen andere ausfällig. Dies liegt in seinem Charakter – und mich besonders haßt er wie die Sünde!«
»Aber die Kerle, die er geschickt hatte, dich zu erwürgen, waren ja ganz nackt!«
»Jawohl«, sagte der König, »splitterfasernackt. Das ist so Mode im Lande der Wirklichkeit. Alle Leute gehen dort nackt, selbst der König, und schämen sich nicht einmal. Es ist ein abscheuliches Volk! – Weil du mir nun aber das Leben gerettet hast, will ich mich dankbar gegen dich erweisen und dir mein Land zeigen. Es ist wohl das herrlichste der Welt, und die Träume sind meine Untertanen!«
Darauf ging der König der Träume voran, und Jörg folgte ihm. Als sie an die Stelle kamen, wo die Wolken auf die Erde hingen, wies der König auf eine Falltüre, welche so versteckt im Busch lag, daß sie gar nicht zu finden war, wenn man es nicht wußte. Er hob sie auf und führte seinen Begleiter fünfhundert Schritte hinab in eine hell erleuchtete Grotte, welche sich meilenweit in wunderbarer Pracht hinzog. Es war unsäglich schön! Da waren Schlösser auf Inseln mitten in großen Seen, und die Inseln schwammen umher wie Schiffe. Wenn man in ein solches Schloß hineingehen wollte, brauchte man sich nur an das Ufer zu stellen und zu rufen:
»Schlößlein, Schlößlein, schwimm heran,
Daß ich in dich 'reingehn kann!«
dann kam es von selbst an das Ufer. Weiter waren noch andere Schlösser da auf den Wolken; die flogen langsam in der Luft. Sprach man aber:
»Steig herab, mein Luftschlößlein,
Daß ich kann in dich hinein!«
so senkten sie sich langsam nieder. Außerdem waren noch da Gärten mit Blumen, die am Tag dufteten und in der Nacht leuchteten; schillernde Vögel, die Märchen erzählten, und eine Menge anderer ganz wunderbarer Sachen. Traumjörge konnte mit Staunen und Bewundern gar nicht fertig werden.
»Nun will ich dir auch noch meine Untertanen, die Träume, zeigen«, sagte der König. »Ich habe deren drei Sorten. Gute Träume für die guten Menschen, böse Träume für die bösen und außerdem Traumkobolde. Mit den letzteren mache ich mir zuweilen einen Spaß, denn ein König muß doch auch zuweilen seinen Spaß haben.« –