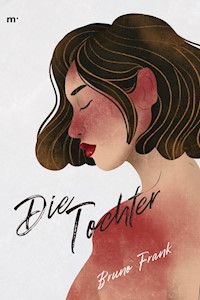3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Leben des Freiherrn von der Trenck ist die Geschichte einer großen tragischen Liebe, bestimmt von Leidenschaft und Freiheitsdrang und überschattet von der rätselvollen Gestalt Friedrichs des Großen. Der ungestüme 17jährige Offizier, der Adjutant des Königs, verliebt sich heimlich in die Prinzessin Amalie von Preußen. Er wird gefangen gesetzt, entflieht und führt ein unstetes abenteuerliches Wanderleben. Friedrich der Große verfolgt seinen einstigen Günstling auch außerhalb seines Landes und läßt ihn abermals in den Kerker werfen. Dennoch hält Trenck das Andenken dieses einsamen Mannes, der seine Liebe zerstört hat, in Ehren und widmet seine Memoiren »dem Geist Friedrichs des Einzigen«. Ungewöhnlich wie sein Leben ist auch der Tod dieses deutschen Adligen, den die freiheitlichen Ideen der Französischen Revolution begeisterten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Ähnliche
Bruno Frank
Trenck
Roman eines Günstlings
FISCHER E-Books
Inhalt
Erstes Buch
Erstes Kapitel
DER KADETT im Regiment Gardes-du-Corps, Friedrich Freiherr von der Trenck, stand inmitten seiner Quartierstube, die nichts weiter aufwies als zwei Betten und Tisch und Schrank und Stühle aus Tannenholz, und betrachtete seine neue Uniform. Deren Stücke lagen ausgebreitet auf einem der Betten, beleuchtet von zwei Kerzen, die der junge Herr rechts und links entzündet hatte, und ihre Pracht kontrastierte beinahe anstößig mit der kahlen Umgebung.
Es lagen dort ein Rock aus scharlachrotem Samt, mit reicher silberner Fransenarbeit verziert und sowohl vorne als auf dem Rücken mit einem großen, leuchtenden Silberstern bestickt, ferner ein Hut aus feinem, schmiegsamstem Filz mit breiten, silbernen Tressen und hochragender, schneeweißer Feder, silberne Sporen, eine silberne Feldbinde und, als Hauptstück, ein eleganter Küraß, ein Brustharnisch, der völlig mit massivem Silber überzogen war und ganze Strahlenbündel, ein wahres Feuerwerk von Silber in die braune Freudlosigkeit der Kommißkammer hinaussandte.
Es war der Hochbegriff einer Galauniform, stoffgewordener Traum eines Knabenherzens, und der hier in Hemd, Kniehosen und Strümpfen vor seinem Bett stand und den Schatz enthusiastisch betrachtete, war denn auch beinahe ein Knabe, wenig über siebzehn.
Er war ungewöhnlich groß und vom vollkommensten Wuchs, in den Schultern breit, schmal in den Hüften, Hände und Füße stark und doch adelig gebildet, mit einem ebenmäßigen und feinen Gesicht, das vom Leben noch ungezeichnet war, aber von Natur aus geprägt mit dem Siegel des Geistes und der Leidenschaft. Dieses Knabenantlitz konnte bedeutend scheinen, und es mußte beunruhigen, denn im Blick der weitgeschnittenen Augen, in den Linien des reichen Mundes, sogar im Muskelspiel der Wangen war etwas Maßloses, das dem jugendlichen Frieden der breiten und glatten Stirn schicksalhaft widersprach.
Maßlos war auch in diesem Augenblick die Freude, der er sich hingab. Er stand da mit unersättlichen Augen und preßte, um sich zu bändigen, so fest seine Fäuste ineinander, daß ihm die Knöchel weiß wurden.
Ja, dies war nun die Uniform eines Offiziers bei den Gardes-du-Corps, die schönste und prächtigste in ganz Europa, und sie kostete weit über tausend Taler, der Silberharnisch allein schon über siebenhundert. Um diese Prunkmontur zu beschaffen, war er vor drei Wochen, gleich nachdem er eingestellt und als Kadett vorläufig eingekleidet worden, mit der täglichen Post nach Berlin hinübergefahren, ohne Urlaub, was dem Unkundigen schlecht hätte bekommen können. Um sieben am Morgen fuhr er ab und stand um zwölf in der ihm unbekannten, weitläufigen Stadt, der die noch lückenhaft bebauten Plätze und Avenuen ein Aussehen gaben ähnlich dem eines Menschen, der zu weite Kleider trägt. Aber er hatte sich zurechtgefunden. Er hatte seinen Purpursamt bei Prager in der Spandauer Straße gekauft, die Fransen dazu bei Pailly Unter den Linden, das Tressenwerk und die Feldbinde im Ephraimschen Hause am Mühlendamm. All dies trug ein Lohndiener hinter ihm her zum empfohlenen Schneider. Den Harnisch aber und die Sporen hatte er An der Stechbahn bei Frommery bestellt. Heute nun waren die fertigen Stücke alle zusammen hier angelangt. Da lagen sie und strahlten.
Auf der Silberwölbung des Panzers zuckte und flackerte plötzlich das Licht. Trenck wandte sich um, nicht ganz ohne Hast. Aber es war nur ein Stubengenosse, von Rochow, der eintrat. Die Herren schliefen paarweise beisammen in der Kaserne, so wenig komfortabel war das Leben in der Leibeskadron des vornehmsten Regiments in Preußen.
Der Leutnant kam heran. Er sah zart, vornehm und klug aus und mochte zwanzig sein. „Oh, ich störe in der Andacht“, sagte er mit einer sympathisch belegten Stimme, „du hältst Gottesdienst vor deiner Zukunft, wie ich sehe.“
Trenck, in Verlegenheit, gab keine Antwort.
„Ich möchte dich nur kurz aufmerksam machen, lieber Trenck, daß du diese hübschen Sachen noch eine Weile in den Kasten schließen mußt, denn Panzer und Silberzeug sind noch nichts für kleine Kadetten.“
„Ich nehme an“, sagte Trenck wenig verbindlich, „daß die Sachen nicht sehr lange im Kasten liegen werden.“
„Da nimmst du vermutlich etwas Falsches an. Man hat dich hier bei den Offizieren einquartiert, das ist eine ungeheure Ehre, zweifellos. Aber vom Schlafen bei den Offizieren bis zum Offizierwerden ist immerhin ein Schritt. Also gib nur acht, daß deine Achillesrüstung nicht blind wird!“
Trenck antwortete wieder nicht, und als der andere nach ihm hinblickte, sah er ihn finster und rot vor Zorn. Er trat auf ihn zu.
„Trenck, ich bitte dich ernstlich, nimm dich zusammen! Du kannst doch nicht solch ein Gesicht ziehen, wenn sich ein Kamerad einen Scherz mit dir macht – ein Vorgesetzter, müßte ich eigentlich sagen“, fügte er verdrossen hinzu. „Ins Bett jetzt, es ist zehn vorbei.“
Sie beschäftigten sich schweigend mit ihrer Toilette. Im wesentlichen bestand sie darin, daß sie ihre ganze Unterkleidung, Hemd und Strümpfe, aber auch die Kniehose, mit einer genau gleichen Garnitur vertauschten. Als sich der Offizier eben seinem Lager zukehren wollte, fühlte er von rückwärts Trencks Hand auf seinem Arm.
Er wandte sich um, sah den jungen Menschen an und lächelte.
„Es ist ja alles gut“, sagte er höchst liebenswürdig. „Nur bezähme dich um Gottes willen! Schlaf wohl.“
Sie löschten das Licht und streckten sich auf die sehr kurzen und unbequemen Ruhestätten hin, Trenck auf der seinen mußte sich förmlich zusammenkrümmen. Sie lagen in fast vollkommener Stille, selten einmal scholl aus den Ställen unter ihnen ein Klirren oder ein Wiehern oder ein Hufschlag herauf. Von draußen kam kein Laut. Um diese Stunde bewegte sich in ganz Potsdam kein Mensch mehr auf den Straßen umher, es war so gut wie verboten. Auch keinerlei Helligkeit drang durch das vorhanglose Fenster herein, der Mond war noch nicht aufgegangen, und die Stadt war ohne Beleuchtung.
„Ist es nicht eigentlich unwürdig, daß wir hier so ohne Licht liegen müssen?“ sagte Trenck nach einer Weile, da er an Rochows Atemzügen erkannte, auch jener liege noch wach.
„Es ist Befehl, also ist es nicht unwürdig.“
„Ist es nicht unwürdig, daß dort überm Kanal der Kommandeur uns beaufsichtigt und es meldet, wenn nach zehn Uhr noch ein Fenster hell gewesen ist?“
„Er hat den Befehl, also ist es nicht unwürdig.“
„Ach Rochow, rede nicht so tugendhaft! Du bist ja doch von unsern sechs Herren der allerkritischste. Meinst du, ich weiß das nicht?“
„Solche Bemerkungen schicken sich nicht für einen Kadetten.“
Diesmal war Trenck nicht beleidigt. Rochow vernahm im Dunkeln, wie er sich emporstützte auf seinem Strohsack.
„Aber ich kann dir versichern“, rief er herüber, „daß ich als blutjunger Student, als ein halbes Kind, in Königsberg hundertmal mehr Freiheit genossen habe.“
„Woraus man vielleicht nur schließen muß, daß halbe Kinder noch nicht auf eine Universität gehören.“
„Oh, ich war auch der Einzige. So jung wie ich war keiner, bei weitem nicht.“
„Liebster Trenck, das weiß ich ja alles, du hast ja die Güte gehabt, mir das mehrfach zu erzählen. Ich weiß, wer mein Stubengenosse ist! Ich weiß, daß sie dich mit dreizehn Jahren schon immatrikuliert haben, und daß du der Benjamin warst unter dreitausend Studenten. Ich weiß auch, was du alles studiert hast: Jus und Mathematik und Philosophie und Naturwissenschaft, und daß du vier Sprachen sprichst und daß du mit vierzehn dein erstes Duell gehabt hast, weil dir die Nase eines Herrn von Wallenstein nicht gefiel …“
„Wallenrodt!“ korrigierte Trenck.
„O Vergebung: Wallenrodt. Und daß du voriges Jahr öffentlich zwei gelehrte Disputationen durchgefochten hast, und daß du ein großes, großes Licht bist. Und nur eines weiß ich nicht: warum du mit solchen Gaben ausgerüstet nichts Besseres zu tun gewußt hast, als dem ersten besten Wink zu folgen und hier in unser Strafregiment einzutreten.“
„Strafregiment!“ rief Trenck und merkte gar nicht, daß er den Standpunkt wechselte. „Das erste Europas!“
„Herr Baron sind in superlativischer Laune. Gleich das erste Europas! Jedenfalls das geplagteste. Jedenfalls das einzige Garderegiment, in dem die Offiziere täglich drei Stunden lang beim Pferdeputzen dabei sein müssen, jedenfalls auch das einzige, bei dem sie in Hosen und Strümpfen schlafen, weil so ziemlich jede Nacht zwei- oder dreimal Alarm geblasen wird.“
„Ganz sicher das einzige, Rochow. Aber warum? Doch nur, weil diese eine kleine Truppe die Muster- und Pflanzschule der ganzen preußischen Reiterei sein soll, – darum wird von uns das Riesige gefordert, darum wird einem nicht einmal der Schlaf gegönnt. Wer das Höchste nicht leistet, soll ausscheiden, beim geringsten Verstoß wird er davongejagt.“
„O ja“, sagte Rochow.
„Aber wer es leistet“, schloß Trenck kindlich verzückt, „wer seinen Mann steht, wer sich bewährt, der wird dereinst auch General und Feldmarschall.“
„Bravo Trenck, so ist’s recht. Hier wird jeder Feldmarschall!“
Aber Trenck ließ sich nicht beirren. Sein Innerstes kehrte sich hervor, sein Ehrgeiz, seine ungemessene Ruhmsucht.
„O Rochow“, sagte er laut und pathetisch in das Dunkel hinein, „das war schon ein Glückstag für mich, als der Baron Lottum nach Königsberg kam. Es gibt doch Fügungen. Bei meinem Großvater mußte er zu Mittag speisen, und ich war dabei!“
„Wie heißt dein Großvater eigentlich?“
„Es ist der Gerichtspräsident von Derschau.“
„Ah, Beamtenadel!“
Trenck schluckte hinunter und sprach in kaum gemäßigtem Tone fort: „Er war selber noch so jung, der Herr von Lottum, und doch schon General, Generaladjutant, so glänzend erhoben. Er sah mich, ich gefiel ihm, er machte mir Aussichten. Gleich war ich bereit. Eine Gloriole flammte vor mir.“
„Eine silberne Rüstung vermutlich.“
„Ich kann darüber nicht spotten hören, Rochow. Du lachst ja vielleicht, aber für mich ist der Ruhm noch etwas Großes, bei dessen Namen es mich schauert. Bedenke doch, wie wir beide es getroffen haben: beide so jung, im vordersten Regiment der Monarchie und, Rochow, daß wir’s nur aussprechen – unter wessen Augen, unter wessen Fahnen!“
„Ja ja!“
„Unter den Fahnen des ersten Monarchen der Welt.“
„Schon wieder des ersten.“
„Des jüngsten, des überraschendsten, des genialsten. Des Königs, dessen erste Tat es war, unter den staunenden Augen der Welt mit kühnem Griffe von dem uralt-übermächtigen Feind sich sein Recht zu holen.“
„Nun, sein Recht …“
„Sein Erbe!“
„Nun, sein Erbe …“
„Du machst Scherz, Rochow. Du kannst das nicht anzweifeln.“
Rochow antwortete nicht sogleich, aber Trenck hörte ihn in der Dunkelheit gutmütig ein wenig vor sich hin lachen. Er ließ sich Zeit. Endlich sagte er in ziemlich leichtem Ton:
„Ach weißt du, bester Trenck, das mit dem Recht und mit dem Erbe, das überlassen wir doch besser den Gelehrten, die werden das in zweihundert Jahren schon untereinander ausmachen. Er war kühn, und es ist ihm geglückt, mehr brauchen wir nicht zu wissen.“
„Eben“, sagte Trenck befriedigt.
„Aber meine Gedanken kann ich mir trotzdem machen, nicht wahr? Zum Beispiel ist es doch sonderbar, daß ich, der Herr von Rochow, jetzt nicht aufstehen darf, wenn es mir Spaß macht, und ein wenig in der Stadt Potsdam spazieren gehen, die von Rechts wegen mir gehört.“
„Wie?“
„In der eigentlich ich König bin.“
„Rochow“, sagte Trenck etwas verdrießlich, „was redest du eigentlich?“
„Du bist gelehrt, Trenck, du hast öffentlich disputiert, aber du bist doch nicht gelehrt genug. Brandenburgische Geschichte scheinst du nicht gelernt zu haben. Sonst müßtest du wissen, wem der erste Hohenzoller, der hier ins Land kam, die Stadt Potsdam hat abnehmen müssen. Einem Rochow, lieber Trenck, einem Rochow!“
Trenck saß aufrecht im Bett. Ganz schwach waren seine Umrisse erkennbar. „Das ist ja wahr“, sagte er aufgeregt. „Das habe ich in meinen Gedanken nie zueinander gebracht. War das wirklich einer von den Deinen?“
„Natürlich“, sagte Rochow behaglich. „Und jetzt liege ich hier als ein kleiner Leutnant unterm Befehl der gleichen Hohenzollern und darf nicht einmal Licht anzünden!“
Licht sollte ihnen werden. Denn im gleichen Augenblick wurde drunten auf der Straße, gerade unter ihrem Fenster, eine Fackel entzündet und ein scharf schmetterndes Trompetensignal zerriß zugleich mit diesem Flammenschein die Nacht.
Der Alarm! Da war es, das Schrecknis, das beinahe allnächtlich und mehrmals oft die Anwohner am Kanal nicht nur, sondern die ganze Umgebung zu willkürlichen Stunden aus dem Schlafe riß, da war sie, die Plage der Offiziere, der Mannschaft, der Pferde. Wo immer man im Quartier lag, hier in Potsdam, in Charlottenburg oder sonstwo – denn die Leibeskadron war gewissermaßen ambulant, und wo der König war, da war sie – nirgends blieb man damit verschont. Der junge Fürst, den man bewachte, schien seiner Elitetruppe nicht das Recht auf menschliche Schwachheit zuzugestehen.
Die beiden jungen Menschen, Trenck und sein Freund, der Herrscher von Potsdam, waren in ihrer nun brandhell erleuchteten Kammer auf die Füße gesprungen und machten sich fertig, mit eiligen Griffen. Oh, gut noch, daß man nicht eingeschlafen war. Denn aufzucken etwa aus erstem Schlaf und mit taumelnden Sinnen nach den Monturstücken tappen, immer aufs Neue war das Gewalt und Qual. Ohne ein Wort fuhren sie in ihre hohen Stiefel und in ihre Dienstuniform, die handbereit lag, ein Griff galt der Feldbinde, einer dem Hut, sie nahmen den Degen und stürzten davon.
Trenck, sonst immer der Raschere, blieb heute zurück. Zu Füßen seines Bettes auf dem Boden lagen sauber hingeschichtet die Galastücke, und auf der Silberwölbung des Panzers tanzte und flackerte blutig das Fackellicht. Er mußte hinschauen. Aber schon stolperte auch er durch den Korridor, schwang sich im Finstern die knarrende Treppe hinunter und lief die rückwärtige Pforte hinaus.
Jetzt war es wirklich kein Vorzug, daß er Offiziersquartier hatte. Die Offizierspferde nämlich standen drüben im königlichen Reitstall an der Mammonstraße, und so war es ein doppelter Weg bis zum Schloß, und wer nicht binnen acht Minuten vom Erklingen des Signals an gekleidet und gewaffnet und gesattelt dort vor der Rampe, der sogenannten Grünen Treppe, hielt, der flog unweigerlich auf vierzehn Tage in Arrest, und wem das zweimal geschah, der durfte seinen Ehrgeiz begraben.
So kam es, daß allnächtlich, wenn der König in Potsdam war, die Einwohner gewisser Straßen, der Berliner Straße nämlich, des Altmarkts und der Schwertfegergasse, den Anblick genießen konnten, wie die Abkömmlinge stolzer Geschlechter Preußens in Abständen hintereinander herrannten, gehetzt, vom Schlafe gleichsam noch dampfend, sporenlärmend und stolpernd und stampfend in den noch schlecht sitzenden Stiefeln. Aber es öffnete sich kein Fenster mehr, das Schauspiel war lange banal.
Trenck kam zum Reitstall, da stand sein braunes Pferd schon rittbereit vor dem Tor. Er sah nach der Gurtung, denn keine Nachtstunde bot Gewähr, daß nicht ein anderer höchst kritisch nach ihr sah, er schwang sich auf und – oh Zauber des Muß! – er hielt vor Ablauf der Frist mit brausenden Schläfen an jener südwestlichen Ecke des Schlosses.
In drei Gliedern war die kleine Schar angeordnet, 150 Mann in rotem Rock und weißer Weste, gleichmäßig beritten auf braunen Pferden. Die sechs Offiziere hielten vor der Front. Der Kadett Trenck, eingereiht in das zweite Glied, tastete unsicher an sich herum und endlich wußte er, was ihn beunruhigte: in der Hast hatte er den neuen Hut erwischt, der ihm nicht zukam, seinen Galahut mit den breiten Borten und der hochstehenden Feder. Nun, es war zu spät, mochte denn alles seinen Lauf gehen.
Tiefste, vollkommene Stille auf dem ungeheuren Paradeplatz. Die Spätherbstnacht war kalt, doch klar. Überm Schlosse seitlich stand der volle Mond. Im ersten Stockwerk war eine Anzahl Fenster erleuchtet, dies war vermutlich das einzige Licht, das in Potsdam jetzt brannte.
Der Posten, ein Garde-du-Corps auch er, präsentierte mit klappendem Griff. Oben war die Mitteltür gegangen. Der König kam die Rampe herunter.
Er war im Gesellschaftsanzug aus Goldbrokat, an dem im Mondlicht große Brillantknöpfe blitzten. Vermutlich hatte er Gäste. Den modisch kleinen Hut trug er unterm rechten Arm, und die reiche Haarwelle, die ihm Stirn und Schläfen umgab, war elegant gerollt und sorgsam gepudert. Für einen Unwissenden hätte es aussehen können, als amüsiere sich hier ein beliebiger Elegant unter den Rokokofürsten damit, seine Leibwache auch des Nachts zu schikanieren, sich an ihrer Schlaftrunkenheit und an der eigenen Willkür zu weiden, während er auf wenige Minuten aus seinen strahlenden Salons zu ihnen niederstieg. Doch über solche Einschätzung hatte sich der junge Herr in Brokat ein für allemal hinausgeschwungen, durch seinen Eroberungskrieg vor zwei Jahren nämlich, auf den Europa noch immer mit offenem Munde zurückschaute.
Er nahm die vorschriftsmäßige Meldung des Kommandeurs entgegen, dankte und schritt zwischen den Gliedern hindurch. Aber sein Abschreiten war heute Formalität, das war sofort fühlbar, er hatte nichts auszusetzen, die Pünktlichkeit genügte ihm diesmal, er blickte freundlich umher. Dennoch schien er etwas zu suchen.
„Kadett von der Trenck“, sagte er und blieb vor ihm stehen, „absteigen, mitkommen!“
Trenck zitterten die Füße im Bügel. War es der Tressenhut? Er überließ sein Pferd dem Manne zur Linken und folgte, taumelnd beinahe, dem König. Unbeweglich hielt die Reiterfront. Friedrich grüßte leicht und ging zwischen der Sphinx aus Stein und dem präsentierenden Posten die Rampe hinauf; der Kadett, zweifelnden Schrittes, zog hinterher. Als sie durch den Mittelgang oben das Schloß betraten, vernahm Trenck ein kurzes Kommando und gleich darauf das Trappeln der abreitenden Eskadron.
Zweites Kapitel
DER UNGEHEURE, leere und hallende Saal, in den man unmittelbar von der Rampe aus gelangte, lag in braunem, wolkigem Dunkel, nur an der rechten Schmalwand, dort, wo eine Tür zu ferneren Gemächern offen stand, brannte in einem Kandelaber ein einziges Licht und schickte schwache Strahlen in jener Ecke umher; rötlich glänzte an der Wand ein Stück Marmor auf, bleich schimmerte weißer Marmor am Boden, und als der König rasch vorüberschritt und die bewegte Luft das Kerzenlicht aufflackern machte, ward für einen Augenblick auch ein riesiges Wandgemälde teilweise aus der Dunkelheit gerissen: ein zackiger Ausschnitt davon wurde sichtbar und Trenck sah einen Fürsten thronend auf seinem Triumphwagen, von vier weißen Hengsten gezogen, von Minerva geleitet und Herkules.
Durch die Wand, welche dieser Triumphzug schmückte, folgte Trenck dem Führer. Kein Diener war sichtbar. Ein ziemlich leeres, großes Zimmer wurde durchschritten, wiederum nur sparsam erleuchtet; ein kolossaler Schatten lief mit dem eleganten König über die getäfelte und gemalte Wand.
Im nächsten Zimmer machten sie Halt. Es war ein kleiner wohnlicher Raum, fast gleichseitig, die Decke leicht gekuppelt, der Boden quadratisch parkettiert. Die Wände bestanden aus einem besonders schönen braunen Material, das gewiß Zedernholz war, aber wie Schildpatt wirkte, silbernes Palmen- und Lorbeergezweige zog sich darüber hin. Zwei große silberne Armleuchter brannten. Ein hoher Spiegel war eingelassen, sein Rahmen war Silber. Ein kleiner Sekretär mit einem Sesselchen davor, ein ovaler Tisch und einige Stühle machten die ganze Einrichtung aus. Alle Sitze waren mit silberfarbenem Tuch überzogen. Eine lichtbraune Tür, vom gleichen silbernen Rankenwerk überspielt, führte in ein Nebenzimmer, aus dem sich Gespräch und leises Lachen und Kristallklirren vernehmen ließ. Selbst diese Laute wirkten silbern, und sie vermischten sich für den jungen Trenck, der salutierend auf der Schwelle stehen geblieben war, mit dem Schmuck, der hier schimmerte.
„Gut, gut“, sagte Friedrich, „Türe schließen, näherkommen! Sie sprechen Französisch?“ fuhr er fort, bereits in dieser Sprache. „Sie waren mir empfohlen. Sie tun jetzt drei Wochen Dienst, haben Sie in dieser Zeit irgendwelche Verstöße gegen die Disziplin begangen?“
Trenck wollte verneinen.
Friedrich hob die Hand: „Ich meine natürlich: abgesehen von der Fahrt ohne Urlaub gleich zu Anfang.“
Trenck biß die Zähne zusammen.
„Sie waren damals nicht unterrichtet. Aber sonst ist nichts vorgekommen?“
„Nein, Sire.“
„Sie haben sich da elegante Sachen machen lassen, ein wenig vor der Zeit“ – und er deutete leicht mit dem Kopfe nach Trencks Galahut – „sind Sie so wohlhabend?“
„Sire, mein Vater hat mir unser Stammgut Großscharlach vererbt. Es bringt tausend Taler im Monat.“
„Das nenne ich reich. Ihre Mutter lebt noch? Wo ist sie?“
„Meine Mutter hat den Oberstleutnant Grafen Lostange geheiratet. Sie leben in Breslau.“
„Ah? Wann hat Ihre Mutter geheiratet?“
„Im Jahre, als mein Vater starb: 1740.“
„Das war“, sagte Friedrich, mit einer sehr merkwürdigen Höflichkeit, „im selben Jahre, in dem auch mein Vater starb.“
Trenck stand und horchte. Diese menschlichen, ja intimen Worte, so unerwartet, so unerklärlich, sie hoben den ungeheuren Abstand auf, der den so absoluten Herrscher von seinem jüngsten Soldaten trennte. Die Nachtstunde kam hinzu. Es trat ihm gewaltig ins Bewußtsein, was hier mit ihm geschah, und der Atem blieb ihm aus.
Der König sprach wieder. Er sprach ziemlich schnell, in einem Französisch, das ihm als seine wahre Mutter- und Haussprache mühelos und elegant vom Munde ging, mit hoher, klingender Stimme; ein eigentümlicher Reiz lag darin, daß er das R nicht völlig rein, sondern weich gerollt, ein wenig nach Art der Engländer oder eines Kindes formte.
„Hören Sie, Trenck“, sagte er, „ich habe Sie mir ein wenig angesehen. Sie können schießen, fechten können Sie auch, Entfernungen schätzen auch, einen Körper haben Sie, als könnten Sie Ihr Pferd nach Hause tragen, wenn es sich den Fuß verstaucht, und den Fuß wird es sich bestimmt verstauchen, wenn Sie so tollkühn darauf losspringen wie vorgestern drüben bei Glienicke. Also das Zeug zu einem Soldaten haben Sie, zu einem Reiter ganz gewiß.“
Trenck flammte vor Glück.
„Aber“, sagte Friedrich, „das ist noch nicht viel. Ich höre da wunderbare Dinge über Ihren Verstand und Ihr Gedächtnis. Sie haben bereits studiert, gleich von der Ammenbrust weg vermutlich. Also, was wissen Sie?“
Er wartete keine Antwort ab auf diese recht allgemeine Frage. „Passen Sie auf“, fuhr er fort und nahm vom Schreibtisch ein Blatt Papier, „ich werde Sie fragen. Aber nicht so wie ein Professor im Examen, hübsch nach der Schnur, sondern holterdiepolter.“ (Er sprach auch dies französisch aus, ganz weich: oldredipoldre.) „Ich habe hier eine Liste, es sind die Rekruten vom Regiment Prinz Heinrich, 39 Namen. Wie lange brauchen Sie, um die auswendig zu lernen?“
„Fünf Minuten, Sire.“
„Ah? Nun, hier ist die Liste. Mühlehof, Renzel, Badenhaupt, Scholz … Es ist gut geschrieben.“
Er reichte dem Kadetten das Blatt hin, nahm Akten zur Hand, lehnte sich mit gekreuzten Beinen leicht gegen den Schreibtisch und war, seinem Gesichtsausdruck nach, im selben Augenblick auch schon völlig absorbiert.
Trenck übersah ohne Furcht die Liste. Auf sein Gedächtnis konnte er sich verlassen, dem König war kein Märchen erzählt worden.
Mit angehaltenem Atem und mit saugenden Sinnen las er die Namenreihe, jedes Lautbild schlug er sich gleichsam ins Gehirn und ging zum nächsten. Beim zweitenmal aber war es nicht mehr der einzelne Klang, den er ergriff, sondern der Zusammenhang mit den Nachbarn, die Lautkette, der Rhythmus. Dann ließ er sein Papier sinken und ging an die Reproduktion.
Er arbeitete methodisch. Plötzlich sah er im Spiegel den König, in ganzer Figur, wie er mit gekreuzten Füßen am Schreibtisch lehnte und las. Unter einem Zwang betrachtete er ihn, mit einer Art von zweitem Bewußtsein, Seelenkräften, die durch sein gewaltsames Memorieren nicht gebunden waren.
Was er zuerst wahrnahm im Spiegel, war eine Einzelheit an Friedrichs Anzug, eine auffallende und beinahe anstößige Inkorrektheit. Der König trug zu seinem schönen Gesellschaftskleid, zwischen dem Galarock aus Goldbrokat und den weißseidenen Strümpfen, ein Paar Reithosen, einfache, ziemlich abgenutzte Hosen aus ganz derbem blauem Tuch. Sie wirkten wie ein gewagter und etwas finsterer Witz.
Trencks Blick glitt nach aufwärts, er umfaßte, während sein Hirn in krampfhafter Mühe an den Soldatennamen arbeitete, des Königs Brust, mächtig breit und gewölbt unter der Seide, ganz unverhältnismäßig heldenhaft, gemessen an der kleinen und zarten Gestalt, er umfaßte die Hände, die das Schriftstück hielten, weiße schmale Hände, Frauenhände beinahe, und machte halt bei dem geneigten Antlitz.
Das Leben im Freien, Feldzug und Manöver, Ritte durch Sonne und Wetter hatten dies Antlitz gefärbt, es war braunrot, wie es dem Kriegsmanne ziemt. Dabei war es ein kleines und feines Gesicht. Die Augen, gesenkt auf das Dokument, konnte Trenck nicht sehen, aber die hochgeschwungenen dunklen Brauen, Erbteil aller Brandenburger, betrachtete er, den schönen Ansatz des Haares, die sonderbar gerade Linie von Stirn und Nase gebildet, das runde, entschiedene Kinn und, zwischen noch weichen Wangen, den weichen Mund, dessen Winkel jedoch abwärts gezogen und schon scharf markiert waren, wie von Leid oder von Enttäuschung oder einfach von körperlichem Ungemach, denn seine Gesundheit war ja nicht die stärkste.
Das Gesicht im Spiegel hob sich empor. Die gespiegelten Augen hafteten plötzlich in Trencks Augen. „Nun also?“ sagte der König und streckte, im Spiegel, fordernd die Hand aus nach der Liste.
Trenck war zusammengefahren. Er war allein gewesen mit dem Spiegelbild und hatte die Gegenwart vergessen. Doch er bekam sich sogleich in die Gewalt und begann: „Mühlehof, Renzel, Badenhaupt, Scholz, Teller, Sadewasser, Köpek, Janiken, Lange, Sokowski, Butzer, Gradolf, Steinkeller, Zindler …“
Bei diesem Namen Zindler, dem vierzehnten in der Reihe, stockte der Kadett. Auf einmal verband er mit dem Klang einen Begriff, und zwar den Begriff von etwas Furchtbarem.
Es war aber dies. Im Regiment Prinz Heinrich hatte zwei Tage vorher ein Offizier dem Rekruten Zindler ein Auge ausgeschlagen. Dann hatte er ihm ein Achtgroschenstück hingeworfen und geschrien: „Das ist das Geld für die Fensterscheibe!“
„Zindler“, wiederholte Trenck, „Zindler“ und schwieg. Er wußte nicht weiter.
Der König wandte ihm den Blick zu und sagte sofort: „Dieser Soldat bekommt eine Pension von mir. Der Offizier liegt in Eisen.“
‚Bin ich denn Glas?‘ dachte Trenck.
„Genug hiermit, andere Proben! Die Namen der Planeten!“ Und Friedrich begann mit leichten Tritten ein wenig vor ihm auf und ab zu wandeln. „Die römischen Kaiser von Titus an! Die Namen der Eumeniden! Die Musen! Die Bilder des Sternkreises! Die zwölf Arbeiten –“ Trenck fiel ihm fast schon ins Wort, ehe der Name des Herkules ausgesprochen war.
„Was wissen Sie von Literatur? Kennen Sie Racine, kennen Sie Boileau, kennen Sie Pradon, kennen Sie Corneille? Beweisen Sie es! Rezitieren Sie Verse von Corneille! Wie, die über den Tod? Ah, das ist eine lustige Wahl.“
Und Trenck, ohne Deklamation, immer im eiligsten Tempo, begann:
Lebe dein Leben mit Todesmut,
Tod ist die Kerkertür dieser Welt,
Und sie führt in ein Nachtgezelt,
Drin es sich tief und herrlich ruht …
Er kam nicht weiter. Es öffnete sich jene Tür, hinter der es so silbern tönte, und eine junge Dame erschien auf der Schwelle. Trenck sah auch sie wiederum im Spiegel, im selben Spiegel, in dem er den König gesehen hatte. Er verstummte.
Inmitten ihrer ungeheuer gebauschten starrseidenen Röcke sank die junge Dame in eine tiefe, offenbar scherzhaft gemeinte Reverenz und sagte mit einem entzückend kindlichen Ausdruck von Bitte und Drolerie dies eine Wort:
„Sire!“
Sie war die Abgesandte der so lang harrenden Gäste. Hinter ihr tat sich in Silber und Zartgrün und Rosa, von Licht überrieselt, überflimmert, als ein wahrer Himmel von Heiterkeit und zierlich geschwungener Pracht das große Festzimmer auf.
„Ich komme, ich komme, Amélie“, sagte der König. „Ihr seid ja zu fünft, liebe Schwester! Ich habe nur noch wenige Minuten.“
Sie sank lächelnd abermals in ihre Beugung zurück, wundervoll und kostbar anzusehen mit ihrer schmalen türkisfarbenen Taille, die aus der schweren Pracht der Röcke aufwuchs, der leuchtenden Brust und dem blühenden Halse, mit ihrem hellen, frischen, lebensvollen Gesicht unter der schneeig gepuderten Haarwoge, diesem schönen Gesicht, das den gezeichneten Zügen des Bruders ähnlich war. Ein Hauch von verwöhnter, gepflegter Jugend wehte von ihr durchs Zimmer.
„Das Jus haben Sie ja auch studiert“, sagte der König sofort, als die Tür sich geschlossen hatte, und tat vielleicht nicht zufällig diesen Schritt hinüber auf das dürrste Wissensfeld. „Das Erbrecht nach Justinian gefälligst! Es gibt da vier Grade der Erben. Wie heißt der Merkspruch?“
Und der Siebzehnjährige, sich aus einer Bezauberung reißend, sekundierte sofort:
„Descendens omnis succedit in ordine primo,
Ascendens propior, germanus, filius ejus,
Tunc latere ex uno …“
„Ich höre an Ihrer Betonung, daß Sie Latein besser verstehen als ich. Das ist gut. Ein Krieger sollte den Caesar lesen können, so bequem wie das Exerzierreglement. Man hat zuviel Ablenkung. Als ich König wurde, wollte ich ernstlich damit beginnen. Aber dann wurde ich sogleich abgelenkt.“
‚Als ich König wurde?‘ dachte Trenck. ‚Wie spricht er zu mir? Ich bin siebzehn Jahre. Er wurde abgelenkt. Ja, statt römische Geschichte zu lesen, hat er preußische Geschichte gemacht.‘
„Preußische Geschichte“, sagte Friedrich, so als denke er einfach die Gedanken des andern weiter, „muß ein preußischer Offizier natürlich noch besser kennen als die Geschichte Roms. Wie kam diese Stadt Potsdam an mein Haus?“
Trenck starrte auf diesen König. Den engte kein Vorurteil ein. Der schrieb sein Besitzrecht nicht Gottes Gnade zu. Der sprach vom Anfang der Herrschaft wie ein andrer Mensch von dem Tage spricht, an dem sein Vater sich einen Pelzrock gekauft hat. Der Abend war zu viel für Trencks Knabenkopf, zu viel Denkstoff wurde ihm zugemutet. Er blieb stumm. Er gefährdete sein Examen. Er stammelte: „Sire …“
„Wissen Sie es nicht? Sie brauchen nur Ihren Schlafkameraden zu fragen.“
„Sire, ehe die Stadt Potsdam dem Hause Hohenzollern anheimfiel, stand sie unter der Botmäßigkeit der Herren von Rochow.“ Trenck leierte, er sagte seine Schullektion her. „Als der Burggraf Friedrich Verweser von Brandenburg wurde, mußte er Potsdam … mußte er Potsdam …“
„… mußte er Potsdam dem Herrn von Rochow mit Gewalt aus den Händen reißen“, ergänzte Friedrich. „Ich sehe, Sie wissen es. Jetzt setzen Sie sich dorthin und zeichnen Sie mir eine kleine Skizze dieser Stadt Potsdam auf, möglichst genau.“
Dies war die schwierigste Aufgabe. Trenck entledigte sich ihrer, indem er alle Geländekenntnis zusammennahm, die ihm von seinen Ritten und Übungen geblieben war. Aber er brachte die komplizierte Halbinselgestalt der Siedlung mit ihren Verzweigungen und Wassereinschnitten doch nur leidlich zu Wege.
„Ja, ja, ja“, sagte der König, wie er das Papier in Händen hielt. „Sie hätten allerdings kenntlich machen müssen, daß die Stadt überall mit Wall und Graben befestigt ist, nur hier im Süden an der Havel einfach mit Palisaden.“
Dies war mehr als milde. Offenbar war der König mit seinen Gedanken nicht bei dem Blatt. Er ließ es auch einfach zu Boden fallen, ging zwei Schritte auf den jungen Menschen zu und sagte:
„Trenck, ich habe Sie prüfen wollen, um die Wundergerüchte über Sie ein wenig zu kontrollieren. Ein König soll nichts glauben. Es ist angenehm zu sehen, daß Sie ein Gedächtnis haben wie der römische Redner Hortensius und daß Sie von Corneille etwas wissen und von Justinian und vom alten Herrn von Rochow. An und für sich ist das noch nichts. Sie sind aber aus dem Stoff, aus dem man Männer macht. Ich will einen aus Ihnen machen.“
Trenck atmete nicht.
„Sie beginnen erst zu leben. An Jahren sind Sie noch ein Kind. Sie haben eine lange Bahn vor sich. Ich will Ihr Leben für mich haben. Sie fahren gut dabei. Aber bewachen Sie sich. Hüten Sie sich. Halten Sie sich. Ich kenne Ihre Wutanfälle, Ihre Zweikämpfe. Meine Erkundigungen waren kaum nötig, es steht alles in Ihrem Gesichte zu lesen. Ihre Zukunft ist höchst gefährdet. Wäre sie es nicht, so wäre sie auch nicht so voller Taten – die möglich sind. Seien Sie hart mit sich, Trenck, härter noch, als es der Dienst verlangt. Seien Sie auch aufrichtig mit mir! Sie können es sein. Seit ich König bin, habe ich noch kein Gesicht gesehen, das mir so gefällt wie Ihres.“
Trenck war auf ein Knie gesunken, mit niedergebeugtem Haupt. Es war keine bedachte Geste. Zu mächtig senkte sich diese Stunde auf seinen Knabennacken. Friedrich sah auch, daß die Bewegung echt war. Er ließ ihn ruhig liegen.
In verändertem Tone fuhr er fort, leicht und angenehm geschäftsmäßig. „Ich mache Sie zum Offizier, Herr von der Trenck. Ihre Ausrüstung ist meine Sorge, senden Sie die Rechnungen an die Hofstaatskasse in Berlin. Sie können sich morgen zwei meiner Pferde aussuchen. Greifen Sie dreist zu, es dürfen schöne Pferde sein. Wir werden viel zusammen reiten. Sie tun Adjutantendienst bei mir. Guten Abend.“
Trenck war aufgesprungen, außer sich. Er wollte reden, danken, beteuern. Aber Friedrich winkte nur einmal gnädig mit der Hand und ging. Der Lichtabgrund aus Silber, Meergrün und Rosa öffnete sich für einen Augenblick, aufschwirrendes Rufen und Grüßen empfing den König, die türkisfarbene Taille der Schönen schien vorzuleuchten, und sogleich war alles verschwunden.
Trenck ging hinweg, auf nicht ganz sicheren Füßen.
Ungeheure Stille im Schloß. Im Marmorsaal war die eine Kerze erloschen, aber in breiten Bahnen flutete Mondlicht ein durch die Riesenfenster und erhellte bleich den gewaltigen Prunk. Trenck, im Gehen, wandte sich um nach dem Bilde des Siegreichen. Es war nun sichtbar in seinem ganzen Ausmaß. Aber blaß und als ein Gespenst thronte der Kurfürst auf seinem Wagen, und totenhaft, geistergleich anzusehen, schienen Minerva und Herkules ihn anderswohin zu geleiten als zum Triumph.
Trenck stieg die Rampe nieder. Der wachthabende Soldat, der Sphinx aus Stein gegenüber, sehr groß anzuschauen im Mondlicht, machte sich fertig zum Salut, unterließ ihn aber, da er den Kadetten erkannte. Der Mann blickte ihm nach, wie er dahinging auf dem breit gedehnten leeren Paradeplatz, der weiß beschienen war. Er taumelte, er überquerte den Platz in einem großen Haken, er schlug auch gar nicht die Richtung ein nach dem Garde-du-Corps-Quartier, es sah aus, als habe er sich spät in der Nacht in des Königs Hause bezecht.
Es war bitter kalt, und er hatte kein Überkleid, aber er fühlte das nicht. Er gelangte durch die Mammonstraße, er hörte im Vorbeiwandern drinnen im Reitstall des Königs Pferde, die er morgen reiten würde, mit den Hufen gegen die Mauer schlagen, er überschritt, immer einsam im Mondlicht, den Kanal auf der Breiten Brücke, bog ab und stand bald an der Stadtmauer. Wie aufwachend beschaute er das verschlossene Jägertor, auf dem oben eine Tiergruppe gegen den magisch erhellten Nachthimmel sich abzeichnete, der Hirsch, der von Hunden gestellt wird. Nun erst schlug er den Heimweg ein, vorbei am großen Bassin. Er ging, den innern Sinn in starrer Entzückung auf ein helles Phantom gerichtet.
Er sah nicht den König, er blickte auch nicht, Glorienträumer der er doch war, in seine Zukunft, die das Gefallen des Herrschers so phantastisch, so über alles Hoffen weit vor ihm auftat. Die Ergriffenheit, die ihn aufs Knie genötigt hatte, war dahin, von der Entscheidungsstunde im Schlosse war nichts übrig in ihm als Ein Augenblick, als Ein Anblick. Er sah sie – in der türkisfarbenen Taille, aus der mit allem betörenden Zauber der Jugend Brust und makelloser Hals sich aufhoben zum blühend schönen Antlitz unter schneeiger Krone. Es war fast das Antlitz des Bruders, das ihm da erschimmerte im gleichen Spiegel, es waren, weitgeschnitten und von dunklem Stahlblau, seine Augen – aber ihr Strahl war ganz ohne Härte; es war, seltsam gerade, ungebrochen, die gleiche Linie von der freien Stirn zur Nase – aber ganz ohne Strenge bei ihr, von einer erregenden Pikanterie; es war derselbe wohlgebildete, feine und verwöhnte Mund, dem man die Beredsamkeit ansah – aber nicht umzeichnet von Kerben der Enttäuschung oder der Trauer oder der Krankheit. Sie erschien ihm, die Schwester dieses Königs, die Tochter von Königen, als das Weib selber, als die vollkommene Lockung des Geschlechts.
Er war, früh herangereift, bis zum heutigen Tage nichts andres gewesen als ruhmbegierig. Sein Vater, in Ostpreußen Landeshauptmann, alter Soldat mit achtzehn Narben, der sich zu früh verabschiedet glaubte, seine Mutter, aus dem Blute hoher Beamter, hatten diese Leidenschaft in ihm genährt. Der schöne, hochbeanlagte Knabe war in ihrem provinziellen Zirkel nicht viel weniger gewesen als ein Wunder, alle Kräfte seiner Seele wurden auf ehrgeizige Ziele gesammelt. Nun trug ihn die eine Nachtstunde höher hinauf als jemals sein Traum. Aber vermessen von Schicksals wegen, geschlagen mit dem Durst nach Schicksal von allem Anfang an, steckte er in dieser selben Nachtstunde zum ersten Mal die Arme nach dem Weibe aus, nach diesem Weibe, der Schwester dieses Königs, der Tochter von Königen.
Von der Kanalseite her hatte er das Quartier erreicht, ward eingelassen und stieg blinden Auges die knarrende Treppe hinauf; dann stand er in seiner Stube, in die durch vorhanglose Scheiben das Mondlicht stark einflutete. In seiner Bezauberung vergaß er die Tür zu schließen und schritt traummäßig vorwärts, den Blick in die geisterhelle Nacht gerichtet, aus der ihm, mit dem Strahl des Gestirns, der Umriß der plötzlich Geliebten entgegenfloß.
Da krachte es, dröhnte und tönte unter ihm, unheilvoll laut in der Nachtstille. Mit seinem schwer gestiefelten Fuß war er auf die Silberwölbung des Panzers getreten und hatte sie zerstampft.
Rochow saß aufrecht im Bett, vom Monde weiß, und rief ihn an, mit schlafschwerer Zunge.
Drittes Kapitel
DER GARTEN stieß an die Spree. Sein Uferstück wurde rechts und links von zwei Lusthäuschen begrenzt. Vor dem einen saß auf einem Schemel Trenck der Adjutant und wartete auf den König.
Überm Flusse hatte er den Mühlendamm vor sich mit Spazierwegen und Gärten und einzelnen, verstreuten Häuschen. Es war ländlich still, nur das Klappen einer Baumschere war vernehmbar und von jenseits des Wassers das Lachen zweier Spaziergängerinnen, dem man anhörte, daß sie rein nur aus Jugend und Albernheit lachten.
Man befand sich in Monbijou, dem Sitz der verwitweten Königin, den sie mit ihren beiden noch unvermählten Töchtern Ulrike und Amalie teilte. Es war ein hübsches, einstöckiges Fürstenhaus, ein wenig außerhalb der Stadt gelegen, von Friedrichs sohnlicher Zuvorkommenheit elegant erweitert und vom etwas verspielten Kunstgefühl der Königin mit vielen reizvollen Kleinigkeiten ausgeschmückt. Friedrich, im vierten Jahre König, ohne Lieblingswohnung noch, ja ohne rechte Stätte, kam mitunter von Potsdam oder Charlottenburg herüber, um der Mutter seine Achtung zu bezeugen. Heute aber war er bei der jüngeren Prinzessin angesagt worden, ausdrücklich bei ihr, denn das schwedische Eheprojekt sollte bereinigt werden. Die Unterredung hatte soeben begonnen.
Trenck, zu seinem Kummer, hatte das Schloß nicht mit dem König betreten.