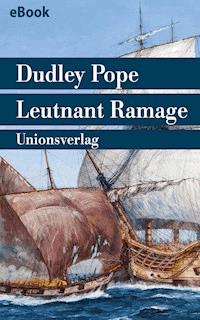8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Admiral Nelson höchstpersönlich erteilt Nicholas Ramage den Befehl, die schöne Marchesa di Volterra mit seinem Kutter Kathleen sicher nach Gibraltar zu bringen, ohne sich in ein Gefecht verwickeln zu lassen. Dennoch stellt und beschießt er eine spanische Fregatte, gewinnt den Kampf, muss aber zulassen, dass die Marchesa von einem aufkreuzenden englischen Schiff an Bord genommen wird. Noch schlimmer: Durch einen Verrat gerät er bald darauf in spanische Gefangenschaft. Ihm gelingt die Flucht – doch diese bleibt nicht sein letztes Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Admiral Nelson höchstpersönlich erteilt Nicholas Ramage den Befehl, die schöne Marchesa di Volterra sicher nach Gibraltar zu bringen. Doch ein aufkreuzendes englisches Schiff nimmt sie an Bord. Noch schlimmer: Durch einen Verrat gerät Ramage bald darauf in spanische Gefangenschaft.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Dudley Pope (1925–1997) ging im Alter von sechzehn Jahren zur Handelsmarine. Nach einer Verletzung wurde er Journalist für maritime Themen. Der Autor C. S. Forester empfahl ihm, Schriftsteller zu werden. Nach durchschlagendem Erfolg lebte er ab 1953 auf seiner Segeljacht.
Zur Webseite von Dudley Pope.
Eugen von Beulwitz (1889–1969) war nicht nur Übersetzer, sondern auch Kapitän. Neben der Serie um Leutnant Nicholas Ramage übersetzte er auch die Abenteuerreihe um Horatio Hornblower von Cecil Scott Forester.
Zur Webseite von Eugen von Beulwitz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Dudley Pope
Trommelwirbel
Die Seefahrten des Leutnant Ramage
Roman
Aus dem Englischen von Eugen von Beulwitz
Die Seefahrten des Leutnant Ramage
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1967 unter dem Titel Ramage and the Drumbeat im Verlag Weidenfeld & Nicolson, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1968 unter dem Titel Ramage – Die Trommel schlug zum Streite im Stahlberg Verlag, Karlsruhe.
Originaltitel: Ramage and the Drum Beat
© 1967 by Dudley Pope
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Paul Wright
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30850-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 20:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TROMMELWIRBEL
1 – Die feuchtwarme Luft des Mittelmeersommers hatte bewirkt …2 – Wenn John Smith II. nüchtern war, wirkte er …3 – Ramage wohnte zurzeit in der Kammer Southwicks …4 – George Edwards, der Stückmeistersmaat der Kathleen, hatte seine …5 – Die spanische Fregatte hieß La Sabina. Sie lag …6 – Ramage war eben im Begriff, über die Reling …7 – Southwick sprang mit einem Satz die letzten drei …8 – Als Ramage eben vor Anbruch der Morgendämmerung durch …9 – Ramage blickte mit gespieltem Gleichmut durch seinen Kieker …10 – Die ganze Besatzung der Kathleen entbehrte die belebende …11 – Die Männer der Kathleen wurden auf der spanischen …12 – Der Nachtschlaf hatte Ramage nicht erfrischt, er war …13 – Während Ramage am folgenden Tag einen Ausflug an …14 – Weihnachten und Neujahr gingen vorüber. Ramage und seine …15 – Vom Büro des Kommissars bis zum Konvent hatte …16 – Der Sturm hielt noch drei weitere Tage an …17 – Als Ramage am nächsten Morgen erwachte, hatte er …18 – Kurz nach Mitternacht begann es«, schrieb Ramage in …19 – Als Ramage durch sein Glas die sechs spanischen …20 – Jetzt war die Kathleen auf ihrem befohlenen Platz …21 – Ramage hielt sich auf einer Karronade im Gleichgewicht …22 – Die Trommel schlug im Gleichtakt mit seinem Herzen …Mehr über dieses Buch
Über Dudley Pope
Über Eugen von Beulwitz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Dudley Pope
Zum Thema Meer
Zum Thema Schmöker
Zum Thema England
Zum Thema Abenteuer
1
Die feuchtwarme Luft des Mittelmeersommers hatte bewirkt, dass die Wasserzeichen des Briefpapiers gequollen waren wie verheilte Schrammen auf der Haut und die Bogen modrige gelbe Ränder bekommen hatten. Der Befehl, von einem Sekretär untadelig zu Papier gebracht, verriet durch die Blässe der Schrift, dass der Mann knapp an Tintenpulver gewesen war. Das Schriftstück war vom 21. Oktober 1796 datiert und trug den Briefkopf: »Kommodore Horatio Nelson, Kommandant Seiner Majestät Schiff Diadem und ältester Offizier Seiner Majestät Schiffe und Fahrzeuge im Hafen von Bastia.« Es war an »Leutnant Lord Ramage, Kommandant Seiner Majestät Schiff Kathleen« adressiert, sein Inhalt beschränkte sich, der Gewohnheit des Kommodore entsprechend, auf ein paar kurze, bündige Sätze:
»Sie werden hiermit ersucht und angewiesen, die Marchesa di Volterra und den Grafen Pitti an Bord des Ihnen unterstellten Schiffes Seiner Majestät zu nehmen und mit den beiden auf dem schnellsten Wege nach Gibraltar zu versegeln. Achten Sie darauf, sich dabei möglichst weit südlich zu halten, um Begegnungen mit feindlichen Kriegsschiffen tunlichst zu vermeiden. Nach der Ankunft in Gibraltar haben Sie sich unverzüglich bei dem Kommandierenden Admiral zu melden, um von ihm Befehle für Ihre weitere Verwendung entgegenzunehmen.«
– und zu erfahren, sagte sich Ramage, dass die Marchesa und Pitti auf einem weit größeren Schiff nach England weitersegeln sollten. Er selbst sollte mit seiner Kathleen wohl wieder zum Verband des Kommodore stoßen, der bis dahin bestimmt den Abtransport der britischen Truppen aus Bastia beendet hatte (sodass ganz Korsika den Rebellen und Franzosen wieder anheimfiel) und nach der Insel Elba zurückgelaufen war, um auch dort zu retten, was noch zu retten war, während die Truppen des Generals Bonaparte auf dem italienischen Festland schon wie eine Sturmflut nach Süden strömten.
In Genua, Pisa, Mailand, Florenz, Livorno, zurzeit vielleicht schon in Civitavecchia und in Rom – kurz in allen Städten und Häfen, die schön und für die Franzosen von Nutzen waren, wehte jetzt die Trikolore, erhob sich der schmiedeeiserne Freiheitsbaum (mit der absurden roten Jakobinermütze obenauf). Dieses Wahrzeichen stand immer auf der Hauptpiazza in der Stadtmitte, und gleich daneben stand die Guillotine für jene bereit, die sich außerstande fühlten, die bitteren Früchte dieses Baumes der Freiheit zu verdauen.
Und doch, sagte sich Ramage schmunzelnd, er konnte sich über Bonaparte bei Gott nicht beschweren. Seiner Invasion hatte er es zu danken, dass er als erstes Kommando Seiner Majestät Kutter Kathleen befehligte, und wiederum Bonaparte, diesem seltsamen Cupido, hatte er es zu danken, dass jetzt eine vor dessen Truppen geflohene schöne Frau auf seiner Kathleen weilte, eine Frau, für die er in Liebe entbrannt war.
Er kitzelte sich mit der Feder seines Gänsekiels die Nase und dachte dabei an einen Befehl, jenen Geheimbefehl, der sich ausgewirkt hatte wie eine Lunte an einer ganzen Reihe von Pulverfässern. Eins um das andere waren sie in den letzten Monaten hochgegangen und hatten dabei seine Laufbahn ernstlich erschüttert.
Am 1. September, als der Kommandant der Fregatte Sibella den Befehl erhielt, war er der jüngste der drei Leutnants an Bord gewesen. Nach jenem Befehl, den nur der Kommandant kannte, sollte die Sibella einen Punkt vor der italienischen Küste ansteuern und dort einige Angehörige des italienischen Adels übernehmen, die vor den Franzosen geflohen waren und sich nahe der Küste verborgen hielten.
Aber die Sibella stieß dabei zufällig auf ein französisches Linienschiff und wurde zum Wrack geschossen. Er, Ramage, war der einzige überlebende Offizier. Als die Nacht anbrach, gelang es ihm, mit den unverwundeten Männern in den übrig gebliebenen Booten zu entkommen. Ehe er die Sibella verließ, nahm er den Geheimbefehl des gefallenen Kommandanten an sich.
Hätte er das Schriftstück in der eigens dafür vorgesehenen beschwerten Kassette über Bord werfen sollen? Natürlich wäre das richtig gewesen, denn es lag immerhin nahe, dass ihn die Franzosen doch noch in ihre Gewalt bekamen.
Er hatte sich nicht dazu entschließen können, sondern den Befehl im offenen Boot gelesen und daraus entnommen, dass die Marchesa di Volterra und zwei ihrer Vettern, die Grafen Pitti und Pisano, sowie mehrere andere Edelleute nur wenige Meilen entfernt an der Küste auf ihre Rettung warteten. Dass die Volterras alte Freunde seiner Eltern waren, hatte seinen Entschluss in keiner Weise beeinflusst – dessen war er sicher –, die Leute mit einem seiner Boote zu retten.
Leider war dann alles schiefgegangen: Nur die Marchesa und ihre beiden Vettern hatten es endlich gewagt, sich dem offenen Boot anzuvertrauen, er selbst aber hatte das Unternehmen zuletzt noch gründlich verpfuscht. Bei einem Überfall durch französische Kavallerie war Pitti allem Anschein nach durch einen Schuss ins Gesicht getötet worden, und Ramage hatte noch Glück gehabt, dass er wenigstens die Marchesa und Pisano in Sicherheit bringen konnte.
Glück? Konnte er dabei wirklich von Glück sprechen? Die Marchesa war verletzt, und Pisano, der sich so feige benahm, dass sich die ganze Bootsbesatzung darüber aufregte, ausgerechnet dieser Pisano hatte ihn plötzlich der Feigheit geziehen. Und als er die beiden sicher nach Korsika gebracht hatte, da hatte er diesen Vorwurf der Feigheit auch noch schriftlich wiederholt.
Heute noch überlief Ramage ein kalter Schauer, wenn er an das Kriegsgericht dachte, das aus dieser Sache entstand. Es war ausgesprochenes Pech, dass der Vorsitzende dieses Gerichts ein Gegner seines Vaters war. Dann aber war es fast unglaublich, wie die Marchesa plötzlich alle Rücksicht auf ihren Vetter beiseiteließ und zu seinen Gunsten aussagte. Ja, sie stellte nicht nur in Abrede, dass er feige gewesen sei, sondern erklärte im Gegenteil, er habe sich verhalten wie ein Held.
Und am Ende, als der erbärmliche Pisano der Verleumdung überführt war, traf Graf Pitti plötzlich in Bastia ein. Von einem Schuss ins Gesicht war keine Rede gewesen, er hatte sich nur den Knöchel verstaucht, als er allein zum Boot rannte, und sich dann unter einem Busch verkrochen, weil er nicht wollte, dass die Retter seinetwegen warteten.
Sowohl die Marchesa wie Antonio Pitti hatten Ramage hinterher dem Kommodore Nelson gegenüber in überschwänglicher Weise herausgestrichen, als dieser während der Kriegsgerichtsverhandlung in Bastia eingelaufen war. Für Ramage aber war und blieb jenes Verfahren eine ärgere Verletzung seines Selbstgefühls, als sich irgendeiner der Beteiligten – ausgenommen höchstens Gianna – träumen ließ. Das ging schon daraus hervor, dass er immer noch darüber nachgrübelte.
Ärgerlich reckte er sich auf. Der Teufel sollte diese ganze Geschichte holen, das war doch alles ausgestanden, er hatte wirklich keine Zeit, wie eine alte Henne herumzusitzen und weiter über das zu brüten, was längst vergangen und vergessen war. Er faltete den Befehl des Kommodore, den er auswendig hersagen konnte, sorgfältig zusammen, schlug sein Logbuch auf und tauchte die Feder in die Tinte. Auf der Linie 9 Uhr schrieb er in die senkrechte Spalte: »Kurs und Wind«, schwungvoll das Wort »Stille«. In die nächste Spalte »Bemerkungen« kam dann: »Sonntag, den 30. Oktober 1796. Besatzung: Dienst nach Plan. 10 Uhr Musterung, 10.30 Uhr Gottesdienst, 11.30 Uhr Decks aufklaren, Rumausgabe. 12 Uhr Backen und Banken.«
Der Ausdruck »Dienst nach Plan« war ihm zuwider, aber er war nun einmal gebräuchlich und erschien täglich mindestens zweimal in jedem Logbuch.
Da es im Augenblick erst 10 Uhr war, hatte er die übrige Routine des Vormittags vorweggenommen. Die Kammer, mit der er sich zurzeit begnügen musste, war so dunkel, heiß und stickig, dass ihm der Aufenthalt in ihr gründlich zuwider war. Ungeduldig wischte er die Feder trocken und machte dabei seinen Daumen schwarz. Dann schloss er das Logbuch und seinen Befehl in den Schreibtisch und ging an Deck. Den Gruß des Postens erwiderte er mit einem kurzen Nicken.
Sein brummiger Ausdruck gab den Männern Anlass, ihm aus dem Weg zu gehen, als er achteraus schritt. Sonntage in See waren ihm vor allem wegen der Salbaderei unangenehm, zu der jeder Kommandant eines Kriegsschiffs Seiner Majestät verpflichtet war, selbst wenn er nur ein ganz junger Leutnant und sein Schiff nur ein winziger Kutter mit zehn Karronaden war.
Noch ärger war ihm, dass er an diesem Spätherbsttag hier im Mittelmeer in der Flaute liegen musste. Die lange, ölglatte Dünung verhieß ihm nicht, dass etwa in den nächsten Stunden, ja in der ganzen kommenden Woche eine Brise aufkommen könnte. So ähnlich musste es im Fegefeuer sein, dachte er. Dabei hatte er es besser als jeder andere an Bord, weil er seine schlechte Laune offen zeigen konnte, was der übrigen Besatzung verwehrt war.
Über die Reling gelehnt, verfolgte er den glatten Kamm jeder Dünung, wie er von achtern aufkam, um seinen Kutter durchzuschaukeln. Erst hob er das breite Heck, dann schoss er voraus, um den Bug zu lüften, während das Achterschiff mit einem klatschenden Lärm ins nächste Wellental sank, der sich etwa anhörte wie das Gequietsche von Füßen in durchweichten Stiefeln.
Die Bewegungen des Schiffs waren regellos, unnatürlich und höchst unangenehm. Der Kutter wurde umhergeworfen wie ein Würfel im Becher, alles, was an Bord beweglich war, bewegte sich. Die Rücklaufschlitten der schweren, ungefügten Karronaden knirschten, und die Läufer ihrer Seitenrichtungstaljen dehnten sich stöhnend, sooft sie mit einem Ruck belastet wurden. Die Blöcke der Fallen schlugen, und die Fallen selbst klatschten heftig gegen den Mast. Und – was Ramage vollends den Rest gab – die Vorsegel waren am Fuß ihrer Stagen festgemacht, auch das Großsegel war geborgen und aufgetucht. Der Verklicker im Topp wirbelte bei jedem Kreisen des Mastes nur wie wild um seine Achse, immer rundherum, statt dass er die Windrichtung angezeigt hätte.
Wegen all dieser Flauten, die nur von kurzen Gewitterböen unterbrochen wurden, hatte die Kathleen in acht Tagen erst vierhundert Meilen zurückgelegt – das ergab eine durchschnittliche Fahrt von weniger als zwei Knoten in der Stunde, nicht einmal so viel wie ein trödelndes Kind auf seinem Schulweg zurücklegte. Dabei war Gibraltar von Bastia elfhundert Seemeilen entfernt, und Ramage hatte stets den Ausdruck »auf dem schnellsten Wege« vor Augen, mit dem ihm der Kommodore seine Aufgabe gestellt hatte.
Ein zorniges Geknurr hinter ihm verriet ihm jetzt, dass Henry Southwick, der alte und für gewöhnlich fast irritierend froh gestimmte Steuermann, sein Erster Offizier, soeben eine letzte Inspektion vornahm, ehe er Schiff und Besatzung klar zur Musterung meldete. Mit einem Mann wie Southwick war die Sonntagsmusterung reine Routine. Ramage wusste genau, dass diesem Mann kein Körnchen Ziegelstaub entging, den man zum Messingputzen benutzte, und dass er jedes Stäubchen Sand entdeckte, dass sich etwa in einem Speigatt versteckt hatte, nachdem das Deck mit Sand und Steinen gescheuert und mit Wasser aus der Handpumpe nachgespült worden war. Das Kupfergeschirr des Kochs war bestimmt blitzblank, die Brotkörbe, Schüsseln und Mucken jeder Back makellos, die Puddingtücher gewaschen. Die Männer waren natürlich schon sauber rasiert und steckten in reinen Hemden und Hosen … Dennoch würde Southwick nun bald vor ihm erscheinen und ihn um die Erlaubnis bitten, die Besatzung mustern zu dürfen. Nach der Musterung wurden dann alle Mann zum Gottesdienst achteraus gepfiffen, den Ramage selbst abzuhalten hatte.
Der Gedanke daran hob sein Selbstbewusstsein, er nahm diese Pflicht ja erst zum dritten Male im Leben auf sich, da er heute genau seit achtzehn Tagen Kommandant der Kathleen war. Noch immer schien es ihm kaum glaublich, dass fast die letzte Eintragung im Musterbuch des Kutters auf seinen Namen lautete: »Leutnant Nicholas Ramage … laut Bestallung vom 19. Oktober 1796 …« Heute war sein dritter Sonntag an Bord – dabei fiel ihm ein, dass nach den Vorschriften des »Dienst an Bord« der Kommandant einmal im Monat der Besatzung die sechsunddreißig Kriegsartikel vorzulesen hatte. Er konnte das gleich heute erledigen, das ersparte ihm die Predigt, außerdem schien die Sonne. Am nächsten Sonntag herrschte vielleicht wieder Sturm und strömender Regen.
Nach drei Jahren Krieg konnten nur die Allerdümmsten jene Bestimmungen noch nicht auswendig hersagen, die jedermann in der Flotte vom Admiral bis zum Schiffsjungen unverblümt über die Gefahren und die Strafen unterrichteten, die ihnen drohten, wenn sie sich des Verrats, der Meuterei, der Gotteslästerung, der Feigheit oder der Trunkenheit schuldig machten. Vor allem aber kannten sie alle den sechsunddreißigsten Artikel, den man scherzhaft den »Deckmantel des Kommandanten« nannte, weil er diesem ausdrücklich das Recht gab, auch alle anderen Missetaten zu bestrafen, die sich abenteuerlustige Seeleute ausdenken mochten. Dennoch konnte man damit rechnen, dass sie auch heute wieder geduldig zuhörten, wenn sie nur zum Abschluss lauthals ein paar geistliche Lieder singen konnten, die ihnen John Smith II. auf seiner schrecklich kratzenden Fiedel vorspielte. Danach rief sie der Pfiff: »Backen und Banken« zu Tisch. Die Freiwächter verbrachten den Rest des Nachmittags mit Possenreißen, Tanzen oder auch mit Zeugflicken. Seine Leute waren keine Musterbesatzung, sagte sich Ramage besorgt, darum brachte man ihm bestimmt noch vor Sonnenuntergang einen oder zwei Stockbetrunkene an, die entweder ihre Rinnrationen aufgespart oder die von Kameraden zusätzlich im Spiel gewonnen hatten.
Die Marchesa di Volterra stand in der Kommandantenkajüte, die sie auf dieser Reise bewohnte, unter dem Skylight und drehte ihren Handspiegel bald nach rechts, bald nach links, um sich zu vergewissern, dass kein loses Härchen dem Chignon entschlüpft war, den sie seit zehn Minuten zu knoten bemüht war. Die Arme taten ihr weh, sie war erhitzt und sehnte sich heute zum ersten Mal nach ihrem Palazzo zurück, seit die Royal Navy in Gestalt des Leutnants Ramage sie mit ihren Vettern vor der Kavallerie Bonapartes gerettet und vom Festland entführt hatte. Dort, in jenem Palast, hatte ein Zucken der Wimpern genügt, und schon waren ein Dutzend Mägde diensteifrig herbeigestürzt.
Heute nun hatte sie zum ersten Mal in ihrem siebzehnjährigen Dasein (nein, fast war sie schon achtzehn, dachte sie stolz) den Wunsch, sich so schön zu machen, dass sie einem bestimmten Mann gefiel, und das musste sie ausgerechnet in dieser winzigen Kammer, ohne Dienstmädchen, ohne Garderobe und ohne Schmuck bewerkstelligen. Wie brachte es Nicholas nur fertig, in einem so winzigen Loch zu leben? Sie war doch viel kleiner als er – wenn sie einander dicht gegenüber standen, ruhte sein Kinn auf ihrem Scheitel. Dabei war der Plafond, oder wie Nicholas dazu sagte, so niedrig, dass sie sich vorneigen musste, wenn sie den Spiegel hoch genug halten wollte. Ungeduldig warf sie ihn zuletzt auf die Schwingkoje und setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, der ihr jetzt als Frisiertisch diente. Accidente! Was nützte ihr alle Mühe? Wäre ihr Haar nur blond! Schwarze Haare hatte doch eine jede, sie wollte anders sein, anders aussehen als die vielen. Ob er vorstehende Backenknochen liebte? Die ihren waren viel zu hoch, und ihr Mund war zu groß, die Lippen hätte sie sich dünner gewünscht. Auch ihre Augen waren zu groß und zu dunkel, sie hätte gern blaue oder graugrüne gehabt, etwa wie eine Katze. Warum war ihre Nase so klein und leicht gebogen? Eine grade Nase wäre ihr viel lieber gewesen. Und ihr Teint war geradezu schandbar. Die Sonne hatte ihre Haut goldbraun getönt, sodass sie aussah wie ein Bauernmädchen und nicht wie eine Dame, die Herrin über eine Stadt und ein Königreich war (wenn dieses Reich auch klein und nur die Stadt groß war). Zwanzigtausend Menschen waren ihr untertan, und keiner davon war jetzt zugegen, um ihr beim Frisieren zu helfen – nur ihr Vetter Antonio, dem nichts Besseres einfiel, als sie zu necken und auszulachen.
Gut, mochte er lachen, aber helfen musste er ihr. Als sie nach ihm rief, betrat ein stämmig gebauter Mann mit vierkant geschnittenem schwarzem Bart ihre Kammer. Er hielt sich gebeugt, um zu vermeiden, dass er mit dem Kopf an die Decksbalken stieß.
»Nun? Welches Gartenfest möchte meine schöne Cousine heute mit ihrer Gegenwart beglücken?«
»Es kommt nur eines infrage, mein Teurer. Hat Leutnant Ramage nicht auch den eleganten Grafen Pitti eingeladen? Jedermann ist bei ihm zu Gast – Nicholas hat veranlasst, dass sie ihre besten Sachen anziehen und geistliche Lieder singen. Vielleicht lässt er noch ein paar mit der siebenschwänzigen Katze auspeitschen, um dir ein besonderes Vergnügen zu bereiten.«
»Es heißt die ›neunschwänzige‹«, korrigierte sie Graf Pitti.
»Meinetwegen hat sie neun Schwänze, Antonio. Bitte hilf mir doch endlich, meine Frisur ein wenig in Ordnung zu bringen.«
»Das ist ganz und gar unnötig. Du bist vollendet schön, das weißt du sehr gut. Wenn du Komplimente hören willst …«
»Sag, willst du mir helfen, mein Haar zu ordnen?«
»Du bist toll in ihn verliebt, nicht wahr?«
Die Frage kam ganz plötzlich und unerwartet. Aber sie errötete nicht und wandte sich auch nicht ab. Sie sah ihm vielmehr fest in die Augen und sagte in scheuem, ja fast ängstlichem Ton: »Ich hätte so etwas nie für möglich gehalten. Ehe ich ihn kennenlernte, war ich ein Kind, jetzt fühle ich mich als Frau, das ist sein Werk. Er ist ein echter Mann, Antonio, er ist so, wie man sich einen Mann vorstellt. Ich kenne nur einen, der ihm zu vergleichen wäre.«
»Und wer ist das?«
»Du, mein lieber Vetter. Eines Tages wird eine Frau für dich ebenso fühlen, wie ich für ihn fühle.«
»Das will ich hoffen«, meinte er trocken, »obwohl ich es nicht verdiene. Aber sag, wie lange kennst du ihn eigentlich – drei Wochen, einen Monat?«
»Ist das denn wichtig?«
»Nein. Vergiss nur nicht, unter welchen Umständen du ihn kennenlerntest. Was da geschah und wie es geschah, gäbe den Stoff für einen Roman. Ein kühner junger Seeoffizier kommt von der Küste ins Land gestürmt, um die schöne Marchesa buchstäblich im letzten Augenblick vor den Hufen der Reiter Napoleons zu retten und …«
»Das habe ich alles bedacht. Ich habe diesen jungen Leutnant aber auch schmutzig, verschwitzt und erschöpft gesehen, ich habe gesehen, wie er, nur mit seinem Messer bewaffnet, gegen jene Reiter Napoleons kämpfte. Ich habe ferner erlebt, wie er wegen eines dummen, hochgespielten Vorwurfs der Feigheit zu Unrecht vor ein Kriegsgericht kam … Gehören diese Dinge etwa auch zum Stoff für einen Roman?«
Pitti schüttelte den Kopf: »Nein, was wird aber, wenn ihr euch trennen müsst? Wenn er für Monate, vielleicht sogar für Jahre mit seinem Schiff in See ist? Geduld war nie deine starke Seite, Gianna. Da du Volterra erbtest, fiel dir doch ohnehin mit einem Mal alles in den Schoß, was du dir wünschen konntest.«
»Das ist richtig«, gab sie zu. »Aber das waren alles materielle Dinge: Juwelen, frohe Feste, aufregendes Erleben. Heute scheint es mir, dass ich alles nur deshalb so unentbehrlich fand, weil ich ihm noch nicht begegnet war. Wenn man niemand hat, den man liebt, dem man vertraut, kurz, für den man lebt, dann ist das Leben langweilig, dann sucht man Ablenkung, Unterhaltung. Wenn die Sonne nicht scheint, braucht man überall viele Kerzen.«
»Erzähle mir doch noch etwas von deinem englischen Kronleuchter.«
Lächelnd gab sie sich Rechenschaft, dass sie im konventionellen Sinn wirklich sehr wenig von ihrem Nicholas wusste. Dagegen hatte sie in dem nun vergangenen Monat inmitten von Gefahren und Abenteuern, angesichts des Todes und der menschlichen Bosheit, vieles über ihn erfahren, was in normalen Zeiten einer Frau in lebenslanger Ehe verborgen bleibt. Auch abgesehen von den Augenblicken unmittelbar drohender Gefahr, hatte sie immer wieder die geheime Qual jener einsamen Entschlüsse miterlebt, von denen das Wohl und Wehe seiner Männer abhing. Sie hatte gesehen, was wohl keiner jener Männer je gewahr wurde, dass der Kommandant eines Kriegsschiffs in schrecklicher Einsamkeit lebt, was einem so jungen und feinfühligen Menschen wie Nicholas besonders schwerfallen musste. Nicholas war in sehr jungen Jahren Kommandant geworden, und seine Stellung hatte ihn noch nicht hart und gleichgültig gegen das Schicksal seiner Untergebenen gemacht (was nach ihrer Überzeugung bei ihm auch späterhin nicht zu befürchten war).
»Vor wenigen Wochen hatte er seinen einundzwanzigsten Geburtstag, seit seinem dreizehnten Lebensjahr fährt er zur See. Die Narbe auf seiner Stirn rührt von einem Säbelhieb her, den er erhielt, als er vor Jahresfrist eine französische Fregatte enterte. Wenn er sich aufregt oder in Bedrängnis ist, reibt er an dieser Narbe herum und blinzelt, außerdem fällt es ihm dann schwer, den Buchstaben rauszusprechen. Ich weiß nicht, warum er nie von seinem Titel Gebrauch macht. Als Sohn eines Earls ist er Lord, und die Navy gebraucht in dienstlichen Schreiben auch diese Anrede. Ich vermute, dass er peinliche Situationen vermeiden möchte, die entstehen könnten, wenn er sich von Vorgesetzten mit ›Lord‹ anreden ließe. Seine Eltern kennen jedenfalls meinen Rang. Oh, Antonio, das nimmt sich doch alles aus wie eine kalte Aufzählung, ich kann ihn dir beim besten Willen nicht beschreiben!«
»Hat es mit seinem Vater nicht irgendeinen Skandal gegeben?«
»Ja, vielleicht kannst du dich an das bekannte Gerichtsverfahren gegen den Admiral Earl of Blazey erinnern. Ich war damals noch zu jung. Du weißt nichts davon? Nun, dieser Earl ist der Vater von Nicholas. Die Franzosen segelten mit einer großen Flotte nach Westindien, und der Earl wurde viel zu spät und mit einem winzigen Schiffsverband hinter ihnen hergeschickt. Er kämpfte tapfer gegen das überlegene Geschwader, aber es gelang ihm nicht, den Gegner zu besiegen – den Franzosen blieb der Sieg ebenfalls versagt. Daraufhin schlug die englische Öffentlichkeit, der nicht bekannt war, wie wenige Schiffe der Earl zur Verfügung hatte – Schiffe, die überdies alt und verbraucht waren –, einen Höllenlärm, der die Regierung in Angst versetzte. Wie es bei Regierungen so üblich ist, wollte sie den Fehler nicht zugeben, den sie begangen hatte, und stellte den Earl vor ein Kriegsgericht, weil er nicht alle französischen Schiffe gekapert hatte.«
»Wurde er für schuldig befunden?«
»Ja – es musste sein, um die Minister zu decken. Er war nun einmal der Sündenbock. Sprach man ihn frei, dann traf die Schuld an dem Misserfolg ganz offenbar die Regierung. Die Richter bei einem Marinekriegsgericht sind Seeoffiziere. Da viele von ihnen in der Politik eine Rolle spielen, war es für die Regierung, beziehungsweise die Admiralität – denn das ist ja das Gleiche – ein Leichtes, solche Offiziere als Richter zu wählen, die vor Gericht ihre Sache unterstützten. Kommodore Nelson sagte mir, solche Dinge kämen öfters vor. Er meinte, die Politik sei der Fluch der Navy.«
»Offenbar hat der Earl also noch viele Feinde in der Navy. Das ist für Nicholas alles andere als angenehm. Es sieht aus wie eine Vendetta.«
»Ja, so ist es in der Tat. Der schreckliche Kerl, der Nicholas in Bastia vor ein Kriegsgericht zerrte, als dieser mich eben gerettet hatte, war ein Günstling dieser Clique. Ein Glück, dass Kommodore Nelson die Zusammenhänge kennt.«
»Wenn der Earl unter den Admiralen immer noch Feinde hat, dann ist auch Nicholas ständig in Gefahr«, überlegte Antonio. »Man kann jeden Menschen ins Unrecht setzen, wenn man nur … Ist sich Nicholas darüber eigentlich im Klaren?«
»Ja, dessen bin ich sicher, obwohl er zu mir kein Wort darüber verlauten ließ. Aber ich habe es oft genug gespürt, wenn er einen wichtigen Entschluss zu fassen hatte. Sofern es dabei auch nur zwei Möglichkeiten gab – in den Augen der Feinde seines Vaters war immer die falsch, für die er sich entschied. Seine Entschlüsse hat das nie beeinflusst, ich spürte nur deutlich, dass er ständig einer lauernden Drohung ausgesetzt war. Es war, als fühlte er, dass der böse Blick auf ihm ruhte …«
»Du hast in einem kurzen Monat eine Menge über Nicholas herausgefunden.«
»Einiges hat mir Jackson erzählt, auch vom Kommodore brachte ich allerhand in Erfahrung.«
»Ist dieser Jackson nicht ein Amerikaner?«
»Ja, er ist ein seltsamer Mann. Man weiß nicht viel über ihn, er hält große Stücke auf Nicholas, obwohl er doppelt so alt ist. Merkwürdig, wenn die beiden in Gefahr sind, ist es, als könnte einer die Gedanken des anderen lesen.«
»Er hat mir das Leben gerettet«, sagte Antonio, »das ist für mich die beste Empfehlung.«
In diesem Augenblick hörte man die zwitschernden Töne einer Bootsmannsmaatenpfeife und gleich darauf einen lauten Befehl. »Gottesdienst«, grinste Antonio, »dein Nicholas gibt einen guten Priester ab.«
Southwick war froh, dass die Musterung und der Gottesdienst vorüber waren. Jetzt hatte er eine Handvoll Leute im Auge, die vorn auf der Back tanzten. John Smith II. saß auf der Trommel der Winsch und spielte ihnen auf seiner kratzenden Fiedel dazu auf. Southwick war von Herzen dankbar, dass die Kathleen eine so gute Besatzung hatte. Von den dreiundsechzig Mann hätte er höchstens zwei oder drei austauschen mögen. An Bord der meisten anderen Schiffe, auf denen er Dienst getan hatte, waren im Gegensatz dazu unter hundert Leuten immer nur zwei oder drei brauchbare gewesen.
Wie sollte man aber wissen, ob Mr Ramage auch etwas bemerkte, dachte er ganz niedergeschlagen. Jeder seiner früheren Kommandanten hatte nach Ziegelstaub, Sand, blindem Messing oder schimmeligem Hartbrot in einer Brotschüssel Ausschau gehalten. Ramage dachte nicht daran. Aber von nahezu zweihundert Kugeln in den Racks neben den Karronaden hatte er ausgerechnet zwei herausgefunden, die unter der schwarzen Farbe so viel Rost angesetzt hatten, dass sie nicht mehr ganz rund waren und beim Laden unter Umständen im Lauf klemmten. Außerdem war zu befürchten, dass sie von ihrer Flugbahn abwichen. Ein Mann, der das entdeckte, ohne die Kugeln mit einer Lehre zu messen, musste imstande sein, durch eine vierzöllige Planke hindurchzuschauen. Nach dieser Betrachtung räumte Southwick willig ein, dass Ramage trotz seiner Jugend der erste aller Kommandanten war, unter denen er gedient hatte, dem der Gefechtswert seines Schiffes mehr am Herzen lag als dessen geputztes Aussehen. Da gerade Krieg war, konnte einem das nur recht sein.
In den sechsundzwanzig Jahren seiner Dienstzeit hatte er nie gedacht, dass er einmal täglich Zeuge sein würde, wie eine Besatzung an drei geschlagenen Stunden Geschützexerzieren in der heißen Vormittagssonne und zwei weiteren vor »Klar bei Hängematten« richtig Gefallen fand. Ein Gutteil dieser gehobenen Stimmung war natürlich der Marchesa zuzuschreiben. Southwick wusste nicht, ob die Idee von ihr oder von Mr Ramage stammte, aber wenn sie mit Mr Ramages Uhr bewaffnet an Deck stand und die Zeit nahm, dann hielt das die Männer sicherlich auf Draht. Und dann war es auch ein hübscher Abschluss des Tages, wenn sie dem Geschütz, das am öftesten als erstes feuerklar gemeldet hatte, aus Mr Ramages Rumvorrat die Preisportionen verteilte.
Aber Southwick war vor allem deshalb überzeugt, dass die Kathleen ein glückhaftes und besonders leistungsfähiges Schiff war, weil jedermann an Bord ihrem Kommandanten, ungeachtet seiner Jugend, volles Vertrauen schenkte. Sechsundzwanzig Jahre Seedienstzeit hatten den Steuermann gelehrt, dass es darauf allein ankam. Der »Dienst an Bord« verlangte, dass die Männer den Kommandanten grüßten und mit Sir anredeten, aber auf diesem Schiff hätten sie das von allein getan. Wenn Mr Ramage auch rasch dabei war, den Leuten wegen nachlässiger Bedienung der Segel oder langsamen Ausrennens der Geschütze eine Abreibung zu verpassen, so wussten doch alle an Bord, dass er selbst die meisten Verrichtungen besser beherrschte als sie, und er hatte eine glückliche Art, ihnen das mit sachlichem Lächeln zu zeigen, wenn es ihm nötig schien; die Männer aber dachten nicht daran, ihm dies etwa nachzutragen, sie sahen darin vielmehr – nun, sagen wir, eine Art von Herausforderung.
Plötzlich merkte Southwick, dass er immer noch seinen Quadranten in der Hand hatte. Er griff nach der Schiefertafel und ging unter Deck in seine Kammer, um dort die eben genommene Mittagsbreite auszurechnen. Mr Ramage rief bestimmt bald nach dem Besteck, da der Tag auf See ja am Mittag begann.
Ramage hätte am liebsten vor Freude gesungen, denn er hatte eben im Norden einen leichten Schatten von Wind entdeckt, der dort über die See hinglitt. Die Kräuselung wurde immer deutlicher und kam auch näher an die Kathleen heran. Noch zwei Minuten, und alle Mann schrien Hurra, als sie im Gleichtakt die Fallen holten, um das Großsegel zu setzen. Ihm folgten dann die größten Klüver und Stagsegel. Wenig später stand auch das Großtoppsegel und der Außenklüver. Während die Männer unter Southwicks Leitung die Schoten holten, warf Ramage einen Blick auf seine Uhr und dann auf die Luvlieken seiner Segel.
Sobald der Steuermann sich überzeugt hatte, dass alle Segel richtig standen, rief er den Schotgasten zu: »Belegen!«, und drehte sich mit einem fragenden Blick nach Ramage um. Als dieser sah, dass auch die Männer mit der Arbeit innehielten, um ihn anzusehen, ließ er seine Uhr betont langsam wieder in die Tasche gleiten und schüttelte den Kopf.
Southwick war im ersten Augenblick sprachlos. Dann fühlte er den Männern ihre Enttäuschung nach und rief, etwas beschämt über den Schwindel, mit breitem Grinsen: »Schon recht, schon recht, ihr habt euren eigenen Rekord um eine halbe Minute geschlagen!«
Dabei schlug er sich froh gelaunt aufs Knie – es sah aus, als hätte er sich bedeutend weniger erwartet –, und die Männer lachten, als er sie wegtreten ließ. Southwick und alle anderen bis auf die Wache verschwanden jetzt unter Deck. Ramage war enttäuscht, dass Gianna nicht an Deck kam, da die Kathleen nun wieder Fahrt machte, aber er konnte sich nicht entschließen, nach ihr zu schicken, um die Brise in ihrer Gesellschaft zu genießen, weil er sich sagte, dass sie vielleicht schlief. Dann fühlte er sich plötzlich ohne ersichtlichen Grund beunruhigt. Er dachte unwillkürlich an seine Mutter, die, wenn ihr zuweilen ein Schauder über den Rücken lief, zu sagen pflegte: »Jetzt geht jemand über mein Grab.«
2
Wenn John Smith II. nüchtern war, wirkte er schlau und durchtrieben, ein Eindruck, der durch seine kleine drahtige Gestalt noch verstärkt wurde, wenn er aber seine Rumration geschluckt hatte – und vielleicht noch ein paar weitere, im Spiel gewonnene dazu –, dann bekam er einen milderen Ausdruck, sein unsteter Blick wurde ruhiger, und das Trinkergesicht erinnerte in seiner seligen Zufriedenheit unwillkürlich an einen Wilderer, der das Revier des Jagdherrn nächtlicherweise gründlich geplündert hat. Der Mann wurde in der Musterrolle als Vollmatrose geführt und trug den Zunamen »der Zweite«, um ihn von einem anderen Seemann gleichen Namens zu unterscheiden. Darüber hinaus stellte Smith die Musikkapelle der Kathleen dar. Er besaß nämlich eine Geige, auf der er besonders gern spielte, wenn er nicht nüchtern war. Sonntags war er damit immer vollauf beschäftigt. Vormittags spielte er beim Gottesdienst geistliche Lieder, nachmittags saß er auf der Trommel der Winsch und spielte den Männern kratzend zum Tanz auf.
Ramage hatte nun eine halbe Stunde der Wache hinter sich. Gewiss, er wusste diesen Smith zu schätzen, weil er ein guter Seemann war und weil er seine Leute bei Laune hielt, aber sein Gekratze auf der Geige war für musikalische Ohren einfach eine Qual, so entsetzlich, dass Ramage dem Kerl seine Fiedel am liebsten aus den flinken Fingern geschossen hätte.
Dabei fiel ihm plötzlich die Schatulle mit den zwei Duellpistolen ein, die ihm Sir Gilbert Elliot, der Vizekönig von Korsika und alte Freund seines Vaters, zum Präsent gemacht hatte, als er erfuhr, dass er zum ersten Mal Kommandant eines Kriegsschiffs geworden war. Bis jetzt hatte er noch keine Zeit gefunden, die Waffen zu erproben, jetzt bot sich dazu endlich die Möglichkeit. Auf seinen Befehl hin holte Jackson sogleich die Mahagonischatulle mit den blanken Messingkanten und öffnete sie auf dem Kajütskylight. Dann entfernte er von beiden Pistolen den schützenden Ölfilm. Die zwei genau gleichen Waffen waren eine Prachtleistung des Meisters Joseph Manton, dessen Firmenzeichen mit Löwe und Einhorn an der Innenseite des Deckels angebracht war. Jede der beiden Pistolen besaß einen langen, sechseckigen Lauf und einen schön geäderten Kolben aus Nussbaumholz. Ramage nahm eine der beiden Waffen in die Hand. Sie war wunderbar ausgewogen. Der Griff passte in seine Hand, als wäre die Waffe die natürliche Verlängerung seines Arms. Der Zeigefinger legte sich um den Abzugsbügel, als ob diese Pistole eigens für die Maße seiner Hand gefertigt worden wäre. In der Mahagonischatulle fand sich eine Form zum Kugelgießen, eine Stanze zum Ausschneiden von Pfropfen, eine Pulverflasche und eine Schachtel mit Reservefeuersteinen. In Ramages Augen machten diese beiden Waffen ihrem Hersteller auf dem Hanover-Square alle Ehre, und er hatte den stolzen Titel auf seinem Firmenschild: »Waffenschmied Seiner Majestät des Königs«, wohl verdient.
Inzwischen hatte Jackson die andere Pistole geladen.
»Ein wunderbares Stück, Sir«, sagte er, als er sie Ramage übergab. »Ich will hinuntergehen und mir vom Zimmermannsmaat ein paar Stücke Holz geben lassen, die Sie als Scheibe benutzen können.«
»Ja«, sagte Ramage, »und sagen Sie durch, dass niemand auf Schüsse zu achten braucht.«
Ein paar Minuten später kam Jackson mit einem ganzen Bündel Holz unter dem Arm zurück. Ramage hatte inzwischen die zweite Pistole geladen. Er stieg auf das Bodenstück der achtersten Karronade und hielt sich dort gegen das Überholen des Schiffs im Gleichgewicht. Zuerst zielte er mit der Pistole in der rechten Hand, dann versuchte er das Gleiche mit der Linken.
»Alles klar, Jackson. Werfen Sie jetzt das größte Stück über Bord.«
Das Holz flog im Bogen durch die Luft, klatschte in einiger Entfernung vom Schiff ins Wasser und glitt sofort achteraus, da das Schiff Fahrt machte.
Ramage hatte die Pistole gespannt, den rechten Arm gestreckt gehoben und zielte an der glatten Oberkante des Laufs entlang. Dann zog er am Drücker.
Zwei Meter jenseits des Holzstücks spritzte das Wasser wie eine kleine weiße Feder in die Höhe.
»Die Seitenrichtung war gut, Sir«, rief Jackson, »Sie haben nur etwas hoch gehalten.«
Gleich darauf feuerte Ramage mit der linken Hand die zweite Pistole ab. Das Holz sprang aus dem Wasser, und die Kugel flog in pfeifenden Sätzen davon.
»Allerhand«, bemerkte Jackson, »und noch dazu mit der linken Hand.«
Ramage grinste in sich hinein. Er hatte Glück gehabt, denn gewöhnlich ruckte er mit der Pistole nach links, wenn er linkshändig schoss.
Er gab Jackson beide Pistolen, damit er sie wieder lud. Als er von der Karronade heruntersprang, sah er Gianna, die eben im Niedergang erschien.
»Accidente!«, rief sie, »ist denn der Feind in Sicht?«
»Nur eine Schießübung. Ich probiere die Pistolen aus, die mir Sir Gilbert schenkte.«
Jetzt kam auch Southwick an Deck, dann gesellte sich Antonio zu ihnen und sah, wie Jackson die Kugel in den Lauf stieß.
»Das sind doch Duellpistolen, Nico, nicht wahr? Für den Gebrauch an Bord sind ihre Läufe wohl etwas lang.«
»Ja, das schon, aber zur Abwechslung macht es Spaß, mit ihnen zu schießen. Unsere Marinemodelle sind so schwer abzuziehen, dass man dem Gegner die Mündung in den Bauch rammen muss, wenn man ihn sicher treffen will. Bei diesen hier löst sich der Schuss auf die leiseste Berührung.«
Gianna nahm die Pistole, die Jackson eben geladen hatte.
»Vorsicht!«, warnte Ramage sie.
Sie maß ihn mit einem spöttischen Blick, hob ihre Röcke und kletterte auf die Karronade.
»Siehst du das Büschel Tang dort? Ich werde es treffen. Wollen wir wetten?«
»Un centesimo.«
»Nein, mehr. Zwei. Los, Beeilung!«
Ohne seine Antwort abzuwarten, spannte sie die Pistole und schoss. Ein paar Fuß hinter dem schwimmenden Tang spritzte das Wasser auf.
»Das Schiff hat sich bewegt.«
»Natürlich, darum hättest du entsprechend tiefer halten sollen.«
»Das ist unfair! Ich zahle nicht. Wir wollen einen anderen Kampf austragen, du mit deinem Messer, ich mit dieser Pistole.«
»Soll das ein Wettkampf sein oder etwa ein Duell?«, fragte Ramage mit einem hintergründigen Lächeln.
»Wir wollen es zunächst einen Wettkampf nennen.«
»Seien Sie vorsichtig, Nico«, warnte Antonio, »vergessen Sie nicht, dass ihre Mutter einen Sohn haben wollte und sie darum wie einen Jungen erzog. Sie schießt wie ein perfekter Jäger, sie reitet wie ein Jockey – und sie spielt wie ein Narr.«
Gianna knickste spöttisch von der Karronade herunter: »Danke, Vetter Antonio. Da kann man sehen, Nico, wie fest in Italien die Familien zusammenhalten!«
»Sagen Sie mir eins, Nico«, unterbrach sie Antonio, »gehört denn das Messerwerfen zur seemännischen Ausbildung? Das kann doch nicht gut sein.«
Ramage lachte: »Nein, das ist italienischen Ursprungs. Meine Eltern lebten ein paar Jahre in Italien und hatten einen italienischen Kutscher. Der brachte es mir bei.«
»Los jetzt!«, rief Gianna ungeduldig. »Jackson wirft ein Stück Holz ins Wasser, und ich treffe es, während Antonio bis zehn zählt. Und du, Nico« – sie sah sich suchend um –, »du stellst dich dort an den Steuerknüppel, oder wie das Ding heißt, und triffst mit deinem Messer den Mast.«
»Du meinst, an die Pinne?«
»Ja, an die Pinne. Ich finde, das ist gerecht. Wie hoch soll der Einsatz sein?«
»Un centesimo.«
»Du bist mir ein schöner Spieler. Kannst du dir nicht etwas mehr leisten?«
»Ich bin nur ein armer Leutnant, meine Gnädige.«
»Dennoch kannst du dir mehr leisten.« Obwohl sie das noch in scherzhaftem Ton sagte, merkte er, dass sie jetzt nicht mehr spaßte. Als er sie darum fragend anblickte, wies sie nur stumm auf seine linke Hand. Er hob sie in die Höhe, da zeigte sie auf den goldenen Siegelring mit dem Greifenwappen an seinem kleinen Finger.
»Gut, Gianna«, sagte er zögernd. »Meinen Siegelring gegen …«
Sie hielt immer noch die Pistole in der Rechten und drehte nun die Hand gerade weit genug, dass er den schweren Goldring an ihrem Mittelfinger sehen konnte.
» – gegen den Ring an deinem Finger.«
»Nein, nein!«, rief sie, »das wäre ungerecht.«
Er kannte sie jetzt zur Genüge, darum sagte er: »Wenn dir das nicht recht ist, können wir ja auf den Kampf verzichten.«
Sie zuckte ungnädig die Schultern und meinte: »Also gut, aber wenn du beim ersten Mal gewinnst, musst du mir noch einmal eine Chance geben.«
Ramage war eben im Begriff, dieses Ansinnen abzulehnen, als er ihre schlaue Berechnung durchschaute. Wenn sie im ersten Gang verlor und im zweiten gewann, dann konnten sie ihre Ringe tauschen, ohne dass jemand davon erfuhr. Es war kindisch, aber er fühlte sich plötzlich im siebten Himmel. Ihr Geheimnis war und blieb natürlich geheim, dennoch machte es ihnen Spaß, sich fast damit zu brüsten.
»Einverstanden«, sagte er, »aber Antonio nimmt die Einsätze in seine Obhut.« Damit zog er seinen Siegelring vom Finger. Dann wandte er sich ab, um nach Jackson zu rufen. Dieser stand mit Southwick schon in der Nähe; Southwick hatte ein kleines Holzkästchen in der Hand.
»Taugt das als Scheibe, Sir?«
»Wenn es halb voll Wasser ist, ja.«
»Es ist aber leer, Sir.«
»Dann ragt es hoch aus dem Wasser. Sagen Sie offen, hat die Marchesa Sie bestochen?«
»An Deck, an Deck!«
Der Ruf vom Masttopp brachte ihnen zu Bewusstsein, dass sie mit Ausnahme des Ausguckpostens und der beiden Rudergänger alle vergessen hatten, dass die Kathleen ein Kriegsschiff war.
»Oberdeck hier!«, brüllte Southwick.
»Steuerbord voraus eine Hulk oder – vielleicht eine kleine Insel in Sicht, Sir.«
»Was soll das heißen – eine Hulk?«
»Ein Schiff ohne Masten, Sir. Man sieht den Rumpf eben über dem Horizont, Sir.«
Southwick gab Jackson seinen Kieker: »Da, entere mit dem Glas in den Topp. Hole dir das Ding heran und schau, was du daraus machen kannst.«
Ramage ärgerte sich über die Rolle, die ihm seine Stellung als Kommandant auferlegte. Als jüngster Leutnant einer Fregatte wäre er jetzt längst geentert, um sich selbst zu überzeugen, was da in Sicht kam. Heute aber, als stolzer Kommandant der winzigen Kathleen, der dennoch die gleiche Macht über Leben und Tod seiner Besatzung in Händen hatte wie der Kommandant eines riesigen Dreideckers, heute musste er unter allen Umständen den Anschein kühlen Gleichmuts bewahren – zum Mindesten, dachte er etwas kleinlaut, würde er das tun, wenn Gianna nicht an Bord wäre und die langweilige Reise in ein Fest verwandelte.
Der hagere blonde Amerikaner lief die Webeleinen so leichtfüßig hinauf, als ob er von einem unsichtbaren Fall gezogen würde. Als er rittlings auf der Breitfockrah saß, zog er den Kieker aus und blickte damit in die Richtung, die ihm der Ausguckposten zeigte.
Henry Southwick sah mit seinen milden Zügen und dem wehenden weißen Haar wirklich aus wie ein gütiger Pastor. Er sollte in wenigen Wochen seinen sechzigsten Geburtstag feiern. Daran musste er denken, als er jetzt einen Blick auf Ramage warf. Obwohl der junge Kommandant kaum mehr als ein Drittel so alt war wie er selbst und obwohl sie noch nicht viel länger als drei Wochen an Bord dieses Schiffes zusammen waren, sagte sich der alte Steuermann, dass eines Tages jeder, der mit Mr Ramage an Bord gewesen war, seinen Kindern und Kindeskindern von diesem Mann vorschwärmen werde; er, Southwick, schloss sich bestimmt nicht davon aus. Voraussetzung war nur, dass der Krieg lang genug dauerte und dass Ramage sowohl die Intrigen der Feinde seines Vaters als auch die Kämpfe mit den Franzosen und den Spaniern heil überstand. Junge Kommandanten gingen Southwick für gewöhnlich auf die Nerven. Er hatte schon unter zu vielen Leuten gedient, die ihr Kommando nur dem Umstand verdankten, dass ihre Väter Geld und Land genug besaßen, um ihren Kandidaten ins Parlament zu bringen. Wenn er sich über den offenkundigen Mangel an Erfahrung eines solchen frischgebackenen Kommandanten ärgerte, hatte man ihm meist entgegnet, sein Vater sei der Regierung eben gut für ein paar Stimmen. (Verdrossen hatte er sich dann immer gefragt, wie es wohl um das Verhältnis von Weideland und Protektion bestellt war.) Aber wie dem auch war, bei Mr Ramage kamen solche Dinge samt und sonders nicht infrage, da die Regierung ja versucht hatte, seinen Vater erschießen zu lassen wie den armen alten Admiral Byng.
Southwick entging nicht, dass Ramage wieder einmal zwinkerte, als ob er in blendendes Licht blicken müsste, und dass er die Narbe über seiner rechten Braue rieb. Er wusste sehr gut um dieses warnende Zeichen, aber er konnte sich beim besten Willen nicht erklären, was Ramage jetzt dazu Anlass gegeben hatte. Ein Blick auf die Marchesa verriet ihm, dass auch sie das Zeichen gesehen hatte und ihn nun gespannt und liebevoll im Auge behielt.
Die beiden passen gut zusammen, sagte er sich. Er konnte ja so gut verstehen, dass sie sich in ihn verliebt hatte, allerdings hätte er wetten mögen, dass Mr Ramage nicht ahnte, wie groß ihre Liebe war. Gefühlvoll malte sich der alte Steuermann aus, die Marchesa sei seine eigene Tochter, und versuchte, Ramage mit ihren Augen zu sehen. Er hatte den klassischen Körperbau der griechischen Statuen, die er auf dem Peloponnes gesehen hatte. Breite Schultern, schmale Hüften, eine federnde Gestalt und jenen Gang, der sofort verriet, dass er zum Führer geboren war, selbst wenn er nur Fetzen am Körper trug. Seine Augen aber verrieten nach Southwicks Meinung das meiste. Sie waren dunkelbraun, saßen über hohen Backenknochen tief in ihren Höhlen und waren von buschigen Brauen überschattet, die einander in gerader Linie berührten, wenn er zornig oder erregt war. Diese Augen konnten so kalt und gefährlich dreinschauen wie die Mündungen zweier Pistolen. Dabei besaß er einen geraden, trockenen Humor, den die Männer über alles liebten. Southwick selbst merkte allerdings oft nur an den winzigen Fältchen um Ramages Augenwinkel, dass sein Kommandant ihn zum Besten hielt.
»An Deck!«, rief jetzt Jackson. »Es ist eine Hulk, ohne Zweifel.«
»Können Sie ihre Bauart ausmachen?«, rief Southwick, der sich mit einem Schlag in die Gegenwart zurückversetzt sah.
»Noch nicht, sie kehrt uns das Heck zu, aber sie giert wohl gleich wieder herum.«
Southwick wusste von vornherein, dass von einer Insel keine Rede sein konnte, denn hier gab es auf viele Meilen kein Land. Aber was hatte ein entmastetes Schiff hier draußen zu suchen? Plötzlich fiel ihm die Sturmbö ein, die sie am Nachmittag zuvor überfallen hatte. Zuerst hatte er gedacht, es sei wieder eines jener herbstlichen Mittelmeergewitter, von denen täglich ein paar niedergingen. Als aber das gestrige Unwetter aufzog, war Mr Ramage an Deck erschienen und hatte ihm nach einem kurzen Rundblick befohlen, sofort alle Segel bergen zu lassen. Als er diesen Befehl weitergab, fiel es ihm schwer, sich nichts von der Überraschung und den Zweifeln anmerken zu lassen, die ihn in jenem Augenblick beherrschten. Aber Mr Ramage sollte recht behalten: Drei Minuten nachdem der letzte der Zeisings, die die geborgenen Segel zusammenhielten, festgemacht war, und während das Schiff in nahezu völliger Flaute rollte, wurde die Kathleen von einer Bö getroffen, die wie eine feste Mauer herangestürmt kam und den Kutter so weit überlegte, dass das Wasser durch die Geschützpforten hereindrang, obwohl sie nur am Mast, an den Spieren, den festgemachten Segeln und dem Rumpf selbst ihre Hebelkraft ansetzen konnte. Sie hatten die Rudergänger an der Pinne verstärken müssen, damit sie das Schiff vor Topp und Takel zum Abfallen brachten.
Southwick hatte im ersten Augenblick sogar erwartet, dass die Kathleen kentern würde, und er war sich darüber klar, dass ihm bestimmt in alle Zukunft verborgen blieb, wie Mr Ramage draufkommen konnte, dass gerade dieses Unwetter so viel Wind mit sich brachte. Es stach ja weder durch die Größe noch durch die Schwärze der Wolken von anderen Böen ab. Wenn aber ein Kapitän die versteckte Gefahr nicht erkannte, dann musste er damit rechnen, dass sein Schiff entweder kenterte oder dass ihm zum Mindesten die Masten über Bord gingen.
Sein Auge suchte Ramage, und als sich ihre Blicke begegneten, da war ihm augenblicklich klar, dass sich sein Leutnant dies schon zusammengereimt hatte, ehe Jackson in die Wanten gestiegen war.
»Könnte es eins unserer eigenen Schiffe sein, Sir?«
»Hier an dieser Stelle? Daran möchte ich zweifeln.«
Dann begab sich Ramage unter Deck, um zum Schreibtisch in seiner richtigen Kajüte zu gehen. Gebeugt, um nicht an die Decksbalken zu stoßen, erwiderte er den Gruß des Postens. Selbst mit geneigtem Kopf konnte er hier nicht aufrecht stehen, aber das war nicht weiter schlimm, da man in der kleinen Kammer ohnedies nicht herumgehen konnte. Diese Kammer, sonst die Kajüte des Kommandanten, diente zurzeit unverkennbar einer jungen Dame als Wohnung, die es gewohnt war, dass ihr ständig Dienstpersonal zur Verfügung stand. Federleichte, intime, mit kostbaren Spitzen gesäumte Kleidungsstücke lagen verstreut auf dem Schreibtisch umher, andere lagen auf der Koje. Als er eines um das andere vom Schreibtisch wegnahm, entdeckte er eines, das noch die Körperformen Giannas verriet: Sie hatte es offenbar abgeworfen, als sie sich zum Essen umzog. Mit Bedacht stellte sich Ramage wieder einmal jene nackte Eva vor, die Ghiberti für das Osttor des Baptisteriums in Florenz geschnitzt hatte, ein Bildnis, für das Gianna als Modell gedient haben könnte, hatte sie doch den gleichen kleinen, schlanken, straffen Körper, die gleichen kleinen, kühnen Brüste, den gleichen flachen Leib … Er räumte die Kleider beiseite, schloss die zweite Schublade auf und holte ein dickes Buch mit einem schmutzigen braunen Einband heraus, das den Titel Signalbuch für Kriegsschiffe trug.
Im hintersten Teil dieses Buches fand er einige nicht bedruckte, mit der Hand beschriebene Seiten, auf denen die Nummern und Positionen der verschiedenen Treffpunkte für die Mittelmeerflotte verzeichnet waren. Er schrieb die Länge und Breite des nächstgelegenen Treffpunkts heraus und zog dann eine Seekarte aus dem Regal über dem Schreibtisch. Dieser Punkt lag fünfundsiebzig Seemeilen östlich vom gegenwärtigen Standort der Kathleen. Bei dem Wind, den sie in der letzten Zeit gehabt hatten, war es ausgeschlossen, dass jenes entmastete Schiff eine britische Fregatte sein konnte, die auf dem Treffpunkt wie ein Wachtposten gewartet hatte, um dorthin beorderten Schiffen neue Befehle oder Nachrichten zu übermitteln.
Er tippte mit dem Finger auf die Karte, die Kathleen stand hier, etwa hundert Meilen westlich der Südspitze Sardiniens, denn er hielt ja möglichst weit nach Süden, um an der Küste Afrikas entlangzulaufen und gleichzeitig möglichst weit von Mallorca, Menorca und der Südostecke Spaniens entfernt zu bleiben. Das Schiff, das sie in Sicht hatten, stand viel zu weit nördlich, als dass es ein britisches hätte sein können, das von Neapel, Malta oder der Levante kam und nach Gibraltar segelte. Er warf einen Blick auf den oberen Rand der Karte. Da lag Toulon. Ja, vielleicht war es ein französisches Schiff der Küstenwache, das von Osten kam und den großen Flottenstützpunkt ansteuern sollte. Dann konnte es hier stehen. Aber er sah auch Barcelona im Westen und weiter südlich Cartagena, Häfen für spanische Kriegsschiffe, deren Kommandanten sich wegen der Untiefen und der unklaren Strömungsverhältnisse längs der afrikanischen Küste möglichst weit nördlich hielten. Auch ein Schiff, das Korsika und Sardinien umsegelt hatte (was die Spanier unlängst verschiedentlich unternommen hatten, um die britische Flotte zu überwachen), konnte sich auf dem Rückweg gerade hier befinden.
Jetzt hörte er Jackson von oben rufen, konnte aber nicht verstehen, was er sagte. Er legte die Karte wieder an ihren Platz, schloss das Signalbuch ein und verließ die Kajüte, als Southwick eben den Niedergang herunterkam.
»Jackson sagt, das Schiff sei eine Fregatte, Sir«, meldete der Steuermann, während er hinter Ramage die Treppe hinaufstieg. »Sie ist total entmastet, von einer Notbesegelung sei keine Spur zu entdecken. Jackson meint, der Bauart nach könnte sie ein spanisches Schiff sein.«
»Danke, Mr Southwick. Halten Sie weiter darauf zu, bis wir Gewissheit haben.«
Gianna und Antonio waren ganz aufgeregt, als sie jetzt auf ihn zukamen. »Wenn das ein Spanier ist, dann können wir ihn nach Gibraltar einschleppen«, meinte Antonio.
Aber Ramage schüttelte den Kopf: »Nein, in Schlepp nehmen kommt nicht infrage, es sei denn, das Schiff wäre britisch.«
»Ach!«, rief Gianna enttäuscht. »Warum denn nicht?«
»Ich –«
»An Deck!«, rief jetzt Jackson. »Spanische Bauart! Jetzt steht das fest!«
Southwick rief: »Verstanden!« Ramage wandte sich ab, um Giannas Frage nicht beantworten zu müssen. Aber Gianna drang noch einmal in ihn.
»Das will ich Ihnen erklären, meine Gnädige«, sagte Ramage in gewichtigem Ton: »Wir haben eine Besatzung von dreiundsechzig Mann und ganze zehn Karronaden mit sechspfundigen Kugeln und kaum fünfhundert Metern Schussweite. Wenn das Schiff dort wirklich eine spanische Fregatte ist, dann hat sie ungefähr zweihundertfünfzig Mann an Bord und dazu mindestens sechsunddreißig Geschütze, deren zwölfpfundige Kugeln eine Reichweite von fünfzehnhundert Metern besitzen. Jede dieser Kugeln könnte uns in ein hilfloses Wrack verwandeln. Sie haben über viereinhalb Zoll Durchmesser – wenn uns nur einige davon in der Wasserlinie treffen, gehen wir hoffnungslos unter.«
Antonio streckte einen Arm quer von sich: »Aber stehen ihre Geschütze denn nicht querschiffs, so wie die unsrigen? Darum können sie sicher nicht voraus oder achteraus schießen.«
»Ja, das stimmt, die Fregatte hat Breitseitgeschütze, und wir könnten aus ihrem Schussbereich bleiben, aber dann könnten sie ihre Bug- und Heckgeschütze gegen uns einsetzen.«
Antonio maß ihn mit einem fragenden Blick.
»Die meisten Schiffe haben vorn und achtern je zwei weitere Geschützpforten. Wenn man auf einen Gegner Jagd macht oder verfolgt wird, dann holt man ein paar von den Breitseitgeschützen herum und schießt durch diese Längsschiffspforten.« Zur Erläuterung zeigte er nach achtern: »Dazu sind die Pforten dort da.«
»Aber das Feuer von zwei Geschützen könnten wir wohl in Kauf nehmen«, meinte Antonio hartnäckig. »Man sieht doch, wie stark die Fregatte rollt. Ohne Segel kann sie auch nicht herumschwenken, um eine Breitseite gegen uns zu feuern. Oder wäre das möglich?«
»Nein, das nicht. Aber wir könnten nichts ausrichten, auch wenn sie keine Geschütze an Bord hätte. Wie sollten wir denn mit den zweihundertfünfzig Mann fertig werden, wenn sie sich entschieden dagegen wehren, dass wir das Schiff entern. Ganz davon zu schweigen, dass sie sich nicht gefangen nehmen lassen.«
»Ha!«, unterbrach ihn Gianna mit Triumph in der Stimme. »Wenn sie keine Geschütze haben, dann könnten wir doch so lange auf sie schießen, bis sie sich ergeben. Oder nicht?«
»Ich habe doch nicht gesagt, dass sie keine Geschütze haben«, entgegnete ihr Ramage, der alle Mühe hatte, seinen Ärger zu unterdrücken.
»Ich habe doch nur gesagt: ›wenn sie keine hätten‹, aber sie haben natürlich Geschütze.«
»Ach, wie schade. Wir hätten Eindruck gemacht, wenn wir mit dem großen Schiff im Schlepp nach Gibraltar eingelaufen wären.«
»Wenn man sich einen kleinen Esel vorstellt, der eine volle Wagenladung Carrara-Marmor den ganzen Weg über die Alpen schleppen muss, dann entspräche das ungefähr dem, was wir mit dieser Schleppfahrt auf uns nehmen müssten. Wenn man die Fregatte auf eine Waage stellen könnte, dann wöge sie etwa dreizehnhundert Tonnen gegen unsere kümmerlichen einhundertsechzig.«
»Das Gewicht der Masten müsste man abrechnen«, warf Antonio ein.
»Gewiss«, gab ihm Ramage ironisch recht. »Masten, Spieren, Bugspriet, Klüverbaum, stehendes und laufendes Gut, Blöcke, Segel und sogar die Boote dürfen Sie abrechnen. Das macht etwa hundert Tonnen, etwas weniger, als die ganze Kathleen wiegt …«
Da rief Southwick: »Jetzt können Sie das Schiff sehen, Sir.«
Ramage entdeckte, da die Kathleen immer näher kam, das kleine schwarze Etwas, das eben über der Erdkrümmung auftauchte, und zeigte es Gianna. Die Fregatte war jetzt noch etwa elf Meilen entfernt. Dann warf er einen Blick nach achtern auf das Kielwasser des Kutters und schätzte, dass er etwa fünf bis sechs Meilen lief. Es vergingen also noch fast zwei Stunden, bis sie in den Feuerbereich der spanischen Geschütze kamen. Dann waren sie der Fregatte wohl auch nahe genug, um ihren Namen auszumachen.
Hinterher fragte er sich verwundert, warum er plötzlich anderen Sinnes wurde und warum er unter Deck ging, um seine beste Uniform gegen eine ältere umzutauschen, die durch Sonne, Seewasser und das unablässige Waschen und Bürsten seines Burschen jene angenehme blassblaue Farbe gewonnen hatte, die ihm weit lieber war als das ursprüngliche dunkle Marineblau.
3
Ramage wohnte zurzeit in der Kammer Southwicks, der wiederum hatte die Kammer des Nächstjüngeren, des Steuermannsmaaten John Appleby, inne. Eben war er mit dem Umziehen zu Ende, als Gianna aus ihrer Kammer zu ihm herüberkam. Mit ernster Miene bat sie ihn, die Tür zu schließen. Da Ramage nicht ahnte, was sie ihm sagen wollte, befahl er zunächst dem Posten, sich ein bisschen zurückzuziehen, sodass dieser außer Hörweite war.
Sie setzte sich an den kleinen Schreibtisch und schwang den Drehstuhl herum, dass sie ihm ins Gesicht sah. Dann hob sie ihre rechte Hand und fuhr mit zartem Finger die Narbe auf seiner Stirn entlang.
»Nico …?«
»Marchesa …?«
Beide brachen in verlegenes Gelächter aus, weil es ihr offenbar sehr schwerfiel zu sagen, was sie auf dem Herzen hatte. Darum sagte er: »Fäuste ballen, Augen schließen und heraus mit der Sprache!«
»Ach, Nico, eigentlich geht es mich ja nichts an, aber …«
»Aber was?«
»Ist es denn richtig, dieses spanische Schiff einfach liegen zu lassen, ohne …?«
»Ohne rasch an Bord zu springen, es einfach in Besitz zu nehmen und die Flagge von Volterra zu setzen?«
»Sei doch ernst, Nico. Ich meine, die Leute könnten hinterher sagen, du hättest feige das Weite gesucht, du hättest dich von vornherein geweigert, die Fregatte zu kapern.«
»Das kann natürlich sein, ich halte es sogar für wahrscheinlich. Andere wiederum werden sagen, es sei heller Wahnsinn, irgendetwas gegen ein Schiff zu unternehmen, das achtmal so groß ist wie die Kathleen. Schon der Versuch verbietet sich von selbst. Wieder andere – dazu gehören Admiral Sir John Jervis und Kommodore Nelson – werden sagen, ich hätte schon dadurch gegen ihren Befehl verstoßen, dass ich nahe genug heranging, um auszumachen, was es mit dem Schiff auf sich habe. Du weißt ja, dass mir der Kommodore den Befehl gab, dich und Antonio auf dem schnellsten und sichersten Wege nach Gibraltar zu bringen. Du weißt doch, dass wir vor jedem fremden Schiff weglaufen sollen und auf keinen Fall kämpfen dürfen.«
»Ja, gewiss, aber Antonio fürchtet, dass in Gibraltar einer der Feinde deines Vaters auftreten könnte, um dir Schwierigkeiten zu machen, wie es in Bastia der Fall war, zumal weder Sir John noch der Kommodore dort anwesend sind. Wer weiß, was dir hätte widerfahren können, wenn der Kommodore nicht in diese skandalöse Kriegsgerichtsverhandlung hineingeplatzt wäre?«