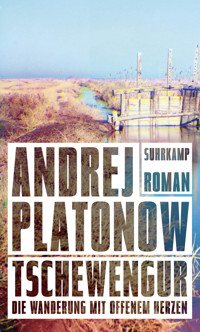
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht nur Die Baugrube, auch das zweite Hauptwerk Andrej Platonows, der Roman Tschewengur, durfte in der Sowjetunion nicht erscheinen. Er habe nichts anderes versucht, als den Anfang der kommunistischen Gesellschaft darzustellen, schreibt der Autor an den mächtigen Maxim Gorki. Das Buch, so die Antwort, sei inakzeptabel, denn die Helden würden nicht als Revolutionäre, sondern als komische Käuze und Halbverrückte wahrgenommen.
Don Quijote und Sancho Pansa durchstreifen die Steppe Südrusslands: Sascha Dwanow hat als Heizer an den Kämpfen der Roten Armee gegen die Weißen teilgenommen. Kopjonkin ist auf dem Ross »Proletarische Kraft« unterwegs, auf der Suche nach dem Grab Rosa Luxemburgs, in deren Namen er Heldentaten begehen will. Soll das, was ihnen unterwegs begegnet, die Verwirklichung der sozialistischen Idee sein? Erst nach der Trennung von Kopjonkin kommt Sascha auf die richtige Spur. In der Steppenstadt Tschewengur soll der Kommunismus bereits angebrochen sein.
Wie elf Bolschewiki und ihr Führer dort die Bourgeoisie vernichten und mit der bettelarmen Bevölkerung das Paradies aufbauen, wird als Geschichte eines gigantischen Scheiterns erzählt. Melancholie und Dunkelheit liegen über der Natur und der Stadt: »In die Tiefe der angebrochenen Nacht gingen ein paar Menschen aus dem Kommunismus ins Ungewisse.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andrej Platonow
TSCHEWENGUR.
Die Wanderung mit offenem Herzen
Roman
Aus dem Russischen von Renate Reschke
Mit einem Nachwort von Hans Günther und einem dialogischen Essay von Dževad Karahasan und Ingo Schulze
Suhrkamp
Inhalt
ANHANG
Anmerkungen
Der Abend der Revolution
Eine Welt, erschaffen aus bodenloser Sprache
Chronik zu Leben und Werk
Editorische Notiz
Biographien
Alte Provinzstädte haben schüttere Waldränder. Dorthin kommen Menschen, um direkt aus der Natur zu leben. Da erscheint so ein Mensch mit wachem und traurig abgezehrtem Gesicht, der kann alles ausbessern und einrichten, doch er selbst verbrachte sein Leben uneingerichtet. Kein Erzeugnis, von der Bratpfanne bis zur Weckuhr, das im Leben dieses Menschen nicht durch seine Hände gegangen wäre. Er lehnte es auch nicht ab, Schuhe zu besohlen, Wolfsschrot zu gießen und falsche Medaillen für den Verkauf auf altertümlichen Dorfjahrmärkten zu prägen. Für sich selbst hatte er nie etwas gemacht – keine Familie, keine Wohnstatt. Im Sommer lebte er einfach in der Natur, hatte sein Werkzeug in einem Sack, den er auch als Kopfkissen benutzte, mehr zur Verwahrung des Werkzeugs als zu seiner Bequemlichkeit. Vor der Frühsonne schützte er sich dadurch, dass er sich am Abend ein Klettenblatt über die Augen legte. Im Winter aber lebte er von den Resten des Sommerverdienstes und zahlte dem Kirchenwächter für die Unterkunft, indem er nachts die Stunden läutete. Er hatte für nichts sonderliches Interesse – nicht für die Menschen, nicht für die Natur, nur für jegliches Erzeugnis. Darum behandelte er Mensch und Flur mit gleichmütiger Zartheit, ohne ihre Interessen anzutasten. An Winterabenden fertigte er manchmal unnütze Dinge: Türme aus Drähten, Schiffe aus Dachblechstücken, klebte Luftschiffe aus Papier und anderes, ausschließlich zum eigenen Vergnügen. Darüber ließ er mitunter sogar eine zufällige Auftragsarbeit liegen, zum Beispiel sollte er neue Reifen auf ein Fass aufziehen, doch er beschäftigte sich mit dem Mechanismus einer Holzuhr, weil er dachte, sie müsse ohne Aufziehen laufen – allein durch die Drehung der Erde.
Dem Kirchenwächter missfielen solche unbezahlten Beschäftigungen.
»Im Alter wirst du betteln gehen, Sachar Pawlowitsch! Das Fass steht seit Tagen da, und du hältst das Holzding an die Erde, wozu bloß.«
Sachar Pawlowitsch schwieg; das Menschenwort war für ihn wie das Waldesrauschen für den Waldbewohner – er hört es nicht. Der Wächter rauchte und sah gelassen in die Ferne – an Gott glaubte er nicht von den vielen Gottesdiensten, doch er wusste zuverlässig, dass Sachar Pawlowitsch nichts zuwege bringen würde: Die Menschen leben seit langem auf der Welt und haben schon alles erdacht. Sachar Pawlowitsch aber nahm das Gegenteil an: Die Menschen haben bei weitem nicht alles erdacht, solange der Naturstoff unberührt von Händen lebt.
Alle vier Jahre war eine Missernte, und das Dorf ging zur Hälfte in die Schächte und Städte, zur anderen Hälfte in die Wälder. Seit jeher weiß man, dass auf Waldlichtungen sogar in Dürrejahren Kräuter, Gemüse und Korn gut gedeihen. Die im Dorf gebliebene Hälfte stürzte zu diesen Lichtungen, um ihr Grünzeug vor der blitzartigen Plünderung durch Ströme gieriger Pilger zu bewahren. Aber diesmal wiederholte sich die Dürre im folgenden Jahr. Das Dorf schloss seine Katen ab und begab sich in zwei Abteilungen hinaus auf die Landstraße – die eine ging nach Kiew, um zu betteln, die andere nach Lugansk zum Broterwerb; einige aber bogen ab in den Wald und die verstrüppten Schluchten, aßen rohes Gras, Lehm und Rinde und verwilderten. Gegangen waren fast nur Erwachsene, die Kinder waren schon beizeiten gestorben oder davongelaufen, um zu betteln. Die stillenden Mütter ließen ihre Säuglinge nach und nach verschmachten, sie hatten nicht genug für sie zu trinken.
Da war eine alte Frau, Ignatjewna, die heilte die Kleinen vom Hunger. Sie gab ihnen einen Pilzaufguss, zur Hälfte mit süßen Kräutern vermischt, und die Kinder, trockenen Schaum auf den Lippen, wurden friedlich und still. Die Mutter küsste ihr Kind auf die gealterte, runzlige Stirn und flüsterte:
»Du hast ausgelitten, mein Kleiner. Dem Herrn sei Dank!«
Ignatjewna stand dabei.
»Er ist hinübergegangen, ist still; er sieht besser aus als im Leben und hört jetzt im Paradies den silbernen Wind.«
Die Mutter betrachtete liebevoll ihr Kind und glaubte an die Erleichterung seines traurigen Geschicks.
»Nimm meinen alten Rock, Ignatjewna, mehr kann ich dir nicht geben. Hab Dank.«
Ignatjewna hielt den Rock gegen das Licht und sagte:
»Du musst ein bisschen weinen, Dmitrewna, das ziemt sich so. Aber dein Rock ist ja völlig abgetragen, gib noch ein Tüchlein dazu oder schenk mir dein Bügeleisen.«
Sachar Pawlowitsch blieb allein im Dorf, ihm gefiel die Menschenleere. Aber meist lebte er im Wald, in einer Erdhütte zusammen mit einem Einsiedler, und ernährte sich von Kräutertee, dessen Nützlichkeit der Einsiedler schon früher herausgefunden hatte.
Sachar Pawlowitsch arbeitete ununterbrochen, um den Hunger zu vergessen, und lernte, aus Holz all das zu machen, was er früher aus Metall gemacht hatte. Der Einsiedler hatte sein Leben lang nichts gemacht, und jetzt machte er erst recht nichts: Bis zu seinem fünfzigsten Jahr hatte er umhergeschaut und abgewartet, was letzten Endes bei der allgemeinen Unruhe herauskommen würde, um sofort tätig zu werden nach Beruhigung und Klärung der Welt; er war überhaupt nicht besessen vom Leben, und so konnte er sich weder zur weiblichen Ehe entschließen noch zu einer allgemeinnützlichen Tätigkeit. Auf die Welt gekommen, hatte er sich gewundert und so bis ins Alter gelebt mit blauen Augen im jugendlichen Gesicht. Als Sachar Pawlowitsch eine Pfanne aus Eichenholz fertigte, war der Einsiedler verblüfft, weil man darin sowieso nichts braten konnte. Sachar Pawlowitsch aber goss Wasser in die Holzpfanne und brachte es bei langsamem Feuer zum Kochen, ohne dass die Pfanne anbrannte. Der Einsiedler war starr vor Staunen:
»Eine gewaltige Sache. Mein lieber Mann, wie soll man auf so was alles kommen!«
Und er ließ die Hände sinken angesichts der umwerfenden allgemeinen Geheimnisse. Niemand hatte ihm je die Einfachheit der Ereignisse erklärt, vielleicht auch war er nur zu unbedarft. In der Tat, als Sachar Pawlowitsch ihm zu erzählen versuchte, warum der Wind wehte und nicht auf der Stelle stand, staunte der Einsiedler nur noch mehr und begriff nicht, obwohl er das Entstehen des Windes genau fühlte.
»Wirklich wahr? Sag bloß! Also von der Sonnenwärme? Wie schön!«
Sachar Pawlowitsch erklärte, die Sonnenwärme sei nicht schön, sondern ganz einfach Hitze.
»Hitze?«, staunte der Einsiedler. »Sieh mal an, so eine Hexe!«
Das Staunen des Einsiedlers wechselte nur von einem Ding aufs andere, doch nichts verwandelte sich in Bewusstsein. Statt mit dem Verstand lebte er mit dem Gefühl vertrauensvoller Achtung.
Den Sommer über fertigte Sachar Pawlowitsch aus Holz alle Erzeugnisse, die er kannte. Die Erdhütte und der Platz davor waren vollgestellt mit Gegenständen seiner technischen Kunst – allen nur möglichen landwirtschaftlichen Maschinen, Werkzeugen, Vorrichtungen und alltäglichen Gerätschaften, alles ganz aus Holz. Seltsam, aber da war kein einziges Ding, das die Natur nachbildete, wie Pferde, Kürbisse oder dergleichen.
Im August ging der Einsiedler in den Schatten, legte sich auf den Bauch und sagte:
»Sachar Pawlowitsch, ich sterbe, ich habe gestern eine Eidechse gegessen. Für dich hab ich zwei Pilze mitgebracht, aber für mich hab ich die Eidechse gebraten. Wedle mit einem Klettenblatt über mir, ich mag den Wind.«
Sachar Pawlowitsch wedelte mit einem Klettenblatt, holte Wasser und gab dem Sterbenden zu trinken.
»Du stirbst doch nicht. Das kommt dir bloß so vor.«
»Ich sterbe, bei Gott, ich sterbe, Sachar Pawlowitsch«, sagte der Einsiedler und fürchtete zu lügen. »Ich behalte nichts drin, in mir lebt ein riesiger Wurm, der hat mir das ganze Blut ausgetrunken.«
Der Einsiedler drehte sich auf den Rücken.
»Was meinst du, muss ich Angst haben oder nicht?«
»Hab keine Angst«, antwortete Sachar Pawlowitsch bestimmt. »Von mir aus könnt ich auch gleich sterben, aber ich bin ja dauernd mit allerlei Erzeugnissen beschäftigt.«
Der Einsiedler freute sich über die Anteilnahme und starb gegen Abend ohne Angst. Sachar Pawlowitsch badete zur Zeit seines Todes im Bach und fand den Einsiedler bereits tot, erstickt an seinem grünen Erbrochenen. Das Erbrochene war zäh und trocken, es klebte wie Teig rund um den Mund des Toten, und kleinkalibrige weiße Maden waren darin tätig.
In der Nacht wachte Sachar Pawlowitsch auf und hörte Regen: der zweite Regen seit April. Da würde der Einsiedler aber staunen, dachte Sachar Pawlowitsch. Doch der Einsiedler, einsam in der Finsternis der sich gleichmäßig vom Himmel ergießenden Ströme, wurde nass und schwoll sacht an.
Durch den schläfrigen, windlosen Regen hindurch sang etwas dumpf und traurig – so weit entfernt, dass dort, wo es sang, bestimmt kein Regen fiel und Tag war. Sachar Pawlowitsch vergaß den Einsiedler und den Regen und den Hunger und stand auf. Eine ferne Maschine war es, die da summte, eine lebendige arbeitende Lokomotive. Er trat ins Freie und stand eine Weile in der Feuchtigkeit des warmen Regens, der vom friedlichen Leben sang, von der Weite der langwährenden Erde. Die dunklen Bäume schlummerten mit gespreizten Zweigen in der zärtlichen Umarmung des ruhigen Regens; sie fühlten sich so wohl, dass sie die Zweige bewegten in wonniger Ermattung und ohne jeden Wind.
Sachar Pawlowitsch beachtete nicht die Erquickung der Natur, ihn erregte die unbekannte verstummte Lokomotive. Als er sich wieder schlafen legte, dachte er: Selbst der Regen ist tätig, ich aber schlafe und verkrieche mich unnütz im Wald, denn gestorben ist der Einsiedler, und auch ich werde sterben; er hat in seinem ganzen Leben kein einziges Erzeugnis gefertigt, er hat immer nur geschaut und sich herangetastet, hat über alles gestaunt, in jeder Einfachheit eine wunderbare Sache gesehen und die Hände zu nichts rühren können, weil er nichts verderben wollte; er hat nur Pilze gepflückt, aber auch die wusste er nicht zu finden; und so ist er gestorben, ohne der Natur jemals geschadet zu haben.
Am Morgen war eine große Sonne, und der Wald sang mit der ganzen Fülle seiner Stimme, indem er den Morgenwind tief unter sein Laub fahren ließ. Sachar Pawlowitsch nahm nicht so sehr den Morgen wahr als den Schichtwechsel der Arbeitskräfte. Der Regen war im Erdreich eingeschlafen – ihn ersetzte die Sonne; sie machte, dass geschäftiger Wind aufkam, dass die Bäume raschelten und die Gräser und Sträucher raunten und dass selbst der Regen, noch ohne sich erholt zu haben, wieder auf die Beine kam, geweckt von kitzelnder Wärme, und seinen Körper zu Wolken sammelte.
Sachar Pawlowitsch packte seine Holzerzeugnisse – so viel hineinpassten – in den Sack und ging in die Ferne, auf einem Pilzpfad der Dorfweiber. Den Einsiedler sah er nicht mehr an: Tote sind unansehnlich. Freilich hatte Sachar Pawlowitsch einen Mann gekannt, einen Fischer vom Mutjowosee, der hatte viele Leute über den Tod ausgefragt und an seiner Neugier gelitten; dieser Fischer liebte mehr als alles die Fische, nicht als Speise, sondern als besondere Wesen, die wahrscheinlich das Geheimnis des Todes kannten. Er zeigte Sachar Pawlowitsch die Augen toter Fische und sagte: »Sieh, welche Weisheit. Der Fisch steht zwischen Leben und Tod, darum ist er stumm und sein Blick ohne Ausdruck; selbst ein Kalb denkt, doch ein Fisch nicht – er weiß schon alles.« Der Fischer beobachtete jahrelang den See und dachte immer nur über eines nach – über das Rätsel des Todes. Sachar Pawlowitsch versuchte es ihm auszureden: »Dort gibt es nichts Besonderes, nur irgendwas Enges.« Übers Jahr hielt es der Fischer nicht mehr aus und stürzte sich vom Boot in den See, nachdem er sich mit einem Strick die Füße zusammengebunden hatte, um nicht doch versehentlich zu schwimmen. Insgeheim glaubte er überhaupt nicht an den Tod, er wollte vor allem sehen, was es dort gab, vielleicht war das viel interessanter, als im Dorf zu leben oder am Ufer des Sees; er sah den Tod als ein anderes Gouvernement, unter dem Himmel gelegen, als wäre es am Grunde eines kühlen Wassers, und er fühlte sich zu ihm hingezogen. Manche Männer, zu denen der Fischer von seiner Absicht sprach, eine Zeitlang im Tod zu leben und dann zurückzukehren, wollten es ihm ausreden, andere pflichteten ihm bei: »Na ja, Versuch macht klug, Dmitri Iwanowitsch. Probier’s, dann erzählst du’s uns.« Dmitri Iwanowitsch probierte es; drei Tage später hatten sie ihn aus dem See gezogen und auf dem Dorffriedhof am Zaun beerdigt.
Jetzt ging Sachar Pawlowitsch am Friedhof vorbei und suchte das Grab des Fischers im Lattenwald der Kreuze. Auf dem Grab des Fischers stand kein Kreuz; er hatte mit seinem Tod kein Herz betrübt, kein Mund hatte seiner gedacht, denn er war nicht kraft seiner Schwäche gestorben, sondern kraft seines neugierigen Verstandes. Eine Frau hatte er nicht zurückgelassen, er war Witwer, und sein kleiner Sohn lebte bei fremden Menschen. Sachar Pawlowitsch war zur Beerdigung gegangen und hatte den Jungen an der Hand geführt – so ein freundlicher und aufgeweckter Junge, ob er nun der Mutter nachschlug oder dem Vater. Wo mochte dieser Junge jetzt sein? Gewiss war er, eine Vollwaise, in den Hungerjahren als Erster gestorben. Hinter dem Sarg des Vaters war der Junge würdevoll und ohne Kummer hergegangen.
»Onkel Sachar, hat sich der Vater mit Absicht so hingelegt?«
»Nicht mit Absicht, Sascha, aus Dummheit, und du hast nun den Schaden davon. Er wird so bald keine Fische wieder fangen.«
»Warum weinen die Tanten?«
»Weil sie Heuchlerinnen sind!«
Als der Sarg neben die Grube gestellt wurde, wollte keiner von dem Toten Abschied nehmen. Sachar Pawlowitsch kniete nieder und streifte mit den Lippen die stopplige frische Wange des Fischers, die reingewaschen worden war am Grund des Sees. Dann sagte er zu dem Jungen:
»Nimm Abschied vom Vater, er ist tot in alle Ewigkeit. Schau ihn an, du wirst dich an ihn erinnern.«
Der Junge schmiegte sich an den Körper des Vaters, an sein altes Hemd, das nach vertrautem lebendigem Schweiß roch, denn das Hemd war ihm für den Sarg angezogen worden, ertrunken war der Vater in einem anderen. Der Junge betastete die Hände, sie rochen nach fischiger Feuchtigkeit, an einem Finger steckte der zinnerne Trauring zu Ehren der vergessenen Mutter. Das Kind wandte den Kopf zu den Menschen, erschrak vor den Fremden und begann bitterlich zu weinen, wobei es Vaters Hemd wie zu seinem Schutz gepackt hielt; sein Kummer war stumm und ohne Bewusstsein des übrigen Lebens und daher untröstlich; der Junge trauerte so um den toten Vater, dass der Tote hätte glücklich sein können. Alle Menschen am Sarg begannen auch zu weinen aus Mitleid mit dem Jungen und auch aus vorzeitigem Mitgefühl mit sich selbst, denn jeder würde einmal sterben und ebenso beweint werden.
Sachar Pawlowitsch dachte bei all seiner Trauer weiter.
»Hör auf zu heulen, Nikiforowna!«, sagte er zu einem Weib, das lauthals und unter hastigem Wehklagen weinte. »Nicht aus Kummer heulst du, nein, damit sie dich beweinen, wenn du selber gestorben bist. Nimm doch den Jungen zu dir, du hast sowieso schon sechs, einer wird zwischen all den eigenen schon mit durchgefüttert.«
Bei Nikiforowna setzte sofort der Weiberverstand ein, und ihr grimmiges Gesicht schrumpfte zusammen; sie weinte ohne Tränen, nur mit den Runzeln.
»Du hast gut reden! Als ob’s bloß das wär – mit durchfüttern. Jetzt ist er klein, aber lass ihn mal groß werden, wie er dann frisst und die Hosen durchwetzt, da kommt man nicht mehr nach mit Ranschaffen.«
Eine andere Frau, Mawra Fetissowna Dwanowa, die schon sieben Kinder hatte, nahm den Jungen. Er gab ihr die Hand, die Frau wischte ihm mit dem Rock das Gesicht, putzte ihm die Nase und führte ihn in ihre Kate.
Dem Jungen fiel die Angel ein, die ihm der Vater gemacht hatte, er hatte sie am See ausgeworfen und dort vergessen. Bestimmt hatte schon ein Fisch angebissen, und den könnte er essen, dann würden die fremden Leute ihn nicht schelten wegen ihres Essens.
»Tante, ich habe einen Fisch an der Angel«, sagte Sascha. »Ich will ihn holen und essen, dann brauchst du mir nichts zu geben.«
Mawra Fetissowna verzog unwillkürlich das Gesicht, schnäuzte sich in einen Zipfel des Kopftuchs und hielt die Hand des Jungen fest.
Sachar Pawlowitsch dachte nach und wollte unter die Barfüßler gehen, doch dann blieb er. Leid und Verwaistheit hatten ihn stark angerührt – aus einem bisher unbekannten Gewissen, das in der Brust aufgegangen war; er wäre gern ohne Rast und Ruh über die Erde gewandert, um dem Leid in allen Dörfern zu begegnen und an fremden Särgen zu weinen. Aber neue Erzeugnisse hielten ihn fest: Der Dorfälteste bat ihn, die Wanduhr zu reparieren, und der Geistliche, das Klavier zu stimmen. Sachar Pawlowitsch hatte sein Lebtag keine Musik gehört, in der Kreisstadt hatte er einmal ein Grammophon gesehen, aber das hatten die Männer zu Tode gequält, und es spielte nicht. Das Grammophon stand in einer Schenke, sie hatten die Seitenwände zerbrochen, um den Betrug zu sehen und denjenigen, der dort sang, und in die Membran war eine Stopfnadel gesteckt. Sachar Pawlowitsch brachte einen Monat mit dem Stimmen des Klaviers zu, er probierte die wehmütigen Töne aus und untersuchte den Mechanismus, der etwas so Zartes hervorbrachte. Er schlug eine Taste an, ein trauriges Singen stieg auf und flog davon; Sachar Pawlowitsch schaute nach oben und wartete auf die Rückkehr des Tones – er war zu schön, um sich spurlos zu vergeuden. Der Geistliche war es leid, auf das Stimmen zu warten, und er sagte: »Alter, schlag nicht umsonst die Töne an, bring die Sache zu Ende und versuche nicht, einen Sinn zu ergründen, der dich nichts angeht.« Sachar Pawlowitsch fühlte sich bis in die Wurzeln seiner Meisterschaft gekränkt und baute in den Mechanismus ein Geheimnis ein, das in einer Sekunde entfernt werden konnte, aber ohne besonderes Wissen nicht zu entdecken war. Danach holte ihn der Pope jede Woche zu sich: »Komm, mein Freund, komm mit, die geheimnisbildende Kraft der Musik ist wieder verschwunden.« Sachar Pawlowitsch hatte das Geheimnis nicht für den Popen eingebaut und auch nicht, um selber so oft wie möglich Musik zu genießen; nein, ihn bewegte lediglich, wie das Erzeugnis konstruiert war, das jedes Herz rührte und den Menschen gütig machte; darum hatte er sein Geheimnis eingefügt, das sich in den Wohlklang mischte und ihn durch Gejaul übertönte. Als Sachar Pawlowitsch nach zehn Reparaturen das Rätsel der Klangvermischung und die Konstruktion des vibrierenden Hauptbrettes begriffen hatte, entfernte er das Geheimnis aus dem Klavier und interessierte sich nie wieder für Töne.
Jetzt erinnerte er sich im Gehen an das verflossene Leben und bereute es nicht. Viele Konstruktionen und Gegenstände hatte er ganz allein in den vergangenen Jahren begriffen und konnte sie in seinen Erzeugnissen wiederholen, wenn er geeignetes Material und Werkzeug hatte. Er ging zum Dorf hinaus, um unbekannten Maschinen und Gegenständen zu begegnen, hinter jener Linie, wo der mächtige Himmel mit den unbeweglichen dörflichen Ländereien zusammenstieß. Er ging dorthin mit einem Herzen, mit welchem die Bauern nach Kiew gehen, wenn der Glaube in ihnen versiegt und das Leben zur Neige geht.
Auf den Dorfstraßen roch es brandig – auf dem Weg lag Asche, in der keine Hühner scharrten, weil die Hühner längst aufgegessen waren. Die Katen standen erfüllt von kinderloser Stille; verwilderte, über ihre Norm hinausgewachsene Kletten erwarteten die Hausherren am Tor, auf den Pfaden und auf allen zertrampelten Flächen, wo sich früher kein Gras gehalten hatte, und wiegten sich wie künftige Bäume. Die Flechtzäune blühten ebenfalls dank der Menschenlosigkeit: sie waren von Hopfen und Winde umrankt, und etliche Pfähle und Ruten hatten ausgeschlagen und versprachen ein Wäldchen zu werden, wenn die Menschen nicht zurückkehrten. Die Hofbrunnen waren ausgetrocknet, Eidechsen huschten ungehindert in die Brunnenkästen, um sich von der Sonnenglut zu erholen und um sich zu vermehren. Sachar Pawlowitsch wunderte sich auch nicht wenig über den unsinnigen Vorgang, dass auf den Feldern das Korn längst gestorben war, während auf den Strohdächern der Häuser Roggen, Hafer und Hirse grünten und Melde rauschte – die Samenkörner hatten in den Strohdächern Wurzeln geschlagen. Auch gelbgrüne Feldvögel waren ins Dorf übergesiedelt und lebten in den Stuben der Häuser, Spatzen stoben in Wolken vom Boden auf und plapperten durch den Wind der Flügel hindurch ihre geschäftigen Hausherrenlieder.
Während Sachar Pawlowitsch durchs Dorf ging, erblickte er einen Bastschuh; der Bastschuh war ohne die Menschen ebenfalls zum Leben erwacht und hatte sein Schicksal gefunden – ihm entwuchs das Reis einer Rotweide, sein übriger Körper aber faulte zu Staub und bot dem Würzelchen des werdenden Strauches Schatten. Unter dem Bastschuh war die Erde sicherlich etwas feuchter, denn viele blasse Grashalme mühten sich, durch ihn hindurchzukriechen. Von allen dörflichen Dingen liebte Sachar Pawlowitsch am meisten den Bastschuh und das Hufeisen und von den Konstruktionen die Brunnen. Auf dem Schornstein der letzten Kate saß eine Schwalbe, die sich bei Sachar Pawlowitschs Anblick eilig in den Rauchkanal hinabließ und dort im Dunkel ihre Brut mit den Flügeln umarmte.
Rechts stand noch die Kirche, dahinter breitete sich das wohlbekannte Feld, flach wie der Wind, der sich gelegt hat. Die kleine Glocke – die zweite Stimme – begann zu schlagen und läutete die Mittagsstunde: zwölfmal. Ackerwinde hatte das Gotteshaus umsponnen und war darauf aus, sich bis zum Kreuz hochzuranken. Die Popengräber entlang der Kirchenmauern waren zugeweht von Steppengras, und die niedrigen Kreuze waren in seinem Dickicht untergegangen. Der Wächter hatte seine Arbeit beendet, er stand noch auf der Treppe und beobachtete den Gang des Sommers; seine Weckuhr war beim langjährigen Zählen der Zeit durcheinandergekommen, dafür spürte der Wächter infolge des Alters die Zeit so genau und scharf wie Leid und Glück; was er auch tat, selbst wenn er schlief (obwohl im Alter das Leben stärker ist als der Schlaf – wachsam und allgegenwärtig), sobald eine Stunde verflossen war, fühlte der Wächter eine unbestimmte Unruhe oder Sehnsucht, dann läutete er die Zeit und kam wieder zur Ruhe.
»Lebst du noch, Alter?«, sagte Sachar Pawlowitsch zu dem Wächter. »Für wen zählst du die Stunden?«
Der Wächter mochte nicht antworten, in den siebzig Jahren seines Lebens war es ihm zur Gewissheit geworden, dass er die Hälfte der Tätigkeiten umsonst getan und drei Viertel aller Worte vergebens gesagt hatte: seine Fürsorge hatte weder die Kinder noch die Frau am Leben erhalten, und die Worte waren vergessen wie fremdes Geräusch. Ich sage diesem Mann ein Wort, hielt sich der Wächter vor, dann geht er eine Werst und behält mich nicht in ewiger Erinnerung, denn wer bin ich ihm – weder Vater noch Helfer.
»Du arbeitest vergebens«, warf Sachar Pawlowitsch ihm vor.
Der Wächter antwortete auf diese Dummheit:
»Wieso vergebens? In meiner Erinnerung ist unser Dorf zehnmal ausgezogen und dann wieder zurückgesiedelt. Auch diesmal wird es zurückkommen, denn lange geht es nicht ohne Menschen.«
»Und zu was ist dein Läuten?«
Der Wächter kannte Sachar Pawlowitsch als einen Mann, der eine lockere Hand für jede Arbeit hatte, aber nicht den Wert der Zeit kannte.
»Zu was das Läuten ist? Mit der Glocke verkürze ich die Zeit und singe Lieder.«
»Nun, dann singe«, sagte Sachar Pawlowitsch und verließ das Dorf.
Abseits vom Dorf kauerte eine Kate ohne Hof, offensichtlich hatte jemand Hals über Kopf geheiratet, sich mit seinem Vater überworfen und war ausgezogen. Auch diese Kate stand leer, und drinnen war es gruselig. Eins nur erfreute Sachar Pawlowitsch zum Abschied – aus dem Schornstein dieser Kate wuchs eine Sonnenblume, sie war schon voll erblüht und neigte ihr reifendes Haupt gen Sonnenaufgang.
Der Weg war zugewachsen mit trockenen, staubmorschen Gräsern. Als Sachar Pawlowitsch sich zum Rauchen hinsetzte, sah er auf dem Boden heimelige Wälder, in denen die Gräser die Bäume waren: eine kleine lebendige Welt mit eigenen Wegen, eigener Wärme, vollständig eingerichtet für die täglichen Bedürfnisse der winzigen regsamen Geschöpfe. Nachdem sich Sachar Pawlowitsch an den Ameisen sattgesehen hatte, behielt er sie noch an die vier Werst seines Weges im Kopf und dachte schließlich: Gäbe man uns einen Ameisen- oder Mückenverstand, dann könnten wir sogleich ein Leben ohne Not in Gang bringen, denn diese Winzlinge sind große Meister eines einträchtigen Lebens; der Mensch hat es noch weit bis zur tüchtigen Ameise.
Sachar Pawlowitsch erreichte den verwilderten Rand einer Stadt, mietete bei einem kinderreichen verwitweten Tischler eine Kammer, trat vors Haus und überlegte, was er arbeiten könnte.
Der Tischler kehrte von der Arbeit heim und setzte sich zu ihm.
»Wie viel soll ich dir für das Zimmer zahlen?«, fragte Sachar Pawlowitsch.
Der Tischler räusperte sich heiser, als wollte er lachen; aus seiner Stimme klang Hoffnungslosigkeit und jene besondere schicksalsergebene Verzweiflung, wie sie einem rundum und auf ewig verbitterten Menschen innewohnt.
»Was arbeitest du? Nichts? Na, dann wohn so bei mir, solange dir meine Kinder nicht den Kopf abreißen.«
Er hatte wahr gesprochen: Gleich in der ersten Nacht übergossen die Söhne des Tischlers – Kinder zwischen zehn und zwanzig – den schlafenden Sachar Pawlowitsch mit ihrem Urin und verrammelten die Kammertür mit der Ofengabel. Aber Sachar Pawlowitsch, der sich nie für Menschen interessiert hatte, war nicht so leicht zu erzürnen. Er wusste, dass es Maschinen und mächtige komplizierte Erzeugnisse gab, und an ihnen maß er den Edelsinn eines Menschen, nicht aber an zufälliger Gemeinheit. Und wirklich, am Morgen sah er, wie geschickt und sicher der älteste Sohn des Tischlers einen Axtstiel fertigte, also war das Wichtigste an ihm nicht der Urin, sondern die Gewandtheit seiner Hände.
Binnen einer Woche wurde Sachar Pawlowitsch ganz krank vom Nichtstun, und er begann ohne Aufforderung das Haus des Tischlers auszubessern. Er flickte die morschen Nahtstellen auf dem Dach, erneuerte die Vortreppe zur Diele und säuberte die Rauchkanäle vom Ruß. In den Abendstunden haute er kleine Pflöcke zurecht.
»Was machst du?«, fragte ihn der Tischler und tupfte sich den Schnurrbart mit Brotrinde ab, denn er hatte gerade gegessen – Kartoffeln und Gurken.
»Vielleicht kann man sie zu was brauchen«, antwortete Sachar Pawlowitsch.
Der Tischler kaute die Rinde und dachte nach.
»Damit kann man Gräber einfrieden! Als meine Kinder fasteten, haben sie alle Gräber auf dem Friedhof absichtlich vollgekackt.«
Sachar Pawlowitschs Schwermut war stärker als das Wissen um die Nutzlosigkeit der Arbeit, und er haute weiterhin Pflöcke zurecht bis zur völligen nächtlichen Erschöpfung. Wenn er nicht arbeitete, strömte ihm das Blut aus den Armen zum Kopf, und er begann so tief über alles gleichzeitig nachzudenken, dass nichts als Hirngespinste dabei herauskamen, und in seinem Herzen erhob sich schwermütige Angst. Am Tage schlenderte er über den sonnigen Hof, und er konnte sich nicht des Gedankens erwehren, dass der Mensch aus dem Wurm hervorgegangen ist, der Wurm aber besteht aus einer einfachen schrecklichen Röhre, in deren Innern nichts ist als leere stinkende Dunkelheit. Sachar Pawlowitsch betrachtete die Stadthäuser und entdeckte, dass sie große Ähnlichkeit mit geschlossenen Särgen hatten, und er fürchtete sich nun, im Haus des Tischlers zu übernachten. Die unbändige Arbeitskraft, die nicht wusste wohin, fraß an seiner Seele; er hatte sich nicht in der Gewalt und quälte sich mit mannigfaltigen Gefühlen, die bei der Arbeit nie in ihm aufgekommen waren. Er begann Träume zu sehen: Sein Vater, ein Bergarbeiter, liegt im Sterben, und die Mutter beträufelt ihn mit Milch aus ihrer Brust, damit er wieder auflebe, aber der Vater sagt ärgerlich zu ihr: »Lass mich wenigstens in Ruhe leiden, du Luder«, dann liegt er lange still und schiebt den Tod hinaus; die Mutter steht über ihn gebeugt und fragt: »Bald?« Der Vater spuckt mit der Erbitterung eines Märtyrers aus, dreht sich mit dem Gesicht nach unten und mahnt: »Begrab mich in der alten Hose, die hier soll Sachar haben.«
Sachar Pawlowitschs einzige Freude war, auf dem Dach zu sitzen und in die Ferne zu blicken, wo zwei Werst von der Stadt entfernt manchmal rasende Eisenbahnzüge vorüberfuhren. Vom Drehen der Räder und vom raschen Atem der Lokomotive kribbelte sein Körper freudig, während ihm leichte Tränen in die Augen traten vor Mitgefühl mit der Lokomotive. Der Tischler beobachtete seinen Untermieter und ließ ihn kostenlos an seinem Tisch mitessen. Die Söhne des Tischlers rotzten beim ersten Mal in Sachar Pawlowitschs Extraschale, da stand der Vater auf und schlug dem ältesten Sohn schwungvoll und wortlos eine Beule unters Auge.
»Ich selber bin ein Mensch wie jeder andre«, sagte der Tischler ruhig, nachdem er sich auf seinen Platz gesetzt hatte, »aber verstehst du, ich hab solche Lumpen in die Welt gesetzt, die bringen mich noch um, eh ich mich’s versehe. Guck dir Fedka an! Hat eine Teufelskraft, wo er sich die angefressen hat, weiß ich auch nicht, die sitzen von klein auf bei schmaler Kost.«
Erste Herbstregen setzten ein – zur Unzeit und unnütz: die Bauern waren längst in fremden Gegenden verschollen, und viele waren auf den Wegen gestorben, hatten es nicht geschafft bis zum Bergwerk und zum südlichen Brot. Sachar Pawlowitsch ging mit dem Tischler zum Bahnhof, um sich zu verdingen, der Tischler kannte dort einen Lokführer.
Den Lokführer fanden sie im Dienstraum, wo sich die Lokomotivbesatzungen ausschliefen. Er sagte, dass es viele Leute gibt, aber keine Arbeit; die Überreste der umliegenden Dörfer leben allesamt im Bahnhof und machen gegen niedriges Entgelt alles, was anfällt. Der Tischler ging hinaus und brachte eine Flasche Wodka und einen Ring Wurst. Nachdem der Lokführer von dem Wodka getrunken hatte, erzählte er Sachar Pawlowitsch und dem Tischler von der Lokomotive und der Westinghouse-Druckluftbremse.
»Weißt du, wie groß die Trägheit ist auf abschüssigem Gelände bei sechzig Achsen in einem Zug?«, sagte der Lokführer, empört über die Unwissenheit seiner Zuhörer, und zeigte mit den Händen federnd die Macht der Trägheit. »Oho! Du öffnest den Bremshahn – unterm Tender sprühen blaue Funken von den Bremsklötzen, die Waggons drängen von hinten, die Lok pfeift mit gedrosseltem Dampf – ein Fauchen und Zischen! Uch, hol’s der Teufel! Gieß ein! Du hättest Gurken kaufen sollen, die Wurst verstopft den Magen!«
Sachar Pawlowitsch saß und schwieg: Er hatte von vornherein nicht geglaubt, mit einer Lokomotive arbeiten zu dürfen, wie sollte er sich hier zurechtfinden nach seinen Holzpfannen!
Die Erzählungen des Lokführers ließen sein Interesse für mechanische Erzeugnisse verstohlener und trauriger werden, wie abgewiesene Liebe.
»Warum lässt du den Kopf hängen?«, sagte der Lokführer, der Sachar Pawlowitschs Kummer bemerkt hatte. »Komm morgen ins Depot, ich red mit dem Altmeister, vielleicht nehmen sie dich als Putzer. Nur Mut, du Hundesohn, willst doch essen …«
Der Lokführer hielt inne, ohne zu Ende gesprochen zu haben, er musste rülpsen.
»Verdammt, deine Wurst will im Rückwärtsgang wieder raus! Du hast die zu zehn Kopeken das Pud gekauft, du Hungerleider, da hätte ich lieber Putzwolle zum Wodka essen sollen … Aber«, wandte er sich wieder an Sachar Pawlowitsch, »aber mach mir die Lok so spiegelblank, dass ich in weißen Handschuhen jedes Teil anfassen kann! Die Lok mag kein einziges Staubkörnchen; eine Maschine, mein Lieber, die ist ein feines Fräulein. Eine Frau taugt da nicht mehr – mit einem Loch zu viel läuft keine Maschine.«
Der Lokführer ließ sich in abstrakten Worten über irgendwelche Frauen aus. Sachar Pawlowitsch hörte aufmerksam zu und verstand kein Wort, er wusste nicht, dass man Frauen auf besondere Weise und von weitem lieben kann; er wusste, dass so ein Mann heiraten muss. Interessiert reden kann man über die Erschaffung der Welt und über unbekannte Erzeugnisse, aber über eine Frau reden, ebenso über Männer, das war unverständlich und langweilig. Früher einmal hatte auch Sachar Pawlowitsch eine Ehefrau gehabt, sie liebte ihn, und er tat ihr nichts zuleide, aber er fand an ihr keine allzu große Freude. Mit vielen Eigenschaften ist der Mensch ausgestattet; wenn man eingehend über sie nachdenkt, kann man sogar über sein eigenes, allsekündliches Atmen vor Begeisterung wiehern. Doch was ergibt sich daraus? Unterhaltung und Spiel mit dem eigenen Körper, aber keine ernsthafte äußere Existenz.
Sachar Pawlowitsch hatte von solchen Gesprächen noch nie etwas gehalten.
Nach einer Stunde fiel dem Lokführer ein, dass er Dienst hatte. Sachar Pawlowitsch und der Tischler begleiteten ihn zu einer Lokomotive, die gerade vom Aufrüsten kam. Der Lokführer rief schon von weitem in dienstlichem Bass seinem Heizer zu:
»Wie ist der Dampf?«
»Sieben atü«, antwortete, aus dem Fenster gelehnt, ohne Lächeln der Heizer.
»Wasser?«
»Normaler Stand.«
»Feuerung?«
»Ich geb Dampf.«
»Bestens.«
Anderntags ging Sachar Pawlowitsch ins Depot. Der Altmeister der Lokführer, ein kleiner bejahrter Mann, der lebendigen Menschen nicht traute, musterte ihn lange. Er liebte die Lokomotiven so schmerzlich und eifersüchtig, dass er nur mit Entsetzen zusehen konnte, wenn sie fuhren. Wäre es nach ihm gegangen, so hätte er alle Lokomotiven zur ewigen Ruhe abgestellt, damit sie nicht von den groben Händen Unwissender verstümmelt würden. Er meinte, Menschen gebe es viele, Maschinen dagegen wenige; die Menschen lebten und könnten für sich selber einstehen, eine Maschine aber sei ein zartes, schutzloses, zerbrechliches Geschöpf: Um eine Lok einwandfrei zu fahren, müsse man vorher seine Frau verlassen, alle Sorgen aus seinem Kopf werfen und sein Brot in Schmieröl tunken, erst dann dürfe man an eine Lok, und auch das erst nach zehnjähriger Geduld!
Der Altmeister studierte Sachar Pawlowitsch und dachte gequält: Bestimmt ein Trottel, wo ein Fingerdruck genügt, fuhrwerkt so ein Klotz mit dem Vorschlaghammer herum, wo man ganz sacht übers Manometerglas wischen muss, grapscht er so zu, dass er den ganzen Apparat samt Röhrchen runterreißt; darf man denn einen Ackerbauern an einen Mechanismus ranlassen? Mein Gott, mein Gott! Der Altmeister ergrimmte schweigend, aber von Herzen. Wo seid ihr hin, ihr alten Schlosser, Gehilfen, Heizer, Putzer? Früher, da hatten die Leute Herzklopfen in der Nähe einer Lokomotive, aber heute denkt jeder, er wär klüger als die Maschine! Gesindel, Kirchenschänder, Strolche, verdammte Trottel! Von Rechts wegen müsste man sofort jeden Verkehr einstellen! Was sind denn das heutzutage für Schlosser? Das reinste Elend, aber keine Menschen! Das sind Landstreicher, Pfuscher, Tollköpfe, denen darf man keinen Bolzen in die Hand geben, aber sie hantieren schon mit dem Regler! Früher, wenn da bei mir auf der Lok während der Fahrt irgendwas klapperte, wenn im Triebwerk was zu singen anfing, hab ich’s mit der Fingernagelspitze gefühlt, ohne mich vom Fleck zu rühren, und hab so gelitten, dass ich am ganzen Körper zitterte, und beim ersten Halt hab ich den Defekt mit den Lippen aufgespürt, weggeleckt, weggesaugt, mit Blut geschmiert, aber blindlings bin ich nicht gefahren. Und der hier will vom Roggenfeld gleich auf die Lok!
»Geh nach Hause, wasch dir erst mal das Maul, dann kannst du an eine Lok rangehen«, sagte der Altmeister zu Sachar Pawlowitsch.
Frisch gewaschen erschien Sachar Pawlowitsch am übernächsten Tag wieder. Der Altmeister lag unter einer Lok, klopfte vorsichtig mit einem Hämmerchen die Federn ab und legte das Ohr an das klingende Metall.
»Motja!«, rief er einen Schlosser, »zieh hier die Mutter einen halben Gang nach.«
Motja setzte den Schraubenschlüssel an und drehte. Der Altmeister war plötzlich so beleidigt, dass er Sachar Pawlowitsch leidtat.
»Motja«, sagte der Altmeister mit stiller unterdrückter Traurigkeit, knirschte dabei aber mit den Zähnen. »Was hast du gemacht, verdammter Lump? Ich hab dir doch gesagt: die Mutter! Welche Mutter? Die Hauptmutter! Aber du hast die Gegenmutter verdreht und mich durcheinandergebracht! Du ziehst die Gegenmutter an! Schon wieder! Was soll ich bloß mit euch machen, ihr verdammten Hornochsen? Hau ab, du Rindvieh!«
»Lassen Sie mich, Herr Mechaniker, ich dreh die Gegenmutter eine halbe Umdrehung zurück und zieh die Hauptmutter einen halben Gang an!«, bat Sachar Pawlowitsch.
Der Altmeister antwortete mit gerührter friedfertiger Stimme, denn er wusste es zu schätzen, dass ein Außenstehender an seiner Wahrheit Anteil nahm.
»Wie? Du hast es mitgekriegt? Der da, der ist ein Holzhacker, aber kein Schlosser. Der kennt doch eine Schraubenmutter nicht mal dem Namen nach. Was soll man da machen? Der geht mit der Lok um wie mit einem Weib, wie mit irgendeiner Schlampe! Herr im Himmel! Na komm, komm her – zieh mir die Mutter richtig an.«
Sachar Pawlowitsch kroch unter die Lokomotive und machte alles genau so, wie es sein musste. Dann hatte der Altmeister bis zum Abend mit den Lokomotiven zu tun und stritt mit den Lokführern herum. Als das Licht angezündet wurde, brachte sich Sachar Pawlowitsch bei dem Altmeister in Erinnerung. Der blieb wieder vor ihm stehen und dachte seine Gedanken.
»Der Vater der Maschine ist der Hebel und ihre Mutter die schiefe Ebene«, sagte der Altmeister freundlich und dachte dabei an etwas Herzerwärmendes, das ihm in den Nächten Frieden gab. »Versuch morgen die Feuerbüchsen zu säubern – sei rechtzeitig da. Aber ich weiß nicht, ich kann nichts versprechen – wir versuchen es, dann sehen wir weiter. Das ist eine zu ernste Sache! Verstehst du: die Feuerbüchse! Nicht irgendwas, nein, die Feuerbüchse! Na geh, geh schon!«
Noch eine Nacht schlief Sachar Pawlowitsch bei dem Tischler in der Kammer, und im Morgengrauen, drei Stunden vor Arbeitsbeginn, kam er ins Depot. Da lagen blankgefahrene Schienen, standen Güterwaggons mit den Aufschriften ferner Länder: Transkaspische, Transkaukasische, Ussurische Eisenbahn. Besondere, seltsame Leute gingen über die Gleise: kluge und konzentrierte Männer – Weichensteller, Lokführer, Kontrolleure und sonstige. Ringsum standen Gebäude, Lokomotiven, Erzeugnisse und Anlagen.
Vor Sachar Pawlowitsch tat sich eine neue kunstvolle Welt auf, die er schon so lange liebte und immer schon zu kennen schien, und er beschloss, sich auf ewig in ihr zu behaupten.
Ein Jahr vor der Missernte wurde Mawra Fetissowna zum siebzehnten Mal schwanger. Ihr Mann, Prochor Abramowitsch Dwanow, freute sich weniger, als es sich gehört hätte. Wenn er täglich die Felder, die Sterne, die riesige strömende Luft betrachtete, dachte er: Es reicht für alle. Und er lebte ruhig in seiner Kate, in der es von winzigen Menschen wimmelte – seiner Nachkommenschaft. Obwohl seine Frau sechzehn Menschen geboren hatte, waren nur sieben am Leben geblieben, das achte war ein angenommenes Kind – der Sohn des auf eigenen Wunsch ertrunkenen Fischers. Als die Frau den Waisenjungen an der Hand ins Haus brachte, hatte Prochor Abramowitsch nichts dagegen gesagt.
»Auch gut, je mehr Kinder da sind, desto leichter stirbt es sich im Alter. Gib ihm zu essen, Mawruscha.«
Der Junge aß Brot mit Milch, dann rückte er beiseite und kniff die Augen zu wegen der fremden Leute.
Mawra Fetissowna betrachtete ihn und seufzte.
»Eine neue Bekümmernis hat uns der Herr geschickt. Der Junge wird wohl nicht alt werden – in seinen Augen ist kein Leben; er wird bloß unnütz Brot essen.«
Aber der Junge starb nicht in den nächsten zwei Jahren und wurde auch nicht ein einziges Mal krank. Er aß wenig, und Mawra Fetissowna fand sich mit der Waise ab.
»Iss nur, iss, mein Junge«, sagte sie, »was du dir bei uns nicht nimmst – von andern kriegst du’s nicht.«
Prochor Abramowitsch war längst zermürbt von der Not und den Kindern und zeigte für nichts tiefe Aufmerksamkeit – ob die Kinder krank waren oder neue geboren wurden, ob die Ernte schlecht war oder erträglich, und darum hielten ihn alle für einen guten Menschen. Nur die fast alljährliche Schwangerschaft seiner Frau freute ihn ein wenig; die Kinder waren das einzige Gefühl von Beständigkeit in seinem Leben, sie nötigten ihn mit ihren weichen kleinen Händen, zu pflügen, sich um die Hauswirtschaft zu kümmern und für alles Mögliche zu sorgen. Er ging, lebte und arbeitete wie ein Schlaftrunkener, hatte keine überschüssige Energie für inneres Glück und wusste nichts ganz genau. Zu Gott betete Prochor Abramowitsch, aber eine herzliche Hinwendung zu ihm spürte er nicht; die Leidenschaften der Jugend, wie die Liebe zu den Frauen, der Wunsch nach gutem Essen und sonstiges, hatten sich in ihm verflüchtigt, denn seine Frau war nicht schön und das Essen eintönig und unnahrhaft jahrein, jahraus. Die Vermehrung der Kinder verminderte in Prochor Abramowitsch das Interesse an sich selbst; ihm wurde davon irgendwie kühler und leichter. Je länger er lebte, desto geduldiger und achtloser verhielt er sich zu allen dörflichen Ereignissen. Wären all seine Kinder an einem Tag gestorben, so hätte er sich am nächsten Tag genauso viele Pflegekinder zusammengeholt, und wären auch die Pflegekinder umgekommen, so hätte er augenblicklich sein Bauernlos hingeworfen, hätte seiner Frau die Freiheit gegeben und wäre barfuß ins Ungewisse hinausgegangen, dorthin, wohin es alle Menschen zieht, wo das Herz vielleicht genauso traurig ist, wo aber wenigstens die Füße Trost finden.
Die siebzehnte Schwangerschaft seiner Frau bekümmerte Prochor Abramowitsch aus wirtschaftlichen Erwägungen: in diesem Herbst wurden im Dorf weniger Kinder geboren als im vergangenen, und vor allem – Tante Marja gebar nicht, die zwanzig Jahre lang hintereinander geboren hatte, ausgenommen die Jahre vor einer Dürre. Das nahm das ganze Dorf zur Kenntnis, und wenn Tante Marja leer und leicht durchs Dorf ging, sagten die Männer: »Na, Marja läuft dies Jahr jungfräulich herum, im Sommer werden wir hungern.«
In diesem Jahr ging Marja auch flach und frei durchs Dorf.
»Liegst du brach, Marja Matwejewna?«, fragten die vorübergehenden Männer achtungsvoll.
»Na ja!«, sagte Marja und schämte sich ihres ungewohnt tauben Zustands.
»Macht nichts«, beruhigten sie sie. »Pass auf, bald machst du wieder einen Sohn, das geht ja bei dir ruck, zuck.«
»Wozu auch unnütz leben«, gab Marja beherzter zur Antwort. »Wenn nur Brot da ist.«
»Da hast du recht«, stimmten die Männer zu. »Im Kinderkriegen sind die Weiber fix, da kommt das Korn nicht mit. Du bist doch eine Hexe, du weißt, wann deine Zeit ist.«
Prochor Abramowitsch sagte zu seiner Frau, dass sie zur Unzeit schwer geworden sei.
»Ach, Proscha«, antwortete Mawra Fetissowna, »ich gebäre, und ich werde für sie betteln gehen, du doch nicht!«
Prochor Abramowitsch verstummte für lange Zeit. Der Dezember kam, aber kein Schnee fiel – die Wintersaat erfror. Mawra Fetissowna gebar Zwillinge.
»Nun hast du geworfen«, sagte an ihrem Bett Prochor Abramowitsch. »Na Gott sei Dank, aber was machen wir jetzt! Die werden wohl am Leben bleiben – sie haben Falten auf der Stirn, und die Fäustchen sind geballt.«
Der Pflegesohn stand auch dabei und blickte auf das Unbegreifliche mit verzerrtem und gealtertem Gesicht. In ihm stieg die ätzende Wärme der Scham für die Erwachsenen hoch, er verlor schlagartig die Liebe zu ihnen und fühlte seine Einsamkeit, und er wollte am liebsten weglaufen und sich in einer Schlucht verstecken. Genauso einsam, trostlos und bang war ihm zumute gewesen, als er verklammerte Hunde gesehen hatte, damals hatte er zwei Tage nichts gegessen und allen Hunden seine Liebe für immer entzogen. Am Bett der Wöchnerin roch es nach Rindfleisch und feuchtem Milchkalb. Mawra Fetissowna aber merkte vor Schwäche nichts, ihr war heiß unter der bunten Flickendecke, und sie hatte ein Bein herausgestreckt, das zerrunzelt war von Alter und Mutterspeck; auf dem Bein waren gelbe Flecke irgendwelcher verödeter Leiden und dicke blaue Adern mit erstarrtem Blut zu sehen, die straff unter der Haut wucherten und kurz davor waren, sie zu zerreißen, um nach außen zu treten; an einer Ader, einem Baum gleich, konnte man fühlen, wie irgendwo das Herz schlug, wie es mit Hartnäckigkeit und Anstrengung das Blut durch die engen einstürzenden Hohlwege des Körpers jagte.
»Na, Sascha, was starrst du denn so?«, fragte Prochor Abramowitsch den geschwächten Pflegesohn. »Du hast zwei Brüderchen bekommen. Schneid dir einen Kanten Brot ab und geh nach draußen, es ist wärmer geworden.«
Sascha ging hinaus, ohne sich Brot zu nehmen. Mawra Fetissowna öffnete die fahlen wässrigen Augen und rief ihren Mann:
»Proscha! Mit dem Waisenjungen haben wir zehn, und du bist der Zwölfte.«
Prochor Abramowitsch kannte selbst die Rechnung.
»Sollen sie leben, für einen weiteren Mund wächst weiteres Korn.«
»Die Leute sagen, es gibt eine Hungersnot, möge Gott dieses Elend verhüten, wo sollen wir hin mit den Säuglingen und den Kleinen?«
»Es gibt keine Hungersnot«, entschied Prochor Abramowitsch zur Beruhigung, »wenn die Wintersaat nichts wird, holen wir’s mit der Sommersaat rein.«
Die Wintersaat wurde tatsächlich nichts, sie hatte schon im Herbst Frost gekriegt und erstickte im Frühjahr endgültig unter der Eiskruste der Felder. Die Sommersaaten ließen bald bangen, bald hoffen, aber irgendwie reiften sie doch und erbrachten zehn Pud pro Dessjatine. Prochor Abramowitschs ältester Sohn war um die elf, und fast genauso alt war der Pflegesohn; einer musste betteln gehen, um der Familie mit Dörrbrot Hilfe zu bringen. Prochor Abramowitsch schwieg; den eigenen Sohn zu schicken war ihm schmerzlich, und den Pflegesohn – peinlich.
»Was sitzt du da und schweigst?«, erboste sich Mawra Fetissowna. »Agapka hat einen Siebenjährigen losgeschickt, Mischka Duwakin ein kleines Mädchen, und du sitzt da wie ein Ölgötze! Die Hirse reicht nicht bis Weihnachten, und Brot haben wir seit Christi Verklärung nicht gesehen.«
Den ganzen Abend nähte Prochor Abramowitsch einen bequemen und geräumigen Beutel aus altem Sackleinen. Zweimal rief er Sascha zu sich und nahm an seinen Schultern Maß.
»Geht’s so? Drückt er nicht?«
»Geht so«, antwortete Sascha.
Der siebenjährige Proschka saß neben dem Vater und fädelte den widerspenstigen Zwirn in die Nadel, wenn er heraussprang, denn der Vater sah nicht gut.
»Papa, jagst du Sascha morgen betteln?«, fragte Proschka.
»Was faselst du da?«, sagte der Vater ärgerlich. »Wenn du größer bist, gehst du selber betteln.«
»Ich nicht«, widersprach Proschka, »ich werde stehlen. Weißt du noch, wie du gesagt hast, dem Onkel Grischa haben sie die Stute weggeholt? Sie haben sie weggeholt, ihnen geht’s gut, und Onkel Grischa hat sich einen Wallach gekauft. Wenn ich groß bin, klau ich den Wallach.«
Am Abend verpflegte Mawra Fetissowna Sascha besser als ihre leiblichen Kinder, sie gab ihm extra, nach den andern, Grützbrei mit Butter und dazu Milch, so viel er wollte. Prochor Abramowitsch holte aus dem Schuppen eine Stange, und als alle schliefen, machte er daraus einen Wanderstab. Sascha schlief nicht und hörte, wie Prochor Abramowitsch den Stock mit dem Brotmesser glattschabte. Proschka schniefte und zuckte, weil eine Schabe über seinen Hals spazierte. Sascha nahm die Schabe herunter, hatte aber Angst, sie zu töten, und warf sie vom Ofen auf den Boden.
»Sascha, schläfst du nicht?«, fragte Prochor Abramowitsch. »Schlaf nur, schlaf!«
Die Kinder wachten immer früh auf, sie begannen im Dunkeln miteinander zu raufen, wenn die Hähne noch schlummerten und die alten Männer zum zweiten Mal aufwachten und sich die wundgelegenen Stellen rieben. Noch hatte im Dorf kein Riegel geknirscht, und nichts zirpte auf den Feldern. Zu solcher Stunde führte Prochor Abramowitsch den Pflegesohn an den Dorfrand. Der Junge ging wie im Schlaf und hielt zutraulich Prochor Abramowitschs Hand. Es war feucht und kühl; der Wächter in der Kirche läutete die Stunde, und das traurige Dröhnen der Glocke beunruhigte den Jungen.
Prochor Abramowitsch beugte sich zu dem Waisenkind herab.
»Sascha, schau mal dorthin. Siehst du, da führt der Weg aus dem Dorf einen Berg hinauf, geh immer diesen Weg. Du wirst dann ein riesengroßes Dorf sehen und einen Wachtturm auf einem Hügel, da hab keine Angst, geh immer drauf zu – so empfängt dich die Stadt, und dort gibt es viel Brot in den Speichern. Wenn du den Beutel voll hast, kommst du nach Hause und ruhst dich aus. Nun leb wohl, mein Junge!«
Sascha hielt Prochor Abramowitschs Hand und blickte in die graue morgendliche Dürftigkeit des herbstlichen Feldes.
»Hat es dort geregnet?«, fragte Sascha nach der fernen Stadt.
»Und wie!«, bestätigte Prochor Abramowitsch.
Da ließ der Junge die Hand los, und ohne Prochor Abramowitsch noch einmal anzuschauen, setzte er sich still in Bewegung – mit Beutel und Stock, den Blick auf den Weg bergan geheftet, um nicht die Richtung zu verlieren. Er verschwand hinter Kirche und Friedhof und war lange nicht mehr zu sehen. Prochor Abramowitsch stand und wartete, wann der Junge jenseits der Senke auftauchen würde. Einsame Spatzen scharrten zu der frühen Stunde auf dem Weg und froren augenscheinlich. Sie sind auch Waisen, dachte Prochor Abramowitsch, wer wirft ihnen etwas hin?
Sascha ging auf den Friedhof, ohne sich bewusst zu sein, was er dort wollte. Zum ersten Mal dachte er jetzt über sich nach und berührte seine Brust: dies bin ich; aber alles um ihn her war fremd und anders als er. Das Haus, in dem er gelebt, wo er Prochor Abramowitsch, Mawra Fetissowna und Proschka geliebt hatte, war also gar nicht sein Haus – man hatte ihn von dort am frühen Morgen hinausgeführt auf die kühle Straße. In der halb kindlichen traurigen Seele, die nicht verdünnt war vom beruhigenden Wasser des Bewusstseins, ballte sich eine drückende Kränkung, er spürte sie bis in die Kehle.
Der Friedhof war bedeckt von abgestorbenen Blättern, ihre Ruhe beschwichtigte jeden Fuß und ließ ihn friedlich auftreten. Überall standen Bauernkreuze, viele ohne Namen und ohne Erinnerung an den Toten. Sascha interessierte sich für jene Kreuze, die am hinfälligsten waren und sich ebenfalls bereitmachten, umzufallen und in der Erde zu sterben. Gräber ohne Kreuze waren noch besser – in ihrer Tiefe lagen Menschen, die auf immer zu Waisen geworden waren: Auch ihre Mütter waren gestorben und manche Väter in Flüssen und Seen ertrunken. Der Grabhügel von Saschas Vater war fast völlig niedergetrampelt, über ihn hinweg führte ein Pfad, auf dem neue Särge ins Dickicht des Friedhofs getragen wurden. Ganz nah und geduldig lag der Vater und beklagte sich nicht, dass es für ihn schlimm und gruselig sei, auf den Winter allein zu bleiben. Was ist dort? Dort ist es schlecht, dort ist es still und eng, von dort ist der Junge mit dem Stab und dem Bettelsack nicht zu sehen.
»Papa, sie haben mich davongejagt zum Betteln, ich sterb jetzt bald zu dir – dir ist doch trübsinnig so allein, mir ist auch trübsinnig.«
Der Junge legte seinen Stab aufs Grab und bedeckte ihn mit Blättern, damit er gut verwahrt blieb und auf ihn wartete.
Sascha nahm sich vor, bald aus der Stadt zurückzukommen, sowie er den Beutel mit Brot gefüllt hatte; dann würde er sich neben dem Grab seines Vaters eine Erdhütte graben und dort leben, da er nun mal kein Heim hatte.
Prochor Abramowitsch war des Wartens müde und wollte schon gehen. Aber Sascha hatte die Bäche in der Talsohle durchquert und stieg nun den lehmigen Hang hinauf. Er ging langsam und war schon erschöpft, doch freute er sich, dass er bald sein Haus und seinen Vater haben würde; mochte der Vater auch tot dort liegen und nichts sagen, dafür würde er immer ganz dicht bei ihm liegen, in seinem schweißwarmen Hemd, mit seinen Armen, die Sascha umfasst hatten, wenn sie beide am See schliefen; mochte der Vater auch tot sein, aber er war unversehrt, immer noch ein und derselbe.
Wo hat er bloß seinen Stock gelassen?, fragte sich Prochor Abramowitsch.
Der Morgen war feucht, der Junge bewältigte den glitschigen Hang, indem er sich mit den Händen abstützte. Der Beutel baumelte an ihm, weit und geräumig wie fremde Kleidung.
»Was hab ich da zusammengenäht, nicht mit Bettleraugen, sondern mit Gieraugen«, schalt sich Prochor Abramowitsch etwas spät. »Voll mit Brot kann Sascha ihn nicht herschleppen. Aber jetzt ist schon alles egal: irgendwie wird’s schon gehen …«
Auf dem höchsten Punkt, wo der Weg auf die andere, unsichtbare Seite der Felder hinunterführte, blieb der Junge stehen. Im Frühlicht des werdenden Tages, auf der Linie des Dorfhorizonts, stand er über einem scheinbaren tiefen Abgrund, am Ufer des Himmelssees. Sascha blickte erschrocken in die Leere der Steppe: Höhe, Weite, tote Erde – alles war feucht und groß und wirkte darum fremd und beängstigend. Aber dem Jungen lag viel daran, heil zurückzukehren, in die Niederung des Dorfes auf den Friedhof, dort war der Vater, dort war es eng, und alles war klein, traurig und durch Erde und Bäume gegen den Wind geschützt. Darum ging er auf die Stadt zu, um Brotstücke zu holen.
Prochor Abramowitsch bekam Mitleid mit dem Waisenjungen, der jetzt auf dem abschüssigen Weg entschwand. Der Junge wird schwach werden vom Wind, wird sich in den Straßengraben legen und umkommen – die weite Welt ist kein heimisches Haus.
Prochor Abramowitsch wollte hinterherlaufen und den Waisenjungen zurückholen, damit alle auf einem Haufen und in Ruhe starben, aber zu Hause waren die eigenen Kinder, die Frau und die letzten Reste Sommergetreide.
Wir sind alle niedrig und gemein, schätzte er sich richtig ein, und von der Richtigkeit wurde ihm leichter. In der Kate saß er tagelang stumm und verloren und beschäftigte sich mit einer unnützen Sache – er schnitzte. In schwerer Seelennot lenkte er sich immer mit dem Schnitzen eines Tannenwaldes oder anderer, nicht existierender Wälder ab, weiter gedieh seine Kunst nicht, denn das Messer war stumpf. Mawra Fetissowna weinte mit Unterbrechungen um den fortgegangenen Pflegesohn. Ihr waren acht Kinder gestorben, und um jedes hatte sie drei Tage und Nächte mit Unterbrechungen am Ofen geweint. Das war für sie das Gleiche wie für Prochor Abramowitsch das Schnitzen. Prochor Abramowitsch wusste schon im Voraus, wie viel Zeit Mawra noch zum Weinen und ihm zum Schnitzen blieb: anderthalb Tage.
Proschka sah sich das eine Weile an und wurde eifersüchtig:
»Weshalb weint ihr, Sascha wird zurückkommen. Vater, walk mir lieber Filzstiefel, Sascha ist nicht dein Sohn, er ist eine Waise. Aber du sitzt da und machst das Messer stumpf, alter Mann.«
»Du meine Güte!« Vor Staunen hörte Mawra auf zu weinen. »Er schwätzt daher wie ein Großer, so ein Lauseei, und muckt schon gegen den Vater auf!«
Aber Proschka hatte recht: Der Waisenjunge kam nach zwei Wochen zurück. Er brachte so viele Brotstücke und trockene Brötchen mit, als hätte er selbst nichts gegessen. Von dem, was er mitgebracht hatte, kostete er auch nichts, denn er legte sich gegen Abend auf den Ofen und konnte nicht warm werden – die Winde unterwegs hatten alle Wärme aus ihm herausgeblasen. In seinem Dämmerzustand murmelte er etwas vom Stock in den Blättern und vom Vater: Der Vater soll den Stock hüten und auf ihn warten, in der Erdhütte am See, wo die Kreuze wachsen und fallen.
Nach drei Wochen, als der Pflegesohn genesen war, nahm Prochor Abramowitsch eine Peitsche und ging zu Fuß in die Stadt, um auf den Plätzen zu stehen und sich zu verdingen.
Proschka folgte Sascha zweimal auf den Friedhof. Er sah, dass sich der Waisenjunge mit den Händen selbst ein Grab grub und nicht tief genug vordrang. Da brachte er dem Jungen den Spaten des Vaters und sagte, damit gehe es leichter, alle Männer grüben mit dem Spaten.
»Dich jagen sie so oder so vom Hof«, verkündete er Sascha die Zukunft. »Der Vater hat im Herbst nicht gesät, und Mutter kriegt im Sommer wieder Junge, womöglich werden es diesmal Drillinge. Ich sag dir die Wahrheit.«
Sascha nahm den Spaten, aber der war zu groß für ihn, und die Arbeit ermüdete ihn rasch.
Proschka stand dabei, fror unter den spärlichen Tropfen eines beißenden späten Regens und riet:
»Grab nicht so breit, für einen Sarg ist kein Geld da, du legst dich so hinein. Mach nur schnell, sonst kommt die Mutter nieder, und du bist ein überflüssiger Esser.«
»Ich grabe mir eine Erdhütte und werde hier leben«, sagte Sascha.
»Ohne unser Essen?«, erkundigte sich Proschka.
»Ja – ohne alles. Im Sommer pflücke ich mir Kerbel, da hab ich was zu essen.«
»Dann lebe«, sagte Proschka beruhigt. »Aber komm nicht zu uns betteln, wir haben nichts.«
Prochor Abramowitsch hatte in der Stadt fünf Pud Mehl verdient, kam auf einem fremden Fuhrwerk zurück und legte sich auf den Ofen. Als sie das Mehl zur Hälfte aufgegessen hatten, überlegte Proschka schon, wie es weitergehen sollte.
»Du Faulenzer«, sagte er eines Tages zum Vater, der vom Ofen auf die wie aus einem Munde brüllenden Zwillinge blickte. »Das Mehl fressen wir auf, und dann verhungern wir. Du hast uns in die Welt gesetzt, nun ernähr uns!«
»Du Satansei«, schnauzte Prochor Abramowitsch von oben. »Du müsstest hier der Vater sein und nicht ich, du Rotzlöffel!«
Proschka saß mit pfiffiger Miene da und überlegte, wie er Vater werden könnte. Er wusste schon, dass die Kinder aus dem Bauch der Mutter kommen – ihr ganzer Bauch war ja voller Narben und Runzeln –, aber woher kommen dann die Waisen? Proschka hatte zweimal nachts, als er aufwachte, gesehen, dass der Vater Mutters Bauch knetete, und dann schwoll der Bauch an, und Kinder kamen zur Welt, Esser. Daran erinnerte er jetzt den Vater:
»Und leg dich nicht auf die Mutter, lieg neben ihr und schlaf. Oma Paraschka, die hat gar nichts Kleines, ihr hat Großvater Fedot nicht den Bauch geknetet …«
Prochor Abramowitsch kletterte vom Ofen, fuhr in die Filzstiefel und sah sich um. In der Kate gab es nichts Überflüssiges; da nahm er den Reisigbesen und schlug Proschka damit ins Gesicht. Proschka schrie nicht, er legte sich sofort mit dem Gesicht nach unten auf die Bank. Prochor Abramowitsch prügelte schweigend auf ihn ein, bemüht, sich mit Wut aufzuladen.
»Tut nicht weh, tut nicht weh, tut überhaupt nicht weh!«, sagte Proschka, ohne sein Gesicht zu zeigen.
Nach der Tracht Prügel stand er auf und sagte, ohne Luft zu holen:
»Dann jag Sascha weg, damit wir keinen überflüssigen Esser haben.«
Prochor Abramowitsch quälte sich mehr als Proschka und saß bekümmert neben der Wiege mit den verstummten Zwillingen. Er hatte Proschka verprügelt, weil Proschka recht hatte: Mawra war wieder schweren Leibes, und er hatte kein Wintergetreide zum Aussäen. Prochor Abramowitsch lebte auf der Welt, wie Gräser am Grunde einer Senke leben: Im Frühling stürzen Schmelzwasser auf sie nieder, im Sommer – Regengüsse, bei Wind – Sand und Staub, und im Winter legt sich schwer und drückend Schnee auf sie; immer und in jeder Minute leben sie unter den Schlägen und dem Druck schwerer Lasten, darum wachsen die Gräser in den Senken schief und krumm und sind bereit, sich zu beugen und die Not durch sich hindurchzulassen. Genauso prasselten die Kinder auf Prochor Abramowitsch nieder – schwerer, als würde er selbst geboren, und häufiger als die Ernte. Wäre das Feld so gebärfreudig wie seine Frau und hätte sich seine Frau mit ihrer Fruchtbarkeit nicht so beeilt, dann wäre er längst ein satter und zufriedener Bauer gewesen. Doch das ganze Leben hindurch kamen die Kinder in gleichmäßigem Strom und begruben, wie der Schlamm die Mulde, seine Seele unter den lehmigen Anschwemmungen von Sorgen, darum fühlte Prochor Abramowitsch kaum sein Leben und persönliche Interessen; kinderlose ungebundene Menschen aber nannten seinen selbstvergessenen Zustand Faulheit.
»Proschka, komm mal her!«, rief er.
»Was willst du?«, sagte Proschka finster. »Erst schlagen, und dann Proschka …«
»Proschka, lauf zu Tante Marja, guck nach, ob ihr Bauch angeschwollen ist oder flach. Ich hab sie lange nicht gesehen; vielleicht ist sie krank?«
Proschka war nicht nachtragend und bemühte sich um seine Familie.
»Ich sollte der Vater sein und du – Proschka«, beleidigte er seinen Vater. »Was soll ich ihren Bauch angaffen; du hast kein Wintergetreide gesät, also müssen wir so und so hungern.«
Proschka zog Mutters Jacke an und knurrte immer noch besorgt wie ein Hausherr:
»Die Männer spinnen. Im Sommer war Tante Marja leer, dabei gab’s Regen. Also hat sie sich vertan – sie hätte einen Esser kriegen müssen, hat sie aber nicht.«
»Die Wintersaat ist erfroren, sie hat’s gespürt«, sagte der Vater leise.
»Die Kleinen saugen doch bei der Mutter und essen überhaupt kein Brot«, entgegnete Proschka. »Und die Mutter kann sich ja vom Sommergetreide ernähren. Ich geh nicht zu dieser Marja; wenn sie einen dicken Bauch hat, kommst du nicht vom Ofen runter, dann sagst du, es wird Kräuter geben und gutes Sommergetreide. Aber wir haben keine Lust zu hungern, und du hast uns mit Mama in die Welt gesetzt.«
Prochor Abramowitsch schwieg. Sascha sagte sowieso nie etwas, wenn er nicht gefragt wurde. Selbst Prochor Abramowitsch, der gegen Proschka wie eine Waise in seinem eigenen Haus wirkte, wusste nicht, was Sascha für ein Mensch war: ein guter oder nicht; betteln gegangen konnte er aus Furcht sein, und was er dachte, sagte er nicht. Doch Sascha dachte wenig, weil er alle Erwachsenen und Kinder für klüger hielt als sich selbst und darum Angst vor ihnen hatte. Mehr als Prochor Abramowitsch fürchtete er Proschka, der jeden Bissen zählte und niemanden außerhalb seines Hofes liebte.
Den Hintern gereckt, mit seinen verderbenbringenden Händen die Gräser streifend, ging ein buckliger Mann durchs Dorf – Pjotr Fjodorowitsch Kondajew. Er hatte seit längerem keine Schmerzen im Kreuz, also war kein Wetterumschwung abzusehen.
In jenem Jahr war die Sonne am Himmel früh gereift – Ende April brannte sie schon wie im tiefen Juli. Die Männer wurden still, denn sie fühlten mit den Füßen den trockenen Boden und mit dem übrigen Körper den dauerhaft zur Ruhe gekommenen Raum der tödlichen Hitze. Die Kinder beobachteten die Horizonte, um rechtzeitig das Aufziehen einer Regenwolke zu bemerken. Aber auf den Feldwegen erhoben sich Staubsäulen, und durch sie hindurch fuhren Leiterwagen aus fremden Dörfern. Kondajew ging mitten auf der Straße zum anderen Dorfende, wo seine Herzenssorge wohnte – die Mädchenfrau Nastja, fünfzehn Jahre alt. Er liebte sie mit jener Stelle, die ihn häufig schmerzte und empfindsam war wie das Herz bei geraden Menschen, mit dem Kreuz, der Knickstelle seines Buckels. Kondajew sah in der Dürre ein Vergnügen und hoffte auf Besseres. Seine Hände waren ständig gelb und grün – er verdarb mit ihnen, wo er ging, die Pflanzen und zerrieb sie zwischen den Fingern. Er freute sich auf die Hungersnot, weil sie alle stattlichen Männer zum Broterwerb in die Fremde treiben würde, und viele von ihnen würden sterben und die Frauen für Kondajew freigeben. Unter der angespannten Sonne, die den Boden ausbrannte und als Staub aufwölken ließ, lächelte Kondajew. Jeden Morgen wusch er sich im Teich und streichelte den Buckel mit seinen flinken, zuverlässigen Händen, die geeignet waren, seine künftige Frau unermüdlich zu umfangen.
Lass nur, dachte Kondajew und nahm einstweilen mit sich vorlieb. Die Männer werden gehen, die Weiber werden bleiben. Wer mich kostet, vergisst es sein Lebtag nicht, ich bin ein ausgehungerter Bulle.





























