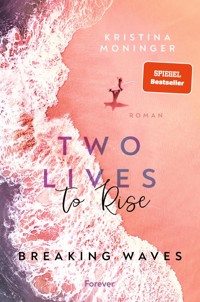
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Breaking Waves
- Sprache: Deutsch
Willkommen zurück auf Harbour Bridge: Die Sommer-Romance rund um vier Freundinnen Fünf Freundinnen. Vier Liebesgeschichten. Eine große Schuld. Isabellas Leben scheint perfekt. Sie ist Erbin eines Luxushotels und wohnt in einer traumhaft schönen Villa mitten in der Natur. Doch was niemand weiß: Sie ist zutiefst unglücklich und einsam. Als Preston in die Bruchbude neben Isabellas Villa in den Dünen einzieht, brennt bei ihr eine Sicherung durch. Preston, der unerträglich laut renoviert und dabei unverschämt gut in seinen Holzfällerhemden aussieht. Isabella kann Nähe kaum ertragen, hat zehn Jahre lang versucht, zu vergessen und ihre engsten Freundinnen auf Abstand gehalten. Doch Preston lässt sich von ihr nicht einschüchtern, und Isabella beginnt, ihre Mauern einzureißen. Bis sie eine grausame Wahrheit über Preston herausfindet, die alles zuvor Geglaubte überschattet … Ihr Nachbar bringt sie um den Schlaf … und um den Verstand Als ihre einstige Freundin Avery wieder auf Harbour Bridge auftaucht, kann Isabella nicht mehr vor ihren Erinnerungen davonlaufen. Sie waren unzertrennlich – Avery, Odina, Lee, Josie und Isabella –, bis Josie vor zehn Jahren spurlos verschwand und die Freundschaft der fünf daran zerbrach. Avery und Odina verfolgen eine neue Spur, die Isabella unter Zugzwang setzt. Und dann ist da noch ihr neuer Nachbar Preston, der ihr ins Gewissen redet. Doch Isabella will auf gar keinen Fall, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Denn eines weiß sie sicher: Sie ist schuld an Josies Verschwinden. Averys Geschichte: Breaking Waves - One Second to Love Isabellas Geschichte: Breaking Waves - Two Lives to Rise Odinas Geschichte: Breaking Waves - Three Tides to Stay Lees Geschichte: Breaking Waves - Four Secrets to Share
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Two Lives to Rise
Kristina Moninger wurde 1985 in Würzburg geboren und hat ihre Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land verbracht, in dem sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihren Zwillingen lebt. Sie hat bereits mehrere gefühlvolle Romane veröffentlicht und ist Nummer-1-Spiegel-Bestsellerautorin. Findet man sie nicht am Schreibtisch, dann sehr wahrscheinlich mit der Nase in einem Buch oder mit Familie und Hund in der Natur.
IHR NACHBAR BRINGT SIE UM DEN SCHLAF … UND UM DEN VERSTAND
Als ihre einstige Freundin Avery wieder auf Harbour Bridge auftaucht, kann Isabella nicht mehr vor ihren Erinnerungen davonlaufen. Sie waren unzertrennlich – Avery, Odina, Lee, Josie und Isabella –, bis Josie vor zehn Jahren spurlos verschwand und die Freundschaft der fünf daran zerbrach. Avery und Odina verfolgen eine neue Spur, die Isabella unter Zugzwang setzt. Und dann ist da noch ihr neuer Nachbar Preston, der ihr ins Gewissen redet. Doch Isabella will auf gar keinen Fall, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Denn eines weiß sie sicher: Sie ist schuld an Josies Verschwinden.
Kristina Moninger
Two Lives to Rise
Breaking Waves
Forever by Ullsteinwww.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH Berlin© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2023Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: Favoritbuero GbR - Bettina ArltTitelabbildung: © Flystock / ShutterstockAutorinnenfoto: © Wundertoll FotografieE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-95818-791-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Epilog
Triggerwarnung
Dank
Zitatnachweis
Leseprobe: Three Tides to Stay
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Tamia, mein Mädchen
Motto
Let me see your beauty broken downLike you would do for one you loveLeonard Cohen
Content Note
Content Note
Dieses Buch beinhaltet sensible Themen, die für manche Menschen belastend sein können.
Am Ende befindet sich eine ausführliche Triggerwarnung.
Prolog
Zehn Jahre zuvor
»Wann haben Sie Josephine Blythe das letzte Mal gesehen?«
»Bitte präzisieren Sie Ihre Angaben!«
»In welcher Verfassung war sie?«
»Wurde sie bedroht?«
»Gibt es Grund zur Annahme, dass jemand sie entführt haben könnte?«
»Wie lange kennen Sie Josephine Blythe bereits?«
»Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Josephine beschreiben?«
Im Verhörraum der Polizeistation in Charleston antwortete ich auf alle Fragen wahrheitsgemäß, wie ein Roboter, der gespeicherte Daten herunterrasselt. Der Officer strich sich über die breite Brust. Er schien meinen abgehackten Ton, meinen abwesenden Blick für Sorge um meine Freundin zu halten und senkte sofort die Stimme. Dabei war ich in diesem Moment nur eine gute Schauspielerin. Einen Moment lang befürchtete ich, dem Officer mit dem Schnauzbart direkt auf seinen glatt polierten, leer geräumten Schreibtisch zu kotzen. Das Tonband vor mir blinkte rot, wie eine Bombe, deren Zünder schon aktiviert wurde. Dabei war die Granate doch längst hochgegangen. Josie war verschwunden. Seit mehr als vierundzwanzig Stunden fehlte von ihr jede Spur. Und alles, woran ich denken konnte, alles, was ich wissen wollte, war, ob mit ihr auch mein Geheimnis abhandengekommen war oder ob jetzt alles herauskommen würde. Ich wusste nicht einmal mehr, was ich mir wünschte. Eine verschwundene Freundin für ein verschwundenes Geheimnis. Oder ein Geheimnis, das keines mehr war, und dafür Josie, die wiederauftauchte. Josie, die aus meinem Geheimnis eine unerträgliche Wahrheit machen würde.
Der Officer sah mich fragend an, ich hatte seine letzte Frage überhört.
»Bitte, beruhigen Sie sich. Je detaillierter Sie sich an den gestrigen Tag erinnern, desto besser stehen die Chancen, Ihre Freundin wiederzufinden.«
Eine große, schlanke Frau kam herein, stellte ein Glas mit Wasser vor mir ab und reichte mir verstohlen ein Taschentuch. Ich ließ es unangerührt auf dem Tisch liegen und wünschte mir, meine Seele wäre so weiß wie dieses kleine Rechteck vor mir. Mein Kopf fühlte sich schwer an. Meine Hände verspannt, die Haut rissig und trocken. Trocken wie meine Wangen. Denn weinen würde ich nicht. Niemals. »Versuchen Sie es«, sagte der Officer noch einmal.
Und ja, ich versuchte es. So sehr, dass ich die Hitze spüren konnte, für die meine helle Haut nicht gemacht war. Ich sah vor meinem inneren Auge Avery, die mit ihren Blicken nach Jake suchte. Oder nach Josie. Vielleicht auch nach beiden. Avery, die sich auf die Zehenspitzen stellte und in Richtung Bar stierte. Ich konnte mir den feinen Schweißfilm auf Lees Stirn vorstellen, spürte, wie sich meine Mundwinkel unwillkürlich zu diesem dünnen, bösartigen Lächeln spannten, wenn ich an Josie dachte. Ich schmeckte den süßlichen Rauch des Haschischs noch auf meiner Zunge und bemerkte im Augenwinkel, wie die Absperrbänder leicht im Wind wackelten, bevor aus diesem sanften Wogen ein lautes Rascheln wurde. Die Bänder waren später gerissen, als wollten sie uns sagen: So geht es euch jetzt auch. Mit dem Unterschied, dass ich mein Band zu den Mädchen schon vorher mutwillig durchgeschnitten hatte. Nein, nicht ich war es gewesen, Josie war es. Eigentlich war sowieso alles Josies Schuld.
»Wie meinen Sie das? Was ist Josies Schuld?«, fragte eine tiefe Stimme.
Ich schaute hoch, blinzelte und realisierte, dass ich diesen Gedanken laut ausgesprochen hatte. Ich sah den Officer nicht an, stattdessen blickte ich aus dem niedrigen Fenster in den Innenhof des Charlestoner Polizeigebäudes.
»Das habe ich nicht gesagt«, murmelte ich.
Der Mann seufzte und startete einen neuen Versuch. »Sie waren also alle zusammen bei dem Festival, Miss White. Und Sie haben sich nicht getrennt? Wer hat Miss Blythes Verschwinden zuerst bemerkt? Konzentrieren Sie sich.«
Der gestrige Tag fühlte sich an, als wäre er ein ganzes Leben entfernt, als hätte er auf einem anderen Planeten stattgefunden, als wäre er einem anderen Menschen geschehen. Und gleichzeitig, so paradox es mir selbst erschien, war ich noch immer dort. In einem Paralleluniversum, in dem Josie über die Wiese tanzte, ihr bildschönes Gesicht entrückt, unleserlich, nach innen verspiegelt. Ich schnappte nach Luft und richtete mich auf. Es war gut möglich, dass wir uns überhaupt nie wieder ansehen würden.
Ich holte tief Luft. »Ja, wir waren alle da. Wir haben getanzt, und Josie stand an der Bar, und irgendwann war sie weg. Ich glaube, Avery war es, die zuerst nach ihr gefragt hat.«
»Miss Winter?«
»Ja. Ja, doch, es war Avery, und … Lee hat einen komischen Kommentar dazu abgegeben, von wegen, warum ausgerechnet Avery wissen will, wo Josie steckt. Wo sie sich doch kurz zuvor heftig gestritten hatten.«
Der Officer hob eine buschige angegraute Augenbraue. Er war interessiert. Und ich hatte einen Fehler gemacht.
»Ich möchte jetzt nach Hause. Ich habe Ihnen alles gesagt, was es zu sagen gibt. So wie es aussieht, ist sie einfach abgehauen, oder?«
»Da bin ich mir nicht sicher, Miss White. Wissen Sie, in den meisten Fällen ist nicht alles so, wie es aussieht.«
Nein, das war es nicht. Und es würde auch nie wieder so sein. Wenn Josie verschwinden konnte, dann konnte auch es verschwinden. Es musste einfach.
1
»Es wurde eine Frau gefunden, am Moss Lake.«
Odinas Worte spülen wie Treibsand durch meinen müden Kopf, bleiben nicht haften, werden von Wellen der Angst gedämpft, verzerrt, verlieren sich und verzetteln sich mit anderen Gedanken. Odina hat mich aus dem Schlaf gerissen, ein Blick auf den Wecker auf meinem Nachttisch verrät mir, dass es kurz nach fünf Uhr morgens ist. Während Odina redet, erinnere ich mich an Kirsa Jensen, einen jener ungelösten Vermisstenfälle der letzten Jahre. Sie verschwand beim Ausreiten; und Augenzeugen berichteten, sie mit einem Mann in einem weißen Wagen sprechen gesehen zu haben. Die Ähnlichkeiten zu Josies Verschwinden sind frappierend, auch wenn die Fälle nicht zusammenhängen können. Und doch, jedes Mal wenn ich in meinen weißen Mercedes steige, muss ich an diese beiden verloren gegangenen Mädchen denken, die nie wiederaufgetaucht sind.
Am anderen Ende der Leitung wartet Odina geduldig auf eine Reaktion, während mir alle möglichen Dinge in ungeordneter Reihenfolge durch den Kopf gehen. Ich muss an das Verhör auf der Polizeistation denken, sehe Josies grüne Haarspitzen vor mir, unseren Streit auf der Gästetoilette des Seasons.
»Kannst du das noch mal wiederholen? Bitte, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.«
Odina stöhnt. Nicht ungeduldig, mehr so, als verursachte es ihr große Qualen, den Satz wiederholen zu müssen. »Es wurde eine weibliche Leiche gefunden, am Moss Lake.« Und nach einem kurzen Moment des Schweigens ergänzt sie: »Es könnte Josie sein.«
Meine Brust ist ein tonnenschwerer Betontransporter, meine Beine sind zu schwach, um die Last meines Körpers zu tragen. Die Last einer alten Schuld. All die Vermisstenfälle, die ich über die Jahre verfolgt habe, all die Blogs, die ich gelesen, Erfahrungsberichte von Angehörigen, die ich verschlungen habe. Nichts davon hat mich auf diesen Moment vorbereitet. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich immer geglaubt, dass Josie einfach verschwunden bleiben wird. Wie Kirsa Jensen, Ruth Wilson, Kristin Smart, Conny Converse … Dass Josie gefunden sein könnte, tot in einem morastigen See, scheint wie der Trailer zu einem morbiden Gruselschocker, nicht wie die viel zu brutale Realität.
Odina und ich atmen uns eine Weile durch den Hörer an. Und es hängen viele unausgesprochene Fragen zwischen uns. Ich vermute, dass Avery schon Bescheid weiß. Seit sie auf der Insel ist und Staub aufwirbelt, haben sie und Odina ihre Freundschaft aufgewärmt. Ob Lee auf Hawaii auch eingeweiht ist? Ob es erforderlich ist, dass wir Freundinnen von damals uns zu diesem schrecklichen Ereignis zusammenraufen? Oder ob, wenn es sich wirklich um Josies Leiche handelt, die Vergangenheit damit endgültig und restlos begraben ist.
»Wo bist du?«, frage ich und starre auf meine weißen Fingerknöchel. All das Weiß um mich herum, das glänzende Chrom, die großen blank polierten Fliesen, die streifenfreien Fensterflächen, sind auf einmal zu hell. Zu rein. Sie passen nicht zu einem Moment wie diesem.
»Avery und ich fahren hin.« Sie bittet mich nicht, sie zu begleiten. Dennoch sage ich ohne zu zögern: »Ich komme mit.«
Es ist kein Angebot, sondern eine Feststellung. Dabei würde ich die Worte gerne sofort zurücknehmen. Was will ich da?
»Gut«, sagt Odina, dann legen wir auf. Und atmen vermutlich beide erleichtert aus. Ich muss sie nicht begleiten. Ich will nicht einmal. Niemand zwingt mich, über die Brücke raus auf die vorgelagerten Inseln zu fahren und diesen vermaledeiten See aufzusuchen. Ich gehe wie ferngesteuert in mein Ankleidezimmer, ziehe eine Bluse und Jeans heraus, schlüpfe hinein und greife nach dem Autoschlüssel. Ich aktiviere die Alarmanlage, stelle die Klimaanlage auf 64° und schließe die Tür hinter mir. Draußen fährt ein kühler Windhauch über meine Haut. Ich hätte eine Jacke überziehen sollen, überlege kurz, umzudrehen, entscheide mich aber dagegen. Es ist so früh, dass der morgendliche Nebel sich noch nicht verzogen hat und sich wie ein hauchzarter Schleier bis zum Strand zieht, wo er über dem Meer verschwindet, um eins mit ihm und den Wolken zu werden, einem endlosen Nichts aus tiefem Blau. Dahinter lauert ein warmer, sonniger Tag. Auf der Treppe hinunter zum Carport vor dem Haus muss ich mich am Geländer festhalten. Meine Gedanken sind ebenso vernebelt wie die Umgebung. Sie finden keinen Halt zwischen damals und heute. Zwischen einem desaströsen Abend, der nur die konsequente Folge viel verhängnisvollerer Dinge gewesen ist, und diesem Leben danach, in dem ich mich eingerichtet habe. Ich bleibe stehen, drehe die Schlüssel in den Händen und will schon umkehren, als ein verdrängtes Bild vor meinem inneren Auge erscheint. Die Umrisse eines großen, breiten Mannes mit dunklem Schnurrbart und getönter Brille. Ich will schreien, aber es gelingt mir, den Impuls zu unterdrücken, indem ich mir den Autoschlüssel so fest in die Handfläche drücke, dass es einen Moment lang nicht möglich ist, zu denken. Dann sind sie verschwunden. Der Mann und der Impuls. Mit zitterigen Beinen erreiche ich den Carport, steige in den Wagen, schaffe es beim dritten Versuch, ihn zu starten, und fahre langsam aus der Einfahrt. Und würge prompt den Motor ab.
»Du bist heute besonders früh dran! Dabei wollte ich gerade loslegen«, höre ich meinen neuen Nachbarn gut gelaunt rufen. Ich drehe mich nur weit genug, um zu erkennen, wo er steht. Ansehen will ich ihn nicht. Er lehnt vor dem klapprigen, rostigen Tor seiner Garage, die er seit Tagen geräuschvoll entrümpelt. Ich will den Wagen wieder starten, aber Preston ist noch nicht fertig.
Es gibt Tage, an denen hasse ich es, ein Cabrio zu fahren. Genau genommen hasse ich es, seit Preston Anderson vor zwei Wochen das heruntergekommene Strandhaus neben mir bezogen hat. Er wird nicht müde, mich ständig anzusprechen. Genauso lange verzichte ich darauf, etwas zu entgegnen. Warum sollte ich mit jemandem reden, dem die Umwelt hier offenbar so vollkommen egal ist? Der sich nicht die Mühe macht, die Nistplätze zu erhalten, sondern brütende Vögel vertreibt, indem er pausenlos Lärm macht, rücksichtslos Bäume abholzt, damit er bequemer mit dem Wagen in die Einfahrt kommt, und so oft den schmalen Pfad hoch- und runtergefahren ist, dass kein einziges Grashälmchen mehr wächst.
Ich hatte gehofft, er würde irgendwann aufhören, Small Talk mit mir führen zu wollen. Anfangs hat er mich noch nach meinem Tag gefragt, das Cabrio bewundert, mir seine nachbarschaftliche Hilfe angeboten und dabei geflissentlich die Tatsache ignoriert, dass ich ihm bei unserer ersten Begegnung mit einem verachtenden Blick klargemacht habe, dass ich nicht an freundschaftlichen Nachbarschaftsverhältnissen interessiert bin. Schon gar nicht mit jemandem, der mir das Haus vor der Nase weggeschnappt hat und verhindert, dass die Wildpferde sich aus ihrem Rückzugsgebiet im Westen der Insel heraustrauen und das Grundstück als Weidefläche nutzen. Seit ihm klar ist, dass ich nicht mit ihm rede, fragt er erst recht. Er hasst mich, ich hasse ihn. Uns unterscheidet dabei nur, dass ich einen Grund für meine Abneigung habe. Ich drücke das Gaspedal durch, ein wenig zu fest für den vom Rasensprenger nassen Asphalt, und biege mit quietschenden Reifen aus unserer geteilten Zufahrt auf die Straße, die parallel zum Strand in Richtung Brücke führt.
Spätestens als ich an den Glasfassaden des Seasons vorbeifahre, habe ich Preston vergessen und denke wieder an Kirsa Jensen. Sie wurde zuletzt am 1. September 1983 an der Mündung des Tuaekuri River gesehen. Blutverschmiert. Ihr Gesicht, das ich aus den Vermisstenanzeigen kenne, mischt sich mit dem von Josie. Kirsas Locken werden zu Josies glattem blondem Haar. Kirsas runde Gesichtsform verwandelt sich in Josies spitzes Kinn. Was, wenn es wirklich Josie ist, die verwest im Wasser liegt? Seit verfluchten zehn Jahren. Wie sieht ein Körper aus nach all dieser Zeit? Wird man gleich erkennen, dass sie es ist? Werden Odina, Avery und ich sie identifizieren müssen? Ich versuche, mich auf die Straße zu konzentrieren. Auf der Brücke herrscht für die Tageszeit viel Verkehr. Ob jetzt die halbe Insel zum Moss Lake fährt, um nachzusehen, was passiert ist? Was mache ich hier eigentlich? Ich könnte dort vorne auf der Bike Lane wenden und wieder zurückfahren. Könnte früher mit der Arbeit anfangen, die Schichteinteilungen für die nächste Woche durchsehen oder den Termin mit dem Berater für die neue Website vorverlegen. Ich könnte zurück zum Haus fahren, Sportklamotten anziehen und ein morgendliches Work-out einlegen. Bis zum Outdoorgym am alten Hafen laufen und mich an der Klimmstange unter der amerikanischen Flagge hochziehen und die Gedanken an Kirsa Jensen und Josie Blythe aus meinem Körper trainieren. Oder ich rufe Aiden an. Aiden steht zu fast jeder Tageszeit zur Verfügung, sofern er nicht gerade durch ein Schwimmbecken krault. Und es würde helfen, ganz bestimmt. Wenn auch nur kurz. Weil auf jedes Treffen mit Aiden ein ekelhaftes, falsches Gefühl folgt.
Statt zu wenden, fahre ich weiter und weiter, biege nach der Brücke zum Marschland ab, dorthin, wo die brüchigen Straßen in Regenzeiten so stark überschwemmt werden, dass sie unbefahrbar sind. Links und rechts der Fahrbahn wächst das Schilfgras wie Unkraut. Es ist so dominant, dass es andere Wildkräuter und Gräser verdrängt hat. Ein Teil des Gebietes rund um den Moss Lake ist wegen der Schilfrohre trockengelegt, weil sich zwischen den dichten Halmen zu viel Schlamm sammelt.
»O Mann, Isa, du und deine Flora-Fauna-Botanik! Wir haben das nachher sowieso wieder vergessen.«
Ich zucke zusammen. Josies Stimme hallt so laut und bedrohlich durch meinen Kopf, dass ich einen Moment lang unaufmerksam bin. Ohne es zu merken, reiße ich das Lenkrad nach links und bremse gleichzeitig. Ein entgegenkommendes Auto hupt wütend, und ich begreife, dass ich gefährlich weit in den Gegenverkehr hineingerutscht bin. Hastig ziehe ich zurück in meine Spur. Eine Thermosflasche, die ich nach dem Training im Auto vergessen habe, donnert durch den Fußraum. Das Geräusch hat fast den gleichen Effekt wie Josies Stimme in meinem Kopf. Ich muss an den Tag denken, an dem wir den Sandhai gefunden haben und Lee Josie ins Gesicht geschlagen hat. Hätte ich mich doch nur nicht ins Auto gesetzt. Wenn die Fahrt zum Fundort einer unidentifizierten Leiche mich schon so durcheinanderbringt, was geschieht dann erst, wenn es tatsächlich Josie ist, die dort liegt?
Ich darf mich damit nicht verrückt machen. Die Finger fest um das Lenkrad gekrallt, nehme ich bewusst den unbefestigten Nebenweg zum Moss Lake. Die Entscheidung stellt sich als goldrichtig heraus. Bereits aus der Ferne sehe ich die blauen Lichter der Polizeiwagen, die den nebelverhangenen See gespenstisch beleuchten. Unter den Rädern meines Mercedes knirscht der Kies. Auf dem offiziellen Anfahrtsweg stauen sich die Autos. Rettungswagen, Einsatzfahrzeuge und die ersten Schaulustigen. Ich reibe mir instinktiv über die Gänsehaut an den Unterarmen.
Am Ufer halte ich an. Wenige Fuß von meinem Wagen entfernt watet ein Mann im Taucheranzug durch das Schilf. Er wirft mir einen kurzen Blick zu, beugt sich nach vorne und übergibt sich. Eilig wende ich mich ab, um nicht wie eine Gafferin zu wirken. Das Seeufer ist mit gelb-schwarzen Absperrbändern gesichert. Ein Trigger für meine Erinnerung. Sofort ist wieder alles da. Klick, als hätte ich ein altes Video gestartet. Das Festival, klick – Josies Haare im Wind, klick – das Rascheln der Werbebanner, wie sie sich im Wind spannen und bauschen. Alles ist so plastisch, dass ich mich gerne dem Mann mit dem Taucheranzug anschließen und meinen leeren Magen auf links stülpen möchte. Neben mir parkt ein schwarzer Dodge, und ich schaue rüber … nein … doch … ich blinzele. Da sitzt Avery neben Odina, und ich sehe ihr direkt durch die Scheibe ins Gesicht. Natürlich war zu erwarten, dass sie hier ist. Schließlich hat Odina mich angerufen, aber dennoch geht mir der Anblick der beiden Freundinnen durch Mark und Bein. Meine Fingerspitzen kribbeln, ich will wegschauen, aber ich kann nicht. Avery hat Tränen in den Augen.
Klick. Ich sehe uns alle auf unseren Brettern in den Wellen schaukeln, fünf Freundinnen in einem längst vergangenen Leben, und ein Lächeln stiehlt sich unweigerlich auf mein angespanntes Gesicht. Ich bekomme es nicht rechtzeitig in den Griff. Avery hat es schon gesehen, Odina ebenfalls. Beide erwidern es überschwänglich. Sie interpretieren mein Lächeln völlig falsch. Das ist kein Zeichen von Verschworenheit, Sisterhood, Freundschaft 2.0 oder irgendeinem anderen Bullshit. Es ist ein Lächeln, das der Vergangenheit gehört.
Ich weiß, was sie beide denken, wenn sie meinen Wagen sehen. Was Odina jedes Mal durch den Kopf geht, wenn sie zu ihrer Schicht ins Seasons kommt. Warum hat sie sich Josies Traumwagen gekauft? Und irgendwann werde ich ihnen erzählen, dass es nie Josies Traumauto war, sondern meines. Ich verehre es nicht wegen Grace Kelly, sondern wegen der Zwillinge vom Zillertal. Einem jener alten deutschen Heimatfilme, die wir in einem Sommer aus Spaß mit Avery angesehen haben und in deren heile Welt ich mich verliebt habe.
So war das mit Josie. So war das schon immer. Manchmal hat sie sich einfach Anekdoten geklaut, Fetzen aus anderen Leben, Ideen und ganze Geschichten, und sie zu ihren eigenen gemacht. Vielleicht weil sie viel langweiliger war, als sie zugeben wollte. Wahrscheinlich ist es seltsam, dass ich jetzt diesen Wagen fahre, von dem meine Freundinnen glauben, es wäre Josies Auto gewesen, wenn sie noch lebte. Aber ist es nicht viel seltsamer, dass Josie mir diesen Traum gestohlen hat?
Avery und Odina haben offenbar zu ihrem blinden Verständnis von früher zurückgefunden. Ich kann das nicht. Es war ein Fehler, herzukommen. Ich werde nicht aussteigen. Ich werde umkehren.
2
Als ich eineinhalb Stunden später zu meinem Haus zurückkehre, stelle ich fest, dass sich in der Garageneinfahrt meines Nachbarn ein riesiger Berg Müll angehäuft hat. Beide Anwesen, seines und meines, teilen sich den letzten Teil der Zufahrt am Ende einer Sackgasse, dahinter befindet sich nur noch breiter Sandstrand. Mein Haus ist ein Meisterwerk moderner Architektur, Prestons Bruchbude ist auch ohne die alten Fahrräder, rostigen Gartenwerkzeuge und das marode Boot vor der Garage ein Auswuchs von 70er-Jahre-Hässlichkeit. Leider kann man das von ihm selbst nicht sagen. Ich schätze sein Baujahr auf die späten Achtziger. Abgesehen von einigen Details, unter anderem seinem Charakter, könnte er attraktiv sein.
Als ich aus meinem Mercedes steige, bückt er sich gerade über eine Tonne Altöl, und ich erhasche einen ziemlich guten Blick auf seinen Hintern. Knackig, fest, in engen Jeans. Dazu trägt er eines dieser weichen Holzfällerhemden mit gesticktem »JBM« auf der Brust, die er offenbar in Hülle und Fülle und allen erdenklichen Farbkombinationen besitzt. Preston dreht sich um, seine ölverschmierten Hände lassen mich unwillkürlich eine Grimasse ziehen. Er hat ein schönes Gesicht. Ebenmäßige Haut, markante Kieferknochen, einen etwas zu breiten Nasenrücken, hübsche volle Lippen. Meistens verstecken sich seine Augen hinter einer Sonnenbrille, aber heute klemmt sie in der Brusttasche des rot-blau karierten Hemds. Sie zwinkern mir zu, ohne dass er sie bewegt, diese Augen. Ich starre ihn schon viel zu lange an. Frage mich, wie ungerecht die Natur sein kann, einem solchen Scheusal ein so schönes Gesicht und so dichtes dunkelblondes Haar zu verleihen.
»Ehrliche Arbeit«, ruft er mir zu. »Davon verstehst du nichts.« Er macht eine wegwerfende Geste in Richtung meiner Strandvilla. Ich finde ihn bereits deutlich weniger attraktiv. Auf meinen Lippen breitet sich mein tödlichstes Lächeln aus – das Lächeln, das Avery immer als »die Hyäne unter den Gesichtsausdrücken« bezeichnet hat. Bei dem Gedanken muss ich beinahe laut lachen. Das hat gerade noch gefehlt.
»Wen musstest du eigentlich schmieren, um für diesen Protzklotz hier die Baugenehmigung zu bekommen?«, fragt Mr. Unausstehlich und grinst mich an.
Das ist das Gute an ihm. Er lässt einem gar keine Chance, darüber nachzudenken, ob man sich womöglich doch in ihm getäuscht hat. Es ist offensichtlich, was er ist: ein arroganter, nervtötender Mann, der nicht hinter die Fassade der Dinge sehen kann. Denn wenn er das könnte, wüsste er, dass mein Protzklotz nicht nur ein ansehnliches Haus ist, sondern vor allem ein Muster für umweltbewusstes Bauen. Ich schlucke meine Antwort hinunter. Das könnte ihm so passen, dass ich jetzt auch noch reagiere. Ich kann sehr gut schweigend gemein sein. Das hab ich von meiner Mutter gelernt, sie ist Meisterin darin, eine Menge zu sagen, ohne auch nur den Mund aufzumachen.
»Dann fang ich mal mit der Rüttelplatte an«, sagt er und deutet auf ein dick mit Staub bedecktes Gerät. Ich frage mich ernsthaft, ob er beabsichtigt, damit einfach den ganzen Schrott plattzumachen und ihn an Ort und Stelle liegen zu lassen.
»Die Rüttelplatte ist ziemlich laut«, fügt er unnötigerweise hinzu. »Ich hoffe, die Wände deines weißen Ausstellungswürfelchens fangen nicht an zu wackeln.«
Mein Würfelchen hat knapp dreihundertfünfzig Quadratmeter, nicht weil ich sie brauche, sondern weil unsinnige Bauvorschriften sie mir auferlegt haben; einen atemberaubenden Blick aufs Meer und, natürlich … eine einsame Bewohnerin. Ich beiße mir auf die Lippe, bis es schmerzt. Noch einmal atme ich tief ein und lasse die Wut meine Luftröhre hinuntersausen. Vielleicht ersticke ich demnächst an meinen runtergeschluckten Worten, aber auf gar keinen Fall werde ich diesem billigen Fixer-Upper-Verschnitt noch mehr Angriffsfläche bieten, als das Flachdach meines Bauhausstil-Bungalows es schon tut. Ich werde ohnehin nicht lange hier sein, nur duschen, mich umziehen und dann ins Hotel fahren. Ich hätte dem ungehobelten Kerl von nebenan gerne gesagt, dass ich meine Arbeit liebe, wenn ich denn mit ihm reden würde. Und auch, dass es mir ziemlich egal ist, womit er heute die Umgebung zur Verzweiflung treibt.
»Nur zu!«, sage ich genervt und drehe ihm den Rücken zu.
»Was war das? Eine Antwort?«, ruft er mir hinterher. Ich kann sein selbstzufriedenes Grinsen durch meinen Rücken hindurch radioaktiv strahlen spüren, höre den Triumph in seiner Stimme.
Zwei Worte nur, die mir rausgerutscht sind. Zwei Worte, und er hat, was er wollte. Ich ärgere mich so über mich selbst, dass ich Lust habe, trotzig mit dem Fuß aufzustampfen.
»Es könnte sein, dass ich morgen für ein paar Stunden Strom und Wasser abstellen muss«, sagt er dann. Bilde ich mir das ein, oder klingt es fast schon entschuldigend? »Wann würde es dir denn passen? Gleich frühmorgens? Sechs, halb sieben?«
Ich drehe mich nicht um, hebe nur die Hand und mache eine gleichgültige, wegwerfende Bewegung und wünschte, ich könnte eines von Maceys frechen Schildern hochhalten. Kiss my ass würde ganz gut passen. Noch einmal wird er keine Antwort von mir bekommen.
Drinnen fahre ich mit der Hand über den weißen Marmor des Küchentresens, als müsste ich überprüfen, ob Devina auch wirklich ordentlich Staub gewischt hat. Dabei tut sie das immer. Devina ist ein »Prestigegeschenk« meiner Eltern. Ich habe eine Haushaltshilfe, die mir so treu ergeben ist, dass sie mir ungefragt Proteinshakes kauft und unbezahlte Überstunden macht. Ich schäme mich dafür. Meine Eltern halten es für angemessen, als Hotelchefin eine Haushälterin zu haben. Ich halte es für unnötig, prätentiös, und seit Preston hier wohnt, ist es mir zudem höchst peinlich. Zumindest kann er den Whirlpool von seinem Grundstück aus nicht sehen. Mein Handy klingelt, und ich ziehe es aus der Tasche, während ich den breiten zweiflügligen Kühlschrank öffne. Ich erwische mich dabei, mir zu wünschen, statt penibel aufgereihter Luxuslebensmittel darin einen alten Joghurtbecher zu sehen. Mit einer Nachricht darauf, wie in der Werbung. Meiner, bloß nicht essen. Herzchen. Aber alles hier gehört mir. Die Shakes, die Joghurts, die Einsamkeit.
Am anderen Ende der Leitung ist meine Schwester Suzanna. »Hi, Izzy«, sagt sie. Während ich nach draußen sehe, über die schwarze Ledercouch hinweg durch die breite Fensterfront auf den Ozean, frage ich mich, wie und warum meine ältere Schwester diesen Ort hier gegen Ashland, Oregon, eintauschen konnte, das in etwa so unspektakulär und farblos ist wie sein Name.
»Hey, Suzy. Alles in Ordnung dort drüben auf der anderen Seite des Landes?«
Suzanna lacht ihr herzliches Lachen, das einen von innen heraus wärmt. Doch lange kann ich mich nicht daran erfreuen, denn just in dem Moment, in dem Suzy loslacht, startet draußen das Höllengerät meines teuflischen Nachbarn. Es dröhnt, als versuchte er, einen Tunnel unter meinem Haus hindurch zu graben. Ich halte mir das andere Ohr zu, schlucke den Ärger hinunter und konzentriere mich auf Suzy.
»Aber klar!«, sagt sie gerade, oder etwas in der Art. »… mal, … ist … bei euch los? … heute Morgen in den Nachrichten … dass eine Leiche im Moss Lake …?«
Jedes zweite Wort meiner Schwester wird von diesem Rüttelding platt gewalzt.
»Ja«, schreie ich. Meine Stimme klingt piepsiger als beabsichtigt. »Man weiß noch nichts Genaues. Vermutlich eine Obdachlose oder jemand aus dem Trailerpark.«
Dass niemand auch nur annährend so etwas angedeutet hat, verschweige ich.
»Das klingt so, als würden nur Menschen aus ärmeren Verhältnissen in so eine Lage geraten …«, gibt Suzanna missbilligend zu verstehen. Die Rüttelplatte verstummt plötzlich, wodurch der Satz in seiner vorwurfsvollen Gänze in meinem Verstand landet und laut nachhallt. Ich antworte nicht. Sie hat ja recht. Ich schließe den Kühlschrank und schaue aus dem Fenster. Da draußen steht er, Mister Do-it-yourself, und beugt sich über die Baumaschine, zieht einen Hammer aus der seitlichen Tasche seiner Hose und klopft auf dem Deckel herum. Ich verspüre ein kurzes Gefühl von Triumph. Hoffentlich gibt das Ding ganz den Geist auf. Bei Suzanna im Hintergrund klimpert es dezent. In Oregon ist es jetzt fast Mittag. Sie wird für vier ihrer fünf Kinder kochen und warten, dass ihr Mann Andrew aus der Werkstatt ins Haus kommt. Suzanna ist in allem der pure Gegensatz zu mir. Sie wäre der Typ, der dem neuen Nachbarn ein Brot und Salz zum Einzug vorbeigebracht hätte und wahrscheinlich längst lachend mit Gummihandschuhen seine Fenster schrubben würde. Suzanna ist warm, ich bin kalt. Und das, obwohl wir in exakt dem gleichen Klima aufgewachsen sind, unter dem strengen Regiment von Rhonda White, die wir Schwestern schwarzhumorig »Mama Alaska« nennen.
Suzanna erkundigt sich nach Hailey, ihrer mittleren Tochter, die sich wegen ihrer Lungenprobleme ein paar Wochen in Seeluft auf Harbour Bridge ausruht und derzeit im Haus meiner Eltern in Charleston wohnt, auch wenn ich versuche, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Während Suzy gerade etwas von einer Preiserhöhung erzählt, die Andrew zu schaffen macht, beginnt der Lärm erneut. Dieses Mal nützt es auch nichts, meinen Finger ins Ohr zu stecken, und ich verspüre den Drang, einen gewissen anderen Finger aus dem Fenster zu zeigen. Vermutlich würde das die Nervbacke nur weiter anstacheln. Also bewahre ich Ruhe und kann Suzy halbwegs folgen, als sie erzählt, dass Melissa, ihre älteste Tochter, unbedingt Latein lernen will, weil sie von einer Fernsehserie, die im alten Rom spielt, fasziniert ist. Sie schließt ihren Familienbericht – unterbrochen vom Dröhnen von Prestons Gerät – mit Connor, der zum dritten Mal an Windpocken leidet, was doch eigentlich ausgeschlossen sein sollte. Ich wechsele das Zimmer, entferne mich so weit wie möglich von Prestons Hof und dem Lärm, aber es hilft nichts. Mit jeder Sekunde, die ich mich anstrenge, um Suzy zu verstehen, wächst meine Wut.
»Was ist denn das für ein Krach bei dir?«, fragt sie schließlich, nachdem ich zum dritten Mal nachhaken muss, weil mir ganze Satzfragmente entgangen sind.
»Das ist der Idiot von nebenan. Warte kurz, ich kläre das«, sage ich. Ich stapfe in die Küche, lege das Telefon auf die Ablage und reiße das Fenster so hastig auf, dass mir dabei die kleine Orchidee im Übertopf entgegenkippt. Im letzten Moment fange ich sie auf und möchte sie aus Zorn Preston an den Kopf werfen, der draußen seelenruhig mit Ohrenschützern seine Rüttelplatte vor sich herschiebt wie einen Kinderwagen.
»Hey!«, brülle ich. »Hey!«, noch lauter, als er nicht reagiert.
Ich bilde mir nicht nur ein, dass er mir einen kurzen Blick zuwirft und schnell wieder wegsieht, ich bin mir sehr sicher, dass das hier Absicht ist. Ich betrachte den Topf, und wäre er nicht ein Geschenk meiner Nichte zu meinem letzten Geburtstag, würde ich ihn opfern, um ein nachbarschaftliches Exempel zu statuieren. So aber schließe ich mit einem lauten Fluch das Fenster, nehme das Telefon wieder und drücke es fest an mein Ohr.
Ich gehe durch mein Haus und lausche dem lebendigen Treiben bei meiner Schwester, untermalt von Besteckklimpern, Hundegebell und gedämpften Flüchen. Dabei höre ich umso lauter, wie leise es bei mir ist, obwohl Preston da draußen so einen Lärm veranstaltet wie eine ganze Baustellenmannschaft. »Du denkst daran, dass du Hailey heute Abend Kino versprochen hast? Aber wenn du wegen der Leiche … also wenn du …«, sagt Suzanna. Sie stockt, und diesmal liegt es nicht daran, dass ich sie nicht verstehe. Ich weiß aber auch so, was sie sagen will.
»Es ist ganz bestimmt nicht Josie«, sage ich.
»Ja, ganz sicher nicht. Natürlich nicht«, erwidert Suzanna eine Spur zu schnell.
»Ich werde mit Hailey ins Kino gehen, ich hab’s ihr ja versprochen.«
Kaum habe ich aufgelegt, schnappe ich mir meinen Haustürschlüssel und renne nach draußen. Meine Schritte erinnern mich unwillkürlich an Hailey, wenn sie sauer auf eines ihrer Geschwister ist. Allerdings ist der Einzige, der sich hier kindisch benimmt, ein Holzfällerhemden tragender Vollhonk namens Preston Anderson.
»Hey«, brülle ich, aber er reagiert wieder nicht. Ich möchte nicht vor das Gerät laufen, es sieht aus, als hätte es einen ziemlich langen Bremsweg. Also nähere ich mich ihm von hinten und boxe ihm unsanft gegen die Schulter, als ich auf seiner Höhe bin. Er zuckt kein bisschen, er dreht sich nicht einmal um. In Zeitlupe streckt er die Hand aus und bringt das dröhnende Ding zum Stehen.
»Ja, bitte? Was kann ich für dich tun?«
»Was soll die Scheiße?«, schreie ich. Ein wenig zu laut, jetzt, da es still geworden ist.
»Hm?«
»Was die Scheiße soll, man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr!«
»Und?«, sagt er mit einer lächerlich schlecht gespielten Unschuldsmiene.
Die Hände in die Seiten gestemmt, baue ich mich vor ihm auf.
»Das fragst du noch?«
»Ja, wieso musst denn du dein eigenes Wort verstehen? Führst du Selbstgespräche?«
»Nein, ich …«
»Na, dann ist ja gut«, erwidert er, und ehe ich mich’s versehe, hat er den Schalter nach vorn gelegt und schiebt sein Männerspielzeug wieder vor sich her. Ich hätte das mit dem Blumentopf machen sollen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als ihm mit schnellen Schritten nachzulaufen und ihn mit wilden Gesten erneut aufzuhalten.
»Ist noch was?«
»Ich brauche Ruhe!«, kreische ich.
»Ich nicht«, kontert er ungerührt. Dann sieht er an mir hinab und bleibt an meinen flachen Sandalen hängen.
»Ich an deiner Stelle würde aus dem Weg gehen oder mir Sicherheitsschuhe anziehen, wenn du helfen willst.«
»Helfen?« Ich fasse es nicht.
»Du kannst auch gerne wieder reingehen und dir die Nägel lackieren.« Er lächelt, als hätte er mir gerade ein Friedensangebot gemacht.
»Wenn ich von der Arbeit komme, ist Schluss mit dem Lärm«, brülle ich und fuchtele drohend mit dem Zeigefinger vor seinem Gesicht herum. Zu spät merke ich, dass ich diese Runde verloren habe. Prestons Augenbraue zuckt amüsiert. Eins zu null für ihn. Aber wir sind noch nicht fertig miteinander, das Spiel hat gerade erst begonnen.
Nach einigen Stunden an der Rezeption des Seasons, die ich mit einer Jobannonce für einen neuen Koch, der Beauftragung für eine Reparatur der Klimaanlagen im dritten Stock und der Organisation des diesjährigen Mitarbeiterfests verbracht habe, ist Preston erfolgreich in die hintersten Winkel meiner Gedanken verbannt. Und ich bin fest entschlossen, ihn dort zu lassen.
Das Beste an meinem Job ist ohnehin, dass er so fordernd ist, dass ich wenig Zeit zum Nachdenken habe. Genau deswegen bin ich noch hier, nicht weil ich eine genetisch bedingte Liebe zum Hotelgewerbe hege, wie meine Eltern glauben. Nicht, weil es mir Spaß macht oder ich besonderes Talent dafür habe. Was würde meine Mutter wohl dazu sagen, dass ich manchmal davon träume, das Seasons mit den Waffen der Insel zu zerstören? Regelmäßig fantasiere ich davon, wie das Seasons die Hotelversion von Atlantis erleidet. Wie es langsam von den Fluten umspült und von Plankton überzogen wird und äußerlich unversehrt im Meer versinkt. So groß wie ein Kreuzfahrtschiff, hässlich, wuchtig, scheinbar unverwüstlich. Anstelle von Immobilienpiranhas würden echte Fische die Lobby bevölkern, angriffslustige Zitronenhaie den Westflügel übernehmen, Wasserschnecken auf dem Marmorboden ablaichen und Seewespen in den Blumentöpfen auf naive Opfer lauern.
Ich beschließe den Tag damit, Kenzies Arbeit zu überprüfen. Die Rezeptionistin hat Schweißflecken unter den Armen. Nicht weil sie heute schon so viel gearbeitet hat, sondern weil sie Angst vor mir hat.
»Ich benötige die Reservierungen sofort«, erkläre ich und versuche, den mühsam antrainierten arroganten Unterton einzusetzen. Kenzie darf nicht wissen, dass ich selbst vergessen habe, die Buchungen von der Website durchzusehen. Es muss am Dienstag oder am Mittwoch letzter Woche passiert sein, als ich in Charleston war, offiziell, um dort »ein ernstes Wörtchen« mit unserem Fischlieferanten zu sprechen. Inoffiziell, weil ich Professor Holbecks Vorlesung zu aquatischer Toxikologie nicht hatte versäumen wollen. Und nun kann es gut sein, dass die Zimmer im Westflügel überbucht sind und ich umdisponieren muss.
Ich muss dieses Problem dringend lösen, bevor Hailey kommt. Ob ich den Kinoabend noch einmal verschieben kann? Wenn ich nicht das enttäuschte Gesicht von Hailey vor mir sähe (und das von Suzanna, die die Gefühle meiner Nichte stets wie ein verdammtes Spiegelkabinett reflektiert), würde ich noch bis Mitternacht weiterarbeiten. Um meine eigene, bisweilen durchscheinende Organisationsunfähigkeit wettzumachen.
Kenzie reicht mir eine Liste, auf der sie versehentliche Doppelbuchungen mit einem gelben Leuchtstift markiert hat. Ich überfliege die Liste hastig, wobei ich die Buchungen für die Suiten im Ostflügel, die nicht betroffen sind, streiche. Ich bleibe hängen. An der Nummer der Suite, die vor Kurzem noch von Avery und ihrer Band gebucht war. Vielleicht hätte ich verhindern sollen, dass Avery im Hotel absteigt, Odina ihr Nachrichten hinterlässt … Dass Avery wieder hier ist, ist nicht nur eine potenzielle Gefahr. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass sie ein akutes Risiko darstellt für etwas, das chronisch in mir brodelt.
»Der Wahnsinn, dass Force of Habit bei uns abgestiegen sind, oder?«, plappert Kenzie. »Ich liebe ja vor allem das erste Album. Wie hieß das gleich?«
»Soulsystem«, murmele ich. Ich kenne nicht nur die Namen aller Songs und Alben, sondern von den meisten Songs sogar die Texte. Schließlich hat Avery einige davon hier auf der Insel geschrieben.
Ich muss mich am Tresen festhalten und meine Augen fest zusammenkneifen, damit die Bilder nicht hochkommen.
»Alles in Ordnung?«, fragt Kenzie besorgt und berührt mich an der Schulter. Ich schüttele sie ab. Erschrocken weicht sie einen Schritt zurück.
Abrupt drehe ich mich um und drücke der verdutzt dreinsehenden Kenzie die Liste wieder in die Hand. »Kümmere dich bitte darum.« Dann stürze ich hinterm Tresen vorbei zu den Mitarbeitertoiletten. Meine Hände auf die Steinplatte vor dem Waschbecken gestützt, schaue ich in den Spiegel. Ich bin blass, bleicher noch als sonst, und diese Linien links und rechts von meinem Mund haben sich inzwischen so fest in die Haut gedrückt, dass sie aussehen, als würden sie mich mit Gewalt davon abhalten, glücklich auszusehen.
3
Fünfzehn Jahre zuvor
»Gefällt dir, was du siehst?« Suzannas Stimme kam aus dem Nichts, ich zuckte heftig zusammen und konnte in dem großen bodentiefen Spiegel unseres gemeinsamen Badezimmers beobachten, wie mein Gesicht seine Farbe veränderte. Der Fluch heller Haut, auf der man Scham sofort erkennen konnte.
Meine Schwester legte mir die Hand auf die Schulter. Sie musste sich dafür ein wenig strecken. Obwohl Suzanna fünf Jahre älter war, hatte ich sie längst an Körpergröße überholt. Sie scherzte, sie würde eben eher in die Breite gehen. Ich kannte keinen Menschen, der auf so eine positive Art mit sich selbst zufrieden war.
Ich betrachtete ihr liebes Gesicht im Spiegel, die Stupsnase, die hellen, geschwungenen Augenbrauen, ihr krauses rotblondes Haar, das sie von unserem Vater hatte, und ihre reine, ebenmäßige Haut, die in der Sonne rot wurde statt braun. Eine unserer wenigen äußerlichen Gemeinsamkeiten. Suzanna wartete geduldig auf meine Antwort, streichelte über meinen Nacken. Es hatte etwas Cartoonhaftes, wie wir hier nebeneinanderstanden – die kleine, rundliche, rothaarige Suzy und ich, die groß gewachsene, schlanke Blondine.
»Was denkst du? Gefällst du dir?«, fragte sie, und ich sah im Spiegel, wie sie ihren Kopf drehte und mich direkt ansah. Die Frage war mir unangenehm. Genauso wie die Tatsache, dass sie mich beim Anstarren erwischt hatte. Man stellte sich nicht einfach minutenlang vor einen Spiegel, um sich selbst anzusehen.
Suzanna holte hörbar Luft. »Erzähl mir mal, was du an dir selbst magst.«
»Ich mag …«, begann ich zögernd. »Meine großen Ohren gar nicht.« Hastig griff ich in meine Haare und schob ein paar Strähnen ins Gesicht.
Suzy streckte ihre Hand aus und strich sie zärtlich hinter mein Ohr. Dann schaute sie mich erwartungsvoll an. »Was du magst, Izzy, nicht, was dir nicht gefällt.«
Noch einmal sah ich mich an. Im Vergleich mit meinen Klassenkameradinnen war ich unscheinbar. Ich hatte kein Talent dafür, mich in Szene zu setzen. Nicht ihre Ausstrahlung, ihr Auftreten … ihr Selbstbewusstsein.
Aber Suzy blieb hartnäckig mit ihren liebevoll auffordernden Blicken. Ich atmete tief ein und sagte leise: »Ich … ich glaube, ich mag meine Nase, sie ist gerade und nicht zu groß und nicht zu klein.«
Suzy lächelte mich ermutigend an. Ich schluckte. »Und vielleicht meine Größe?« Ich war mir nicht sicher, ob es gut war, dass ich so hochgewachsen war, oder ob es weiblicher gewesen wäre, kleiner zu sein.
»Ich mag meine Größe, und du hast alles Recht der Welt, deine zu mögen. Warum denn auch nicht?«
Suzanna zwinkerte mir zu.
»Ich habe ganz passable Beine«, stellte ich fest. »Und eigentlich mag ich auch meine Hände, das große Nagelbett … sie sehen schöner aus, wenn sie lackiert sind, als wenn man kleine Finger hat …«
»Du bist wunderschön«, sagte Suzanna und tippte mit ihrem Zeigefinger auf meine Brust. »Von außen, und was noch viel wichtiger ist, von innen. Das darfst du zeigen. Du solltest mit dir, so wie du bist, glücklich sein. Man kann andere erniedrigen, um sich selbst zu erhöhen. Und kurze Zeit hilft das sogar, um sich besser zu fühlen, aber irgendwann schlägt das zurück. Du musst mit dir selbst zufrieden sein, dann hast du es gar nicht nötig, dir über andere Gedanken zu machen.«
Mit diesen Worten stellte sie sich auf die Zehenspitzen und küsste mich auf die Wange.
Ich stand noch eine ganze Weile vor dem Spiegel und fragte mich, ob Suzanna gewusst hatte, dass ich ihre Worte so bitter nötig hatte. Ob sie wusste, wie unsicher ich mich fühlte, seit ich von der staatlichen Junior High School auf die private Ashley Hall gewechselt war. Dort, wo im Gegensatz zur kleinen Inselschule so viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt wurde und ich gerade an meiner Schüchternheit zu scheitern drohte. Als Tochter der Hotelmoguln Rhonda und Alistor White wurde ich innerhalb kürzester Zeit in den Olymp der beliebten Mädchen erhoben. Olive Yates, Laura Sawyer, Lien Nguyen und Amber Calhoun hatten mich dazu auserkoren, die Fünfte in ihrem Bund zu werden. Die vier waren die High Society der Ashley Hall und allgemein bekannt als die LOLAs, basierend auf den Initialen ihrer Vornamen. Ich hatte alles, was man brauchte, um zu den beliebtesten Mädchen der Schule zu gehören: Geld, die richtige Kleidung, eine schlanke Figur und ein hübsches Gesicht. Doch trotz alldem drohte ich an meiner Schüchternheit und inneren Unsicherheit zu scheitern, die mir keiner ansah, außer wenn ich bis in die Haarspitzen errötete. Ich lief Gefahr, meinen Platz an Lien, Olive, Laura und Ambers Seite an eines der vielen Mädchen aus reichen Charlestoner Familien zu verlieren, die sich die Finger danach leckten, zu den neuen Top Vier der Schule zu gehören. Vielleicht hatte Suzy recht, und es würde helfen, mich besser zu fühlen, wenn ich mich den Lästereien der Mädchen aus der Cheerleadergang anschließen würde. Erniedrigen, um zu erhöhen … das klang viel fieser, als es tatsächlich war. In Wahrheit bedeutete es mitmachen, um nicht ausgeschlossen zu werden.
Obwohl ich insgeheim natürlich wusste, dass Suzy mit ihren Worten das genaue Gegenteil beabsichtigt hatte.
Lien stocherte lustlos in ihrem Salat herum, schob das matschige Blatt zur Seite, drückte es zusammen und spießte es auf ihre Gabel. Olive, die neben ihr saß, verzog die Lippen. »Weißt du, wie viele Kalorien diese Soße hat? Wiiiiderlich!«
»Sieh dir Odina an, wie fett sie ist!«, sagte Laura laut, und reflexartig zuckte ich zusammen. Ich hatte mich noch nicht daran gewöhnt, dass niemand vor ihrem Spott sicher war. Und ich wartete auf den Tag, an dem sie erkennen würden, dass ich nur ein Spiel spielte. Dass ihre Gesellschaft mir genauso zuwider war wie Olive die Salatsoße der Schulmensa. Aber offensichtlich kümmerte es die beliebtesten Mädchen der Schule nicht, was ich wirklich dachte, solange ich es nicht laut aussprach. Ich genoss ihren Schutz und ihr Ansehen, während ich gleichzeitig verabscheute, nicht mutig genug zu sein, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich war ungern ihr Anhängsel, aber es erschien mir noch schlimmer, vollständig ausgeschlossen zu sein.
Laura zeigte nun unverhohlen zur Essensausgabe, auf den wohlgeformten Hintern von Odina Bianchi. »Ich wette, sie frisst den ganzen Tag Pasta und Pizza«, fiel Olive ein. »Wiiiiderlich.«
Odina, das neue Lieblingsopfer der LOLAs, drehte sich mit ihrem Tablett zu den Tischen und gab den Mädchen das, was sie sich erhofft hatten. Auf ihrem Tablett befand sich neben einer Diet Coke ein Teller mit einem Burger und Wedges. Ihr Blick traf meinen, und ich hätte gerne gelächelt. Stattdessen sah ich hinunter auf meinen eigenen Teller, auf dem sich ein Apfel einsam fühlte. Auch ohne sie anzusehen, wusste ich, dass Odina mit ihrer gebräunten Haut, den dunklen, glänzenden Haaren und den vollen roten Lippen auf eine Art schön war, die nichts mit vergänglicher Mode, Schmuck oder Make-up zu tun hatte. Vermutlich hatten die LOLAs deshalb Angst vor ihr. Ich blinzelte und sah, wie sie an unserem Tisch vorbeiging, mit erhobenem Kopf, schwingenden Hüften und einem Stolz, den man sich nicht antrainieren konnte, sondern der einem in den Genen liegen musste. Ich hatte Mühe, meine Bewunderung zu verbergen. Bewunderung dafür, wie jemand, der erst wenige Jahre zuvor aus einem weit entfernten Land hierhergezogen und so offensichtlich anders war, dass es sämtliche Konventionen sprengte, sich so selbstbewusst bewegen konnte. Es war, als trüge sie einen dicken Schutzschild, an dem die Gehässigkeiten ihrer Mitschülerinnen einfach abprallten. Im Physikunterricht hatten wir erst kürzlich über die faszinierende Tatsache gesprochen, dass ein Regentropfen, der auf Steinboden traf, in viele kleine Spritzer zerplatzte, während er beim Aufprall auf das Blatt einer Lotuspflanze flach wie ein Pfannkuchen wurde. Odina war ganz eindeutig eine solche Lotuspflanze. Spott konnte ihr nichts anhaben, während er bei Menschen wie mir großen Schaden anrichtete, in alle Richtungen verspritzte und für maximale Unruhe sorgte.
Odina und ich lebten beide auf Harbour Bridge, und wir kannten uns flüchtig. Wir hatten beim Sommerprogramm des Youth Volunteer Corps im gleichen Team Volleyball gespielt und uns bei den gelegentlichen Besuchen unserer Familien in der Kirche zugelächelt. Ich hatte gewusst, dass sie auch auf die Ashley Hall High gehen würde, und gehofft, sie näher kennenzulernen.
Und dann war es anders gekommen. Wir standen plötzlich auf verschiedenen Seiten, hatten eine soziale Grenze zwischen uns, die ich nicht zu überschreiten wagte. Ich wusste, was von mir erwartet wurde. Und auch wenn es mir zutiefst zuwider war, murmelte ich: »Diese Klamotten.« Ich fing im Augenwinkel noch den letzten Zipfel von Odinas zitronengelbem Oberteil und der Leinenhose auf. »Die hat sie aber nicht aus Mailand.«
Lien kicherte gehässig. Ihr anerkennender Blick ging mir durch Mark und Bein, blieb in meiner Magengegend hängen und sorgte für ein seltsames, Übelkeit erregendes Gefühl. »Sieht eher nach Bananenplantage in Sizilien aus«, sagte Amber und lachte.
Ich hätte ihr gerne gesagt, dass das schon rein geografisch betrachtet Unsinn war, aber ich biss mir auf die Unterlippe. Meine Mutter hatte mir mehrmals klargemacht, wie wichtig es war, sich mit den Mädchen gut zu stellen. Lauras Vater saß in irgendeinem Wirtschaftsausschuss, und Liens Eltern hatten Anteile am größten Reiseveranstalter der USA. Es war keine gute Idee, es sich mit ihnen zu verscherzen. Ich wollte keinen Ärger für meine Eltern, vor allem aber wollte ich nicht allein dastehen. Das war die bittere, peinliche Wahrheit.
»Wir fahren über die Feiertage nach Long Island, mein Onkel hat ein Haus in Southampton. Was meint ihr, sollen wir vorher noch mal shoppen gehen?«, erkundigte sich Amber.
Ich nickte geistesabwesend, beobachtete, wie Odina sich allein an einen Tisch setzte und mit Genuss ihren Burger verzehrte.
»Isabella, was habt ihr vor? Wirst du deine einsame Insel übers Wochenende auch mal verlassen? Oder musst du über Thanksgiving Truthähne im Hotel stopfen?«
Ich zuckte zusammen. Laura gefiel es nur zu gut, es so darzustellen, als würde ich persönlich in der Küche des Seasons stehen. Aber Amber sprang mir überraschend bei. »Hast du nicht erzählt, du fährst mit deinen Eltern nach Florida?«
»Ja, wir haben einen Trip nach Tampa geplant«, sagte ich. Ich konnte noch immer nicht ganz daran glauben, dass der Urlaub, den meine Eltern mir und Suzy seit zwei Jahren versprachen, wirklich stattfinden würde. Während Olive und Amber eine hitzige Diskussion anzettelten, ob man in diesem Jahr in den Hamptons auf weiße Kleider oder auf maritime Outfits setzte, hörte ich nur halbherzig zu. Meine Gedanken flatterten von Odina Bianchi zu meinen Eltern und dem unguten Gefühl, dass Suzy und ich wieder auf vergeblich gepackten Koffern sitzen würden, weil unserem Vater in letzter Sekunde irgendein wichtiger Termin dazwischenkam.
Suzanna hatte darauf bestanden, dass wir mitten in der Hotellobby Position bezogen. Auf den gepackten Koffern. Damit wir so aussahen, wie wir uns schon unsere ganze Kindheit fühlten: bestellt und nicht abgeholt. Lästig. Abgelegt. Vergessen. Wie die Gegenstände, die Hotelgäste absichtlich zurückließen, damit sich jemand anderes um ihren Verbleib kümmerte. Verwaschene Bikinis, verbogene Sonnenbrillen, ausgelesene Bücher, zerkaute Zahnbürsten, defekte Sextoys und in einem Fall sogar der Ehering, den sich die Besitzerin partout nicht hatte nachschicken lassen wollen.
»Es ist ein Sit-in«, erklärte Suzy mir und ließ gedankenverloren die Schnalle an ihrem Koffer auf- und zuklappen. Es war ein nervtötendes Geräusch. Heather räusperte sich hinter der Rezeption, wagte aber nicht zu verlangen, dass wir verschwanden oder Suzy wenigstens mit dem Geklapper aufhörte.
»Wir demonstrieren gegen die Verletzung der Fürsorgepflicht unserer Erzeuger und sanktionieren sie.«
»Funktioniert aber nur, wenn unsere Erzeuger mitbekommen, was wir hier machen, oder?«
Suzanna überlegte einen Moment lang. »Okay, vielleicht wäre es Zeit für einen außergerichtlichen Vergleich!«
»Vielleicht kommen sie ja doch noch mit«, gab ich leise zu bedenken. Ich wollte einfach nicht glauben, dass unsere Eltern den Urlaub schon wieder absagten. Obwohl alles dafürsprach. Vor einer Stunde war unser Vater in sein Büro verschwunden, unsere Mutter hatte vor zwanzig Minuten verkündet, es wäre etwas Wichtiges dazwischengekommen und wir sollten besser noch einmal in unsere Zimmer gehen und warten. Sie hatte geflissentlich ignoriert, wie ich vorwurfsvoll die Flugtickets hochgehalten hatte.
Suzy ließ die Schnalle los. »Du musst was rausverhandeln«, erklärte sie nachdenklich. Da sie fünf Jahre Vorsprung im Enttäuschtsein hatte, lag sie wahrscheinlich wieder richtig. »Wir beide, wenn nicht jetzt, wann dann. Strafe muss sein. Jetzt kriegst du alles von ihnen. Gibt es irgendetwas, was du schon immer machen wolltest und was sie dir nicht erlaubt haben?«
Ich dachte nach, drehte das Flugticket in meinen Händen, kam aber zu keinem Ergebnis. Für gewöhnlich gab es nichts, was ich nicht bekam. Ich hatte freie Verfügbarkeit über die Kreditkarte, die ich zum letzten Geburtstag bekommen hatte. Solange Suzy und ich uns benahmen und uns hin und wieder mit unseren Eltern auf irgendwelchen Events präsentierten und unsere Noten nicht abfielen, hatten wir ziemlich viele Freiheiten.
»Denk nach!«, drängte Suzy.
Ich sah durch die Glastüren hinaus und beobachtete, wie ein Pick-up langsam am Hotel vorbeifuhr. Auf der Ladefläche türmten sich bunte Surfbretter, Kitesegel und allerlei Kram. Die grelle Aufschrift konnte ich nicht entziffern, nur erkennen, dass irgendetwas mit »Break« darauf stand.
»Ich könnte surfen lernen«, murmelte ich und sah zu Suzy.
»Surfen?«
»Ja, surfen«, behauptete ich. Nicht weil ich das dringende Bedürfnis verspürte, zu surfen, sondern weil ich mir sicher war, dass meine Mutter absolut dagegen sein würde. Unsere Eltern legten schon Wert auf Sport, und natürlich, Suzy und ich nahmen Tennisunterricht, weil unser Vater ein riesiger Sampras- und McEnroe-Fan war. Tennis war das Einzige außerhalb des Hotels, für das er Leidenschaft aufbringen konnte. Suzy war eine passable Spielerin, aber ich war furchtbar. Doch da unsere Eltern keine Zeit hatten, uns bei Turnieren zuzusehen, war es im Grunde egal.
Harbour Bridge war ein beliebtes Urlaubsziel für Wassersportler, aber unsere Eltern waren – seit ich denken konnte – weder im Meer baden gewesen, noch hatten sie sich jemals auf irgendeine andere Art und Weise am Strand amüsiert. Der diente nur als Kulisse. Wie wir.
Vielleicht würde ich eine gute Surferin sein. Der Gedanke gefiel mir irgendwie. Ich hatte wesentlich mehr für den Strand, die Natur und das Meer übrig als für den Kunstrasenplatz im Maybank Tennis Center. Über Suzys Gesicht breitete sich ein verschwörerisches Grinsen aus. »Surfen werden sie hassen!«
Meine Mundwinkel verzogen sich zu einem diebischen schwesterlichen Geheimbundlächeln.
Eine Weile sahen wir uns stumm in der Lobby um. Das Sit-in fing an, mich zu langweilen.
»Ich bestehe darauf, trotzdem wegzufahren«, meinte Suzy schließlich.
»Wohin? Den Flieger nach Tampa kannst du knicken.«
»Egal! Zur Not fahre ich nach Idaho oder nach Oregon.«
»Was willst du in Idaho? Gold schürfen? Und wer bitte will Urlaub in Oregon machen?«
Suzanna zuckte unbeeindruckt mit den Schultern. »Irgendwann bin ich hier weg. Und dann lebe ich in einem Staat mit vielen Bergen und satter, saftiger Natur. An meiner Seite ein echter Naturbursche, ein Ranger oder so – mit Bauchansatz, sodass ich auch einen haben kann, ohne mich schlecht zu fühlen. Und ich werde sechs bis sieben Kinder bekommen. Die den Bauch mehr als rechtfertigen.«
Ich starrte sie an. »Das ist dein Ernst?«
»Mein voller«, erklärte sie.
Wir saßen noch eine geschlagene Stunde in der Lobby. Und dann schickten meine Eltern Jekaterina aus der PR-Abteilung. Überhaupt entsandten sie gerne Leute. Zum Elternabend ging die Köchin, die Putzfrau bastelte mit uns Poster für den Veterans Day, und bei den Sommerfesten unserer Schulen halfen Rezeptionistinnen oder andere Angestellte. Vieles, was Suzy jetzt für mich tat, war in ihrer Kindheit ebenfalls in fremde Hände gegeben worden. Es waren Büroangestellte, die Suzy französische Vokabeln abhörten, ein Zimmermädchen, das ihr erklärt hatte, wie man einen Tampon richtig benutzte, und Wade von der Haustechnik, der ihr gezeigt hatte, wie man einen Schaltwagen fuhr.
Und jetzt reiste eben Jekaterina mit uns in den Urlaub, ich hatte das Versprechen, nach unserer Rückkehr Surfstunden nehmen zu dürfen, und Suzy die Erlaubnis, auf ein Festival irgendwo in Salt Lake City zu fliegen, das meine Eltern ursprünglich verboten hatten, aus Sorge, Suzy könnte zu den Mormonen überlaufen.
Man konnte sich vieles kaufen im Leben. Sogar Zeit, indem man ungeliebte Dinge von anderen erledigen ließ. Liebe hielten unsere Eltern auch für ein Tauschgut.
Mit Jekaterina fuhren wir nicht nach Oregon, nicht nach Idaho und natürlich auch nicht nach Tampa, sondern auf eine 132 Meilen entfernte Insel in Georgia.
Genau genommen waren wir auf einer Zwillingsinsel von Harbour Bridge gelandet, wie Suzy nicht müde wurde zu betonen. Tybee Island war wie unsere Heimat eine Barriereinsel, im Hinterland eingekesselt von Marschland, von vorn umgeben vom Ozean. Und obwohl ich es im Biologieunterricht in der Primary School gelernt hatte, wurde mir erst in diesem Sommer mit Jekaterina bewusst, wie besonders das war.
Wir verbrachten die Ferien im Elternhaus unserer Hotelangestellten, die sich redlich Mühe gab, uns eine unvergessliche Zeit zu bereiten. Was mich betraf, so gelang ihr das. Ich genoss jede einzelne Minute. Suzanna dagegen behauptete noch Jahre später, sie hätte sich nie wieder in ihrem Leben so gelangweilt. Jekaterinas jüngerer Bruder Alexis war irgendeine Art von Biologiestudent und nebenbei verdammt gut aussehend. Er hatte lange helle Haare und trug die ganze Zeit hautenge Longsleeves und olivgrüne Shorts, und ich war schrecklich verliebt. Täglich schrieb ich schwülstige Liebesbriefe, die ich in Flaschen steckte und im Ozean versenkte. (Eine Umweltsünde, auf die ich rückblickend nicht sehr stolz bin.)
Jekaterina selbst hatte ein paar Semester Biologie in Boston studiert, bevor sie auf Tourismus umschwenkte, und sie lachte laut und herzlich, wenn Suzy Tybee Island mit Harbour Bridge verglich. »Was meinst du, warum ich ausgerechnet ins Seasons gekommen bin? Wegen der schönen Architektur?«
Weil ich hemmungslos in Alexis verliebt war, suchte ich, sooft es ging, seine Gesellschaft und begleitete ihn auf endlosen Spaziergängen ins Hinterland der Insel. Er erklärte mir alles geduldig, sah in meinem Wissensdurst nur kindliche Neugier und nicht die verknallte Bewunderung, die ich für ihn empfand. Und doch gelang es ihm, mich für das Marschland zu begeistern. Dort, wo Ebbe und Flut den Rhythmus bestimmten und Veränderung die einzige Konstante war, wie er nicht müde wurde zu betonen. Wir fuhren gelegentlich mit einem kleinen Außenmotorboot durch die Flüsse und Priele im Marschland und kontrollierten die Messgeräte. Wie kleine Funkmasten standen sie mitten im untiefen Gelände, das mit seinen flachen Seen und Grasfeldern wirkte, als wäre es nicht von dieser Welt. Hier hatten Zebra-Killifische, winzige Krebse und andere Bewohner der sandigen Untergründe ihr Zuhause gefunden. Von Tag zu Tag fühlte ich mich stärker mit meiner Heimat verbunden. Mit diesem Streifen Erde an der Ostküste Nordamerikas, mit den wilden Marschlandinseln, mit Tybee Island und Harbour Bridge. Stundenlang studierte ich die Gezeiten und staunte, wie sich bei Ebbe die Landbewohner zielsicher näherten, als hätte man eine Horde Wölfe mit Fleisch aus dem Dickicht gelockt. Bald konnte ich Dunkelenten, Kanadareiher und Spitzschwanzibisse benennen und wusste, welche Fischarten bei Flut zum Fressen heranströmten.
Morgens war ich vor allen andern wach, betrachtete den Sonnenaufgang über der Weite des Marschlands und wartete darauf, dass Jekaterina mir eine dampfende Tasse Tee vor die Nase stellte und dabei »Seelenfrühstück« murmelte, bevor sie sich neben mich setzte und schweigend mitansah, wie ein neuer Tag voller kleiner und großer Wunder begann.
Am Ende der Ferien hatte ich eine klare Vorstellung von meiner Zukunft. Ich wollte Naturforscherin oder Meeresbiologin werden – jemand, der diese einzigartige Natur schützte und sie vor Gefahren bewahrte. Doch als ich Suzy von meinen Plänen erzählte, lachte sie laut. Als wäre das viel abwegiger, als sich eine Zukunft mit sechs Kindern in Oregon zu wünschen. »Du wirst schon sehen, meistens kommt es anders, als man denkt.« Und ich dachte trotzig, dass das vielleicht auf sie zutreffen mochte, auf mich dagegen ganz sicher nicht.
4
Ich fahre aus der Tiefgarage hinaus auf die breite Center Street, die über die Brücke nach Charleston und Mount Pleasant führt. Ich drehe das Radio lauter, als ich einen alten Song von Force of Habit höre. Kurz danach ertönt die monotone Stimme der Nachrichtensprecherin und ich horche auf.
»… und so wurde bekannt, dass ein männlicher Verdächtiger auf dem Polizeirevier Charleston festgehalten und verhört wird. Jesper S. geriet nach seinem Erscheinen am Moss Lake sowie einer anonymen Anzeige schnell ins Visier der Ermittler. Inwieweit seine Verhaftung mit der weiblichen Leiche …«
Ruckartig schießt meine Hand nach vorn und dreht das Radio aus. Mein Herz donnert ungesund schnell in der Brust, und einen Augenblick lang ist da dieser unbändige Drang, umzudrehen und nach dem Seasons in die Waterfront Avenue abzubiegen, nach Avery zu sehen oder meinen SL über den unebenen Weg zu dem Haus zu jagen, in dem Odina lebt. Aber ich bleibe auf gerader Strecke und verbiete mir jeden weiteren Gedanken.
Vor dem Haus meiner Eltern in Charleston angekommen, parke ich, ohne den Motor abzuschalten, und schaue auf meine Armbanduhr. Eine Rolex Oyster Perpetual Day Date mit 18 Karat Everose-Gold und einer diamantbesetzten Lünette. Das letzte Weihnachtsgeschenk meiner Mutter. Pure Verschwendung, wenn man bedenkt, dass sie auch nichts anderes kann, als die Uhrzeit anzuzeigen. Es ist bereits kurz vor acht. Bloß nicht daran denken, dass die Leiche jetzt irgendwo – vermutlich in Charleston ganz in der Nähe – in der Rechtsmedizin liegt. Dass dieser Körper vielleicht Josies ist. Ein Körper, den ich so oft angesehen, bewundert, umarmt, berührt und vermisst habe. Und darin, in dieser Hülle, so viele Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte, Ängste und Geheimnisse, die mit ihm gestorben sind.
Ich öffne den Haargummi in meinem Nacken, löse den strengen Zopf und schüttele mein hellblondes Haar kurz über den Kopf. Als ich hochsehe, hat sich die Tür des Hauses geöffnet. Hailey hüpft auf dem Treppenabsatz des Hauses im Kolonialstil, dessen Eingangsbereich so sehr an das Weiße Haus in Washington erinnert, dass ich mich frage, ob meine Mutter es deswegen ausgesucht hat. Als Statement in Bezug auf unseren Nachnamen oder weil sie sich als eine Art Präsidentin der Charlestoner High Society sieht.





























