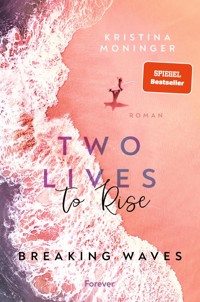9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt hat sich ohne dich weitergedreht – nur dein Herz kann sich erinnern. Stell dir vor, du triffst deine große Liebe. Ein absolut magischer Moment. Ihr verabredet ein Date und verabschiedet euch mit Herzklopfen. Dann wachst du nach einem üblen Sturz auf – und fünf Jahre sollen vergangen sein. Du weißt nicht, was geschehen ist. Kennst dich nicht mehr aus in deinem Leben und fragst dich beim Blick in den Spiegel: Wer bist du, Teresa? Und dir wird klar, dass du in den letzten Jahren nicht nur dich selbst, sondern auch Henry verloren hast, den Mann mit den wunderschönen Augen. Dein Herz erinnert sich. Aber kann es eine zweite Chance geben, nach allem, was geschehen ist? Ein Roman zum Lachen und Weinen. Über Verlust und Versöhnung, über wahre Gefühle und den Mut, den es braucht, zu sich selbst zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Kristina Moninger
Was wir sehen, wenn wir lieben
Roman
Über dieses Buch
Die Welt hat sich ohne dich weitergedreht – nur dein Herz kann sich erinnern.
Teresa kennt sich nicht mehr aus in ihrem Leben. Gerade noch hat sie sich mit Herzklopfen von Henry verabschiedet, da wacht sie nach einem schweren Sturz im Krankenhaus auf. Die Diagnose: Gedächtnisverlust. Fünf Jahre sollen seit dem Date mit Henry vergangen sein, doch Teresa erinnert sich an nichts. Wieso wohnt sie nicht mehr mit ihrer Schwester zusammen? Was wurde aus ihrem Tattoostudio? Wer ist der nackte Mann in ihrem Bad? Und vor allem: Wo ist Henry?
Teresa muss Ordnung in das Chaos ihres Lebens bringen. Und sie muss Henry wiederfinden. Aber kann es überhaupt eine zweite Chance für ihre Liebe geben – nach allem, was in den letzten Jahren passiert ist?
Vita
Kristina Moninger wurde 1985 in Würzburg geboren und hat ihre Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land verbracht, in dem sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihren Zwillingen lebt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung hat sie ein Übersetzerstudium abgeschlossen. Ihre größte Leidenschaft jedoch gehört dem Schreiben. Sie hat bereits erfolgreich mehrere Romane veröffentlicht und eine große Fangemeinde aufgebaut. Findet man sie nicht am Schreibtisch, dann sehr wahrscheinlich hinter einem Buch oder mit Familie und Hund in der Natur.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-00919-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Schwestern – ich liebe euch!
Vielleicht ist das Leben eine Zwiebel.
Es brennt in den Augen, hat viele verschiedene Schichten,
und manchmal ist es schwer verdaulich.
Prolog
Manchmal geschieht etwas völlig Unerwartetes und setzt eine Kettenreaktion in Gang, die das ganze Leben verändert. Eine einzige Sekunde reicht dann aus, um einen unscheinbaren Augenblick zu einem Herzensmoment werden zu lassen. So wie in dieser Sekunde, in dieser unscheinbaren Straße in einer Münchner Wohngegend, an einem unbedeutenden Junitag.
Es ist diese Sekunde, in der ich den Blick von meinem Schlüsselbund löse und mich noch ärgere, dass ich die kurzen Jeans ohne Taschen trage. Der Moment, in dem ich in sein Gesicht sehe. Und zwar genau auf diesen kleinen Punkt in seiner Pupille, von dem ich gar nicht wusste, wie sehr ich ihn vermisst hatte.
Dabei waren mir gerade eben noch total unwichtige Dinge durch den Kopf gegangen: ob ich das schwarze Kleid aus dem Vintage-Shop wirklich kaufen soll, ob wir noch genug Obst zu Hause haben und wann ich heute eigentlich in der Uni sein muss. Da steht er plötzlich vor mir. Henry. Einfach so.
Sofort flüchten alle Gedanken aus meinem Kopf, als wären sie Zugvögel und viel zu spät dran, sich in den Süden aufzumachen. Kurz wirkt Henry wie aus der Zeit gefallen. Nicht, weil er noch genauso aussieht wie früher, sondern weil sein Anblick immer noch so vertraut scheint, als hätten wir uns gestern erst gesehen.
Noch bevor ich etwas sagen kann, schaue ich auf seine Füße, vielleicht weil ich sehen muss, dass er da wirklich steht und nicht wie eine Fata Morgana vor mir schwebt. Aber seine für einen Mann erstaunlich gut gepflegten Zehen sind fest verankert in schwarzen Birkenstocktretern, die bequem sein sollen und doch aussehen, als hätte man den großen Zeh gewaltsam vom Fuß gespreizt und zur Einsamkeit verdammt.
Es ist nicht etwa so, dass mir der Rest zwischen Pupille und Zeh nicht auffällt. Da ist viel dazwischen. Ein ganzer, hochgewachsener Männerkörper. Und trotzdem immer noch ein wenig Junge.
Dann ist da dieses Lächeln, das mich fast rot werden lässt, obwohl seine Lippen meine nie berührt haben. Und die dichten, aber akkurat geschwungenen Brauen unter einer glatten, gebräunten Stirn und eine schwungvolle Welle braunen Haars, das einen dazu verlocken will, mit den Fingern hindurchzufahren. Sein Körper unter dem schlichten Shirt sieht gar nicht so schlicht aus, und ich kann mir mühelos vorstellen, dass er viel trainiert hat in diesen lächerlichen drei bis vier Jahren, in denen wir uns nicht mehr gesehen haben.
«Teresa?»
Er steckt den Bügel seiner Sonnenbrille lässig am Kragen seines Shirts fest.
Wieder einmal muss ich feststellen, dass ich zwar anderen problemlos Farbe mit einer Nadel unter die Haut stechen kann, aber kein Mann jemals wirklich unter meine Oberfläche gedrungen ist und mein Herz berührt hat. So sehr ich mir das auch gewünscht hätte. Vielleicht ist Henry der Grund dafür. Vielleicht auch nicht.
«Henry Bayer!», antworte ich mit einem Ausrufezeichen und einer kurzen Pause zwischen Vor- und Nachnamen. So als wären die beiden wie seine Zehen durch ein Stück Leder getrennt.
«Wie lange ist das her?», sagt Henry und zwingt mich, mit der Zwiesprache in meinem Kopf aufzuhören. Nicht mehr jeden meiner Gedanken innerlich an ihn zu adressieren.
Ich will «zu lange» antworten und denke gleichzeitig «nicht lange genug». Stattdessen grinse ich unbeholfen, und meine Stimme klingt, wie immer, wenn ich aufgeregt bin, noch tiefer als sonst: «Gut siehst du aus.»
Das ist wenigstens die ganze Wahrheit.
«Was machst du hier?», will er wissen und kommt noch ein Stück näher. Ein Motorrad röhrt um die Ecke, und ein Kind schreit, weil es mit den Knien auf dem Pflaster gelandet ist. Eine seltsame Hintergrundmusik für einen Moment, der irgendwie mehr nach Geigen verlangt.
«Ich wohne um die Ecke», antworte ich. «Bin gerade auf dem Weg zu meinem Auto.»
Er nickt, legt den Kopf etwas schief und schaut dann auf meine Hände. Nervös streiche ich mit der Linken, in der ich immer noch die Schlüssel halte, über meinen Pony, tue so, als müssten die Fransen dringend glatt gestrichen werden. Ruhig, Brauner.
«Bist du unter die Handwerker gegangen?» Er lächelt und deutet auf meine andere Hand.
Ich schaue nach unten, sehe aber statt der roten Zange in meiner Rechten nur seine nackten Beine, die in dunklen Shorts stecken.
«Handwerker? Ach so, wegen der Zange. Nein, die brauche ich für mein Auto.»
«Ah.» Er lacht laut. Es macht immer noch warm, dieses Lachen, und legt sich wie eine Heizdecke um meinen Körper, trotzdem bekomme ich eine Gänsehaut.
«Ja. Ich habe da ein kleines Problem mit der Schaltung, und die alte Zange hat gestern den Geist aufgegeben.» Ich spüre, wie da dieses breite Lächeln an meinen Lippen knabbert und mich bittet, es doch einfach zuzulassen. Warum auch nicht? Wenn nicht für Henry Bayer, für wen dann?
«Was machst du hier?», frage ich und gebe dem Lächeln ungehindert nach.
«Ich besuche einen Freund.» Er deutet mit der Hand in die Richtung der frisch sanierten Gebäudereihe in meinem Rücken.
«Wohnst du wieder hier?», erkundige ich mich.
Er nickt. «Seit kurzem. War vorher ein paar Jahre in Stuttgart.»
Das erklärt, warum ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe. Aber so ist das eben – Menschen verschwinden. Das passiert. Sie ziehen weg, man sieht sie nie wieder. Nur dass Henry nie ganz verschwunden ist. Nicht aus meinem Kopf und auch nicht aus meinem Herzen, obwohl meine Künstlerinnenmutter seit Jahrzehnten daran arbeitet, die Romantik in mir durch Surrealismus zu ersetzen.
«Was macht denn Celine?», fragt Henry weiter. «Wie geht es ihr? Ich habe schon ewig nichts mehr von ihr gehört.»
«Gut», antworte ich knapp, nicht, weil ich nicht über meine Schwester sprechen will, sondern weil es schwierig ist, zu erklären, wie es Celine in den letzten Jahren ergangen ist. «Momentan ist sie für ein paar Wochen auf einem Bauernhof in der Uckermark.» Dass der Biohof Teil ihrer Reha ist, will ich ihm nicht auf die Nase binden.
«Oh, Mann, das passt so zu ihr. Richte ihr schöne Grüße aus!» Er strahlt mich an. «Echt Wahnsinn, dass wir uns so zufällig treffen. Aber sag mal, wo hast du das kleine Mädchen gelassen, das immer an Celines Tür gelauscht hat?»
Er zwinkert, und ich zucke innerlich zusammen. Erinnere mich an all die peinlichen Momente aus einer Zeit, in der ich Henry mehr oder weniger heimlich angehimmelt habe. Daran, wie ich wirklich oft ein Ohr an die Tür zu Celines Zimmer gelegt habe, um zu hören, ob ihr bester Freund Henry vielleicht von mir spricht (tat er nicht). Und daran, dass er mich auf dem Balkon meiner Tante beim Sonnenbaden erwischt hat (oben ohne) und – noch schlimmer – an seinen Kommentar dazu: «Nur gut, dass du noch nichts verstecken brauchst.»
Heute muss ich mich eigentlich nicht verstecken, klein fühle ich mich dennoch.
Weil ich nicht antworte, die Luft gibt nicht genug Sauerstoff dafür her, sagt Henry: «Was machst du denn jetzt so?»
Ich will tief einatmen, die Zange auf den Boden legen und die Hände lässig in die nicht vorhandenen Hosentaschen stecken, als er mir das ungesagte Wort abschneidet.
«Warte!» Er hebt die Hand. «Ich hab eigentlich überhaupt keine Zeit gerade, um ehrlich zu sein. Aber … wir könnten uns ja mal auf einen Kaffee treffen.»
«Ja, sicher, klar. Warum nicht», antworte ich schnell, zu schnell. «Würde mich freuen», füge ich auch noch etwas zu eifrig hinzu.
Er lächelt wieder. Dieses Henry-Bayer-Lächeln, das aus meinem selbstbewussten, erwachsenen Ich wieder das Teenagermädchen macht, das immer ein bisschen zu schräg angezogen gewesen war, ein absichtlicher Underdog, der sich der Masse nicht hatte fügen wollen und der dennoch bis über beide Ohren in den Schulliebling verliebt gewesen war. Den Kumpel meiner Schwester, der mir bestenfalls freundschaftlich über den Kopf gewuschelt hat. Mann, Henry, meine Haare.
Ich strecke den Rücken durch und ein wenig die Brüste raus, immerhin habe ich jetzt welche. «Wie wäre es Ende der Woche?»
«Warum nicht», erwidert er lächelnd. «Sehr gern.»
Jetzt bloß das Angebot nicht vage auf der Straße stehen lassen. «Kennst du das Zweinachviertel?» Ich widerstehe nur mit Mühe dem Drang, meine Hände an die Wangen zu drücken, in der Hoffnung, dass meine immer kalten Finger meine viel zu heißen Wangen ein wenig kühlen könnten.
«Ja.» Er nickt.
«Also Freitag? Um drei im Zweinachviertel?», schlage ich vor.
«Das klingt super!»
Er berührt mich leicht an der Schulter, und als er schon fast an mir vorbeigegangen ist, dreht er sich noch einmal um.
«Teresa …» Mein Name klingt aus seinem Mund, als wäre er ein Geheimnis. «Was für eine Schönheit du geworden bist.»
Jetzt sagt mein breites Lächeln: Siehst du, Teresa, für solche Momente bist du gemacht. Und ich spüre, wie meine Wangen noch wärmer und noch kribbeliger werden. Eine Farbveränderung wie ein Pinselstrich übers Gesicht.
Was für eine Schönheit du schon immer warst, will ich sagen, schlucke die Worte aber herunter. Einmal, zweimal. Das muss reichen.
«Schön, dich getroffen zu haben, Henry.»
Er grinst erneut und geht dann weiter. Aber er dreht sich noch ein weiteres Mal um. Nach einer gefühlten Ewigkeit, während der ich schon wieder die Luft angehalten hatte. An einem bis dahin unspektakulären Junitag, in einer unscheinbaren Straße in einer beliebigen Münchner Wohngegend. Ein Herzensmoment.
Kapitel 1
Fünf Jahre später
«Können Sie uns hören?»
Es ist weich und warm hier. Ich will gar nicht weg. Ich will bleiben. Für immer, oder zumindest noch für eine ganze Weile. Aber sie schubsen mich, drängen mich und sind nicht bereit nachzugeben – diese Stimmen, die ich nicht kenne.
Ich liege im Wasser, und die Sonne scheint mir auf den Bauch, ich will meine Augen nicht öffnen. Aber jedes Mal, wenn jemand sagt «Hören Sie mich?», blinzele ich automatisch. Dann wird es kälter. Das Licht wirkt plötzlich hart und verliert so viel von seinem Glanz, es ist dann einfach nur noch grell.
Ich will nicht, aber sie sind stärker. Ihre Worte sind wie Köder, ausgeworfen für einen Fisch, der es eigentlich besser weiß und trotzdem zuschnappt. Einfach, weil der Köder echt sein könnte. Die Stimmen zerren jetzt an mir, und ich kann mich nicht mehr widersetzen. Sie wollen unbedingt, dass ich aus dem Wasser komme, so sehr ich mich auch dagegen wehre.
«Wie heißen Sie?»
Mir ist schlecht. So schlecht. Ich möchte mich übergeben. Ich habe das Wasser verlassen, und das war keine gute Idee.
«Fische sterben auf dem Trockenen. Nicht, weil sie keine Luft bekommen, sondern weil ihre Kiemenlamellen austrocknen und der Gasaustausch zu stark abnimmt. Eigentlich erstickt der Fisch also doch.»
Er hat so ein schönes Lachen, der Mann, der das gerade sagt. Und ich stimme ein in dieses Lachen.
«Sie heißen also Frau Fisch?», sagt eine andere Stimme. Die klingt deutlich unangenehmer.
Vielleicht habe ich das mit dem Fisch laut gesagt? Ich weiß nicht einmal mehr, woher ich das Wissen habe. Dafür weiß ich jetzt, dass das viel zu grelle Licht aus einer Taschenlampe kommt, die mir fies in die Augen leuchtet.
«Können Sie mir noch einmal Ihren vollständigen Namen sagen, Frau Fisch?»
«Teresa», krächze ich. «Ich heiße Teresa Kempf.»
«Sehr gut», lobt der Mann und nimmt die Taschenlampe weg. Er hält einen Personalausweis hoch und nickt. Offenbar weiß er nun, dass ich wirklich ich bin.
Jetzt, da mir das Licht nicht mehr in die Augen leuchtet, kann ich ihn auch sehen. Er ist um die vierzig, trägt Sanitäterkleidung, hat dicke Augenbrauen und ein nettes Lächeln.
«Danke», sagt er.
«Wofür?», frage ich.
«Für das Kompliment.»
Schwierig, wenn man seine Gedanken unbeabsichtigt ausspricht.
«Sie können aber keine Gedanken lesen?», frage ich sicherheitshalber.
«Nein.» Er zeigt beim Lächeln schiefe Zähne, und ich konzentriere mich sehr, das jetzt nicht laut zu sagen.
Seltsamerweise fühle ich mich ein wenig beschwipst. Was Unsinn ist, ich trinke so gut wie nie Alkohol und schon gar nicht am helllichten Tag. Wobei ich feststellen muss, dass um mich herum dunkle Nacht herrscht. Und mir ist auf einmal kalt, obwohl ich in diese komische Goldfolie gewickelt bin.
«Keine Sorge, es ist normal, dass Sie etwas verwirrt sind», sagt der Sanitäter. «Sie waren kurze Zeit bewusstlos.»
«Kurze Zeit?», antworte ich. «Es war doch gerade noch hell.»
Irritiert schaue ich mich um, aber viel ist nicht zu sehen. Ich liege in einem Rettungswagen auf einer Pritsche, und offenbar hat es geregnet, denn auf den Scheiben perlt Wasser. Seltsam, für heute war doch gar kein Regen gemeldet. Außerdem riecht es komisch hier. Nach Urin – ich hoffe sehr, dass es nicht mein eigener ist. Und nach Marihuana. Und auch ein wenig nach Zigarettenrauch.
Für einen winzigen Moment ist der andere Mann wieder da. Der, dessen Stimme so weich klingt und dessen Namen ich vergessen habe.
«Du bist also wieder hier?», sage ich.
Wie schön, wie unglaublich schön, dass du wieder da bist, hätte ich beinahe hinzugefügt. Es ist schwer, diesem Ansturm von Gefühlen standzuhalten und nicht alles sofort in Worte zu verpacken.
«Ich bin wieder hier. Und du bist zum Glück auch da.»
«Es wird bald wieder hell», sagt der Mann, der mir etwas realer erscheint als der, der sich immer wieder in meine Gedanken mischt.
Hinter dem Sanitäter taucht jetzt eine dunkelblonde Frau auf, die ihm die Hände auf die Schultern legt. «Na, ist sie wieder da?»
«Ich war ja gar nicht weg», antworte ich.
«Schlagfertiges Persönchen», erklärt der Mann und dreht sich zu seiner Kollegin um, als wäre ich wirklich nicht da.
Ich will gerade protestieren, da fällt mir ein seltsames Detail auf. Auf meiner linken Hand, die wie ein Fremdkörper aus der Golddecke hervorragt, steht etwas. Hastig reiße ich die Hand hoch, wobei die Knisterfolie zur Seite rutscht, und starre auf den Buchstaben auf meinem Handrücken. Es ist ein verschlungenes C, das vom Gelenk bis zu den Fingerknöcheln reicht. Schnell spucke ich mir in die andere Hand und reibe über den Buchstaben. Aber er geht nicht weg. Das muss sehr hartnäckiger Filzstift sein. Ich hasse es, dass Sophie das immer noch macht. Als wären wir Kinder und ich wieder im Schulbus eingeschlafen.
«Das geht nicht weg», sagt die Frau und wirft ihrem Kollegen einen seltsamen Blick zu. «Das ist eine Tätowierung.»
«Ich weiß, was eine Tätowierung ist», erwidere ich. «Ich mache Tätowierungen. Das ist mein Beruf. Aber die hier, die gehört nicht zu mir.»
«Na ja, wir haben Ihnen keinen neuen Arm angeschraubt, also gehört sie wohl doch zu Ihnen.» Sie klingt gereizt. «Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus, und dann machen wir ein paar Tests, um zu sehen, ob Sie Ihren kleinen Unfall hier gut überstanden haben.»
«Ich hatte einen Unfall?» Natürlich. Es muss ja einen Grund geben, dass wir hier im Krankenwagen plaudern. Um die blöde Bemalung an meiner Hand kann ich mich auch später noch kümmern.
Bevor ich eine Antwort erhalte, wird mir bewusst, was ich anhabe. Ein fast bauchfreies Top und kurze Jeansshorts. Und dass ich damit zum ersten Mal in meinem Leben ein schlimmeres Outfit trage als meine Mutter.
«Darf ich die Alufolie behalten?», frage ich, weil ich schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich wissen wollte. «Meine Mutter würde sie lieben. Die macht sich daraus glatt ein Kleid.»
«Das ist metallisierte Plastikfolie», sagt die Frau und schaut wieder so komisch.
Klugscheißerin.
Das hab ich nicht laut gesagt. Ganz sicher nicht.
«Sie wissen also, wer Ihre Mutter ist?», fragt sie jetzt und runzelt die Nase.
«Glauben Sie mir, die könnte niemand vergessen», antworte ich, bekomme aber keinen Lacher dafür.
«Welches Jahr haben wir?», fragt sie vollkommen unvermittelt. Es wird immer dämlicher.
«2014», sage ich, woraufhin sie guckt, als hätte ich gerade behauptet, wir befänden uns in den Achtzigern, noch vor dem Mauerfall. «Was ist denn überhaupt passiert?» Ich versuche, mich auf der Liege nach oben zu drücken, um zu sehen, ob ich noch immer in der Römerstraße bin. Allerdings kann ich von meiner Position aus gar nichts sehen. Und wo ist eigentlich meine Zange? Ohne die Zange kriege ich den ersten Gang in der Möhre nie rein. Ich brauche das Ding, zumal es ja schon die Ersatzzange ist.
Bevor ich erneut fragen kann, sagt der Mann mit dem netten Lachen und den schiefen Zähnen: «Sie kamen aus der Diskothek.» Die Art, wie er Diskothek sagt, als wäre das eine ansteckende Autoimmunkrankheit, bringt mich zum Schmunzeln. «Und dann sind Sie die Treppe hinuntergestürzt. Wir haben den Verdacht, dass Sie … unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen und möglicherweise …»
Das ergibt alles keinen Sinn. Ich schüttele den Kopf und bereue es sofort. Der Schmerz fährt in meinen Schädel und rasiert messerscharf über meinen Verstand.
«Moment, wie soll ich denn jetzt schon irgendetwas eingeworfen haben, ich bin ja gerade erst aufgewacht!», widerspreche ich und verziehe gepeinigt das Gesicht.
«Vorher!», wirft die Frau dazwischen. «Sie sind in der Diskothek gewesen und kamen angetrunken oder unter Drogeneinfluss heraus und sind die Treppe zur U-Bahn hinuntergestürzt.»
Drogen? Haben die sie noch alle? Ich stemme mich erneut hoch und drehe meinen Brummschädel vorsichtig nach hinten, und auf einmal weiß ich, wo ich bin. Da drüben liegt das Harry Klein. Ich war noch nie drinnen, habe aber schon davorgestanden. Und dort geht es zur U-Bahn hinunter. Wenn ich nach rechts schaue, sehe ich das Gebäude, in dem der Burger King und die Spielothek beheimatet sind. Ich bin in der Nähe vom Stachus.
«War ich im Harry Klein?»
Was nicht sein kann. Warum sollte ich mitten am Tag in einen Elektroclub gehen? Warum sollte ich überhaupt in einen Elektroclub gehen. Ich mag die Musik nicht mal besonders.
Die Frau nickt.
«Oh, cool. Da wollte ich schon lange mal hin», sage ich mit einer Ironie, die keinen der beiden zu einer Reaktion veranlasst.
Beunruhigend ist allerdings vielmehr, dass ich mich nicht daran erinnere, dort gewesen zu sein. Das ist der Moment, in dem bei mir zum ersten Mal, seit man mir in die Augen geleuchtet hat, so etwas wie Angst aufkommt. Ich habe offensichtlich einen Filmriss. Erinnere mich nicht, wie ich hierhergekommen bin, was ich hier gemacht habe und warum ich die Treppen runtergefallen sein soll. Ich stand doch eben noch mit Henry auf der Straße. In Schwabing. Nicht am Stachus.
Auf einmal ist die Kälte vergessen. Alles in mir wird warm, glüht, und in meinem Innern keimt eine Panik, die es mir schwer macht, ruhig zu atmen. Wenn ich nicht aufpasse, muss ich mich gleich übergeben.
Der Sanitäter scheint das zu bemerken. Er reicht mir eine Tüte. «Wir nehmen Sie jetzt mit in die Uniklinik und verständigen Ihre Angehörigen. Wohnen Sie mit jemandem zusammen?»
Ich nicke, die Tüte unters Kinn geklemmt, schlucke und schaffe es dann zu sagen: «Mit meiner zweitältesten Schwester. Sophie Kempf. Aber kann ich nicht einfach gleich nach Hause?»
Er schüttelt entschieden den Kopf und reicht mir ein Handy. Sein Handy. Ich besitze nämlich kein iPhone und schon gar nicht so eins. Es sieht so neu aus, als wäre es noch gar nicht geboren. Flach wie eine Flunder, grau und schick. Sehr schick. Meines ist ein altes Samsung, das sich ständig aufhängt und dessen Display ein breiter Riss ziert.
«Äh, ich glaube nicht, dass Sie die Nummer meiner Schwester haben.» Ich nehme die Tüte herunter und lege sie auf die Folie.
«Das ist Ihr Handy!»
«Kann nicht sein.»
«Es war in Ihrer Hosentasche.»
Ich finde es ein wenig seltsam, dass er mir das Handy aus der Hosentasche gezogen hat, auch wenn ich wohl bewusstlos war. Mein Handy ist es trotzdem nicht.
«Versuchen Sie doch mal, es zu entsperren», sagt die Sanitäterin. Nicht unfreundlich, aber schon etwas ungeduldig.
Ihr zuliebe nehme ich es in die Hand und versuche, die Zahlen einzutippen. Aber das Handy ist ja an. Es wartet nur auf eine Entsperrung, und ich verstehe nicht, warum auf einmal ein Fingerscanner auftaucht. Das ist mir unheimlich. Ich will es zurückgeben. Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Oder die beiden hier wollen mir aus welchen Gründen auch immer meine Fingerabdrücke entlocken.
«Mit dem Daumen entsperren», klärt mich die Frau auf. «Versuchen Sie es.»
Das muss ein Trick sein, um an meine Fingerabdrücke zu kommen. Ganz bestimmt.
«Mach ich nicht. Kann ich nicht ein anderes Handy benutzen? Ihres?»
Sie schüttelt den Kopf. Aber der Sanitäter seufzt, greift in seine Tasche und entsperrt tatsächlich mit dem Daumen sein eigenes Handy.
Ich versuche, mich an Sophies Nummer zu erinnern, und es gelingt mir sogar. Ich wähle, aber es dauert sehr lange, bis jemand abnimmt. Und dieser jemand ist nicht Sophie.
«Hartmann», meldete sich eine fremde Frauenstimme.
«Ist Sophie da?»
«Jibt et hier nich», antwortete die Frau. «Ick kann Ihnen aber den Johnny geben.»
«Äh, nein danke.»
Ich lege schnell auf.
«Falsche Nummer oder verwählt», sage ich zu dem Sanitäter und beiße mir auf die Lippe.
«Wie heißt Ihre Schwester?», fragt er und nimmt sein Handy wieder an sich.
«Sophie Kempf.»
Er greift nach dem Handy, das meins sein soll, und drückt meinen Daumen auf das Display.
«Hey!», protestiere ich. Was für eine Unverschämtheit! Aber tatsächlich leuchtet das Display jetzt auf, und ich sehe ein Bild von Celine auf dem Bildschirm. Das Handy ist also wirklich meins. Ich zucke mit den Achseln, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll.
Eine Weile scrollt er auf dem Display und sieht mich schließlich triumphierend an. «Da haben wir sie ja!»
Er beginnt zu telefonieren, ich kann aber nicht hören, was er sagt, weil in diesem Moment eine Sirene losplärrt. Ich hoffe, dass es nicht noch einen Krankenwagen meinetwegen gibt.
Mit zunehmender Verzweiflung suche ich in meinem Hirn nach Erinnerungen. Warum war ich im Harry Klein? Und warum offensichtlich auch noch alleine? Warum wollte ich U-Bahn fahren, wenn ich doch die Möhre habe? Wie kann es überhaupt sein, dass mir ein paar Stunden meines Lebens fehlen und ich keine Ahnung habe, wie ich sie verbracht habe?
Ich ziehe die Goldfolie wieder zurecht und erschrecke erneut beim Anblick meines Eddingtattoos. Irgendjemand muss sich einen sehr üblen Scherz mit mir erlaubt oder – noch schlimmer – mich betäubt und in diese Klamotten gesteckt haben. Auch ohne auf das Größenschild geschaut zu haben, weiß ich, dass die Jeansshorts ziemlich schmal sind. Ich bin ziemlich schmal. Um nicht zu sagen dürr. Dabei war ich noch nie dürr. In meinem ganzen Leben nicht. Ich habe Rundungen, an vielen Stellen, und ich habe Brüste. Aber die sind in den letzten Stunden wohl auch abhandengekommen. Alles an mir fühlt sich fremd an. Nichts ist so, wie ich es kenne. Ich bekomme Angst. Richtige Angst. Auf meiner Stirn bildet sich kalter Schweiß, und ich spüre, wie meine Hände zu zittern beginnen. Hastig taste ich nach meinen Haaren. Vielleicht habe ich keine Haare mehr! Warum mir dieser seltsame Gedanke kommt und warum er mich so sehr in Aufruhr versetzt, dass ich plötzlich nicht mehr richtig atmen kann, weiß ich nicht. Nur dass es irgendwie unheimlich wichtig ist, dass ich Haare habe.
Puh. Ich habe welche. Sogar ziemlich lange. Aber mein Pony ist weg. Wie kann es sein, dass mein Pony fehlt? Ich trage Pony, seit ich denken kann.
Plötzlich ist da wieder diese Stimme.
«Das da …» Er zupft grinsend an meinem Pony. «Ist auch ein wenig wie eine Gardine.»
«Wie bitte?», sage ich gespielt empört. «Mein Pony ist doch keine Gardine.»
«Eine sehr hübsche Gardine», entgegnet er und hebt die Hände. Und dann legt er sie um meine Hüften, einfach so. Drückt mich sanft gegen die Wand mit dem winzigen Fenster, sodass ich mit dem linken Fuß gegen etwas stoße und es klirrend umfällt. «Der Blumentopf … Ich …», murmele ich, aber da ist sein Mund schon auf meinem.
Nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit für erotische Phantasien, denke ich und taste noch einmal nach meiner Stirn. Das ist doch wohl alles ein dummer Scherz. Ich will hier nicht sein. Ich muss weg hier.
Zuerst merke ich gar nicht, dass ich plötzlich laut schreie. Erst als sich meine beiden vermeintlichen Retter über mich beugen, mich wieder auf die Trage drücken, das Gold um mich zurechtziehen und mir eine Spritze geben, wird mir klar, dass ich panisch hyperventiliere. Aber die Welt dreht sich um mich herum und will irgendwie nicht an der richtigen Stelle einrasten. Sie wirbelt einfach weiter, viel zu schnell, und lässt sich nicht mehr stoppen.
Kapitel 2
«Teresa, wir sind alle da.»
Die Stimmen um mich herum klingen so vertraut, dass ich mich am liebsten von ihnen einwickeln lassen würde. Ich fühle mich ein bisschen wie an Weihnachten, nur der Plätzchenenduft fehlt. Es riecht mehr nach Frühjahrsputz und Essigreiniger. Und eigentlich war doch auch gerade noch Sommer, oder? Vielleicht habe ich das schon wieder laut gesagt. Denn jemand lacht, laut und kernig, es ist ein Mann, den ich schon sehr lange kenne. Vielleicht mein Vater. Nein, die Stimme ist zu jung, um mein Vater zu sein. Viel zu jung. Das ist … Ich weiß doch, wer das ist. Nur sein Name will mir nicht einfallen. Alles ist so schwer. Ich will die Augen zumachen, da merke ich, dass ich sie längst geschlossen habe.
Der Mann lächelt. Er hat so wunderschöne Augen und diese braunen Haare, die ihm immer wieder in die Stirn fallen.
«Du hast da was …», sage ich und strecke die Hand nach seiner Schläfe aus. Er nimmt seine Hand zur gleichen Zeit hoch, und unsere Fingerspitzen berühren sich. Nur ganz leicht. Mein Herz setzt einen Takt aus und poltert dann unbeholfen wieder munter drauflos.
«Öl!», antwortet er und reibt sich die Stirn. «Entschuldige. Mir ist was total Blödes passiert. Ich hab mich ausgesperrt … Also, ich wollte noch duschen und mir was Anständiges anziehen, aber dann ist mir die Wohnungstür ins Schloss gefallen, und das war’s dann …»Er lacht. «Sorry für den Aufzug.»
Das T-Shirt sieht nicht so aus, als wäre es seins. Dafür ist es ein bis zwei Nummern zu groß. Er zupft am Saum, als wäre ihm das schlichte schwarze Teil mit der weißen Aufschrift «Nevermind» peinlich. Muss es aber ganz bestimmt nicht. Ich mag es und hoffe, dass etwas «Anständiges» unter normalen Umständen nicht bedeutet, dass er zum Stehkragenhemdträger geworden ist.
«Mir gefällt’s», antworte ich. «Wirklich.»
«Ich wollte nicht zu spät kommen. Am Ende bist du weg, und wir verpassen uns wieder um Jahre.»
«Das wäre tragisch!»
Jetzt schaffe ich es, die Augen aufzumachen. Ich blicke in eine Reihe von Gesichtern. Doch, das ist mein Vater. Aber er hat kein Öl im Gesicht.
«Tragisch …», murmele ich. «Wer hat das gesagt?» Ich schaue fragend in die Runde. Aber niemand antwortet. Gespenstisches Schweigen legt sich über den Raum. Ich muss an die Fische denken und den Sanitäter. Und sofort ist die Angst wieder da.
«Ganz ruhig, Teresa. Sie haben dir ein Beruhigungsmittel gegeben. Es ist alles gut. Wir sind ja da.»
Dann höre ich eine zweite Frauenstimme: «Tu mir das nicht an. Nicht auch noch du!»
Ich blinzele und will die Augen nicht mehr schließen.
«Wer bist du?» Ich krächze die Worte mehr, als dass ich wirklich rede. Da ist was in meinem Hals, das schmerzt. Und vor mir – nein, über mir – ist plötzlich viel zu nah das Gesicht meiner Schwester Sophie. Es ist ihre Stimme, ihre Nase, aber nicht ihre Frisur, und ihre Lippen scheinen das auch nicht zu sein. Sie ist ungeschminkt und hat dicke Ringe um ihre Augen. Wie ein Waschbär aus dem Zoo. Der Vergleich kratzt mir im Hals und will ein nervöses Lachen werden, was ich zum Glück verhindern kann.
«Oh Gott, sie erkennt uns nicht!», seufzt die Stimme aus diesem Sophie-ähnlichen Körper.
«Dich erkennt sie nicht», sagt jemand, und ich versuche, den Kopf zu drehen, aber er tut so furchtbar weh, dass ich es sofort wieder aufgebe. «Mich wird sie wohl erkennen.»
Das Sophie-Gesicht verschwindet und macht Platz für blau-blonde Haarsträhnen, die so nahe auf mich herunterbaumeln, dass sie meine Wangen kitzeln. Das gleiche Blau findet sich auf den Augenlidern wieder, und die Frau hat recht: Wie könnte ich sie nicht erkennen? Das ist meine Mutter. Von so nah habe ich sie allerdings lange nicht gesehen. Sie trägt einen anderen Lippenstift als sonst und sieht irgendwie alt aus. Und das goldene Kleid spannt sich viel zu eng um ihre üppige Oberweite. Ausgerechnet Gold, ich möchte kichern, aber da kommt nichts.
«Mama», sage ich stattdessen, und sofort kommt das Gesicht noch näher und drückt mir feuchte Küsse auf Wangen und Stirn. Dann wird es weggezogen.
Ich will die Augen wieder schließen, weil mir schwindelig wird, aber jemand hält mich davon ab. Es istSophie. Was auch immer sie mit ihren Haaren und ihrem Gesicht gemacht hat.
«Du bleibst da», sagt sie bestimmt. «Du gehst nicht weg, hörst du.»
Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich nicht auf einer Pritsche liege, sondern auf einem Bett. Einem richtig bequemen Bett, das folglich nicht meines sein kann. Sophie und ich wollen uns schon ewig neue Matratzen kaufen, aber es gibt immer Dinge, die irgendwie wichtiger sind.
«Warum erkennst du mich nicht?», fragt Sophie viel zu laut. Es klirrt in meinen Ohren und mischt sich mit einem seltsamen Surren, das mich an etwas erinnert.
«War ich in einer Maschine?»
«In einem Computertopographen», antwortet mein Vater.
«Tomograph», korrigiert meine Mutter.
Ich seufze erleichtert. Alles beim Alten.
«Na, jedenfalls ist alles dran», sagt mein Vater. «Keine Sorge, Schnäuzchen. Du hattest großes Glück.» Es ist seltsam befremdlich, dass er diesen alten Kosenamen verwendet. Vorsichtig setzt er sich neben mich aufs Bett. Es knarzt kurz, und wir grinsen uns einen Moment lang an.
«Erkennst du mich wirklich nicht?», fragt Sophie noch einmal.
Ich drehe mich vorsichtig zu ihr. Sie lehnt jetzt am Fensterbrett und hat sich mit den Händen auf der Heizung davor abgestützt.
«Was hast du mit deinen Haaren gemacht?» Sophies hübsche lange Haare sind raspelkurz und liegen flach an ihrem Kopf an. Es sieht schön aus, es steht ihr, aber es macht mir aus irgendeinem Grund auch Angst.
«Was hast du nur immer mit Haaren?», fragt meine Mutter. «Als du noch nicht wach warst, hast du auch die ganze Zeit etwas von Haaren gemurmelt.»
Sie fängt sich einen bösen Blick von Papa ein. Das mit den bösen Blicken kenne ich schon, die scharfe Stimme dazu nicht. «Kannst du dir das nicht denken, Edda», zischt er.
Ich ignoriere ihr Gezanke und deute auf meine Schwester. «Du bist Sophie, meine zweitälteste Schwester, die letzte Woche durchs Physikum gerasselt ist, aber nur, weil sie eine faule Socke ist. Außerdem bist du der nervigste, unordentlichste Mensch, den ich kenne.»
Sophie nickt langsam, aber sie lächelt nicht. Dabei lächelt sie eigentlich immer, wenn ich solche Dinge sage. Ich bin nicht gut darin, die richtigen Worte zu finden. Ich gehöre zu den Leuten, die auch auf einem Fußballfeld zielsicher in ein stecknadelgroßes Fettnäpfen treten. Ach was, treten, ich wälze mich darin. Ständig sage ich meine Meinung. Zu laut, zu ehrlich, zu detailliert. Aber Sophie stört sich für gewöhnlich nicht daran.
«Ist doch nicht schlimm, dass du durchgerasselt bist», sage ich und sehe von Sophie zu meiner Mutter und zurück. «Perfektion braucht einen winzig kleinen Anflug eines Fehlers, einen Schönheitsmakel, um überhaupt erst perfekt zu sein.»
«Oh Gott, Teresa!» Sophie stürzt auf mich zu, wirft sich mit voller Wucht auf meine Brust und schlingt ihre Arme so gut es geht um mich. «Ich … ich hab dich wieder. Wir haben uns alle solche Sorgen gemacht.»
«Aber warum denn?», stöhne ich und versuche, sie ein bisschen von mir zu schieben.
«Du erdrückst sie ja», sagt Papa. «Natürlich haben wir uns alle Sorgen gemacht. Du warst bewusstlos und hast wirres Zeug geredet.»
«Über … Fische?», frage ich vorsichtig.
Er nickt, und sowohl sein Gesicht als auch das von Mama hellen sich etwas auf. Man sollte sich wohl besser an den Mist erinnern können, den man bewusstlos von sich gibt.
«Es wird alles wieder gut, Schnäuzchen. Carla wollte übrigens auch mit reinkommen, aber sie haben nur Familie zugelassen.»
«Wer ist Carla?», frage ich.
Papas Gesicht verliert ein wenig die Spannung, seine Backen sacken etwas nach unten. Seine Hautfarbe ist grau und viel blasser als sonst. Es tut mir leid, dass ich offensichtlich die Ursache dafür bin. Und es tut mir leid, dass ich offenbar eine falsche Frage gestellt habe. Aber ich kenne wirklich keine Carla. So sehr ich mich auch anstrenge.
«Teresa, die Ärzte wollen nachher noch ein paar Tests machen», grätscht meine Mutter dazwischen, «aber wir wollten … Also, ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber … Welches Datum haben wir?»
Ich seufze. «Was habt ihr nur alle mit dem Datum. Natürlich weiß ich, welcher Tag heute ist.»
Das glaube ich jedenfalls. Aber ich sage ihnen besser nicht, dass in meinem Innern ein Gefühl pocht, das ich von mir nicht kenne. Es ist das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Wenn auch nur für ein paar Stunden. Einatmen, ausatmen, ruhig bleiben und das Ganze gleich noch mal.
Ich höre selbst, dass meine Stimme schwankt, wie ein Betrunkener, als ich sage: «Heute ist Mittwoch, der 25. Juni 2014.»
Dann überschlagen sich die Reaktionen. Mein Vater lacht laut, aber weder echt noch überzeugend. Meine Mutter hält sich die Hände vors Gesicht und schreit: «Um Himmels willen, Kind!», und Sophie starrt mich einfach nur an, als hätte ich einen meiner blöden Witze gemacht, die sie nicht versteht.
«Nicht?», frage ich vorsichtig. «Ist vielleicht schon der 26. oder 27. Juni? Schaut mich doch nicht so an!» Wie ein Zirkusäffchen – so begafft fühle ich mich. Teresa aus dem Kuriositätenkabinett.
«Du hast einen Witz gemacht, Teresa», sagt mein Vater. Es ist mehr eine Feststellung als eine Frage. Er hätte gerne, dass ich einen Witz gemacht hätte. Das kann ich deutlich hören.
«Was denn? Es ist …» Ein Gedanke schleicht sich in meinen Verstand und beißt sich dort fest. Er tut weh, dieser Gedanke, aber er kann nicht wahr sein. Sophies Haare, meine Haare, mein Körper, Mamas Gesicht, das Harry Klein … Alles schlägt plötzlich Saltos in meinem Hirn und verheddert sich zu einem unentwirrbaren Knäuel ängstlicher Wahrnehmung. «Es ist doch 2014, oder? Wir haben WM – morgen spielt Deutschland.»
«Die WM ist vorbei, Teresa», sagt Sophie und hustet. Sie sieht aus, als würde sie gleich weinen.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gar nichts mehr.
«Wer hat gewonnen?», frage ich leise, dabei ist mir das völlig egal. Dass ich etwas verloren habe dagegen, scheint ganz offensichtlich. Nicht nur ein paar Stunden, Tage, Wochen … vielleicht sogar Monate.
«Wir sind Weltmeister!», sagt Papa mit Stolz in der Stimme, fast so, als hätte er selbst mitgespielt.
Irritiert blicke ich von einem zum anderen, aber keiner sieht mir in die Augen. Ich schlucke schwer an diesem Knoten in meinem Hals, der mir deutlich zu verstehen gibt: Hier stimmt etwas nicht.
Ich räuspere mich. «Also, welches Datum haben wir?»
Als niemand antwortet und sie weiterhin alle auf den Boden schauen, als stünde es dort geschrieben, wiederhole ich meine Frage. Diesmal lauter: «Welches Datum haben wir?»
«Es ist Mai, Teresa», sagt Sophie. «Mai 2019.»
«Ha!», mache ich. Etwas Passenderes fällt mir nicht ein. «Netter Versuch!»
Ich schaue sie an, warte darauf, dass sie lächelt. Dieses breite Lachen, bei dem sich ihre Mundwinkel so weit nach oben ziehen, dass ihre Wangen zu wackeln scheinen. Ich schaue auf meine Mutter, warte darauf, dass sie gluckst und kichert wie eine alte Legehenne, und ich schaue auf meinen Vater, warte, dass er leise brummt und dann in ein herzhaftes, kehliges Lachen ausbricht.
Nichts passiert.
«Fünf Jahre?»
Mama schließt die Augen. Das Blau auf ihren Lidern ist sehr grell, ihren Lippenstift hat sie längst abgekaut.
«Ja», sagt Sophie schließlich. «Fünf Jahre.»
Sie und Papa tauschen einen Blick, einen der mir nicht gefällt. Es liegt zu viel darin. Zu viel Wissen, das mir fehlt. Zu viel Traurigkeit, die andere Ursachen haben muss als allein die Tatsache, dass ich mich in einem anderen Jahr befinde als der Rest meiner Familie.
Kapitel 3
Retrograde Amnesie, sagen die Ärzte. Ich kann diese beiden Worte inzwischen sogar rückwärts aufsagen. Eisenma Edargorter. Mit etwas Phantasie klingt es wie der Titel eines Abenteuerromans: «Eisen am Edargorter». Mein Leben ist einem Abenteuerroman gerade schon sehr ähnlich, fühlt sich aber noch etwas fantasymäßig an, nur ohne Drachen.
«Häufig hängt mit der Retrograden Amnesie auch eine Anterograde Amnesie zusammen.» Der Arzt rückt seine Brille zurecht, sieht mich aber immerhin direkt an. An der Wand hinter seinem Schreibtisch hängt ein hässlicher Kunstdruck von Matisse. Der Tanz von 1910, sagt mein Langzeitgedächtnis, um das ich mir offenbar keine Sorgen machen muss. Der Arzt selbst sieht aus, als wäre er einem Wilhelm-Busch-Gedicht entsprungen. Es fehlt nur der erhobene Zeigefinger, und er gäbe einen guten Lehrer Lämpel ab.
«Das bedeutet», fährt er fort, «Betroffene können neue Informationen nicht speichern. Aber das scheint bei Ihnen nicht der Fall zu sein. Und auch bei einer Retrograden Amnesie kehrt die Erinnerung in den meisten Fällen zurück.»
Ich höre nur «in den meisten Fällen». Selten in meinem Leben habe ich zu «den meisten» gehört. Ob freiwillig oder unfreiwillig. Dieses «in den meisten Fällen» soll mich beruhigen, bewirkt aber das Gegenteil. Ich rutsche auf dem Stuhl herum und finde keine bequeme Position.
Das Wort anterograde heißt rückwärts edargoretna – das klingt ein wenig wie ein Vulkan. Einer, der ausbricht und alles verändert. Und wo er wütet, da bleibt nichts, wie es vorher war.
Genauso fühle ich mich. Die Lava hat meine Erinnerungen der letzten Jahre fortgespült.
«Was kann man denn in meinem Fall tun?», frage ich und knete meine Hände. «Können Sie mir irgendetwas spritzen? Etwas, das mein Hirn zur Rückkehr in den Normalzustand aktiviert? Eine Reanimation meiner Erinnerungen? Irgendetwas mit Elektroschock vielleicht?»
Da muss es doch was geben, ich kann doch nicht einfach abwarten, bis mir irgendwann wieder einfällt, was ich die letzten fünf Jahre so gemacht habe. Ich will es mir auch nicht erzählen lassen, ich will First-Hand-Erinnerungen.
«Red nicht so einen Unsinn, Teresa», schimpft Sophie, die sich wie bei jeder Untersuchung in den letzten Stunden als mein persönlicher Medizinalrat aufführt. «Bei einer Retrograden Amnesie liegt wahrscheinlich eine Störung des episodischen Gedächtnisses zugrunde, das im Hippocampus, im Diencephalon und im Temporallappen lokalisiert ist. Ursachen sind Schädel-Hirn-Traumata, traumatische Ereignisse oder Infektionen, und man vermutet, dass auch Alkohol und Drogen eine Rolle spielen könnten.»
Sie sieht mich streng an, während sie die Fakten wikipediamäßig herunterrattert und dabei diesen «Ich-bin-bald-Ärztin»-Blick an den Tag legt.
«Sie denkt, sie wäre schon Ärztin, aber sie ist durchs Physikum gefallen», sage ich an den Arzt gewandt und zwinkere, um die boshafte Aussage etwas abzumildern. Erst dann fällt mir ein, dass das fünf Jahre her ist. Dann dürfte Sophie eigentlich nicht sauer sein, mittlerweile müsste sie das Studium hinter sich haben.
«Ich auch.» Der Arzt macht eine wegwerfende Handbewegung. «Zweimal sogar, nicht so tragisch.» Er lächelt freundlich und erinnert plötzlich gar nicht mehr an Lehrer Lämpel.
«Ich bin dreimal durchgefallen», sagt Sophie und schaut auf das Bild mit den nackten Tänzern.
«Oha», macht der Arzt.
«Das heißt?», frage ich vorsichtig. Ich interessiere mich ehrlich für die Belange meiner Schwester, bin also noch nicht ganz matschig.
«Das heißt, ich werde nie Ärztin sein.» Sie versucht zwar, mit den Achseln zu zucken, aber es wird ein sehr trauriges Zucken. Ein Zwangszucken, das sagt: Es sollte mir egal sein, ist es aber nicht.
Ich schniefe und sage dann leise: «Das … tut mir leid, Sophie. Das tut mir unheimlich leid, ich wollte nicht …» Zerknirscht beiße ich mir auf den Daumen. «Das war so doof von mir …»
Sie winkt ab. Die Geste ist noch weniger überzeugend als ihr Achselzucken. «Ich studiere jetzt Biochemie und mache ein paar Schichten mehr im Krankenhaus. Schon okay. Alles nicht so einfach, seit du weg bist.»
«Seit ich weg bin?»
«Ja, seit wir nicht mehr zusammenwohnen», sagt sie.
«Wir wohnen nicht mehr zusammen? Wo wohne ich dann?»
Wohne ich vielleicht bei dem Mann, der mir das von den Fischen erzählt hat? Der, der bei unserem Date genauso nervös war wie ich? Ich hoffe, Sophie sagt ja. Denn augenblicklich fühle ich mich, als wäre ich nicht nur erinnerungslos, sondern auch noch obdachlos. Was sicher Unsinn ist. Ich hoffe nur, ich wohne nicht wieder bei unserer Mutter.
Der Arzt räuspert sich – zu unserer Wohnsituation kann er ja auch nun wirklich nichts beitragen. «Bleiben Sie ruhig noch einen Moment sitzen. Wir machen später noch ein paar Tests, das CT war unauffällig, und so wie es aussieht, können Sie morgen schon nach Hause.»
«Ja, wenn ich bis dahin weiß, wo das ist», erwidere ich spöttisch.
Der Arzt steht auf.
«Du hast eine Wohnung gekauft», sagt Sophie und sieht mich endlich wieder an.
Ich lache laut. Weil das eine sehr abwegige Vorstellung meines eigenen Ichs ist. «Der war gut!»
«Hast du wirklich.»
Sie meint das ernst!
«Ich habe eine Wohnung gekauft? Von welchem Geld?»
«Du verdienst gut», sagt sie knapp.
Irgendetwas an der Art, wie sie das sagt, verrät mir, dass es ihr nicht gefällt. Ich weiß nur noch nicht, ob es ihr nicht gefällt, dass ich gut verdiene, oder ob ihr Missfallen mehr mit der Art meines Erwerbs zusammenhängt.
«Ich … Ich mache doch nichts Unmoralisches?»
Lehrer Lämpel zögert sein Gehen noch hinaus. Ich wette, er will auch wissen, womit ich mein Geld verdiene. Vielleicht sieht er mich in Gedanken lasziv eine Stange hinunterrutschen. Oder aber, er glaubt, ich verkaufe verschämt kichernden Hausfrauen Sextoys zur Wiederbelebung ihres eingeschlafenen Liebeslebens. Mache ich am Ende wirklich so etwas?
«Was meinst du mit unmoralisch?», hakt Sophie nach.
«Na ja …» Ich beschließe, es langsam anzugehen, und werfe Dr. Amnesie einen bedeutungsvollen Blick zu. Aber offenbar kann ich das nicht mehr so gut, oder er ignoriert es. Denn er sammelt jetzt betont langsam seine Papiere zusammen. «Sophie, bin ich in einem Callcenter und mache lästige Werbeanrufe, oder vermittle ich Leiharbeiter für einen Hungerlohn an geizige Arbeitgeber oder … Sag nicht, dass ich Versicherungsvertreterin geworden bin?»
Sophie hüstelt, und ich befürchte schon das Schlimmste, als sie endlich den Kopf schüttelt und lächelt. Wenn auch nur sehr zaghaft. «Du bist Galeristin in der New Art of Munich.»
«Hä?», bringe ich hervor. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich erwartet habe.
«Moment, du willst mir erzählen, ich habe meine eigene Wohnung und arbeite in einer renommierten Galerie, nicht am Kassenhäuschen, sondern als Kuratorin?»
«Exakt.»
Lehrer Lämpel wird auf einmal sehr viel schneller mit dem Zusammenpacken. Was für mich eine Enthüllung gigantischen Ausmaßes ist, scheint ihn zu langweilen. Er hat doch auf Pole-Dance spekuliert, da bin ich mir sicher.
«Unsere Mutter ist sehr stolz auf dich», fügt Sophie hinzu, nachdem der Arzt gegangen ist. Eine Information, die sehr viel darüber aussagt, was Sophie von meinem Leben hält.
«Oje», presse ich heraus. «Und du, wie findest du das?»
Sophie macht einen seltsamen «Mmmh»-Laut, zieht die Unterlippe nach innen und schaut wieder an die Wand, als hätte sie neuerdings ihre Liebe für Matisse entdeckt. Dabei kann sie mit Kunst genauso wenig anfangen wie unser Vater.
Schließlich erbarmt sie sich: «Es ist beeindruckend, was du die letzten Jahre geschafft hast. Trotz allem. Also …» Sie bricht ab, es klingt aber so, als wollte sie noch etwas sagen.
«Beeindruckend? Sophie, du bist meine Schwester, sag mir bitte deine Meinung und erspar mir das Geheuchel. Ich habe vielleicht vergessen, was die letzten fünf Jahre so los war, aber ich weiß noch ganz genau, wie es aussieht, wenn du lügst oder mir etwas verheimlichst.»
Doch statt mir ihre Wahrheit ins Gesicht zu knallen, macht Sophie einen Rückzieher. Sie steht auf, schiebt den Stuhl zurück und sagt allen Ernstes: «Das ist alles ein bisschen viel im Moment, glaube ich. Wir kriegen das schon hin. Ruh dich erst einmal etwas aus. Dann wird schon alles wiederkommen.»
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es ihr sehr viel lieber wäre, ich würde die Wahrheit selbst herausfinden, als dass sie mir mein Leben erklären müsste. Was verständlich ist, und doch macht mir gerade das Angst.
«Sophie, was hältst du davon, dass ich Kuratorin bin?», beharre ich und packe sie am Ärmel, bevor sie an mir vorbei aus dem Zimmer gehen kann. Ich will nicht allein hier sein. Ich will überhaupt nicht allein sein mit diesem Leben, das angeblich mir gehört. Und wenn ich mich dazu mit meinen Zähnen in der Wolle ihres Pullis verbeißen muss, dann ist das okay. Die paar Fusseln kann ich ab.
Sie dreht sich um, und ein trauriger Ausdruck huscht über ihr Gesicht. «Wenn du mich fragst, finde ich es sehr schade, dass du das Tätowieren aufgegeben hast.»
«Oh», mache ich. «Ich habe ganz damit aufgehört?»
Sie nickt.
«Wann?»
«Vor ein paar Jahren.»
Ratlos sacke ich auf den Stuhl zurück. Als Celine, Sophie und ich klein waren, haben wir vor dem Zubettgehen immer ein Spiel gespielt. Ein nicht ungefährliches. Zwei von uns stellten sich auf die Bettdecke, während die andere sie unter unseren Füßen wegzog. Sophie ist dabei einmal so heftig auf die Bettkante geknallt, dass sie am Kopf genäht werden musste. Später hat sie immer behauptet, das wäre der Tag gewesen, an dem sie sich für die Medizin entschieden hat.
Ich fühle mich, als zöge man mir nicht nur eine Bettdecke, sondern mein ganzes Leben unter den Füßen weg. Und darunter ist nichts. Nichts, was mich auffängt.
«Warum habe ich aufgehört zu tätowieren?», frage ich erneut. Meine Augen brennen, und mein Herz rast. Als müsste es die Geschwindigkeit einhalten, mit der sich die vergessenen fünf Jahre in mein Gedächtnis hämmern wollen. Aber mein Kopf ist ein Speicher, den man ausgeleert hat, ohne mir zu sagen, wo der Inhalt hingekippt wurde.
«Das … weiß ich nicht.»
Sie lügt. Und wie sie lügt. Warum tut sie das?
«Was sagt Celine dazu?»
Einen Moment lang wird Sophie ganz bleich. Was irgendwie schlimmer ist als lügen.
«Du kennst sie – sie stand doch immer hinter deinen Entscheidungen», sagt sie schließlich. Ihre Stimme klingt dabei fremd, und ich frage mich, welche Beziehung wir überhaupt miteinander haben. Wir drei. Im Jahr 2019.
Können wir nicht so tun, als wären diese fünf Jahre nicht geschehen? Können wir nicht so tun, als wäre alles beim Alten? Und gut. Denn irgendetwas ist gar nicht gut, das spüre ich.
Kapitel 4
Fünf Jahre zuvor – Henry
Ich stehe vor dem Café und reibe mir im Gesicht herum. Merke: Ein Glaskasten mit der Kuchenkarte ist kein Spiegelersatz. Irgendwo klebt da doch bestimmt noch Öl und vermischt sich mit dem Schweiß auf meiner Stirn. Schließlich bin ich die fast drei Kilometer hierher gesprintet.
Noch mal ein Blick auf mein Spiegelbild in der Scheibe, aber um die Erdbeersahnetorte und die Schwarzwälderkirsch herum lässt sich nichts erkennen. Egal, dann eben mit Ölflecken. Es ist doch nur Teresa. Aber was heißt überhaupt nur …? Ich sehe Emir die Augen verdrehen. Mit einer Frau ist es wie mit einem Auto: Konzentriere dich auf die Karosserie. Die macht am wenigsten Ärger. Wenn du dich erst mal mit der komplizierten Steuerelektronik beschäftigen musst …
Ach was, das ist Teresa, und sie fährt ihr Auto mit Hilfe einer alten Zange, also kann es ihr nicht allzu viel ausmachen, dass ich keinen Boxenstopp mehr in der Dusche machen konnte.
Reiß dich zusammen, Henry. Rein da jetzt.
Drinnen entdecke ich sie nicht gleich. Es war doch um drei im Zweinachviertel, oder?
Dann sehe ich sie. Sie sitzt auf einer Bank an dem bodentiefen Fenster, von dem man in den Hinterhof sehen kann. Es duftet stark nach Kaffeebohnen und frischgebackenem Kuchen. Teresa hebt jetzt den Kopf, und ich winke ihr zu.
Die langen braunen Haare hängen ihr über die Schultern, sie trägt ein weißes Oberteil und eine Jeansjacke darüber. Ihre Lippen glänzen rot, ansonsten wirkt sie ungeschminkt – und sehr schön. Ob sie noch immer so ein Freigeist ist wie früher? Ob sie sich noch immer nichts aus der Meinung anderer Leute macht? Ich hoffe es.
Jetzt sieht sie mich, und ihr gerade noch so ernstes Gesicht hellt sich ein wenig auf. Wahrscheinlich wird meines gerade auch ein paar Farbtöne fröhlicher.
«Hey, du bist da!», ruft sie und springt so ruckartig auf, dass sie mit dem Oberschenkel gegen die Tischplatte stößt – aber keine Miene dabei verzieht.
«Hast du etwa gedacht, ich würde dich sitzenlassen?», frage ich, als ich direkt vor ihr stehe. Ich grinse irgendwie blöd. Meine Finger kribbeln. Ich strecke sie, aber das Kribbeln geht nicht weg. Muss eine Nebenwirkung meines rasanten Laufstils sein.
«Nein», antwortet sie und lacht.
Jetzt stehen wir voreinander. Was tun? Sie umarmen? Zu viel … Ihr die Hand geben? Zu steif … Küsschen auf die Wange? Affig … Vielleicht sollte ich ihr einfach nur eine Hand auf den Arm legen.
Herrgott, seit wann ist so etwas Einfaches so schrecklich kompliziert?
Unwillkürlich streiche ich mir noch einmal schnell über die Haare, bereue es aber sofort. Was wenn ich das Öl jetzt auch noch auf meinem Kopf verteilt habe? Egal. Ich beuge mich mich vor und lege meinen Arm kurz um ihre Schultern. Sie kommt mir zierlich vor. Aber irgendwie fühlt sich der Größenunterschied zwischen uns gut an. Er scheint auf den Zentimeter genau perfekt zu sein.
«Schön, dich zu sehen», sage ich und strahle dabei wie mein eigener Reaktor. Zurückhaltung wäre vielleicht angebracht.
«Ja, ich freu mich auch.» Sie mustert mich kurz. «Du hast da was …», sagt sie und streckt ihre Hand nach meiner Schläfe aus. Ich nehme meine zur gleichen Zeit nach oben, und dann berühren sich für einen Moment unsere Fingerspitzen. Eine gefühlte Ewigkeit später atme ich wieder aus. Wie lange man die Luft anhalten kann, ohne es zu merken, ist wirklich erstaunlich.
«Das ist Öl», erkläre ich und verziehe das Gesicht. «Entschuldige. Mir ist was total Blödes passiert. Ich hab mich ausgesperrt … Also, ich wollte noch duschen und mir was Anständiges anziehen, aber dann ist mir die Wohungstür ins Schloss gefallen, und das war’s dann …» Ich hab mir notdürftig das Gesicht mit alten Lumpen aus der Werkstatt abgewischt und mir vom Nachbarn ein T-Shirt geliehen. So genau muss sie das ja aber nicht wissen. Ich lache. «Sorry für den Aufzug.»
«Mir gefällt’s», sagt sie. «Wirklich.»
Teresa lässt sich wieder auf die Bank fallen, ich setze mich ihr gegenüber.
«Ich wollte nicht zu spät kommen», erkläre ich. «Am Ende bist du weg, und wir verpassen uns wieder um Jahre.»
«Das wäre tragisch», erwidert sie und streicht sich über den Pony. Dann greift sie nach der Getränkekarte und dreht sie in ihren Händen. Sie ist nervös, bei mir sind es die drei Tassen Kaffee heute Morgen. Ganz bestimmt.
«Absolut!»
Den Blick festgenagelt an ihr, räuspere ich mich und sage: «Ich renne auch nicht mehr davon wie beim letzten Mal.»
«Schon okay», antwortet sie und fragt dann: «Du bist also wieder in München?»
«Ja, ich bin wieder hier. Und du zum Glück auch noch.»
Wir bestellen bei der Kellnerin, die an unseren Tisch getreten ist, einen Eistee und ein Radler für mich. Es ist mir fast lästig, das Gespräch mit Teresa deswegen unterbrechen zu müssen.
«Es fühlt sich richtig gut an, wieder hier zu sein», erkläre ich, als die Kellnerin abzieht. «Stuttgart war ganz nett für ein paar Jahre. Aber die Berge haben mir gefehlt, das ganze südliche Flair, die Werkstatt, alte Freunde und überhaupt die Leute hier.»
«Was hast du in Stuttgart gemacht?»
«Mir mit meiner kleinen Schwester eine Wohnung geteilt – Diane war dort für Psychologie eingeschrieben. Und ich habe bei Daimler ein duales Studium gemacht. Viel Lernerei dafür, dass ich einfach nur an Autos herumbasteln will …» Ich rede zu viel. «Und du? Was hast du gemacht?»
«Ich studiere noch. Kunstgeschichte. Aber eigentlich gehört meine Leidenschaft dem Zeichnen. Ich arbeite in einem Tattoostudio, zeichne Vorlagen und so.»
Ich nicke. Genau die Teresa, die ich gekannt habe. Ein bisschen verrückt, herrlich unangepasst und immer eher gegen den Strom als mit. «Das ist cool. Passt zu dir. Du warst schon immer anders.»
Das ist ein Kompliment, und hoffentlich versteht sie es als solches.
Sie verzieht den Mund. «So anders, dass du mich auf keinen Fall dabeihaben wolltest, wenn ihr unterwegs wart. Celine, Markus, du … und wie die anderen alle hießen.»
«Na ja, du wusstest dir doch schon immer zu helfen.» Ich lache. «Wie du es geschafft hast, dich in den Kofferraum zu mogeln und mit zum See zu fahren. Das war schon ’ne Nummer.»
«Es war peinlich!», erklärt sie und hält sich die Hände vors Gesicht. Schöne, kleine Hände mit zarten Fingern und gepflegten Nägeln ohne bunte Kriegsbemalung. «Und es war ziemlich unbequem zwischen den ganzen Bierdosen.»
Die Erinnerung bringt mich zum Lachen. «Du hättest an deine Badesachen denken können.»
«Oh Gott, du weißt es noch.» Teresa schüttelt sich.
«Könnte ich nie vergessen», murmele ich.
«Ich war ein schlimmes Anhängsel, oder?»
Schlimm war nur, dass sie irgendwie tabu war. Als Celines kleine Schwester, die nie müde wurde, zu betonen, was Teresa für ein «unreifes Baby» war.
«Nein, du warst …» Kann ich das sagen? Mein Lächeln gerät ein wenig schief, als ich sage: «Du warst ein sehr hübsches, sehr freches Anhängsel, und ich wusste an dem Tag nicht mehr, wo ich hinschauen sollte. Du bist ja nur in Unterwäsche schwimmen gegangen … Aber ich konnte unmöglich starren, Celine hätte mir die Augen ausgekratzt, wenn ich mich an dich rangemacht hätte.»
«Hattest du das denn vor?», fragt sie und senkt den Blick ein wenig.
«Jetzt bringst du mich in Verlegenheit», behaupte ich. So süß, wie verlegen sie jetzt wirkt.
«Wusste gar nicht, dass das geht.» Sie schaut wieder hoch. Mit funkelnden Augen.
«Oh doch, schon. Manche Menschen können das durchaus.»
«Ich war ganz schön verknallt in dich», platzt sie heraus.
«Warst du? Hab ich gar nicht gemerkt.»
«Lügner», erwidert Teresa spöttisch.
«Erwischt. Aber ich hab mich geschmeichelt gefühlt. Wirklich.»
«Ach was, dich haben sie doch alle angehimmelt, und ich war nur die mit den verrückten Klamotten, die von ihren Schwestern mit Filzstiften bemalt wurde, während sie im Bus schlief.»
Ich seufze und lege den Kopf ein wenig schief. «Wer sagt denn, dass ich mich dabei nicht genauso unwohl gefühlt habe wie du?»
Das nimmt sie mir nicht ab. Dabei würde ich ihr gerne zeigen, wie ernst es mir mit dieser Aussage ist. Dass die Mädchen mich meistens nicht halb so interessiert haben wie mein Mofa. Sie runzelt die Stirn, stützt die Ellbogen auf den Tisch und protestiert: «Zwischen Filzstift und Frauenschwarm der Schule liegen Welten!»
Ich zucke leicht die Achseln. «Gar keine so großen Welten, wie du denkst!»
«Ozeane», antwortet sie und ergänzt dann noch: «Weltmeere.»
«Vielleicht der Eisbach, mehr nicht. Außerdem glaube ich an die tektonische Plattenverschiebung.»
«Und an die Evolution?»
«Absolut. Aber du warst noch nie das hässliche Entlein, für das du dich gehalten hast, Teresa. Du warst schon immer interessanter als die Tussis aus der Kollegstufe.»
Jetzt wird sie rot und lächelt so charmant dabei. Diese