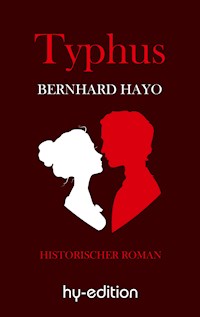
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1790. Eine todbringende Krankheitswelle bedroht das beschauliche Städtchen Guldenburg. Verzweifelt ruft der Magistrat den jungen, doch bereits renommierten Arzt Leander Fabrizius um Hilfe im Kampf gegen die unbekannte Seuche. Der ehrgeizige Mediziner sieht die Chance, sein Wissen und seine Fähigkeiten zum Wohle der Menschen anzuwenden und zugleich seine Forschungen weiter voranzutreiben. Unterstützt von seinem undurchsichtigen Adlatus Florian Häusler stellt er sich der Herausforderung, die seinen ganzen Einsatz fordern wird. Inmitten von Krankheit, Mühen und Elend begegnet er der jungen Rosalie, Tochter eines Tagelöhners, die dank seiner Behandlung dem Tod entgeht. Zwischen beiden entspinnen sich zaghaft zarte Bande. Doch trotz seines erfolgreichen Wirkens sieht sich Leander Fabrizius Skepsis und Unverständnis für seine Arbeit gegenüber. Missgunst und Intrigen stören nicht nur sein privates Glück, sondern bringen ihn und Rosalie schließlich in höchste Gefahr. Bernhard Hayo entfaltet ein farbenprächtiges Panorama der Welt des ausgehenden 18.Jahrhunderts: Vom Straßenjungen im Elendsviertel der Stadt bis zum Magistratsherrn im großbürgerlichen Wohlstand zeichnet er plastisch und detailreich ein überaus lebendiges Bild seiner Figuren und Schauplätze. Dabei verwebt er geschickt historische Hintergründe mit Fiktionalem zu einer ebenso spannenden wie anrührenden Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Frau Burga in Liebe und Dankbarkeit
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Nachwort
Kapitel 1
Das Mädchen saß da, mit abwesendem Blick, vor der alten, verrotteten Holztür auf der vom Regen nassen Steinstufe, die Beine mit durchgedrückten Knien von sich gestreckt. Die ursprünglich blonden, nicht ganz schulterlangen, glatten Haare hatten ihren Glanz verloren und hingen in mattem Grauschimmer als feuchte Strähnen am Kopf herab. Das knielange, vergilbte weiße Leinenhemd war übersät mit Blut und Schmutz und klebte an vielen Stellen am Körper. Es mochte vielleicht 16, 17 Jahre alt sein. Genau konnte man ihm das in seinem Zustand nicht ansehen.
Die beiden Männer, die gerade erst neu in der Stadt angekommen waren, näherten sich dem Mädchen, das allerdings seinerseits keine Notiz von ihnen nahm. In seiner Halsbeuge sah der jüngere der beiden Männer einen kleinen, runden Fleck, der sich rötlich von der blassen Haut abhob. Er schob mit dem Zeigefinger den halb offenen Kragen des Hemdes ein wenig zur Seite, nickte leicht und sagte dann zu seinem Begleiter: „Typhus!“
Dieser runzelte besorgt die Stirn. Dann setzten sie ihren Weg durch die schmutzigen Straßen der verwinkelten Oberstadt fort. Kleine Häuser und Hütten waren an die Stadtmauer gebaut. Überall lag Unrat. Dort, wo es kein Pflaster gab, hatte der Regen der vergangenen Tage die Straßen und Wege knöcheltief aufgeweicht. Der Stallmist türmte sich vor den kleinen Ställen, die seitlich an die heruntergekommenen Behausungen angebaut waren. Diese Holzverschläge beherbergten Hühner und Ziegen, die ihren Besitzern ein bescheidenes Auskommen verschafften. Der Gestank von Abfall, fauligem Wasser, Kot und Urin hing in der Luft. Überall in der Stadt, besonders aber hier, in den ärmeren Vierteln, war es üblich, den Inhalt der Nachtgeschirre nächtens aus dem Fenster zu kippen. Auch des Tags erleichterten sich viele Zeitgenossen ungeniert in die Ecken und hinter Mauervorsprünge der verwinkelten Gassen und Straßen der altehrwürdigen Kleinstadt. Die Stadtoberen versuchten seit Jahren vergeblich, diese Unart auszurotten. Und als wäre es nicht genug des Schmutzes, flossen die Abwässer aus den Häusern direkt auf die Straße und überfluteten die schmalen Rinnen. Gelegentliche Regengüsse reichten nicht aus, um die Exkremente fortzuspülen. Und so sammelte sich der Unrat der Menschen in dem offenen Kanal in der Mitte der Hauptstraße, um sich dann jenseits der Stadtmauer in das dort vorbeifließende Flüsschen Riste zu ergießen. Die meisten Bürger mieden diesen Bereich, denn das sonst sehr klare Gewässer nahm an dieser Stelle eine Auge und Nase beleidigende Qualität an.
Mit kleineren Sprüngen und Hüpfern beständig den schmutzigen Pfützen und schlammigen Stellen ausweichend, gelangten die beiden Männer durch die obere Kirchgasse entlang der Kirchhofmauer über den Pfarrstieg zum Marktplatz. Der Jüngere der beiden machte einen sehr gepflegten Eindruck. Die weißen Seidenstrümpfe steckten in unverhältnismäßig groben, aber praktischen Reiseschuhen. Die schwarze, nach der derzeitigen Mode unter den Knien gebundene Hose war aus gutem Stoff, was auf einen wohlsituierten Träger schließen ließ. Der bequeme Reiserock stand offen und offenbarte darunter eine schlichte, aber saubere, dunkelgraue Weste. Diesem Herrn war schon vom Gesicht her anzusehen, dass er einem gehobenen Stand angehörte und in einer solchen Umgebung nicht zu Hause war. Der ausladende Zweispitz auf dem Kopf verlieh dem Träger einen militärischen Anschein.
Sein Begleiter bot dagegen ein grobschlächtigeres Bild. Mit seinem wenig sorgsam rasierten Gesicht blickte er eher unfreundlich drein. Der Zustand seiner Garderobe ließ darauf schließen, dass er keine besondere Sorgfalt auf die Auswahl und Pflege seiner Kleidung verwendete.
Der Marktplatz, ein Carré im Zentrum des Städtchens, gab den Neuankömmlingen den Blick auf ein imposantes Rathaus frei. Er wurde umrahmt von mehr oder weniger prächtigen Bürgerhäusern, von denen einige ihre besten Zeiten wohl schon hinter sich hatten. Im Vergleich zu anderen Städten, die die beiden Fremden kennengelernt hatten, zumal ihrer Heimatstadt Halberstadt, machte dieser Marktflecken einen eher altertümlichen Eindruck.
„Hier herrscht wohl noch Kaiser Karl“, sagte der Jüngere. Der andere quittierte das mit einem spöttischen „Iss wohl so!“.
Das alte Rathaus, ein wuchtiger, spätgotischer Fachwerkbau, dessen vorderer Teil von mächtigen Eichenpfosten getragen wurde und der so eine etwa zehn Meter lange und sechs Meter breite Markthalle überdachte, die mit ausgetretenen, rechteckigen Steinplatten ausgelegt war, dominierte den Marktplatz. An jeder Ecke der vorderen Fassade erhob sich ein spitz behelmter sechseckiger Erkerturm. Es war eine außergewöhnliche Konstruktion, die das Gebäude von allen umstehenden Häusern erheblich abhob. Hier sollte ein repräsentatives Bauwerk den Anspruch der wohlsituierten, bürgerlich geprägten Stadtvertretung bezeugen. Selbst bei diesem nicht unbedingt einladenden Wetter verfehlte dieses Gebäude seine Wirkung auf den Betrachter nicht.
Die beiden Ankömmlinge schauten sich um. Hinter dem Rathaus erblickten sie die imposante Stadtkirche. Mit ihrem achteckigen Turm, der hochgezogenen Dachspitze und der mächtigen Mauer, die den Kirchplatz mitsamt dem angrenzenden Kirchhof umfasste, bot sie einen wehrhaften Anblick. Dahinter reihten sich einige Wohnhäuser, die die Straße nach Osten säumten. Der grob gepflasterte Marktplatz erstreckte sich bis zum Rathaus auf der gegenüberliegenden Seite. Er war von Häusern eingerahmt, die auf diese Weise ein weiträumiges geschlossenes Rechteck bildeten. Am anderem Ende befand sich der große runde Marktbrunnen.
Die Männer betraten die Markthalle, an deren Rückseite eine düster wirkende Holztreppe zu den oberen Stockwerken des Rathauses führte. Hier befanden sich die Amtsräume des Bürgermeisters und der Ratssaal.
Ein älterer Stadtbediensteter empfing sie, und nachdem der Jüngere sich vorgestellt hatte, sagte er: „Bürgermeister Blumenbach erwartet Euch bereits.“ Der Gast klopfte an die Tür, auf die der Ratsdiener gewiesen hatte, und sie traten nach gut vernehmbarer Aufforderung ein.
Der Bürgermeister, ein großer Mann mit leicht angegrautem Vollbart und besorgter Miene, stand hinter einem schweren Schreibtisch voller Dokumente und Bücher. In einem mit edlem Stickwerk versehenen Wams mit einem schmalen Fellkragen steckte in ein beeindruckender Bauch, über dem sich eng und stramm eine mit filigranen Ornamenten bestickte Weste spannte.
„Ihr seid also der berühmte, hochgeehrte und studierte Doktor aus Halberstadt, auf dem all unsere Hoffnung liegt“, begann er umständlich und in einem Tonfall, der seine Stellung unterstreichen sollte.
„Ja, ich bin Doktor Leander Fabrizius, Doctor medicinae am Militärhospital zu Halberstadt. Seid gegrüßt! Und dies hier ist mein Adlatus Florian Reiser.“ Dieser verbeugte sich mit untertäniger Geste.
„Wir werden versuchen, Eure Stadt von dem Übel zu befreien, von dem Ihr in Eurem Schreiben berichtet habt. Uns ist schon eine Person mit eindeutigen Merkmalen aufgefallen, und ich bin mir fast sicher, auch schon sagen zu können, welche Seuche Eure Stadt heimsucht.“
„Sprecht! Was glaubt Ihr, ist es, das bereits so viele unserer Bürger befallen hat?“, unterbrach ihn der Bürgermeister voller Ungeduld. „Unser Stadtmedicus hat schon befürchtet, die Pest könnte uns wieder heimsuchen. Wir sind alle in großer Sorge!“
„Ich glaube nicht, dass es die Pest ist", versuchte Leander Fabrizius den verängstigt wirkenden Bürgermeister zu beruhigen. „Es handelt sich hier dem Anschein nach um ein Fleck- oder Nervenfieber mit dem Namen ‚Typhus’“, sagte Leander sehr überzeugt, und er konnte beobachten, wie diese Eröffnung den Bürgermeister traf, sodass dieser sich erschüttert auf seinen Stuhl fallen ließ.
„Furchtbar! Wie können wir das überstehen?“, seufzte Blumenbach und fuhr sich so ungelenk mit der Hand über die mit Schweißperlen bedeckte Stirn, dass die weiß gepuderte Perücke nach hinten rutschte. Auf diese Weise gab er ein unfreiwillig komisches Bild ab, das Florian zum Grinsen brachte. Schnell wandte dieser sich ab, um seine Erheiterung zu verbergen. „Diese Krankheit hat unseres Wissens in den Städten Müllens und Webernheim, aber auch andernorts, verheerend gehaust und viele Hunderte von Toten gefordert. Was können wir tun? Eine große Angst geht um in der Stadt und lähmt das Leben in unserem doch sonst so schönen Flecken.“
„Ich muss zunächst die Gelegenheit haben, die bekannten Fälle zu untersuchen und dann auch zu behandeln", antwortete Leander. „Da ich die Gegebenheiten der Stadt noch nicht kenne, würde ich mich gerne etwas genauer umsehen. Eines kann ich jedoch schon jetzt sagen: Um die Ausbreitung der Epidemie zu verhindern, sind besondere Vorkehrungen und Einrichtungen vonnöten. Wir brauchen ein Hospital. Einen größeren Raum oder besser noch ein Haus, in dem die Kranken untergebracht werden können. Ruft Ihr Euern Rat zusammen! Ich werde meine Absicht dort genau erläutern, und Ihr könnt die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Es gilt keine Zeit zu verlieren, wenn wir erfolgreich sein wollen! Wann könnt Ihr eine Ratsversammlung einberufen? Ich denke, die Angelegenheit ist von so großer Bedeutung, dass die Herren Räte informiert sein sollten!"
„Das lässt sich einrichten. Wir haben Euch erwartet und sind in darauf vorbereitet, uns zu versammeln. Ich lasse die Herren Räte für morgen zusammenrufen. Doktor von Brooch, unser Stadtmedicus wird dann auch da sein. Sie sollten sich mit ihm beraten und sich seiner Unterstützung versichern. Er kennt die Menschen hier seit vielen Jahren und weiß auch, von welchen Krankheiten sie schon befallen waren.“
Der Tonfall des Bürgermeisters ließ erkennen, dass man eigentlich auch weiterhin auf den Rat des alten Stadtmedicus hören wollte, und mit einem unguten Gefühl unsicherer Erwartung verabschiedete sich Leander: „Gut, dann werden wir nun unsere Herberge beziehen. Der Kutscher hat das Gepäck sicher schon abgeliefert. Wir sehen uns dann also morgen.“ Und insistierend fragte er nun noch einmal sehr deutlich: „Wann wird die Ratssitzung stattfinden?“
„Ich werde den Rat für zehn Uhr morgen früh einberufen.“
„Danke, wir werden da sein.“
Mit einem kurzen Kopfnicken bedeutete Leander seinem Gehilfen, der während des kurzen Gesprächs nahe der Tür gestanden hatte, dass sie gehen würden.
Florian Häusler war jetzt seit etwa einer Woche in Leanders Diensten. Als Sohn eines in der Umgebung von Halberstadt tätigen Baders und Zahnbrechers hatte er einige Erfahrung im Umgang mit Patienten aus fast allen Schichten der Bevölkerung. Besonders geschickt war er im Versorgen von Wunden und Geschwüren. Auch im Zusammenmischen von Salben, Tinkturen und diversen Medizinen kannte er sich recht gut aus, sodass er Leander ein nützlicher Gehilfe sein konnte, der ihm lästige Arbeiten abnahm. Dadurch konnte sich Leander intensiver der Erforschung von Krankheiten und der Niederschrift der Verläufe widmen. Florian war ein ruhiger Zeitgenosse und Leander hatte nach dieser ersten Woche der Zusammenarbeit das Gefühl, diesen dienstbaren, aber verschlossenen und manchmal eigenartigen Gesellen noch nicht richtig zu kennen. Aber er verdrängte diese Gedanken ob der anstehenden Aufgaben, denn einen anderen Gehilfen hätte er in der gebotenen Eile nicht finden können.
Der Doktor und sein Adlatus verließen das Rathaus und überquerten den Marktplatz, der von einem gemauerten Graben durchzogen war. Darin sammelte sich, wie sie schon gesehen hatten, ein Teil der Abwässer aus den angrenzenden Häusern und den Rinnen der engen Seitenstraßen und wurde in die Riste, den kleinen Fluss, der die Stadt von Westen nach Nordosten umfloss, geleitet.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes befand sich eine Häuserzeile, an deren Ecke, die von Marktplatz und Marktstraße gebildet wurde, sie ein großes Gebäude erblickten. Auf einer an einem ausladenden, gusseisernen Ausleger befestigten, runden Kupfertafel prangte der vergoldete Kopf eines Ochsen. Hier war also das „Gasthaus zum Goldenen Ochsen“.
Man hatte ihnen gemäß dem letzten Brief des Bürgermeisters hier die Zimmer reserviert. Erwartungsfroh, nach der beschwerlichen Anreise eine gute Unterkunft vorzufinden, überquerten sie den Platz. Die Aussicht auf ein warmes Zimmer zum Trocknen und Auslüften der Kleider sowie ein warmes Mahl beschleunigte ihre Schritte.
Der Markt war kaum belebt. Nur wenige Menschen gingen achtlos an ihnen vorbei. Über der Stadt lag eine bleierne Schwere und man konnte die Not, die Furcht vor der todbringenden Krankheit förmlich spüren.
Sie betraten das Gasthaus, das von außen einen ordentlichen und einladenden Eindruck machte. In der niedrigen, aber durchaus geräumigen Gaststube waren nur wenige Gäste. Der Wirt stand am Fenster. Er hatte seine neuen Gäste bereits kommen sehen.
„Guten Tag“, sagte er betont freundlich, „Ihr seid sicher die Doctores, die uns in unserem Elend helfen sollen, mit dieser verdammten Seuche fertigzuwerden.“
„Guten Tag. Das ist Doktor Fabrizius“, kam Florian einer Antwort Leanders zuvor, „ich bin der Adlatus des Herrn Doktor, und wir werden Eure Seuche so gründlich ausrotten, dass keiner mehr je daran denken wird. Der Doktor ist ein hochgelehrter Arzt und im ganzen Land berühmt für seine Methoden. Ihr könnt Euch glücklich schätzen, dass er sich die Zeit genommen hat, hierher zu kommen!“
Leander mochte die vorlaute Art seines Gehilfen nicht. Es war ihm peinlich, wenn Florian so prahlerisch redete, aber er gebot seinem Gehilfen nicht Einhalt, da er sich auch weiterhin seiner zuverlässigen Dienste sicher sein wollte. Er grüßte ebenfalls freundlich, nahm den Hut ab und entledigte sich seines Mantels. Florians Vorstellung hatte ihre Wirkung nicht verfehlt, und so entgegnete der Wirt sichtlich beeindruckt und eingeschüchtert:
„Wir alle haben Euch voller Ungeduld erwartet. Die Bürger von Guldenburg sind verzweifelt und setzen all ihre Hoffnung auf Euch. Ihr seid sicher müde von der Reise und wollt Euch ausruhen. Die Straßen sind ja in einem elenden Zustande, und das Wetter hat die Reise sicher auch nicht angenehmer gemacht. Ich zeige Euch die Zimmer. Richtet Euch ein, anschließend könnt Ihr etwas essen. Der Kutscher hat das Gepäck bereits abgeliefert, es steht nebenan. Der Julian, welcher mein Sohn ist, wird es gleich nach oben bringen.“ Der Wirt war freundlich und wohl auch froh, Gäste für eine längere Zeit in seinem Haus zu haben. Es schien nicht so, als ob in dieser verseuchten Stadt viele Gäste sich länger aufhalten mochten. Die Männer stiegen also die alte, ausgetretene Holztreppe nach oben, und der Wirt zeigte ihnen die beiden Zimmer. Die kleinen, schmutzigen Fensterscheiben der niedrigen Stuben verbargen den Blick zur Straße beinahe vollständig. Die Stuben, welche nebeneinander lagen, waren wohl schon längere Zeit nicht mehr vermietet und gelüftet worden, denn sie empfingen die Gäste mit einem feucht-modrigen Geruch. Von unten drang der gedämpfte Lärm der Gaststube, sodass Leander befürchtete, hier weder in Ruhe schlafen noch vernünftig arbeiten zu können.
Nachdem der Sohn des Wirtes ihnen die Gepäckstücke heraufgebracht hatte, stellte Leander fest, dass ihm in seinem Zimmer nicht mehr viel Platz blieb. Die Kiste mit den Instrumenten, die Bücher und Hefte für Aufzeichnungen nahmen viel Raum ein und so war das kleine Zimmer fast völlig ausgefüllt, und er konnte sich kaum bewegen. Hier musste eine andere Lösung her.
Er verstaute die wichtigsten Sachen in dem kleinen, nachlässig ausgewischten Schrank, wusch sich in der bereitstehenden Schüssel, nachdem er aus dem verbeulten Kupferkrug etwas Wasser hineingegossen hatte, Gesicht und Hände, so gut es ging, und verließ dann das Zimmer. Draußen auf dem Treppenabsatz stand schon Florian und verzog vielsagend das Gesicht. Sein Zimmer schien also auch nicht viel besser zu sein.
„Hoffen wir, dass das Essen besser ist“, versuchte Leander die Stimmung etwas aufzuheitern und bedeutete seinem Adlatus, ihm nach unten zu folgen.
Hier hatte der Wirt ihnen schon einen Tisch etwas abseits des Gasthaustrubels in einem Nebenraum gedeckt. Kaum hatten sie sich gesetzt, kam schon die Tochter des Wirts, eine dralle, einfältig wirkende Person um die zwanzig und stellte eine Suppenterrine auf den Tisch. Die Suppe dampfte und verbreitete einen vielversprechenden Duft. Das dazu gereichte frische, dunkle Brot hatte eine knusprige Kruste und schmeckte herzhaft, sodass sich der Doktor und sein Begleiter sich sofort über das sehnlich erwartete Essen hermachten. Die anheimelnde Wärme der Stube, die von einem über Eck gebauten, mit hübsch verzierten Kacheln verkleideten Ofen strahlte, ließ allmählich eine entspannte Stimmung aufkommen, und so konnte man die Erlebnisse der Reise noch einmal Revue passieren lassen und die entsprechenden Kommentare dazugeben. Leander und Florian waren froh, nach der langen Reise nun zur Ruhe gekommen zu sein, denn die Fahrt über holprige Landstraßen und aufgeweichte Feldwege war in der engen Postkutsche wirklich kein Vergnügen gewesen.
Kapitel 2
Vor einer Woche hatten sie in gespannter Erwartung die Reise nach Guldenburg angetreten. Die Abfahrt in Halberstadt gestaltete sich vielversprechend. Der Tag hatte freundlich begonnen, sodass sie der bevorstehenden Aufgabe in Guldenburg wohlgemut entgegensehen konnten.
Die frisch eingespannten Pferde machten den Eindruck, als könnten sie die Reise kaum erwarten. Der Kutscher, ein kräftiger, noch recht junger Bursche, wuchtete gut gelaunt die Gepäckstücke auf den Wagen.
„Vorsicht! Diese Koffer bitte nicht werfen! Da drin sind medizinische Instrumente und Glasflaschen!“, konnte ihm Leander noch rechtzeitig zurufen, und mit geübtem Griff verstaute der Bursche die Truhe mit der wertvollen Fracht und schnallte alles sicher fest.
Die Kutsche war eine der neueren, die jetzt immer öfter zu sehen waren. Sauber, mit gut gepolsterten Sitzbänken und einem geräumigen, hell ausgekleideten Innenraum ließ sie eine einigermaßen angenehme Reise erwarten.
Mit Leander und Florin stiegen eine ältere Dame und ein junges Fräulein ein. Tante und Nichte, wie sich später herausstellte. Um sechs Uhr stieß der Kutscher ins Horn, schnalzte, gab einen geübten Knaller mit der Peitsche in die Luft und ließ die Pferde antraben. Das Rattern der Räder hallte durch die morgendlichen Straßen Halberstadts. Hie und da rief der Kutscher einem Vorbeigehenden ein freundliches „Hallo!“ zu, und auch Leander, der in Halberstadt gut bekannt war, winkte dem einen oder anderen Passanten zu.
Florian, sein neuer Gehilfe, indes verhielt sich still und machte sogleich Anstalten, sich in eine bequeme Sitzposition für ein Nickerchen zu bringen.
Inzwischen rollte der Wagen zum Tor hinaus vorbei an den kleinen Häusern der Vorstadt und fuhr nun zur Freude der Insassen ruhiger. Draußen zogen Wolken, Wälder, Wiesen und Dörfer vorbei, die Landschaften wechselten ihr Aussehen mal allmählich, mal plötzlich und boten, wenn man nicht gerade eingenickt war, immer neue Eindrücke.
Kaum waren sie aus der Stadt hinaus und auf der Landstraße, begann die dralle Dame, einen Proviantkorb zu durchwühlen und dem Mädchen die verschiedensten Bissen zu reichen, so, als würde sie einen Schoßhund füttern. Das Mädchen, von seiner Tante liebevoll mal „Lieschen“, mal „Liese“ genannt oder mit anderen, teils seltsamen Kosenamen bedacht, nahm die dargebotenen Speisen zunächst noch eher teilnahmslos an, dann wurde es ihr aber wohl zu viel, und sie lehnte mit offensichtlich angewiderter Miene die angebotenen Happen ab.
Es war die Alte, die als Erste die Konversation begann, und Leander konnte sofort erahnen, dass nun der beschwerlichere Teil der Reise beginnen würde.
„Die Kleine ist nun alt genug“, hatte die Dame in lautem, aufdringlich krächzendem Tonfall begonnen, „wir fahren nach Wilmenau. Dort wird sie die Klosterschule der Benediktinerinnen besuchen. Wissen Sie, in unserer Familie sind eine gute Erziehung und eine hochstehende Bildung sehr wichtig! Die Arme hat vor acht Jahren ihre Mutter verloren. Sie starb bei der Geburt des Kleinsten, und der Vater stand ganz allein da. Nun ja, als Schwester konnte ich die Familie ja nicht im Stich lassen, und so habe ich mich ihrer angenommen. Wir haben zwar Personal im Haushalt, aber der Vater, mein Schwager, ist Kaufmann und viel auf Reisen, und Kinder brauchen nun mal eine feste Hand, jemanden, der ihnen eine gute Erziehung gibt und die richtigen Werte vermittelt. Und nun, sie ist jetzt vierzehn, wird sie in der Klosterschule eine angemessene und fromme Bildung erhalten. Die Schwestern in Wilmenau haben einen guten Ruf, zu Hause wäre sie doch nur den schlechten Einflüssen der Stadt ausgesetzt. Nein, nein, so weit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen. Und ich muss mich ja noch um die anderen drei kümmern. Der Jüngste ist acht, Ihr wisst, bei dessen Geburt die Mutter, meine Schwester, gestorben ist. Sie hat so gelitten, die Arme. Dann ist da noch die Hilde mit fast zehn, ein rechter Wildfang. Sie braucht eine starke Hand. Und Johannes, er geht in die Singschule am Dom und soll einmal als Musiker in den Kirchendienst. Nun, so berühmt, wie dieser Junge aus Salzburg, von dem man in letzter Zeit so viel hört, wird er wohl nicht werden. Aber der wurde ja sogar von der Kaiserin von Österreich eingeladen. Vielleicht hat der Junge aber auch das Zeug zum Pfarrer. Das werden wir sehen ….“
Der Redeschwall der aufdringlichen Dame entfernte sich immer weiter von Leanders Ohr, und langsam entglitt er in einen vom Schütteln der Kutsche unterstützten Schlaf. So setzte die kleine Reisegesellschaft ihre Reise in dem schaukelnden Gefährt fort. Die Landstraße war trocken, es hatte in diesem März sehr wenig und in den letzten Tagen gar nicht geregnet. So kam die Postkutsche gut voran.
„… wenn Lise einmal alt genug ist, werden wir sie wieder ins Haus nehmen. Sie wird dann von einer Hausdame die Etikette lernen, und ein Hauslehrer wird sie in der französischen Sprache unterrichten, das ist jetzt modern. Sicher wird sie sehr schnell im Bekanntenkreis ihres Vaters eine gute Partie finden. - Oh, ich glaube, wir müssen halten.“
So sacht, wie Leander eingeschlafen war, war er auch wieder aufgewacht, und der Redefluss der mitteilungsfrohen Reisebegleiterin prasselte immer noch unaufhörlich auf den armen Florian ein.
Nun aber hatte wohl ein körperliches Bedürfnis ihre Mitteilsamkeit unterbrochen. Sie klopfte mit der Handfläche durch das Türfenster an die Außenseite der Tür. Das Klopfen war sehr bestimmend und ließ keinen Zweifel an der Dringlichkeit ihres Ansinnens. Der Kutscher lehnte sich mit einem fragenden Blick vom Kutschbock und schaute nach hinten.
„Anhalten!“, rief sie ihm mit herausgestrecktem Kopf und heftigem Befehlston zu, und der Kutscher brachte den Wagen mit einem lauten „Hooh!“ unter einer Baumgruppe zum Stehen. Behände sprang er ab, klappte die Ausstiegstreppe aus und öffnete die Tür. Er reichte der Dame die Hand, die sich mit der Grazie eines Nilpferds aus dem Wagen wuchtete.
„Bitte bleiben Sie noch einen Augenblick im Wagen“, bat der Kutscher die anderen Fahrgäste, „danach können Sie sich auch ein wenig die Füße vertreten, wir sind gut in der Zeit und werden dann auch bald unsere erste Station erreichen. Dort haben Sie Gelegenheit, sich zu erfrischen."
Die eindeutigen, plätschernden Geräusche hinter dem Wagen waren nicht zu überhören, und nachdem die Dicke wieder – sichtlich erleichtert – erschienen war und umständlich die Röcke geschürzt und zurechtgerückt hatte, stieg auch der Rest der Reisegesellschaft aus, um sich ihrerseits unter den Bäumen im Schatten etwas zu ergehen. Es war inzwischen fast Mittag, und die Sonne, gelegentlich von ein paar dünnen Wolken verdeckt, machte den Aufenthalt im Freien erträglich. Dazu verbreitete ein für die Jahreszeit ungewöhnlich mildes Lüftchen eine angenehme Stimmung.
Wie weit man bereits gekommen war, ließ sich jedoch nicht erkennen. Die wenigen Dörfer und kleinen Gehöfte gaben jedenfalls keinen Anhalt, und Leander wollte den Postier, der mit der Kontrolle der Pferde und des Wagens beschäftigt war, nicht stören. Zudem hatte dieser ja auch die baldige Ankunft in einer Poststation angekündigt.
„Bitte wieder einsteigen!“, rief der Kutscher, nachdem er alles kontrolliert hatte. Er half den Damen in den Wagen, klappte die Einstiegshilfe wieder ein, zurrte noch ein, zwei Gurte fest und schwang sich mit routinierter Bewegung auf den Bock.
Mit einem lauten Peitschenknall und einem Ruck, der die Fahrgäste gründlich durchschüttelte, war man wieder zurück auf der Landstraße.
„Unser Kutscher scheint ja durchaus ordentlich zu sein, ein kräftiger Bursche, da müssen wir wohl keine Angst haben, dass er den Wagen in den Graben lenkt, wie mir neulich geschehen. Aber da war der Fahrer auch schon in der Früh reichlich betrunken.“ Die Dame erzählte dann in aller Ausführlichkeit, wie der betrunkene Fahrer sehr schnell über eine schlechte Landstraße gefahren wäre, wie sich ein Rad gelöst hätte und abgesprungen war und der Wagen zur Seite geschlagen, dass alles durcheinandergeflogen sei, und die Fahrgäste übereinandergelegen hätten, und „über mir ein Portepee-Fähnrich zu liegen kam, was äußert peinlich war!“
„Dann wollen wir nur hoffen, dass uns Ähnliches auf dieser Reise erspart bleiben wird.“ Leander hatte sich gar nicht auszumalen gewagt, wie sich ein ähnliches Ereignis bei ihnen abspielen würde.
In derlei Gedanken versunken, versuchte Leander, ein wenig Ruhe zu finden. Florian hatte schon wieder eine, soweit in der Enge der Kabine möglich, bequeme Schlafposition eingenommen. Die vorbeiziehende, leicht hüglige Landschaft wirkte auf alle beruhigend. Die aufdringliche Dame schien sich mit ihrem körperlichen Bedürfnis auch ihres übermäßigen Mitteilungsbedürfnisses entledigt zu haben, denn sie grummelte noch etwas Unverständliches zu dem Mädchen und richtete sich dann ebenfalls zum Schlafen gemütlich ein. Leander hatte die Augen geschlossen, und unterstützt vom Schaukeln des Postwagens auf der inzwischen recht ebenen Landstraße gingen ihm ungeordnete Gedanken über seine zukünftige Aufgabe durch den Kopf.
Nun waren sie schon fast einen ganzen Tag in diesem unbequemen Gefährt durchgeschüttelt worden, und jedes Mal, wenn Leander aus seinem Halbschlaf aufgeschreckte, sei es, dass der Wagen durch ein Schlagloch krachte, dass sein Kopf an die Holzkante des Fensters schlug oder dass die korpulente Dame gegenüber mit dem Fuß an ihn stieß, jedes Mal schaute er mit verschlafenem Blick nach draußen und hoffte, dass man die Poststation bald erreicht haben würde. Dann wiederum dankte er im Stillen seinem Schöpfer und Herrn für das Wetter, dass die trockene und nicht allzu kalte Luft es erlaubte, die Fenster einen Spalt offen zu lassen. Nicht auszudenken, welche Luft in dieser engen Kabine geherrscht hätte, wäre dies nicht möglich gewesen!
Nach einem weiteren kurzen Halt und einer holprigen Fahrt durch eine überwiegend waldige Gegend erreichte die Postkutsche mit ihren Reisegästen noch vor Anbruch der Dunkelheit die erste Poststation.
Leander konnte erkennen, dass es sich um ein großes Gut mit einem geräumigen Innenhof handelte. In der Umgebung standen verstreut einige kleine Häuser. Als die Kutsche mit lautem Geratter durch das hohe Tor fuhr, sprangen sogleich einige Bedienstete herbei, die dem Kutscher halfen, die Pferde zu versorgen, den Fahrgästen beim Auszusteigen behilflich zu sein und das benötigte Gepäck abzuladen. Die Gäste wurden zu den Unterkünften geführt, und wenig später servierte man ihnen in der Gaststube das Abendessen.
Der Kutscher hatte dem Postmeister eine Tasche mit Postsendungen überreicht und von diesem im Gegenzug eine andere erhalten. Die beiden wechselten einige Worte über den Zustand der Straßen, dann gesellte sich der Kutscher freundlich, aber schweigsam zur Reisegesellschaft.
Diese saß bereits um einen Tisch versammelt, vor sich verschiedene einfache Speisen. Leander erlaubte sich einen Becher von dem Wein, den ihm zuvor der Herbergsbetreiber, der wohl auch der Hofbauer war, angepriesen hatte.
Gleich nach dem Essen begab man sich in den angewiesenen Schlafquartieren zur Bettruhe. Die Betten waren einfach; Mit Stroh gefüllte Säcke dienten als Matratzen, die mit dicken Tüchern bedeckt ein simples, aber erträgliches Lager bildeten. Die Daunendecken darüber waren recht komfortabel und mehr, als man von dieser ländlichen Herberge erwarten konnte.
Müde von den Strapazen des ersten Reisetages waren Leander und Florian sehr schnell eingeschlafen.
*
Sobald er das Horn des Kutschers durch das Geviert des Innenhofes erschallen hörte, wachte Leander auf. Noch etwas verschlafen erhob er sich von seinem Nachtlager. In der Stube war es kühl. Er zog sich das Laken um die Schultern und ging zu dem kleinen Fenster, das einen Blick auf den Innenhof des Gutes erlaubte. Es war noch dunkel, doch im Hof wurde es unruhig und geschäftig. Er sah die Küchenmägde aus Türen huschen und in andere wieder verschwinden. Die Kutschpferde wurden aus dem Stall in den Hof geführt und noch einmal getränkt.
Nacheinander fanden sich die vier Fahrgäste, die gestern eingetroffen waren, im Gastraum ein. Zu ihnen hatte sich ein dicklicher, älterer Herr gesellt, der als fünfter Fahrgast mit zusteigen sollte. Man hatte ihnen eine Schüssel mit kräftiger Brühe und einige Kanten Brot auf den Tisch gestellt. Sofort bediente sich der neue Reisekumpan, schöpfte sich mit wenig rücksichtsvoller, ausladender Bewegung seinen Teller voll, biss herzhaft in eine Brotecke und legte gleich, so gut das mit seinem übervollen Mund möglich war, lauthals los:
„Na, dann werden wir ja heute eine nette Reisegesellschaft sein. Darf ich mich vorstellen: Johann Willmers, Weinhändler aus Bremen. Bin unterwegs zu neuen Kunden. Ja, wir haben da inzwischen einen ganz hervorragenden Tropfen im Sortiment. Durch den Transport in den neuen Eichenfässern gewinnt der Rote enorm, und die Leute lieben ihn. Da können die Weißen von Rhein und Neckar nur schwer mithalten. Aber wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit, da kann ich den Herrschaften noch manch Wissenswertes erzählen.“
Leander schwante Schlimmes: Der Weinhändler und die Dicke im Redewettstreit; das konnte anstrengend werden. Dennoch nahm er den Reigen des Vorstellens auf, und so präsentierten sich die anderen Fahrgäste reihum dem Weinhändler. Florian hatte sich kurz gefasst und nur Vor- und Nachnamen genannt. „Wir reisen gemeinsam in medizinischer Mission“, ergänzte Leander. „Ach, dann seid Ihr also Ärzte, interessant! Da hätte ich einige Fragen an Euch“, hakte Willmers gleich nach. Dann stellte sich die Dame vor:
„Ich bin Else Kohl, und die junge Dame hier ist meine Nichte Lieselotte. Sie wird morgen in die Klosterschule in Willmenau eintreten.“ Leander war erstaunt und erfreut, dass die Vorstellung der Dame so kurz vonstattengegangen war, allerdings stand zu befürchten, dass dies nicht die letzten Sätze aus ihrem Mund für den Rest des Tages sein würden.
Kaum waren sie mit dem Mahl fertig, als auch schon der Kutscher in der Tür stehend zum Aufbruch gemahnt hatte. Die Reisegesellschaft machte sich allmählich, Frau Kohl recht umständlich, was ihrer Nichte sichtlich peinlich war, auf den Weg zur Kutsche. Der Kutscher half den Damen in den Wagen, wo Frau Kohl sogleich darauf achtete, dass ihre Nichte den Fensterplatz einnahm und so nicht neben dem Weinhändler sitzen musste. Das war also nun die Sitzordnung in der Kutsche: Leander und Florian hatten das Privileg, sich die Sitzbank mit dem Rücken zum Kutscher zu zweit zu teilen. Leander gegenüber saß das Mädchen Liese, und nachdem er seinen Sitz eingenommen hatte, begrüßte sie ihn mit einem scheuen Kopfnicken, als hätten sie sich gerade zum ersten Mal gesehen. Leander nickte amüsiert zurück und war’s damit zufrieden, denn den ganzen Tag dieses hübsche, unschuldig und unsicher dreinblickende Mädchen unmittelbar gegenüber zu haben, war ihm bei Weitem lieber, als die „dicke Else“ - diesen Namen hatte er ihr heimlich gegeben - anschauen zu müssen, wie sie entweder redete, schmatzte oder schnarchte. Neben ihr zwängte sich der korpulente Weinhändler in die Polster und, wie um Bestätigung heischend, schaute er mit einem breiten Grinsen in die Runde. Der Kutscher schloss die Wagentüren, stieg auf den Kutschbock und knallte mit der Peitsche, sodass die Pferde langsam aus dem Hof trabten. Einige der Mägde hatten noch freundlich hinterhergewinkt, dann ging die Reise weiter. Mit kräftigen Tritten nahmen die frischen Pferde den kurzen Anstieg bis auf die Höhe der alten Heerstraße, die nun in weiten Schwüngen über den Hügelkamm führte. Zurückblickend sah Leander noch einmal das Ensemble des Hofguts mit den kleinen Gesindehäusern und dem großen Innenhof und ertappte sich bei dem Gedanken, hier in dieser abgeschiedenen idyllischen Welt noch gerne einige Zeit verweilen zu wollen.
Am Vorabend hatte er sich aus dem Koffer zwei Büchlein herausgeholt, um sich auf der Fahrt zum einen die Zeit mit nützlicher Lektüre zu vertreiben, und sich zweitens so der lästigen Konversation mit der „dicken Else“ zu entziehen. Mit Florian, der ohnehin sehr wortkarg war, wechselte er höchstens das eine oder andere Wort zur bevorstehenden gemeinsamen Arbeit, und das Mädchen redete in seiner Schüchternheit nur, wenn es angesprochen wurde. Ansonsten beschäftigte es sich mit einem Büchlein, das den vielsagenden Titel trug: „Erbauliche und instruktive Geschichten und Legenden aus dem Leben der Heiligen“, das wohl nicht allzu fesselnd sein konnte, denn Liese schlug es immer wieder zu und schaute verträumt in die Landschaft.
Leander holte jetzt ebenfalls ein Buch hervor, das gerade im Vorjahr erschienen war und zu dessen eingehender Lektüre er bisher keine Zeit hatte. Es trug den Titel „Anatomisches Handbuch, Teil I“ und der Verfasser war kein Geringerer als der Jenaer Professor Dr. Justus Christian Loder, bei dem er studiert hatte und mit dem er inzwischen einen freundschaftlichen Austausch pflegte. Beide hatten vor dem Erscheinen des Buches regen Kontakt, und so wusste Leander zum großen Teil, was sein Freund in dem Buch darstellen würde. Er schätzte Justus wegen seiner hervorragenden, profunden Kenntnisse und teils unerwartet neuartigen Darstellungsweise. Im Bekanntenkreis des Professors tauchte auch immer wieder der Geheimrat Goethe auf, der sich von Justus in die Kenntnisse der Anatomie einweisen ließ. Justus hatte Leander einmal zu einer von Goethes Abendgesellschaften mitgenommen, und Leander hatte staunend gelauscht, wie dieser universell gebildete Mann über alles Erdenkliche referierte, unter anderem über seine Entdeckung des Zwischenkieferknochens im Jahr 1784, den die Wissenschaft bis dahin nur bei Primaten nachgewiesen hatte und beim Menschen ausschloss, was immer das auch bedeuten mochte. Immerhin erhielt der Geheimrat für diese Entdeckung allgemeine Anerkennung und Bewunderung auch von ärztlicher Seite. Der Abend war in einer entspannten, fröhlichen Atmosphäre verlaufen, und Leander verstand seither, warum diesem Herrn Geheimrat Goethe allgemein eine solch vorzügliche Hochachtung entgegengebracht wurde.
Während der Lektüre von Loders Buch machte er sich Notizen in ein kleines Heftchen, das er stets mit sich führte, und machte Florian auf die eine oder andere Besonderheit aufmerksam.
„Wissen Sie“, ergriff plötzlich der Weinhändler in unsensibler Lautstärke in einer Phase der Ruhe das Wort, „wissen Sie, wir kaufen unseren Wein im Süden von Frankreich, im Gebiet von Bordeaux, und lassen ihn in guten deutschen Eichenfässern hierhertransportieren. Und in diesen Fässern erhält der Wein seinen besonderen Geschmack und seine Qualität, die bei uns so geschätzt wird. Er ist dann viel besser als am Ursprungsort. Tja! Da können die Franzmänner noch etwas von uns lernen. Aber es steht zu befürchten, dass die jetzigen Vorkommnisse uns das Geschäft verderben können. Die haben dort alles auf den Kopf gestellt. Wie soll das möglich sein, bitte schön, ohne König! Das wird nicht ohne allerlei Unruhe vonstattengehen! Und dabei verspricht der 89er ein vorzüglicher Jahrgang zu werden. Mein Partner in Frankreich versucht, mir noch einige Fässer auf die Seite zu schaffen, ehe diese Revolutionsbanden ihn wegsaufen. Das wird ein göttlicher Tropfen; und ein gutes Geschäft obendrein.“
Leander vertiefte sich in seine Lektüre und vermied es, auch nur den Anschein von Interesse am Vortrag des lauten Mitreisenden zu zeigen. Florian schaute, wie meist, abwesend aus dem Fenster oder schloss kurzzeitig die Augen. Als dem Weinhändler endlich klar wurde, dass er keine Zuhörer mehr würde fesseln können, endete er, als wolle er seinen Vortrag ordentlich beschließen: „Na, dann wollen wir heute mal auf eine angenehme Reise hoffen. Die Straße scheint hier ja einigermaßen in Ordnung zu sein. Wenn es denn so bleibt, können wir froh sein.“
Nun war für eine längere Zeit Ruhe im Abteil eingekehrt. Leander konnte sich ungestört seiner Lektüre widmen und Notizen machen. Das junge Fräulein schaute ebenfalls hin und wieder in sein Buch. Gelegentlich hob sie den Kopf, um aus dem Fenster zu schauen und Leander schüchtern und freundlich zuzulächeln.
Je weiter sie kamen, desto mehr bedeckte sich der Himmel, und Leander erkannte, dass dies keine Schönwetterwolken mehr waren. Ein kühler Wind kam auf, und man schloss das Wagenfenster.
Leanders Gedanken schweiften ab, und er versuchte sich vorzustellen, was sie in jenem unbekannten, wohl auch unbedeutenden kleinen Städtchen Guldenburg erwarten würde. In letzter Zeit häuften sich Berichte über Nervenfieberepidemien in verschiedenen Städten. Es wurden erschreckende Zahlen von Todesopfern genannt, die in manchen Fällen in die Hunderte gingen, und allmählich kamen ihm Zweifel, ob er, auch mit der Hilfe von Florian, dem Bader, in der Lage sein würde, einer solch großen Aufgabe zu begegnen.
Gegen Mittag hielt der Wagen an einer Poststation. Die Pferde wurden getränkt, und der Posthalter servierte den Reisenden ein einfaches, aber herzhaftes Mahl: Schinken und geräucherte Wurst, ein frisches Brot und einen Krug Milch. Die Fahrgäste erhielten Gelegenheit, sich ein wenig die Beine zu vertreten, eine wahre Erholung, denn die Knochen hatten in der holpernden Kutsche, die anscheinend kein Loch in der Straße ausließ, einiges zu ertragen. Man konnte sich seiner körperlichen Bedürfnisse entledigen, und Leander erkundigte sich nach den Einzelheiten des Fleckens, in dem man gelandet war. Die Station war Teil einer kleinen Siedlung namens Andreashof. So konnte Leander ungefähr abschätzen, wie weit es noch bis Guldenburg sei.
Sorge allerdings bereitete ihm das Wetter. Ein aufkommender Regen zwang die Reisegesellschaft, in der Poststation Unterstand zu nehmen, bis der Kutscher den Wagen für die Weiterreise bereitgemacht hatte. Bei schon strömendem Regen stiegen alle wieder ein. Was nun kam, war der wohl schlimmste Teil der Reise. Die dicke Else hatte sich gut gesättigt und machte sich wieder zwischen dem Weinhändler und Lieschen breit. Die Kleine zwängte sich mit verängstigtem Gesicht in ihre Ecke, zog ein wollenes Tuch fest um den Hals zusammen und verschränkte die Arme vor der Brust. Mit furchterfülltem Blick versuchte sie, durch das beschlagene Kabinenfenster nach draußen zu schauen, indem sie beständig mit einem Tüchlein ein kleines Guckloch freiwischte. Die Tante hatte ihr wohl einige Schauergeschichten erzählt, wie gefährlich und beschwerlich das Reisen auf vom Regen aufgeweichten Straßen wohl sein würde.
„Hm, da haben wir jetzt aber ein Wasserloch erwischt!“, grunzte der Weinhändler, „und wie es ausschaut, wird sich das bis zum Abend nicht ändern. Jetzt heißt es Schlamm rutschen, das ist fast wie Schlittenfahren, nur ungemütlicher und nicht so lustig. Hoffen wir, dass der Kutscherkerl sein Handwerk versteht, und wir nicht irgendwo mit gebrochenem Rad liegen bleiben!“
„Es wird schon werden“, versuchte Leander zu beruhigen und wie zur Bestätigung seiner Sorglosigkeit nahm er sein Büchlein hervor, um wieder zu lesen.
Natürlich war ihm klar, dass der Rest des Tages und wohl auch die Nacht kein Vergnügen zu werden versprach, denn die nächste Etappe sollte, mit Ausnahme von kurzen Pferdewechseln, durchgefahren werden.
Schnell war die Straße, wenn man sie noch als solche bezeichnen wollte, tief aufgeweicht gewesen, und die Pferde hatten Mühe, den Wagen durch die schlammigen Furchen zu ziehen. Bei der nächsten Station blieben alle im Wagen sitzen, die Pferde wurden im peitschenden Regen schnell gewechselt, und schon fuhr die Kutsche weiter.
*
Abends, vier Stunden später als erwartet, erreichten sie die Station in Sippensfeld.
Hier verließ die dicke Else mit ihrer Nichte die Kutsche. Von diesem Halt hatten sie lediglich noch eine kurze Strecke mit der nächsten Kutsche, die erwartet wurde, bis zu ihrem Ziel in Wilmenau zurückzulegen.
Freundlich verabschiedete man sich, wünschte sich noch eine gute Weiterreise, und während der Kutscher das Gepäck der Damen ablud und den Rest wieder neu geordnet verstaute und festzurrte, nahmen Leander, Florian und der Weinhändler schnell noch eine kleine Stärkung zu sich. Keine zwanzig Minuten später ging die Reise mit neuen Pferden weiter.
„Hoffentlich findet unser Kutscher in der Dunkelheit und bei dem Regen den Weg. Ich hatte schon einmal das Vergnügen, und wir saßen schließlich bis zum Morgen in einem abgelegenen Wald im Schlammloch fest. Dann mussten wir eine Stunde laufen, bis wir einen Bauer fanden, der den Wagen mit zwei Vorspannpferden wieder aus dem Schlamassel ziehen konnte. Bis wir dann wieder zurück auf dem richtigen Weg waren, war noch einmal ein halber Tag für die Katz. Ich kann Euch sagen, so etwas ist wahrlich kein Spaß.“ Der mitreisende Weinhändler schien von wirklichen Ängsten geplagt, denn der Tonfall, in dem er seine Geschichte vorgetragen hatte, hatte die schlimmsten Befürchtungen verraten.
Die Fahrt war in strömendem Regen weitergegangen. Zunächst hatten sie einen Wald durchquert, in dem die Bäume den schlimmsten Regen abgehalten hatten. Allerdings war der Weg ziemlich schlecht gewesen. Ständig hatte es Schläge von Felsbrocken gegeben, die den Weg an manchen Stellen so eng werden ließen, dass man hatte befürchten müssen, stecken zu bleiben.
„In solchen Waldstücken muss man Angst haben, von üblem Gesinde überfallen zu werden“, hatte der Weinhändler mit zitternder und hörbar verängstigter Stimme gesagt.
„Aber unser Fahrer scheint doch erfahren genug, als dass er uns nicht in eine solche Gefahr bringen würde. Außerdem gibt es mittlerweile immer strengere Gesetze und härtere Strafen zur Eindämmung der Wegelagerei.“ Leander wusste, dass diese Gesetze nicht unbedingt den gewünschten Erfolg hatten, aber er hatte gehofft, mit dieser Einwendung für mehr Beruhigung im Kutschabteil zu sorgen.
Nachdem sie den Wald durchquert hatten, waren sie nach etwa einer Stunde in ein kleines, verschlafenes Städtchen gekommen, und der Kutscher hatte die Posthalterei angesteuert, wo die Pferde gewechselt und den Fahrgästen eine kleine Erfrischung gereicht worden war. Ohne langen Aufenthalt war es weiter durch das nicht sehr große Stadttor hinaus auf die Landstraße gegangen. Ununterbrochen hatte der Regen auf das Kutschendach geprasselt, und Leander hatte den armen Kutscher bedauert, der, den Hut tief ins Gesicht gezogen und den völlig durchnässten Mantel um sich gewickelt, dem Wetter trotzen musste, im Dunkel und im dichten Regen den Weg finden musste. Leander hatte versucht zu schlafen, Florian hatte sich im Halbschlaf nach hinten gelehnt und hin und wieder leise vor sich hin geschnarcht.
Gegen Morgen - es hätte längst hell sein müssen, aber die dichten Wolken hatten die Morgendämmerung noch zurückgehalten - hatte der Kutscher an einem Bauernhof gehalten. Er war hier wohl bekannt, denn sogleich war der Bauer herausgetreten und hatte ihn freundschaftlich begrüßt.
„Hallo Berthold, du alter Halunke, bist mal wieder im Lande. Komm herein und bring deine Fahrgäste mit! Es gibt etwas Gutes zu essen, dann schafft ihr den Rest des Weges auch noch.“
Die drei Reisenden waren froh gewesen, aus dem klammen Kutschabteil steigen zu können. Der nächtliche Regen hatte den Boden aufgeweicht, und so waren sie im Hofe zwischen Hühnerkot und Resten von Schweinemist knöcheltief im Matsch eingesunken und hatten versucht, durch weite Schritte die Tür zur Küche möglichst wenig besudelt zu erreichen.
Drinnen hatte die Bäuerin am Tisch gesessen und mit Gemüse hantiert, das sie schnitt und säuberte. Daneben, den scheuen Blick kaum aufhebend, hatte ein Mädchen gesessen, etwa 14 Jahre alt. Es war die Tochter der Bauersleute.
„Gregor, bring Milch, s’sind Gäst da. Der Berthold mit Reisenden“, hatte der Bauer nach hinten in den Stall gerufen. Inzwischen waren Bäuerin und Mädchen aufgestanden und hatten die Fahrgäste begrüßt, die eine herzhaft derb, die andere schüchtern mit einem verlegenen Lächeln.
Die Neuankömmlinge waren aufgefordert worden, sich zu setzen und konnten Mäntel, Hüte und Röcke vor den wärmenden Ofen hängen - eine willkommene, angenehme Unterbrechung der Reise. Die Bäuerin hatte die Milch verteilt und hatte auch ein paar Scheiben Brot und etwas herzhaft geräucherten Schinken bereitgestellt.
„Dann geht’s nach Guldenburg?“, hatte der Bauer eher beiläufig gefragt, denn das war die nächste Station der Kutsche und für Leander und Florian der vorläufige Endpunkt ihrer Reise.
„Ja, für die beiden Doktores wohl“, hatte sofort der Weinhändler geantwortet. „Aber für mich geht’s noch weiter. Mache kurz Station, und dann führen die Geschäfte mich nach Süddeutschland. Die Württemberger sind für gute Geschäfte immer zu kriegen. Haben zwar selbst einen Tropfen, der nicht zu verachten ist, aber dem Rotspon spricht man auch dort gerne zu.“
„Doktores?“, hatte die Bäuerin gefragt. „Kommts wejen der Seuch? Ja, dort haben’s jetzt Doktoren nötig. Die ganze Stadt is befallen, wie mer hört. Angst kriejen kann mer, dass es nicht noch zu uns nach heraußen kommt. Und keener kann helfe. Viele Todte haben’s, und es liege die Kranke herum, und helft kei Aderlass bei keinem net und sonst auch nix.“ Die Angst vor der Seuche und die mitleidige Verzweiflung waren ihr anzumerken.
„Gott sei Dank ist heraußen noch nichts ankomme von dem Übel. Und wolle mer hoffe, dass’s och so bleibt. Dann wolle die Herre Doktore wohl heile helfe. Da haben’s awwer gründlich Arbeit. Mir bleibe vorerscht vom Markt weg mit unsere Sache. Nit dass mer noch eine Ansteckung mitbringe“, setzte der Bauer, den der Kutscher mit „Eberhard“ begrüßt hatte, nach.
Leander erzählte nun, was der Sinn ihrer Reise sei, und alle hörten aufmerksam und anerkennend zu. Sogar der Weinhändler hatte für den Moment keinen Kommentar abzugeben und nickte den beiden respektvoll zu.
Inzwischen hatte sich draußen der Himmel geöffnet, und so etwas wie Frühlingsahnung war mit den letzten Regenresten von Dächern und Bäumen getröpfelt. Die Reisenden hatten sich für die einfache, aber schmackhafte Mahlzeit bedankt, und Leander und Willmers hatten den Bauersleuten ein paar Groschen auf den Küchentisch gelegt. Die blinkenden Münzen hatten sofort die Aufmerksamkeit des Mädchens auf sich gezogen. Es war ersichtlich gewesen, dass Geld hier selten auf dem Tisch lag. Die angetrockneten und aufgewärmten Kleider hatten den durchgeschüttelten Reisenden gutgetan, und so hatten sie sich herzlich und mit nochmaligem überschwänglichem Dank verabschiedet. Die Bauersleute hatten ihre unerwarteten Gäste nach draußen geleitet, wo sich der Himmel zunehmend von einer etwas freundlicheren Seite zeigte.
„Passens auf! Der Eberhard is e schneller Hund, der losst die Kutschen auch bei schlechte Weg gründlich rennen. Eh dass er’s umschmeißt, springen’s halt schnell raus!“, hatte der Bauer ihnen schalkhaft zugerufen und mit zurückgelegtem Kopf zum Himmel geblinzelt. Auch ihm schien das schönere Wetter sichtlich besser zu gefallen, als der Regen der vergangenen Tage.
Wieder im Wagen ging es zunächst langsam über die aufgeweichten Wege voran, und die Pferde hatten schwer zu ziehen, denn die Räder versanken tief im Schlamm, und nur allmählich besserte sich der Zustand, als man die Hauptstraße erreicht hatte.
„Da vorne isses!“, rief der Kutscher vom Bock nach hinten, und wirklich, im Dunst der feuchten Wiesen war in der Ferne eine Stadt zu erkennen. „In einer Stund werden wir dort sein.“ Erleichtert nahm Leander die Nachricht auf und auch Florian entrang sich ein erleichtertes „Ho, da war's Zeit. Viel länger hätt ich diese Knochenmühle nicht ertragen.“





























