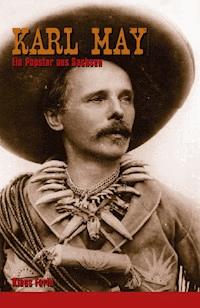Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus dem Inhalt: Ein kicker-Tag. Notizen vom Schlachtfeld * Chaostage in Hannover * Im Gespräch mit Götz George und Eberhard Feik * Wie weit ist der Weg nach Deutschland? * Zur Misere der deutschen Jugendforschung * Jugendkulturen und Drogen * Kein Refugium für Couchpotatoes: Die ästhetische Praxis in Jugendkulturen * Die Wiedergänger des Untertan * Hassgesänge – Homophobie im Musikbusiness * Der Staat und die Autonomen * What the fuck, Menschheit?!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Farin
Über die Jugend und andere Krankheiten
Essays, Interviews und Reden 1985–2018
Der Autor
Klaus Farin, geboren 1958 in Gelsenkirchen, gab bereits im Alter von 15 Jahren seine erste Zeitschrift in seinem Gelsenkirchener Gymnasium heraus, mit 18 war er der jüngste Volkshochschuldozent Deutschlands; sein erstes Buch veröffentlichte er mit 20 Jahren, das Vorwort schrieb Günter Wallraff.
Seit 1980 lebt er – Punk sei Dank – in Berlin. Nach Tätigkeiten als Konzertveranstalter und -Security, Buchhändler und Journalist lebt und arbeitet er heute als freier Autor und Lektor in Neukölln, daneben ist er auf Vortragsreisen in Deutschland und Österreich unterwegs.
Der zusammen mit Eberhard Seidel verfasste Band Krieg in den Städten wurde aufgrund seines neuartigen Ansatzes, die Jugendlichen selbst zu Wort kommen zu lassen, zu einem „modernen Klassiker“ (Ralph Giordano) der Jugendsozialforschung. Aus dieser Arbeit heraus ergab sich eine längere Beschäftigung mit Skinheads, der zahlreiche Publikationen zu anderen Jugendkulturen folgten. Die Gesamtauflage seiner Bücher liegt derzeit bei über 400.000 Exemplaren.
Von 1998 bis 2011 war Klaus Farin Leiter des auch von ihm gegründeten Archiv der Jugendkulturen. Heute ist er Vorsitzender der Stiftung Respekt – Die Stiftung zur Förderung von jugendkultureller Vielfalt und Toleranz, Forschung und Bildung (www.respekt-stiftung.de).
Weitere Infos:klausfarin.de; www.facebook.com/klaus.farin.
Bei Interesse an einer Veranstaltung mit Klaus Farin senden Sie bitte eine E-Mail an: [email protected]
"Wer sich auf die Realität einlässt, muss die beruhigende Eindeutigkeit aufgeben."
Originalausgabe
© 2018 Hirnkost KG
Lahnstraße 25
12055 Berlin
www.jugendkulturen-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage April 2018
Vertrieb für den Buchhandel
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder
shop.hirnkost.de
Layout: Linda Kutzki
Titelfoto: Doris Hofer
ISBN
PRINT: 978-3-945398-93-7
PDF: 978-3-945398-94-4
EPUB: 978-3-945398-95-1
Dieses Buch gibt es auch als E-Book – bei allen Anbietern und für alle Formate.
Unsere Bücher kann man auch abonnieren: shop.hirnkost.de
Inhalt
Zum Geleit
»Ich sehe mich als verwirrten Linken.« Götz George über Schimanski, die Polizei und die Politik
„Am Anfang hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen.“Ein Besuch bei Eberhard Feik
Ohne Buschtrommeln. „Gastarbeiter-Literatur“
Ein Kicker-Tag. Notizen vom Schlachtfeld
Die am lautesten schreien, sind am wenigsten gefährdet. Die „Anti-Antifa“ veröffentlicht eine „Fahndungsliste“ ihrer Gegner
„Kurzhaarige junge Herren“Klaus Farin im Gespräch mit Mariam Niroumand
Zur Abwechslung mal Punks. Chaostage in Hannover
Terror der IdiotenOder: Wie Antifas ein antifaschistisches Skinheadfestival verhinderten
Wie weit ist der Weg nach Deutschland?
Mobile Jugendarbeit – Zwischen professionellem Handeln und sozialer Feuerwehr?
Zur Misere der deutschen Jugendforschung. „Einmal einen Heitmeyer in deutscher Übersetzung lesen …“
Jugendkulturen und Drogen
Mitwirkung und Partizipation - wollen Jugendliche das überhaupt?
Die Körperidee in Jugendkulturen
Kein Refugium für Couch-Potatoes. Die ästhetische Praxis in Jugendkulturen
Die Wiedergänger des Untertan
Hassgesänge - Homophobie im Musikbusiness
„HipHop ist die letzte große Jugendkultur“
Fünf Thesen über die Jugend und andere Krankheiten
„Politisch intendierte Gewalt muss auch politisch vermittelbar sein.“Der Staat, die Autonomen und der Archivar der Jugendfrisuren
Sind Jugendkulturen eigentlich Jungenkulturen? Ein genderorientierter Einblick in Jugendkulturen und Gewalt
„Heimat ist das Thema unserer Zeit.“Ein Gespräch über Frei.Wild und Deutschrock
What the fuck, Menschheit?!
Stadt - Land - Flucht
Die Jugend
Zum Geleit
Immer wieder geschieht es nach Vorträgen oder Diskussionsveranstaltungen, dass der eine oder die andere interessierte Zuhörer_in mit der heiklen Frage auf mich zukommt: Wo kann man das denn nachlesen, was Sie gerade erzählt haben …? Es wäre natürlich schön, wenn ich dann einfach dem Veranstalter mein zerknittertes Manuskript in die Hand drücken könnte: Bitte 20-mal kopieren. Doch leider habe ich nie ein Manuskript bei meinen Vorträgen. Nur manchmal, in Universitäten oder vor besonders „hochkarätigem“ professoralen Publikum, nehme ich einen kleinen Stapel Papier mit auf die Bühne, irgendwelche, meist leere Blätter, weil ich weiß, dann wird das, was ich gleich erzählen werde, sofort ernster genommen. Dabei gibt es nichts Langweiligeres für das Publikum als vom Blatt abgelesene Referate (außer vielleicht, man lässt das Publikum auch noch via Power Point den Vortragstext zeitgleich mitlesen). Meines Erachtens sollten Professor_innen und andere Lehrende, die nicht in der Lage sind, ihren Stoff spannend, in freier Rede und ohne Power-Point-Krücke zu vermitteln, zu Schulungen zwangsverpflichtet werden. Bildung, die nicht spannend, aufregend, provozierend, unterhaltend daherkommt, verpufft wirkungslos, nicht nur bei der durch Bilder geprägten Jugend. Es reicht nicht, Inhalte vermitteln zu wollen, man muss sie auch vermitteln können, wenn man möchte, dass sie ankommen. So trage ich grundsätzlich nur vor, was ich im Kopf habe. Anfragen zu Themen, bei denen ich noch schriftliche Gedächtnisstützen bräuchte, bescheide ich prinzipiell negativ – und beschäftige mich manchmal dennoch weiter mit dem Thema, um dann vielleicht ein Jahr später bei der gleichen Anfrage zuzusagen …
Trotzdem habe ich immer wieder Vorträge von mir mitgeschnitten oder Beiträge für Kongressdokumentationen oder Zeitschriften verschriftlichen müssen. In diesem Büchlein finden Sie nun eine kleine Auswahl davon – zu den am häufigsten gefragten Themen – zusammengestellt, ergänzt um einige – wie ich finde: heute noch sehr aktuelle – Kommentare und Kulturbeiträge.
Das Liebste an meiner journalistischen Arbeit war mir eigentlich nie das Schreiben, sondern das Führen von Interviews. Nicht nur, weil ich so als Kulturjournalist die Möglichkeit hatte, zahlreiche Künstler_innen, die ich mochte, persönlich zu treffen, wie etwa Herbert Grönemeyer und Ina Deter, Udo Lindenberg und Doro Pesch, Rio Reiser und Dietmar Schönherr, Joe Cocker und Rod Stewart, sondern vor allem, weil man dabei wirklich etwas lernte, andere Wirklichkeiten kennenlernte, während man beim Schreiben ja letztendlich nur reproduzierte, was man ohnehin schon im Kopf hatte. So habe ich als Tatort-Fan einmal die Gelegenheit genutzt, einige Tage an Dreharbeiten zu einem neuen Schimanski in Duisburg teilzunehmen. Dort konnte ich natürlich auch mit den beiden Hauptdarstellern Götz George und Eberhard Feik reden und mich mit ihnen für ausführlichere Interviews bei ihnen zu Hause verabreden. Beide haben mich sehr beeindruckt und angenehm überrascht. So hat etwa das Interview mit Götz George in seiner Villa in Zehlendorf viel länger gedauert als vereinbart, und abends lud er uns – mich und den Fotografen Marco Saß – ein, ihn noch auf einen Absacker in seine Stammkneipe zu begleiten. Dort konnten wir dann noch ein, zwei Bierchen mit ihm und Manfred Krug trinken. Beide sind leider schon verstorben. Götz George wäre in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden, Eberhard Feik starb schon im Oktober 1994 im Alter von nur 50 Jahren. Die beiden Interviews habe ich auch in diesen Band aufgenommen.
Möge die Auswahl unterhaltsam und anregend sein und mir zukünftig einige Stunden zusätzlicher Freizeit verschaffen.
In diesem Sinne wünscht viel Vergnügen
Klaus Farin, Dierhagen im Februar 2018
»Ich sehe mich als verwirrten Linken.«
Götz George über Schimanski, die Polizei und die Politik
„Ein guter Filmproduzent wittert das gute Thema, ein Redakteur wittert nur Gefahr.“
Gibt es grundlegende Unterschiede zwischen dem Schimanski im Kino und dem TV-Schimanski?
Du kannst nicht völlig aus der vorgegebenen Rolle ausbrechen. Was wir machen konnten, ist, ihn suspendieren zu lassen, damit er freie Hand hat und nicht als deutscher Beamter durch die Gegend laufen muss. Im Fernsehen geht das natürlich nicht, da bekommst du sofort von der Bild eine reingewürgt, die sind ja die Gralshüter deutscher Moral. Aber im Kino geht das eben. Da hast du weniger Zuschauer, da darfst du frecher sein. Dann hat der Film ein höheres Budget, etwa 4,5 Millionen. Die brauchst du, um mehr Action aufzufahren. Allerdings haben wir nicht versucht, mit Rambo zu konkurrieren. Wir haben uns mehr auf innere Action konzentriert, den Verfall des Bullen gezeigt, aber auch seinen Gerechtigkeitssinn. Denn das lieben die Leute ja an Schimanski: dass er immer wieder auf die Schnauze fällt mit seinem extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der nicht immer identisch ist mit den herkömmlichen Vorschriften und Regeln. Mit so einem Gerechtigkeitssinn zu leben, heute in der BRD, bedeutet, mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Das finde ich spannender als herkömmliche Action, denn so wird einiges aufgezeigt von der Situation hier im Land. Bei jedem Schimanski-Tatort ist ja irgendein soziales Moment drin. Im Kinofilm wird das besonders stark herausgearbeitet. Ich bin zwar kein besonders politischer Mann, nicht wie Eberhard Feik, der ja durch und durch ein Revoluzzer ist, aber in unserem Beruf kann man, weil eben Millionen die Filme sehen, einiges bewirken, wenn man ein Thema nicht so flach behandelt. Gerade in Duisburg, im Ruhrpott, sind soziale Probleme angesagt. Wenn du dort drehst, musst du dich einfach damit auseinandersetzen.
Bei den Dreharbeiten warst du noch sehr skeptisch. Das Drehbuch wäre keine Sensation.
Das war’s auch nicht. Aber wir haben es dreimal umgeschrieben und dann war ich damit als Basis einverstanden.
In Zahn um Zahn wird Schimanski Opfer einer rüden „Sonderbehandlung“ der Polizei. Allerdings in Marseille. Wäre es möglich, im Tatort entsprechende Methoden der deutschen Polizei aufzugreifen?
Ich glaube nicht. Aber ich würde es sehr befürworten. Natürlich müssten wir bloßlegen, was innerhalb der Polizei passiert, innerhalb dieses ganzen Staatsapparates. Undercover-Agenten, agents provocateurs, BKA – da bewegt sich doch fast alles in der Illegalität. Aber es kommt in der Regel nicht heraus, was da an Überschreitungen stattfindet. Da müssen sich schon Bullen direkt an die Autobahn stellen und abkassieren. Die Aufklärungsquote ist ja das Maß aller Dinge. Wer weiterkommen will, muss was vorweisen können. Dann der Druck der Presse, eines bestimmten Teils der Presse. Dass es so zu illegalen Maßnahmen kommt, ist logisch. Natürlich versuchen wir, das aufzugreifen. Im Film beispielsweise wollten wir unter die Rocker, die sich zu Beginn mit der Polizei eine Straßenschlacht liefern, ein paar agents provocateurs einschleusen, die Randale machen, um einzuheizen. Ich hätte einen im Rockerkostüm angesprochen, Mensch, dich kenn ich doch, du bist doch ein Kollege. Eine tolle Szene, aber die Polizei sagte, das ist nicht machbar, nicht mit uns.
Welchen Einfluss hatte denn die Polizei auf die Dreharbeiten?
Wir sind in Duisburg natürlich auf die Zusammenarbeit mit dem Polizeiapparat angewiesen. Ohne deren Unterstützung kannst du einen Tatort nicht machen. Also bekommen sie vorher die Drehbücher und haben ein Mitspracherecht, was die Darstellung ihres Polizeiapparates betrifft. Und in dem Moment, wo agents provocateurs oder Undercover-Agenten im Drehbuch stehen, verweigert die Polizei sofort ihre Unterstützung.
Schimanski wird also als nützlich angesehen für die Imagewerbung der Polizei?
Nicht unbedingt. Vor allem seine Ermittlungsmethoden sind doch so eigenwillig, dass man als Bürger schon Angst bekommen kann vor der Polizei. Wenn Schimanski nicht anklopft, sondern gleich die Tür eintritt, lässt sich wohl eine gewisse Schrecksekunde nicht vermeiden. Natürlich ist es vorprogrammiert, wie weit er gehen kann. Er wird immer wieder von Thanner oder anderen gebremst. Und er hat die Fähigkeit, sich zu entschuldigen, Buße zu tun. So sorgt die Dramaturgie des Drehbuchs schon dafür, dass der Rahmen des Öffentlich-Rechtlichen nicht gesprengt wird. Ich plädiere oft für viel extremere Situationen, weil ich meine, man muss einen Menschen auch im völligen Umkippen zeigen. Aber da komme ich nicht durch. Im Film kannst du natürlich mehr bringen. Die ganzen Italo-Western leben ja davon, dass sie extrem übertreiben. Aber die Oberen des Öffentlich-Rechtlichen urteilen nicht danach, was sie sich selbst zumuten können, die denken immer sofort ans Publikum, das sie zugleich verachten und fürchten. Da könnte ja unter Umständen so ein alter Opa, Marke vorgestern, in seinem Wohnzimmer sitzen und denken, oh Gott, was passiert da mit unserem Staat.
In der Realität möchte ich dem Bullen Schimanski auch nicht begegnen.
Ich glaube, du hättest bei ihm eine viel größere Chance als bei anderen Bullen, denn er ist ja eher links gezeichnet, eine soziale Figur, einer, der eher scharf gegen die großen Bosse wird, sich aber immer auf die Seite der Minderheiten stellt. Obwohl die Verantwortlichen immer sagen, das ist eine Unterhaltungssendung und kein politisches Forum, aber det seh ick nich ein. Wir erreichen 15 bis 20 Millionen Zuschauer, und da ist so ein bisschen politischer Unterricht als Zugabe schon ganz jut.
Du hättest den Tatort gerne politischer?
Ich hätte gerne einen richtigen Polit-Thriller. Das wäre mein Wunschtraum. Deshalb hab ich auch ein eigenes Drehbuch geschrieben, in dem es um Neonazis ging, weil ich finde, dass der normale Deutsche einfach viel zu wenig von dieser Szene weiß. Die sind sogar akzeptiert, wenn sie nicht gerade das Oktoberfest mit ’ner Bombe stören. Ich wollte darin auch eine Demonstration zeigen und wie die Bullen mit ihren Videokameras die ganze Szene abfilmen. Das hat schließlich mit unserer politischen Landschaft zu tun; das gibt es, also wollte ich es zeigen. Auch Ausschreitungen der Polizei und wie sie gedeckt werden. Ich hatte eine Szene drin, wo der Schimanski selbst als Ziviler von seinen uniformierten Kollegen eins aufs Maul kriegt. Aber ich sollte das dann alles umschreiben, und da ich diesen Prozess des Umschreibens kenne – am Ende ist alles raus, was dir am Herzen lag –, habe ich gesagt, so oder gar nicht, und damit war’s gar nicht. Aber ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die wissen ja schließlich, dass sie mich motivieren müssen, weiterzumachen. Und es ist ja nicht so, dass ich beruflich den Tatort brauche, um als Schauspieler zu existieren. Aber mir ist bei der Sache wieder einmal der Unterschied zwischen Film und Fernsehen aufgegangen. Ein guter Filmproduzent wittert das gute Thema, ein Redakteur wittert nur Gefahr. Der hat immer Angst, seinen Sessel zu verlieren.
Sind Kinoproduzenten also engagierter als Fernsehproduzenten?
Nein. Aber ihr Kriterium, ob ein Stoff taugt, ist der Gewinn, den sie sich damit versprechen. Deshalb sind im Kino auch provokante Themen möglich – wenn sie Action zu bieten haben. Als Autorenfilm, der nur engagiert ist, aber nicht als Action-Thriller produziert werden kann, hast du in Deutschland auch im Kino keine Chance. Wenn du überhaupt einen Produzenten findest, läuft der Film anschließend in den Kunstkinos, bekommt auch ’nen Bundesfilmpreis, spielt aber nichts ein. Die einzigen, die es sich heute leisten können, einen Krimi mit drei Personen in einem Büro handeln zu lassen, sind die Franzosen. Bei uns muss es im Kino brodeln.
Bis 1969 hast du 26 Kinofilme gedreht, steht in deiner Biographie, danach in 15 Jahren nur einen einzigen, Aus einem deutschen Leben, über den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. Wie kam das, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der sich politisch und im Film endlich was tat, bei dir Funkstille eintrat?
Ich war für die Newcomer, die den deutschen Film umstürzen wollten, nur ein alter Opa. Ich hab ja meinen ersten Film 1958 gemacht und bekam dafür gleich den Deutschen Filmpreis und den Kritikerpreis. Dann habe ich die ganzen Karl-May-Filme gedreht, was mich für die Jungen natürlich sowieso abstempelte. Aber ich glaube, das hauptsächliche Problem dieser jungen Regisseure, mit einem wie mir zu arbeiten, war, dass es ja alles Laien waren. Natürlich hatten die auch Angst vor der Konfrontation mit Profis, dass ihnen plötzlich ein Schauspieler, der zehn, 15 Filme gedreht hat, sagt, dass das, was sie da gerade produzieren, Scheiße ist. Ich hab heute noch Probleme mit jungen Regisseuren, die absolut nicht wissen, wie sie sich artikulieren sollen. Wenn ihnen eine Szene nicht gefällt, sagen sie, mach doch mal anders. Sag ich: „Klar, mach ich, aber wie?“ – „Irgendwie“. Fassbinder hat mal bei mir angefragt, ob ich in einer Serie von ihm mitspielen will. Da wollte ich mit ihm über seine Bücher reden und der stand die ganze Zeit nur am Flipper und war überhaupt nicht in der Lage, darüber zu reden. Da hab ich abgesagt.
Ist Schimanski ein Rot-Grüner?
Ja, sicher. Die politische Couleur kriegt der schon allein durch seine Kleidung und sein rebellisches Auftreten. Und seine Handlungsweisen sind ja immer eindeutig. Auch seine Sprüche, die mir meist spontan einfallen oder die ich gemeinsam mit dem Eberhard noch einbaue. Er hat seine Freunde immer im kleinen Mief-Milieu. Es gibt auch kaum einen Schimanski-Tatort, wo nicht irgendein Nazi auftaucht, der „Heil Hitler!“ sagt und aus der Tür fliegt. Wir nehmen auch die Polizei hart ran. Die Bild regt sich ja regelmäßig auf, wenn ich wieder ein paar Bullen als Trachtengruppe bezeichnet habe.
Götz George und Schimanski sind auch hier einer Meinung?
Sicher. Früher SPD gewählt, dann alternativ, sobald es die gab, aber das war irgendwann auch nicht mehr das Wahre. Ich würde mich als verwirrten Linken bezeichnen, wobei ich, wenn man mich fragt, immer sage, ich bin unpolitisch. Denn wenn heute einer von mir ein politisches Statement zu irgendeiner aktuellen Sache erwartet, bin ich hilflos. Die Tagespolitik bekomme ich kaum mit. Während der Dreharbeiten habe ich einen 16-Stunden-Tag, da bleibt nicht die Zeit, mich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Da fall ich abends nur müde ins Bett. Nach den Dreharbeiten fahre ich nach Sardinien, da schalt ich vollkommen ab, bereite mich auf die nächste Rolle vor. Außerdem gibt es da sowieso nur die Bild, und dieses Drecksblatt kaufe ich aus Prinzip nicht. Da komme ich dann aus Italien zurück und höre oder lese im Flieger wie neulich: Es gab in Mexiko ein schreckliches Erdbeben und in Deutschland ist Axel Springer gestorben – wobei eine der beiden Nachrichten natürlich ganz fürchterlich war. Politisch aufmerksam werde ich immer nur, wenn ich sehe, das kannst du irgendwie in eine Szene einbauen. Da muss ich auch die Produktion loben. Normalerweise wird ja ein Buch abgesegnet und dann darf daran nichts mehr geändert werden. Bei uns läuft das schon flexibler, ich entwickle viele Ideen spontan beim Dreh. Die segnen zwar ein Buch vorher ab, kriegen aber einen völlig anderen Film – und akzeptieren das. Aber deshalb fand ich auch unseren letzten TatortHaus am Wald so langweilig. Der war nur auf Spannung gemacht, ohne irgendeinen sozialen Hintergrund. Deshalb hab ich mich mit dem Regisseur auch nicht vertragen und gesagt, ich hab keine Lust mehr, mit dem noch mal zu arbeiten. Ich möchte lieber politisch powern.
Könntest du dir vorstellen, wieder Wahlkampf zu machen wie 1972 für Willy Brandt?
Na logisch.
Für wen?
Na, da kommen ja nur SPD und die Grünen infrage. Denn es muss schon eine ernsthafte Partei sein, die auch regierungsfähig ist. Die Grünen geben wichtige Anstöße, aber ob sie auch in der Lage sind, diesen Apparat in den Griff zu kriegen, das weiß ich nicht. Das müssten sie aber, denn wir leben hier in einem vollkapitalistischen System, da braucht es zur Veränderung mehr als witzige Ideen. Wenn mich heute jemand fragt, würde ich sagen, ich gebe meine Stimme zwar ungern, aber doch der SPD. Aber die müssen mit den Grünen koalieren. Berlin ist natürlich eine besondere Situation, da ist die SPD so korrupt wie die CDU und eigentlich überhaupt nicht wählbar. Aber wir brauchen schon allein deshalb hier wieder eine SPD-Regierung, damit es eine weitere Annäherung mit der DDR gibt. Ich hab immer gearbeitet, meine Kohle verdient, hab mir ’n schönet Haus gebaut, aber engagier mich immer für die Kleenen. Hab ick immer gemacht, det is meine Denke. Deshalb bin ich im Herzen ein alter SPD-Mann geblieben. Aber ich trete nicht gerne auf. Das ist mir oft zu aufdringlich, wie manche Kollegen ihre politische Überzeugung verkaufen. Ich sag lieber, ich bin unpolitisch, und bringe klein, klein manchmal was unter.
Erstveröffentlicht in: Vorwärts vom 19. Oktober 1985
„Am Anfang hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen.“
Ein Besuch bei Eberhard Feik
Du kommst aus Sachsen?
Ich bin während der Evakuierung am 23.11.1943 in Chemnitz geboren. Ich hab noch vier Geschwister, bin der Jüngste. Als dann die Russen kamen, sind wir wieder nach Köln zurück. Ins Bergische Land. Bis zu meiner Einschulung habe ich dort auf dem Land gelebt und bin dann in einem Vorort von Köln, Höhenhaus, in die Grundschule gegangen, anschließend in der Stadt selbst aufs Gymnasium. Ich habe eine sehr freizügige Jugend erlebt.
Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater war Ingenieur, also Maschinenbauer, meine Mutter hat sich um die Kinder gekümmert. Wobei ich sagen muss, meine Mutter ist 1903 geboren und war in den frühen 20er Jahren schon selbstständig, hat also einen Beruf gehabt, Postbeamtin, und meinem Vater das Studium finanziert. Mein Vater hatte als Schlosser angefangen, aber Interesse zu studieren gezeigt. Sein Vater war Landbriefträger, mein anderer Großvater Steiger, das Ganze spielte sich in der Gegend von Dortmund ab. Ich fand das eine bewundernswerte Leistung meiner Mutter.
In Köln hab ich dann ’64 das Abitur gemacht und angefangen an einer Schauspielschule in einem kleinen Kellertheater, das es heute noch gibt. Nebenbei hab ich Deutsch, Englisch und Theaterwissenschaft studiert, zehn Semester lang, aber wirklich nur nebenbei. Ich habe sehr viel gespielt bereits auf dieser Theaterschule, für fünf D-Mark am Abend. Als ich 1967 mit der Schauspielschule fertig war, hatte ich praktisch alles gelernt. Denn alle Funktionen wurden dort so besetzt, wie es gerade notwendig war. Ich hab also Einlass gemacht, ich hab das Licht gemacht, Bühnenbild, geschminkt, Klamotten zusammengestellt … Das war damals eine sehr schöne und sehr fruchtbare Zeit.
Warum bist du überhaupt Schauspieler geworden – und nicht Kripobeamter oder Schlosser?
Ich kann da nur mutmaßen. Schauspielerei ist in unserer Familie genauso exotisch wie der Beruf des Walfischfängers. Ich habe weder Vorfahren noch Geschwister, die sich damit beschäftigten. Ich nehme an, wenn du als Nachzügler unter bis zu 14 Jahren älteren Geschwistern groß wirst, musst du Mechanismen entwickeln vorzukommen – hey, mich gibt es auch. Und ich hab mich weder dadurch hervorgetan, dass ich ein besonders guter Schüler war, noch dadurch, dass ich besonders artig war, sondern dadurch, dass ich immer irgendwelche Geschichten angestellt habe. In der Pubertät zum Beispiel hatte ich ein Leistungshoch im Sport, mit 14, 15 war ich Jahrgangsbester von Köln im Bannerwettkampf, also Bodenturnen und Leichtathletik. Da war ich unheimlich fit. Während die anderen Jungs sich langsam für ganz andere Dinge zu interessieren begannen, hat mich nur interessiert, wie ich die Kugel noch weiter werfen konnte, wie ich meine Leistung im Sport noch steigern konnte. Die Entwicklungen, die normalerweise mit der Pubertät laufen, sind bei mir sehr viel später gekommen, da hatte ich schon Kinder. Eh ich zur Besinnung kam, war ich 30.
Ich hatte nie das Gefühl, jetzt werde ich Schauspieler. Es war immer die Befriedigung einer Lust, im Spiel das zu tun, was mir die Wirklichkeit nicht zuließ. Da bist du der kleine Bruder, machst die Klappe auf und kriegst gleich einen auf den Deckel. Insofern hab ich damals wohl Techniken entwickelt, vorzukommen, ohne anzuecken. Den Ausschlag gab aber wohl mein absoluter Jugendfreund Jürgen Flimm. Wir haben schon in der Schule viel zusammen gemacht, beim Schulkarneval, bei irgendwelchen Jubiläumsveranstaltungen. Ich war damals einer der berühmtesten Büttenredner von Köln. Und Krätzchensänger. Also das, was den Leuten heute von den Black Föös her bekannt ist, hab ich damals gemacht. – Als die Bierchen und Kölsch angesagt waren und das mit dem Sport nicht mehr so lief, weil die Puste wegblieb. Während der Studentenzeit hab ich noch Boulevardtheater gespielt. Heute bereue ich, dass ich das nicht bewusster mitbekommen habe. Denn von den Kollegen, die ausschließlich Boulevardstücke spielen, kann man eine Menge lernen, etwa über Dialogtechniken. Die beiden Jahre, die ich am Theater am Dom gespielt habe, möchte ich nicht missen. Dann stand ich vor der Entscheidung: Was mach ich jetzt? Mach ich den Lehrer fertig, den man mir von zu Hause angeraten hat, einen Sicherheitsberuf? Ich hätte noch zwei Semester bis zum Vorexamen studieren müssen. Dann hörte ich von einem Freund, der in Krefeld Dramaturg war, wir suchen so einen wie dich. Ich bin hingefahren, hab vorgesprochen und bin genommen worden. Das gab natürlich einen Riesenkrach zu Hause mit meinen Eltern, die mich in der Zukunft schon als herumfahrender Landstreicher gesehen haben, „bei den Zigeunern“.
Ich bin dann mit meinem Kind und meiner Frau Anneli Wagner, die übrigens Journalistin gelernt hat, vorher auch Schauspielerin war, jetzt Drehbücher schreibt und Filmemacherin ist, nach Krefeld gegangen. Von da an ging es rasend weiter. Ich hab nach einem Jahr von Peter Palitzsch ein Angebot für das Staatstheater Stuttgart bekommen, bin mit ihm zwei Jahre später nach Frankfurt gegangen. Aber irgendwie bin ich dann in eine Sackgasse geraten. Ich hab mich mehr für Mitbestimmungsdiskussionen interessiert als für die Ausübung meines Berufes. Ich war damals in der Gewerkschaft Deutscher Bühnenarbeiter und sehr engagiert. Das war richtig, aber ich hätte meine Arbeit nicht völlig vernachlässigen dürfen. Die Revolution wäre ja sowieso gekommen, auch wenn ich etwas weniger dafür getan hätte. [Lacht.] Damals sah ich in der Schaubühne den Prinz von Homburg. Da war ich so hellauf begeistert, dass ich mich spät abends noch an die Schreibmaschine gesetzt habe und dem Peter Stein einen Brief geschrieben habe, mich würde die Arbeitsweise interessieren, die so ein Ergebnis ermöglicht. Ein halbes Jahr später bekam ich einen Brief zurück: Was ich denn eigentlich sei, Schauspieler oder Dramaturg? Na gut, ich bin dann zum Vorsprechen vorbeigegangen. Mein Vertrag in Frankfurt lief gerade aus und ich sollte drei Monate später nach Hamburg ans Thalia gehen, spielte in der Übergangszeit in Kaiserslautern den Luther. Ich habe dort Szenen aus der großen Predigt vorgesprochen und der Stein sagte nur: „Danke, danke, hör mal auf. Spielst du eigentlich für Gehörlose und Blinde?“ Aber drei Tage später kam das Angebot, an die Schaubühne am Halleschen Ufer zu gehen. Also brach die ganze Familie, inzwischen waren es zwei Töchter, wieder die Zelte ab und schlug sie neu in Berlin auf. Die sechs Jahre an der Schaubühne wurden für mich die entscheidenden Jahre überhaupt.
Äußerlich war das Theater eine heruntergekommene Spielstätte in einem abgelegenen Gewerkschaftshaus in Kreuzberg. 1970 kam Peter Stein an das Theater und machte es mit seinen Inszenierungen innerhalb weniger Jahre zu einem Ereignis. Stein debütierte in Berlin mit dem Brecht-Stück Die Mutter, das heroisierend die Wandlung einer unpolitischen Proletarierin aus dem vorrevolutionären Russland zur überzeugten Bolschewistin darstellt. Es folgten weitere Aufführungen, die die muffige Mauerstadt aufmischten und die Berliner CDU zum Kochen brachten. Vor ernsten Konsequenzen schützte der künstlerische Erfolg. Die Schauspieler waren Stars oder sollten später welche werden: Edith Clever und Jutta Lampe, Bruno Ganz und Otto Sander. Und mittendrin von 1973 an der etwas jüngere Eberhard Feik.
Dem linken Ideal folgend, versuchte sich die Schaubühne an innerbetrieblicher Demokratie. Die Schauspieler erhielten Einheitsgagen. Tage- und nächtelang debattierte das Ensemble die nächsten Stücke oder die Weltlage oder beides. Man traf sich zu Marx-Seminaren und bereitete Inszenierungen mit gleichermaßen politischem wie akademischem Eifer vor. Um dem bundesdeutschen Proletariat Kultur und Klassenbewusstsein nahezubringen, zog man als Wanderbühne durch Betriebe und nahm schließlich sogar türkischsprachige Stücke ins Programm, um auch Gastarbeiter zu erreichen.
„Es war hart“, erinnert sich Ilse Ritter, 70, Freundin und Kollegin Feiks während der Schaubühnen-Zeit. „Jeden Abend Vorstellung, man war frühestens um Mitternacht zu Hause, morgens um zehn rappelte man sich wieder auf zur Probe. Und am einzigen freien Tag gab’s dann noch irgendeine Sitzung. Da wurden Unterschriften gesammelt für Mao in China.“ Die Stimmung muss teilweise sehr eigen gewesen sein. „Ich kam morgens ins Haus und habe ‚Guten Morgen‘ gesagt, aber kein Mensch grüßte zurück. Es hieß: Diese bürgerliche Scheiße haben wir uns abgewöhnt.“ Im Ensemble habe damals eine „Grundbegeisterung für Utopien“ geherrscht – für alles, nur nicht für die Bundesrepublik. Die Politik sei „schon sein Ding gewesen“, sagt sie über Eberhard Feik. „In den Sitzungen – und es gab endlos viele Sitzungen – war er sehr eloquent.“
Aus: „Die Akte Feik“ von Toralf Staud, in: Zeitmagazin 52/2014
Aus heutiger Sicht war die Schaubühne damals ja ein geradezu revolutionäres Theater: gleiche Löhne, Mitbestimmung, politisch hochbrisante Produktionen …
Aber mein Anspruch war natürlich gewaltig höher. Und als ich dort hinkam, war vieles schon wieder abgebaut. Konflikte, die einfach aufgrund nicht zu vereinbarender Positionen und Interessen nicht durch Mitbestimmung einvernehmlich zu lösen waren, wurden wieder hierarchisch entschieden. Ich habe damals vieles nicht begriffen, was so unter den Kollegen lief an zwischenmenschlichen Hierarchien. Ich habe immer naiv gedacht, alle sind doch hier gleich. Und so habe ich mich in Situationen reinmanövriert, an denen die Kollegen allerdings nicht ganz unschuldig waren, sie haben mich vor den Beton laufen lassen. Ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich mit mir so todunglücklich war, dass ich gesagt habe, ich muss hier weggehen.
Was waren denn konkret die Konfliktpunkte?
Ich hab immer geglaubt, ich müsste was anderes spielen, größere Rollen. Ich hab ja auch wirklich was geleistet dort. Aber es war vor allem wohl meine Haltung zu diesem Beruf, mit der ich auch immer wieder bei den Kollegen aneckte: Ich war nie der Meinung und bin es auch heute nicht, die Schaubühne sei ein elitärer Haufen und dürfe sich so benehmen. Ich weiß nicht, was daran elitär sein soll, wenn Schauspieler und Regisseure zusammenkommen und das machen und ausprobieren, was sie subjektiv interessiert, und darauf hoffen, Zuschauer dafür zu finden. Ich hätte kürzlich die Gelegenheit gehabt, wieder dort im Lear mitzuspielen, aber das Angebot kam zu kurzfristig. Als Freiberufler kann ich nicht so kurzfristig 14 Tage nur eine Rolle lernen und alles andere absagen. Das hat mich tierisch geärgert. Bei der Schaubühne werden Engagements ja geradezu libidinös vergeben. Da wird nicht jemand verpflichtet, nur weil er ein guter Schauspieler ist, sondern die Kollegen müssen ihn als Person, als Mensch auch wollen. Das ist oft ein Prozess über Jahre.