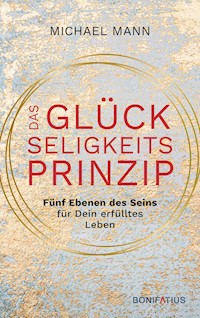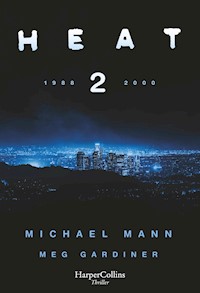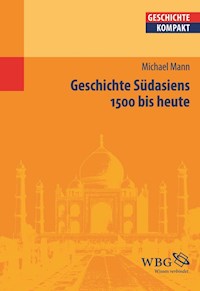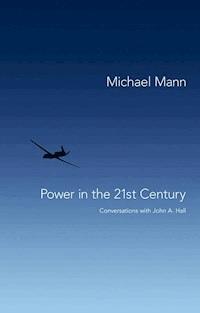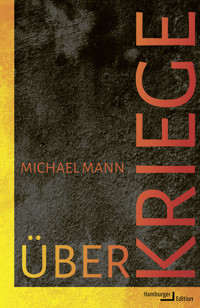
40,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum werden Kriege geführt? Was ist ausschlaggebend für die Entscheidung zum Krieg? Michael Mann erzählt die Geschichte des Krieges vom antiken Rom bis zum Überfall auf die Ukraine, vom kaiserlichen China bis zu Auseinandersetzungen im Nahen Osten, von Japan und Europa bis zur postkolonialen Geschichte Lateinamerikas und zu den Kriegen der Vereinigten Staaten. Obwohl sich die Waffen und die Organisation des Krieges im Laufe der Zeit enorm gewandelt haben, hat sich der Charakter der Entscheidungsprozesse kaum verändert. Fast immer wurde und wird der finale Entschluss von sehr kleinen Gruppen von Machthabern getroffen, manchmal nur von einer Person. Charaktere, Emotionen und Ideologien sind ausschlaggebend. Doch auch Status, Ehre und Ruhm spielen nach wie vor eine große Rolle. Die meisten Herrscher, die Kriege beginnen, verlieren sie, und in historischer Perspektive ist die große Mehrheit der Staaten aufgrund von Kriegen untergegangen. Durch die meisterhafte Verbindung ideologischer, wirtschaftlicher, politischer und militärischer Analysen eröffnet der preisgekrönte Soziologe Michael Mann neue Perspektiven auf die Geschichte und Gegenwart von Kriegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1320
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MICHAEL MANN
ÜBER KRIEGE
Aus dem Englischen von
Laura Su Bischoff,
Michael Bischoff und
Ulrike Bischoff
Hamburger Edition
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-437-4
© der deutschen Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-383-4
© der Originalausgabe 2023 by Michael Mann
Originally published by Yale University Press
Translation rights arranged by The Sandra Dijkstra Literacy Agency
Titel der Originalausgabe: »On Wars«
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
INHALT
Vorwort
EINS
Militärmacht und Krieg
ZWEI
Ist Krieg etwas Universelles?
DREI
Theorien zu Kriegsgründen
VIER
Die Römische Republik
FÜNF
Das alte China
SECHS
Das kaiserliche China
SIEBEN
Das mittelalterliche und das moderne Japan
ACHT
Eintausend Jahre Europa
NEUN
Siebenhundert Jahre Süd- und Mittelamerika
ZEHN
Werden Kriege weniger?
ELF
Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld I: Von der Antike bis zum Amerikanischen Bürgerkrieg
ZWÖLF
Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld II: Die Weltkriege
DREIZEHN
Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld III: Kommunistische Kriege
VIERZEHN
Jüngere Kriege in muslimischen Ländern
FÜNFZEHN
Mögliche Zukunft
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Personenregister
Über den Autor
Vorwort
Im Jahr 2013 beendete ich den vierten und letzten Band meines Werkes The Sources of Social Power sowie zwei Aufsätze, die nicht in dieses Buch passten. Während der Arbeit daran fiel mir auf, dass ich die Rolle militärischer Macht in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft zwar immer betont, aber ihren Hauptmechanismus, den Krieg, nie systematisch untersucht hatte. Daher habe ich mich in den letzten acht Jahren mit einer weitreichenden Erforschung der Kriege im Laufe der Menschheitsgeschichte – und ein bisschen auch in der Vorgeschichte – beschäftigt.
Meine Faszination vom Krieg geht auf keinerlei persönliche Erfahrung zurück. Laut unserer Familienüberlieferung wurde ich im Zweiten Weltkrieg während eines deutschen Bombenangriffs auf Manchester im Keller eines dortigen Krankenhauses geboren. Falls das stimmt, war es meine letzte Kriegserfahrung. Die Wehrpflicht wurde in Großbritannien, ein Jahr bevor ich sie hätte ableisten müssen, abgeschafft, und als ich amerikanischer Staatsbürger wurde, war ich bereits zu alt, um eingezogen zu werden. Ich habe noch nie eine Schusswaffe besessen oder abgefeuert. Manche Soziologinnen1 erforschen sich selbst – sie schreiben beispielsweise über ihre eigene Gesellschaftsschicht, ihre ethnische Gruppe oder ihre sexuelle Identität, aber andere, ich eingeschlossen, ebenso wie Anthropologen sind von dem Versuch fasziniert, fremde Lebensweisen zu verstehen.
Dank der Covid-19-Pandemie konnte ich mich in den letzten zwei Jahren dieses Forschungsprojekts ausschließlich der – internetbasierten – Arbeit daran widmen, unterstützt nicht nur von der wunderbaren UCLA Young Research Library, sondern auch von den Internetressourcen von JSTOR für Zeitschriftenartikel, Z-Library für den Internetzugang zu den meisten Büchern, die ich brauchte, und Wikipedia für die schnelle Überprüfung von Daten und Fakten. Allerdings muss ich gleich zugeben, dass sich meine Lektüre auf englisch- und französischsprachige Werke beschränkte.
Ich möchte meiner Literaturagentin Elise Capron von der Sandra Dijkstra Agency für ihre Unterstützung und ihr Marketing-Geschick danken. Wie immer stehe ich intellektuell in der Schuld bei John A. Hall sowie bei Randall Collins und Siniša Malešević für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Gewalt, auch wenn ich zuweilen anderer Meinung war als sie. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen an der University of California, Los Angeles, sowie den Studentinnen und Studenten des Soziologieseminars 237. Den klassischen Autoren über den Krieg von Sun Zi über Polybios und Ibn Khaldun bis zu Clausewitz, Ardant du Picq und Raymond Aron gilt meine Ehrerbietung. Zudem habe ich einer Vielzahl von Archäologen, Anthropologinnen und Historikern für ihre zahlreichen empirischen Studien zu danken, auf die ich ausgiebig zurückgegriffen habe. Die Klärung der theoretischen Probleme, um die es hier geht, ist Politologinnen zu verdanken. Außerdem bedanke ich mich bei zwei anonymen Rezensenten meines Manuskripts für ihre sachdienliche Kritik, die ich aufzunehmen versucht habe.
Nicky Hart ist seit über vierzig Jahren meine ständige Gefährtin. Ohne ihre Liebe, Unterstützung, intellektuellen Anregungen und Erinnerungen an die Sonnenseite des Lebens hätte ich dieses recht düstere Projekt nicht fertigstellen können. Aus ähnlichen Gründen möchte ich meinen Kindern Louise, Gareth und Laura danken. Mögen sie – und die ganze Menschheit – das gleiche Glück haben wie ich, nie in Kriegen kämpfen oder als Zivilisten leiden zu müssen.
1 In dieser Übersetzung bemühen wir uns um eine gendergerechte Sprache, indem wir wahllos zwischen den grammatikalischen Geschlechtern wechseln. Auf dieses Vorgehen verzichten wir jedoch in historischen Kontexten, in denen Frauen vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen blieben [Anm. d. Übers.].
EINS
Militärmacht und Krieg
Kriege fördern die schlimmsten Seiten der Menschen zutage, sie führen dazu, dass Menschen sich gegenseitig massenhaft töten und verstümmeln. Es fällt nicht schwer, das zu bedauern. Schon Herodot zitierte Lydiens König Krösus, der im 6. Jahrhundert v. u. Z. gesagt haben soll: »Denn keiner ist so dumm, dass er Krieg dem Frieden vorzieht; denn im Frieden begraben die Kinder ihre Eltern, im Krieg dagegen die Eltern ihre Kinder.«1 Und im 18. Jahrhundert erklärte Benjamin Franklin: »Es gab nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden.« Rebecca West drückte sich schärfer aus, als sie 1941 über bewaffnete Konflikte in der jugoslawischen Geschichte sagte: »Es ist manchmal sehr schwierig, zwischen Geschichte und dem Gestank eines Stinktiers zu unterscheiden.« Aber was entscheidet darüber, ob Krieg oder Frieden gewählt wird? Sind Kriege von der menschlichen Natur, dem Wesen der menschlichen Gesellschaft oder von anderen Kräften getrieben? Sind Kriege rational? Bewirken sie überhaupt etwas Gutes? Meine Antwort lautet im weitesten Sinne, dass Kriege zwar ein rationales Element enthalten, dieses jedoch in unterschiedlichem Maße in die Emotionen und Ideologien der Menschen, besonders ihrer Herrschenden, und in die Strukturen und Kulturen der menschlichen Gesellschaft eingeflochten wird. Diese Kombination treibt Herrschende oft zu Kriegen, die selten rational sind und nur wenigen Vorteile bringen. Wären Menschen und ihre Herrschenden überwiegend rationale Wesen, gäbe es weitaus weniger Kriege – ein Ideal, das es durchaus wert ist, es zumindest anzustreben.
Da ich viele Kriege analysiere, steht dieses Wort in meinem Buchtitel im Plural. Die meisten Untersuchungen zum Krieg stammen von Historikerinnen und Politologen, die sich auf Internationale Beziehungen spezialisiert haben. Im Fokus dieses Fachgebiets stehen bewaffnete Konflikte zwischen den europäischen Großmächten seit 1816, da aus dieser Zeit quantitative Daten zu Kriegen vorliegen. Die bevorzugte Methode ist die Statistik, aber es ist zugleich einseitig auf Europa und die Moderne ausgerichtet. Dagegen befassen sich Historiker mit Kriegen vieler Regionen und Epochen. Zudem erinnern sie uns daran, dass Kriege sich nicht als losgelöste, unabhängige Fälle ereignen, die sich in statistischen Modellen erfassen ließen. Vielmehr stehen sie in einer Abfolge, in der die Erfahrungen der Vergangenheit die Lebenden zutiefst beeinflussen. Allerdings trauen sich nur wenige Historikerinnen an eine vergleichende Analyse über verschiedene Regionen und Geschichtsepochen heran. Ich wage es, gestützt auf ihre eingehenden Analysen.
Aus dem Blickwinkel der vergleichenden und historischen Soziologie befasse ich mich mit der Abfolge von Krieg und Frieden in verschiedenen Regionen und Geschichtsepochen, die ich ausgewählt habe, weil sie gut dokumentierte Fälle mit unterschiedlichen Kriegshäufigkeiten bieten – namentlich Rom, China zur Kaiserzeit, die Mongolen, Japan, Europa im Mittelalter und in der Moderne, das präkolumbische Amerika und Lateinamerika, die beiden Weltkriege und die jüngeren Kriege Amerikas und des Nahen Ostens. Gut dokumentiert heißt, dass es eine Fülle von Schriftzeugnissen gibt, allerdings haben viele Gesellschaften keine solchen Dokumente hinterlassen. Leider habe ich die historischen Kriege in Süd- und Südostasien sowie die im klassischen Griechenland aus Gründen des Umfangs, der Sprache und persönlicher Erschöpfung vernachlässigen müssen. Ich behaupte nicht, dass meine Auswahl der Kriege repräsentativ ist. Das ist unmöglich, da die Gesamtzahl der Kriege unbekannt ist und viele der bekannten nur spärlich dokumentiert sind, wie es bei den im 8. und 10. Kapitel angesprochenen Kolonialkriegen der Fall ist. Ich befasse mich mit der Abfolge von Kriegen, da sie nur selten als Einzelereignis vorkommen und die Vergangenheit zwingende Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Das ist die Tyrannei der Geschichte. Soweit vorhanden, führe ich einfache Statistiken an. Mein Fokus liegt auf zwischenstaatlichen Kriegen, aber da sie häufig mit Bürgerkriegen und extrastaatlichen Konflikten (Kämpfen mit nichtstaatlichen Herausforderern) verknüpft sind, erörtere ich diese ebenfalls, soweit sie relevant sind und Dokumente existieren. Militärmacht wird auch zur Unterdrückung im Inland eingesetzt, was eine Voraussetzung dafür ist, dass Herrschende überhaupt Kriege führen können, aber auf diese Art der Repression gehe ich nicht ausführlich ein.
Im Laufe der Geschichte haben Kriege sich in Hinblick auf Waffen, Technologie und Organisation offenkundig stark verändert. In den letzten beiden Jahrhunderten ist das Tötungspotenzial von Waffen exponentiell gewachsen, und im 20. Jahrhundert kam noch die Vernichtungskraft durch Luftstreitkräfte und im 21. Jahrhundert der Cyberwar hinzu. Das machte weitgehende Veränderungen der militärischen Organisation und Taktik notwendig. Die Organisation staatlicher Streitkräfte ist wesentlich komplexer geworden, und der Charakter von Schlachten hat sich erheblich verändert. Das »brutale« Töten im Kampf »Mann gegen Mann« ist teils dem »gefühllosen« Töten aus der Ferne gewichen. Soldaten ziehen nicht mehr aufrecht stehend in die Schlacht. Wenn sie das täten, würden sie dezimiert. Moderne Soldatinnen verteilen sich in kleinen Einheiten über größere Schlachtfelder, suchen Deckung, leben in Unterständen – und das recht erfolgreich, denn trotz weitaus tödlicherer Waffen ist die Quote der Getöteten und Verletzten nicht gestiegen. Die medizinische Versorgung des Militärs hat dazu geführt, dass die Zahl derjenigen, die an ihren Verletzungen sterben, drastisch gesunken ist und ein stärkeres Bewusstsein für psychische Erkrankungen herrscht. Allerdings hat sich durch die Waffen, besonders solche, die aus der Luft einzusetzen sind, der Anteil der zivilen Todesopfer und Verletzten erhöht, und mittlerweile ist es üblich, die Gesamtbevölkerung eines Landes als Feind anzusehen. In der Moderne sind politische und religiöse Ideologien, die den Krieg rechtfertigen, tiefer in die Gesellschaftsstruktur eingedrungen. Durch den starken Anstieg der Alphabetisierung in der Moderne verfügen wir mittlerweile über erheblich mehr Schriftzeugnisse, da zu den Schilderungen der Chronisten früherer Zeiten nun auch Berichte einfacher Soldaten und sozialwissenschaftliche Erhebungen hinzugekommen sind.
Dagegen haben sich die Kriegsgründe und der Charakter der Entscheidungen über Krieg und Frieden wesentlich weniger verändert. Die größten Variationen bestehen zwischen den verschiedenen Kriegsarten. Ich unterscheide zwischen Angriffskriegen, Verteidigungskriegen und Kriegen aufgrund gegenseitiger Provokation und Eskalation. Die Angriffskriege unterteile ich in: (1) kurzfristige Überfälle; (2) den Einsatz von Militärmacht, um ausländische Regime zu stürzen oder zu stärken und gefügig zu machen, also eine Form von indirektem Imperialismus; (3) Eroberung von und unmittelbare Herrschaft über Grenzgebiete; (4) Eroberung und unmittelbare Herrschaft über ganze Reiche. Ein Angriffskrieg führt offenkundig auch zur Verteidigung der Angegriffenen, und so mischen sich in vielen Kriegen Elemente mehrerer Kriegsarten. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen symmetrischer und asymmetrischer Kriegführung, also die Frage, ob die beteiligten Kampftruppen über annähernd die gleiche oder erheblich unterschiedliche Kampfkraft verfügen. Jede dieser Kriegsarten wies im Laufe der Geschichte gewisse gemeinsame Merkmale auf, sodass Verallgemeinerungen möglich sind. Allerdings besteht ein historischer Unterschied zwischen militärischen Überfällen und imperialer Eroberung einerseits und Regimewechseln und der Eroberung von Teilgebieten andererseits. Die beiden erstgenannten Formen sind in den letzten Jahrzehnten nahezu völlig verschwunden, während sich die beiden letztgenannten gehalten haben.
Als Soziologe halte ich mich an zwei methodische Grundsätze: einerseits an die Notwendigkeit analytischer und konzeptioneller Strenge, die zwangsläufig verallgemeinernd ist; andererseits an die Notwendigkeit, die empirische Realität zu erfassen, die unausweichlich vielfältig ist. Zwischen beiden besteht ein – wie ich hoffe, kreatives – Spannungsverhältnis. Ich beginne mit den universellen Konzepten und einer nahezu universellen Annahme, die den Rahmen meiner Forschung bildet. Dabei gehe ich davon aus, dass wir Menschen bestrebt sind, die Ressourcen zu mehren, die wir wertschätzen – materieller Besitz, Freuden, Wissen, gesellschaftlicher Status und alles andere, dem wir Wert beimessen –, oder dass dies zumindest für genügend Menschen gilt, um der menschlichen Gesellschaft ihre Dynamik zu verleihen und ihre Geschichte zu prägen. Um unsere Ressourcen zu vermehren oder zu bewahren, müssen wir Macht ausüben, definiert als Fähigkeit, andere zu Dingen zu bewegen, die sie ansonsten nicht tun würden.
Macht hat zwei Gesichter: Zum einen ermöglicht sie es manchen Menschen, ihre Ziele zu erreichen, indem sie andere beherrschen. Diese »Macht über« andere, »Verteilungsmacht« oder Herrschaft genannt, bringt Imperien, gesellschaftliche Hierarchien, Gesellschaftsschichten und Gender- und »Rassen«-Herrschaft hervor. Dies alles sind treibende Kräfte von Kriegen. Zum anderen ermöglicht Macht es Menschen jedoch auch zusammenzuarbeiten, um Dinge zu erreichen, die sie einzeln nicht umsetzen könnten. Diese »Macht durch« andere ist die Kollektivmacht. Ohne sie, also ohne die Kooperation von Menschen zur Erreichung ihrer Ziele, wäre menschliche Entwicklung nicht möglich, während es in nahezu allen bekannten Gesellschaften Verteilungsmachtverhältnisse, also gesellschaftliche Hierarchien, gab. Kollektiv- und Verteilungsmacht sind eng miteinander verflochten, vor allem im Denken von Herrschern, die in der Regel behaupten, sie übten ihre Macht über andere zum Nutzen aller aus, ebenso wie Imperialisten behaupten, sie brächten den Eroberten die Vorzüge der Zivilisation – wie es chinesische, römische, europäische, sowjetische Herrschende getan haben und gegenwärtig amerikanische tun.
In meinem Werk Sources of Social Power unterscheide ich vier Machtquellen: ideologische, wirtschaftliche, militärische und politische. Diese Einteilung habe ich mittlerweile in drei Punkten verändert: Erstens unterscheide ich zwischen politischer Macht, die Herrschende im Inland ausüben, und der »diplomatischen«, friedlichen geopolitischen Macht, die im Ausland ausgeübt wird. Zweitens verknüpfe ich Ideologien mit Emotionen, da beide empirische Erkenntnis übersteigen. Ideologien und Emotionen »füllen die Lücken« zwischen den Bruchstücken wissenschaftlich und empirisch nachweisbaren Wissens. Wir besitzen keine objektiven Erkenntnisse über die Welt, daher handeln wir mithilfe generalisierter Deutungssysteme (wie Liberalismus, Konservatismus, Nationalismus, Religion, Familienwerte) und emotionaler Bindungen. Beide sind miteinander verwoben, weil wirkmächtige Ideologien zu starken Emotionen führen. Drittens sehe ich diese vier Machtquellen als Mittel, die Ziele zu erreichen, die Menschen sich setzen. Davon bin ich nach wie vor überzeugt, aber inzwischen füge ich ausdrücklich hinzu, dass Macht auch als Selbstzweck verstanden werden kann, was ich im Folgenden näher erklären werde.
Kontrolle über diese Machtressourcen bietet die wesentlichen Möglichkeiten, andere zu bewegen, dass sie Dinge tun, die sie andernfalls nicht tun würden. Ideologische, wirtschaftliche, militärische, politische und geopolitische Macht auszuüben, ist das Hauptmittel, angestrebte Ziele zu erreichen. Wenn wir Kriege erklären wollen, müssen wir also begreifen, warum Menschen sich für Krieg entscheiden, statt zur Sicherung als wertvoll erachteter Ziele wirtschaftlichen Austausch, gemeinsame kooperative Ideologien oder friedliche Politik oder Geopolitik zu nutzen. Tatsächlich werden mehr Streitigkeiten mit solchen Mitteln beigelegt oder klein gehalten, ohne zum Krieg zu führen. Geopolitik umfasst zwei verschiedene Elemente: die Auswirkung der geografischen, ökologischen Umgebung auf menschliches Handeln, das die Autoren des 19. Jahrhunderts betonten; und die internationalen Beziehungen zwischen Staaten und Gemeinschaften, die heutige Politologinnen hervorheben. Vielleicht ist »Entscheidung« für den Krieg nicht die richtige Wortwahl. Herrschende fühlen sich möglicherweise durch die Rolle des Kriegers, die man ihrer Ansicht nach von ihnen erwartet, unter Druck gesetzt. Krieg ist einfach das Mittel, zu dem römische Senatoren, mongolische Khans, französische Könige oder amerikanische Präsidenten gewöhnlich greifen, wenn sie den Eindruck haben, beleidigt worden zu sein, oder wenn sie eine Chance wittern. Tatsächlich haben sie häufig das Gefühl, in bestimmten Situationen keine andere Wahl zu haben, als Krieg zu führen.
Soweit wir es beurteilen können, zog die große Mehrheit der Menschen im Laufe der Geschichte Frieden dem Krieg vor. Sie hatten den Eindruck, dass sie ihre angestrebten Ziele besser durch Handel, gemeinsame Ideologien oder Diplomatie als durch die Ausübung militärischer Macht erreichen konnten. Also möchte ich die Ausnahmen – den Krieg – zu erklären versuchen.
Die (Ir-)Rationalität des Krieges
Sind Kriege rational? Die grundlegende Frage lautet, ob Kriege tatsächlich angestrebte und wünschenswerte Ziele verwirklichen. Falls ja, könnten wir einen Krieg als rational bezeichnen; falls nein, wäre er wohl irrational. Allerdings müssen wir zwischen der Rationalität der Mittel und der des Zwecks unterscheiden. Rationalität der Mittel betrifft die effiziente Entscheidungsfindung, die wohlüberlegt und kalkulierend, vermutlich nach einigen Debatten, die Ziele und Mittel aufgrund der besten zu dieser Zeit verfügbaren Informationen abwägt und Krieg dann für das adäquate Mittel hält, die erwünschten Ziele zu erreichen. Zur Irrationalität der Mittel kommt es, wenn die Kriegsentscheidung überhastet, uninformiert, emotional oder aus ideologischen Gründen getroffen wird und absehbar ist, dass sie als Mittel ungeeignet ist, die Ziele zu erreichen. Es kommt häufig vor, dass die durch Krieg angestrebten Ziele nicht erreicht werden. Das kann aber viele Gründe haben, die zum Zeitpunkt der Kriegsentscheidung keineswegs alle vorhersehbar waren. Der Krieg erweist sich als Fehler, was aber im Voraus nicht klar war – er war falsch, aber nicht irrational.
Daher füge ich hier nun das Rechtsprinzip der »vernünftigen Person« oder des vernünftigen Beobachters hinzu. Wäre eine solche Person zu der Einschätzung gelangt, dass ein Krieg seinen Zweck erfüllen würde? Herrschende, die sich für Krieg entscheiden, halten dies selbstverständlich für rationales Verhalten. So dachte Adolf Hitler, als er in Russland einmarschierte, den Vereinigten Staaten den Krieg erklärte und die Jüdinnen und Juden ermordete. Aber nur wenige teilten diese Einschätzung, unter anderem auch viele seiner Generäle. Die Beurteilung der Rationalität ist Sache von Zeitgenossen oder späteren Wissenschaftlern wie mir. Es besteht Spielraum für Meinungsverschiedenheiten, aber der Vorwurf der Irrationalität lässt sich erheben, wenn diese Beobachterinnen nach den verfügbaren Indizien zu dem Schluss kommen, dass die angestrebten Ziele, ungeachtet der späteren Unsicherheiten des Krieges, nicht hätten erreicht werden können. Diese Ansicht habe ich beispielsweise kurz vor der amerikanischen Invasion im Irak 2003 in meinem Buch Die ohnmächtige Supermacht geäußert.2 Geht man von der großzügigen Annahme aus, dass die Regierung Bush als Hauptziel verfolgte, Saddam Husseins autokratisches Regime durch einen demokratischen Staat zu ersetzen, so hatten die US-Streitkräfte nie bedeutende irakische Verbündete, die dieses Bestreben geteilt hätten, und sie hatten sich in keiner Weise darauf vorbereitet, mit sektiererischen Spaltungen innerhalb der irakischen Bevölkerung umzugehen. Wie ich vorhergesagt habe, mussten die Amerikaner mit manchen sektiererischen Gruppen Vereinbarungen treffen, über andere zu herrschen, und so entstand eine ungeordnete Ethnokratie, keine geordnete Demokratie. Es war ein irrationaler Krieg für ein illusionäres Ziel. Das Gleiche gilt weitgehend für Präsident Putins Invasion in der Ukraine 2022. Bei den meisten Kriegen ist die Torheit jedoch nicht so offensichtlich. Ob es sich um eine Irrationalität der Mittel handelt, mag umstritten sein.
Die Rationalität der Ziele zu beurteilen, ist problematisch, da es letztlich ein Urteil darüber beinhaltet, ob Krieg »Nutzen« bringt, und wenn ja, für wen. Über Nutzen lässt sich streiten. Hitler entwickelte ein außerordentlich effizientes Programm zur Ermordung von Juden, das innerhalb von nur vier Jahren sechs Millionen Menschen tötete, eine Rationalität der Mittel, die wohl in der gesamten Geschichte ihresgleichen sucht. Hitler und seine Anhänger glaubten, dieser Genozid sei auch als Ziel rational, da sie fürchteten, die bloße Existenz von Juden bedrohe die Zivilisation. Aber praktisch niemand sonst glaubte dies oder hätte diesen Zweck für rational in dem Sinne gehalten, dass er einen allgemeinen Nutzen darstellte. Uns erscheint Hitler in seinem Streben nach diesem Ziel als verrückt. Das ist jedoch ein Extremfall, und ob und wem ein Ziel »Nutzen« bringt, ist oftmals umstritten.
Auf etwas sichererem Terrain bewegen wir uns mit dem engeren materialistischen Verständnis von Rationalität, das Verfechter des Realismus und Marxismus vertreten. Sie sehen Kriege als hauptsächlich auf wirtschaftlichen Gewinn oder geopolitisches Überleben (oder beides) ausgerichtet, wobei der durch den Krieg erlangte wahrscheinliche Profit oder das sichere Überleben dessen Kosten übersteigt oder auch nicht. In diese Berechnung fließen vier Elemente ein: a) die Kosten in Geldwert; b) die Kosten an Menschenleben; c) die Wahrscheinlichkeit des Sieges; und d) der aus dem Sieg wahrscheinlich erwachsende Lohn. In meinen Fallstudien versuche ich einzuschätzen, in welchem Maße jedes dieser Elemente in Betracht gezogen wird. Aus dieser Art von wirtschaftlich-militärischer Abwägung besteht die instrumentelle Rationalität oder Zweckrationalität, wie Max Weber sie definierte. Wären die Kosten absehbar größer als der Gewinn, wäre Krieg materiell irrational. Doch selbst diese Bewertung ist schwierig, da wirtschaftlicher Gewinn, Opferraten und Siegeschancen nicht dieselben Maßeinheiten verwenden und es sich unmöglich berechnen lässt, wie viel Profit bei welchen Siegeschancen wie viele Todesopfer wert ist. Wenn das menschliche Leben als heilig gilt, ist kein noch so hoher Profit ein Todesopfer wert – die pazifistische Position.
Es gibt jedoch noch eine Position dazwischen, bei der man die Verhältnismäßigkeit berücksichtigt. Wie wir sehen werden, versuchen Soldaten im Kampf häufig folgende Überlegung anzustellen: Sie akzeptieren es, ihr Leben zu riskieren, wenn man sie nicht als Kanonenfutter verheizt und gute Chancen auf einen Sieg bestehen. Halten sie dies für unwahrscheinlich, werden sie versuchen, Befehle zu unterlaufen, zu meutern oder zu desertieren. Nach der Verhältnismäßigkeit ließe sich beispielsweise urteilen, dass die nach Todesopfern einundzwanzig schlimmsten Kriege und Gräuel der Geschichte (siehe Tabelle 10.1), die jeweils über drei Millionen Todesopfer forderten, nicht als rational gelten können, selbst wenn sie den Angreifern Gewinn brachten. Aber wie viele Tote wäre der Krieg wert? Darauf gibt es keine zufriedenstellende Antwort. Große Eroberer mögen dem Leben der »feindlichen« Bevölkerung oder auch ihrer eigenen Soldaten kaum Beachtung schenken. Aus ihrer Sicht ist die Kriegsentscheidung rational, da sie ihnen und ihrem Umfeld nützt. Dagegen mögen wir den Eindruck haben, dass der Nutzen nicht breit genug gestreut ist, um als Rechtfertigung zu dienen. Zumindest müssen wir sorgfältig abwägen, welcher Nutzen welchem Anteil des Volkes zufällt, und entsprechend beurteilen, wie rational ein Krieg ist. Auch wenn sich herausstellt, dass Kriege sich in dieser Hinsicht erheblich unterscheiden, dürften wir in der Regel feststellen, dass die meisten in Hinblick auf Mittel und Ziele irrational sind.
Kriege können aber auch auf nichtmaterielle Ziele gerichtet sein, wie Ruhm und Ehre zu erlangen, Wut zu beschwichtigen, Rache zu üben oder eine Ideologie zu verfolgen. Auch Macht kann als Selbstzweck angestrebt werden. Friedrich Nietzsche schrieb: »Was ist gut? – Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? – Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? – Das Gefühl davon, daß die Macht wächst – daß ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht, nicht Friede überhaupt sondern Krieg.«3
Den Befehlshabern mag es innere Freude bereiten, andere zu beherrschen, ungeachtet sonstigen Nutzens, den sie daraus ziehen. Sie erfreuen sich an den Emotionen, die Untergebene und eroberte Völker ihnen entgegenbringen, von Verehrung und Bewunderung über Respekt und Neid bis hin zu Hass, Furcht und blankem Schrecken. Dschingis Khan soll gesagt haben: »Das höchste Glück eines Mannes ist, den Feind zu verfolgen und zu besiegen, sich seines ganzen Besitztums zu bemächtigen, seine verheirateten Frauen schluchzen und weinen zu lassen, auf seinen Wallachen zu reiten, die Leiber seiner Frauen als Nachtgewand und Stütze zu benutzen, ihren rosafarbenen Busen zu betrachten und zu küssen, an ihren Lippen, süß wie die Beere an der Brust, zu saugen.«4
Politische Korrektheit hindert moderne Staatsführungen daran, solche Dinge zu sagen, aber Macht ist nach wie vor etwas Berauschendes, das keiner anderen Rechtfertigung bedarf. Wie der Philosoph und Politologe Raymond Aron sagte: »Die Befriedigung der Eigenliebe, der Sieg oder das Prestige sind nicht weniger real als die sogenannte materielle Befriedigung, wie der Gewinn einer Provinz oder einer Bevölkerung.«5 Solche Befriedigungen sind schwer fassbar und nicht leicht zu quantifizieren. Es mag durchaus sein, dass sie dem Volk als Ganzem nicht nützen, sondern verheerend sind. Das Streben von »Staatsmännern« nach Status, Prestige und Ehre für sich und ihren Staat ist ein wichtiger Kriegsgrund, unabhängig von anderen Belohnungen, die sie daraus ziehen mögen. Zudem kann eine gewisse Erregung und Freude an der Macht auch auf die breite Bevölkerung übergreifen, wie es vermutlich bei den Römern und den Mongolen der Fall war und gegenwärtig bei vielen Amerikanern festzustellen ist, deren Stolz auf die Militärmacht ihres Landes ihr eigenes Ego stärkt.
Wenn Herrschaft und Ruhm als Selbstzweck angestrebt werden, entspricht das möglicherweise Max Webers zweiter Form der Rationalität, der Wertrationalität, die er definiert als bestimmt durch »bewußten Glauben an den – ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden – unbedingten Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg. […] Vom Standpunkt der Zweckrationalität aus aber ist Wertrationalität immer, und zwar je mehr sie den Wert, an dem das Handeln orientiert wird, zum absoluten Wert steigert, umso mehr: irrational, weil sie ja umso weniger auf die Folgen des Handelns reflektiert, je unbedingter allein dessen Eigenwert […] für sie in Betracht kommt.«6
Sein Begriff »Wertrationalität« mag paradox erscheinen, entspricht aber sicher Hitlers pervertierter Rationalität. Viele mächtige Gruppen können von Werten getrieben sein, die Vorrang vor allem anderen bekommen – von Hass, Ruhm, Ehre oder ideologischem Wandel. Herrschende, die solche Ziele verfolgen, kalkulieren möglicherweise genau die verfügbaren Mittel, um sie zu erreichen. Aber sind diese Ziele »rational«? Der Nutzen, den sie bringen, ist gewöhnlich sehr ungleich verteilt und kommt vor allem kleinen Eliten zugute. Solche Ziele mögen von rastlosem, unendlichem Ehrgeiz zeugen – von der Krankheit grenzenlosen Strebens, wie Émile Durkheim es nannte. Das Hauptproblem eines grenzenlosen Eroberungsstrebens ist die Zahl der Menschenleben, die es vernichtet. Krieg ist etwas Seltsames: Er ist darauf angelegt, eine große Menge von Menschen zu töten, und das erfordert sicher eine sehr gute Rechtfertigung. Generell gilt Selbstverteidigung als eine solche, aber das ist, wie wir sehen werden, ein recht dehnbarer Begriff.
Wenn es um die Rationalität des Krieges geht, werde ich also Vorsicht walten lassen und mich bemühen, zwischen Mittel und Zweck, Irrtümern und Irrationalität, Kosten und Nutzen, Siegeschancen und gesellschaftlichen Zwängen zu unterscheiden. Ich werde versuchen einzuschätzen, wer von den von mir behandelten Kriegen profitierte und wer dabei verlor – für wen genau der Krieg rational im Sinne von nützlich war. Fast immer lautet die Antwort: für niemanden.
Militärmacht definieren
Zu menschlichen Gesellschaften gehören Konflikte und Kooperation zwischen Personen, die in variierenden Kombinationen über ideologische, wirtschaftliche, militärische und politische oder geopolitische Macht verfügen. Diese Elemente sorgen für die Schlüsseldynamik der Menschheitsgeschichte hin zur Entwicklung immer komplexerer, mächtigerer Gesellschaften. Konflikte können relativ friedlich verlaufen – und eine Mischung aus ideologischer, wirtschaftlicher oder politisch-diplomatischer Macht nutzen – oder kriegerisch mit Militärmacht ausgetragen werden. Militärische Macht kann den angestrebten Zweck auch erfüllen, wenn ihr Einsatz lediglich angedroht wird, ohne dass tatsächlich ein Krieg folgt. Der chinesische Militärstratege Sun Zi schrieb im 6. Jahrhundert v. u. Z.: »Wer sich auf die Kriegskunst versteht, unterwirft die Armeen, ohne Schlachten zu schlagen.«7 Krieg ist nur ein Mittel, Ziele zu erreichen, und wir müssen fragen, unter welchen Umständen Menschengruppen zu diesem Zweck Militärmacht einsetzen.
Das erste von drei weiteren Themen dieses Buches betrifft also die Frage nach den Kriegsgründen – wann, wo, von wem und warum wird die Entscheidung für Krieg statt Frieden getroffen oder als unbeabsichtigte Folge hingenommen. Wenn wir Immanuel Kants Ideal eines ewigen Friedens erreichen wollen, müssen wir wissen, was es zu vermeiden gilt, da es andernfalls zum Krieg führen könnte. Den Kriegsgründen und der Rationalität von Kriegen im Laufe der Menschheitsgeschichte widme ich acht Kapitel.
Mein zweites zusätzliches Thema betrifft die Kulmination des Krieges in Schlachten und seine Kosten in Form von Toten und Verwundeten. Dabei konzentriere ich mich darauf, wie Soldaten – in der Regel Männer – dazu gebracht werden, ein solches Risiko zu akzeptieren. Warum kämpfen sie trotz der erheblichen Möglichkeit, dass sie getötet oder körperlich oder psychisch verstümmelt werden? Nur wenige Soldaten mögen den Kampf, wie werden sie also mit ihren in der Schlacht vorherrschenden Gemütszuständen fertig: mit Angst und Schrecken? Viele vertreten die Ansicht, Soldaten hätten moralische Bedenken, die sie in ihrem Kampfverhalten stark beeinflussten. Den Umgang mit Angst, Schrecken und moralischen Bedenken behandele ich in drei weiteren Kapiteln. Ihr Fokus liegt hauptsächlich auf Kriegen, die von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis heute stattfanden. Diese Reduzierung ist leider notwendig, weil es die einzigen Kriege sind, in denen die meisten Soldaten lesen und schreiben konnten und daher Schriftzeugnisse hinterlassen haben. Bei Seeleuten muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich ihre Erfahrungen nicht einbezogen habe, aber auch ohne sie ist dieses Buch bereits umfangreich genug geworden. Eine gewisse Aufmerksamkeit finden Angehörige der Luftstreitkräfte, allerdings aus naheliegenden Gründen erst im 20. und 21. Jahrhundert.
Mein drittes zusätzliches Thema betrifft die Frage, ob Kriege abgenommen haben, sei es im Laufe der Menschheitsgeschichte oder erst in moderner Zeit oder sogar erst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im 10. Kapitel befasse ich mich skeptisch mit diesen Behauptungen. Bei der Kriegshäufigkeit sind keine lang- oder kurzfristigen Trends erkennbar. Es geht hier allerdings nicht um herkömmliche Militärgeschichte. Taktiken, Waffen, Schlachtformationen und Ähnliches lasse ich beiseite, soweit sie keinen Einfluss auf die oben genannten Fragen haben.
Militärmacht ist die gesellschaftliche Organisation tödlicher Gewalt. Sie zwingt Menschen durch Androhung von Tod oder schweren Verletzungen, Dinge zu tun, die sie ansonsten nicht tun würden. Der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz erklärte: »Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.«8 Militärmacht ist physisch, brutal, unberechenbar. Trotz aller positiven Anreize bei Rekrutierungskampagnen und trotz der Hilfseinsätze von Armeen im Fall von Naturkatastrophen ist die Hauptaufgabe von Militärs vor allem, Menschen zu töten. Da eine tödliche Bedrohung erschreckend ist, weckt Militärmacht unverwechselbare Emotionen und körperliche Symptome. Die Herangehensweisen an Krieg, der Krieg selbst und die tatsächlichen Gefechte sind von erheblich größerer emotionaler Intensität geprägt als Wirtschaft und Politik mit ihrer relativ pragmatischen Ruhe, während Ideologien sowohl kühl als auch hitzig sein können. Clausewitz fügte noch ein gerütteltes Maß an Zufall hinzu: »Der Krieg ist das Gebiet der Ungewißheit; drei Viertel derjenigen Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewißheit. […] Der Krieg ist das Gebiet des Zufalls.«9 Das lag seiner Ansicht nach an den »Friktionen« des Kampfes, in dem nichts so läuft, wie geplant. Der Duke of Wellington erklärte, Krieg sei »zu erraten, was auf der anderen Seite des Hügels ist«. Diese Generäle verwiesen also auf ein Zufallselement im Krieg, das offenkundig unsere Chancen beeinträchtigt, eine umfassende Theorie des Krieges zu entwickeln.
Das sind die prägenden Merkmale militärischer Macht, die sie von den anderen drei Machtquellen unterscheiden. Damit soll keinesfalls ein oftmals enger Zusammenhang zwischen politischer und militärischer Macht geleugnet werden. Meist konzentriere ich mich auf zwischenstaatliche Kriege, aber Kriege zwischen Gemeinschaften ohne eigenen Staat, Bürgerkriege und Konflikte mit nichtstaatlichen Guerillatruppen spielen eine ebenso wichtige Rolle wie Widersprüche zwischen militärischer und politischer Macht, wie sie beispielsweise in Putschen oder Vorkehrungen gegen Putschversuche von Herrschern zutage treten, die ihre Streitkräfte bewusst schwächen, um sich vor ihren eigenen Generälen zu schützen. Diese beiden Machtformen dürfen wir also nicht vermengen.
In Streitkräften herrscht routinemäßig Zwang vor. Der Rang ist alles. Militärmacht stellt die rigideste Form der Klassenstruktur dar, die in menschlichen Gesellschaften zu finden ist. Ranghöheren ist in einem Maße zu gehorchen, wie man es in ideologischen, wirtschaftlichen oder politischen Organisationen nicht kennt. Soldaten haben unterschrieben, ihren freien Willen aufzugeben. Sie können nicht ungehindert gehen, wenn sie feststellen, dass der Krieg nicht nach ihrem Geschmack ist. Sie unterstehen strenger militärischer Disziplin, die darauf abzielt, den Drang, sich wegzuducken oder zu flüchten, zu unterdrücken. Ihr Leben wird von Befehlen bestimmt, so unangenehm oder dumm Offiziere und so brutal der damit verbundene Drill und die Disziplinierungen auch erscheinen mögen. Wenn sie nicht gehorchen, droht ihnen körperliches Leid und manchmal auch der Tod.
Es gibt Ausnahmen. Guerillas und Angehörige anderer weniger förmlich organisierter Streitkräfte wie Stammeskrieger oder manche Feudalheere sind insofern freier, als sie Befehle infrage stellen und sogar beschließen können, sich aus dem Kampf zurückzuziehen, wenn sie unzufrieden sind. In modernen Armeen gibt es auch schriftlich fixierte Verhaltensregeln, die im Prinzip die Macht Ranghöherer einschränken sollen. Allerdings bedarf es einigen Muts, sich gegen die vorgesetzten Offiziere auf solche Vorschriften zu berufen. Selbst zwischen modernen regulären Streitkräften bestehen Unterschiede – beispielsweise zwischen der strengen Disziplin der preußischen Armee des 18. Jahrhunderts und den lockereren US-Streitkräften von heute. Dennoch üben Armeen grundsätzlich Zwang nach innen und außen aus, um eine Militärkultur zu schaffen, die rationale und sonstige Entscheidungsmöglichkeiten für die unteren Ränge stark einschränkt.
Streitkräfte haben jedoch eine duale Organisationsform, die besonders in Eliteregimentern die scheinbaren Gegensätze der Hierarchie und der Kameradschaft, der strengen Disziplin und des starken Korpsgeists in sich vereint. Diese Kombinationen werden von Kommandeuren so kultiviert, dass Soldaten auf Angst nicht mit Flucht reagieren, wie gewöhnliche Menschen es tun würden. Kommandeure sorgen möglicherweise auch für Alkohol und Drogen, um das Gespür der Soldaten für Gefahr zu dämpfen. Auch das ist ein typisches Merkmal von Organisationen, die tödliche Gewalt anwenden. Aber die nach außen gegen feindliche Soldaten und Zivilisten gerichtete Militärmacht ist die rigoroseste, furchterregendste und willkürlichste Macht von allen.
Militärs sind auf die anderen Machtquellen angewiesen: auf wirtschaftliche Versorgungsgüter und die Logistik, sie zu verteilen; auf ideologische Moral, gestützt auf variierende Kombinationen aus Solidarität, Loyalität, Patriotismus und dem Glauben, dass der Krieg gerecht und zu gewinnen ist; und auf politische Ressourcen in Form von Wehrpflichtigen und Finanzquellen. Ist die Militärmacht aber erst einmal mobilisiert, entwickelt sie letztlich ein Eigenleben, denn nur sie kann Leben vernichten und Territorien verwüsten. Meist spielt sie nur zeitweise eine Rolle. Sie mag als eigene Militärkaste in separaten Gemeinschaften am Rand der Gesellschaft schlummern. In vielen Stammes- oder Feudalgesellschaften und unter Guerillas existierten »Armeen« außerhalb von Kriegszeiten so gut wie gar nicht. Aber wenn Krieg droht, rückt Militärmacht in erschreckenden, destruktiven und unberechenbaren explosionsartigen Ausbrüchen in den Mittelpunkt.
Die vier Machtquellen sind Idealtypen, und die meisten realen Organisationen kombinieren Elemente von mehr als einer von ihnen. Manche Wirtschaftsorganisationen üben tödliche Macht aus wie im System der Sklavenarbeit; und in ideologischen Organisationen kann Ketzerei zum Tod führen. Es gibt auch mildere Formen von Zwang – schwarze Listen, die andere Arbeitgeber vor entlassenen Arbeitskräften warnen, oder gesellschaftliche Ausgrenzung von Personen, die aus einer ideologischen Bewegung austreten. Menschen, die in einem bestimmten politischen Gemeinwesen leben, sind wohl oder übel Teil dieser Gemeinschaft und deren Gesetzen und Strafen unterworfen. In vielen Staaten gibt es die Todesstrafe, und alle ahnden Gesetzesbrüche mit Geld- oder Haftstrafen oder körperlichen Strafen. Alle Formen der Machtorganisation üben einen gewissen Zwang aus, viele nehmen körperliche Bestrafungen vor und einige töten. Aber in Armeen ist der Zwang weitaus durchgängiger vorhanden und tödlich – sowohl nach innen wie auch nach außen, da es auf allen Seiten Opfer gibt. Ramsay MacDonald, in den 1920er Jahren Labour-Premierminister von Großbritannien, stellte fest: »Wir hören, dass Krieg als Mord bezeichnet wird. Das ist er nicht: Er ist Selbstmord.« In Wirklichkeit ist er beides.
Es gibt auch harmlosere Aspekte militärischer Organisation, die sich in begeisterten freiwilligen Meldungen zum Militärdienst, tiefer Kameradschaft, schicken Uniformen, Fahnen, mitreißenden Militärkapellen, dem Glauben an eine Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt, und in Patriotismus äußern. Im Krieg treten sie jedoch hinter das Töten zurück. Die bei der Einschreibung vorhandene Begeisterung hält sich selten lange. In diesem Buch geht es nicht um ruhmreiche Militärgeschichte. Krieg ist die Hölle, und für diese Hölle trainieren Militärs ihre Soldaten, die das schon bald erfahren. Zivilisten wissen dies oft nicht.
Noch eine Definition: Militarismus verknüpft die Machtdominanz der Militäreliten in der Gesellschaft mit einer ideologischen Überhöhung militärischer Tugenden gegenüber Friedensideologien und einer umfangreichen, aggressiven militärischen Einsatzbereitschaft. Militarismus gibt es in Abstufungen: Manche Gesellschaften sind äußerst militaristisch, andere weniger – und weisen daher eine geringere Wahrscheinlichkeit auf, Kriege anzufangen.
Nur wenige »Regeln der Kriegführung« schränken Militärmacht ein, und selbst die bestehenden sind auch in der Ära der Genfer Konventionen und des Internationalen Strafgerichtshofs schwer durchzusetzen. Bislang fanden Kriegsverbrecherprozesse nur gegen Kriegsverlierer statt. Bei den Nürnberger Prozessen gegen nationalsozialistische Führungskräfte lautete der Hauptanklagepunkt Entfesselung eines Angriffskrieges – eine Tat, die nach der Charta der Vereinten Nationen und nach späteren internationalen Abkommen grundsätzlich verboten wurde. Allerdings ist der Angriffskrieg inzwischen als Vorwurf aus Kriegsverbrecherprozessen verschwunden, stattdessen konzentrieren sie sich auf zwei andere Straftatbestände: Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid. Da US-Kriege heutzutage überwiegend Angriffskriege sind, könnte kein amerikanischer Politiker und keine Politikerin akzeptieren, dass dieser Vorwurf erhoben würde. Mittlerweile haben sich zahlreiche Normen zu »zulässigen« und »unzulässigen« Mitteln der Kriegführung entwickelt, aber es gab auch viele Verstöße dagegen. Solche Normen betreffen besonders die Behandlung von Offizieren, Kriegsgefangenen und Zivilisten, vor allem alten Männern, Frauen und Kindern, werden aber häufig nicht eingehalten. Anders als bei der wirtschaftlichen und ideologischen Macht – und vor allem anders als bei der politischen Macht, deren Kern das Gesetz ist – gelten für die Militärmacht nur relativ wenige Regeln und Normen. Krieg ist die am wenigsten geregelte, am wenigsten berechenbare Sphäre menschlichen Handelns – was sowohl rationale Entscheidungen als auch Kausalanalysen schwieriger macht.
Krieg definieren
Ein Krieg ist ein tödlicher Konflikt zwischen zwei Gruppen, organisiert von rivalisierenden Staaten oder Gemeinwesen oder von rivalisierenden Gemeinschaften in einem durch Bürgerkrieg zerrissenen Land. Obwohl Analysen häufig zwischenstaatliche Kriege von Bürgerkriegen getrennt behandeln, sind sie in etwa einem Drittel der Fälle vermischt. Aber wie groß muss ein bewaffneter Konflikt sein, um als Krieg zu gelten? Es geht nicht um Duelle, Schlägereien oder auch Scharmützel zwischen rivalisieren Patrouillen. Aber wo ziehen wir die Trennlinie? Müssen wir das überhaupt? Die meisten Politologinnen folgen dem Forschungsprojekt »Correlates of War« (CoW), das Statistiken zu Kriegen seit 1816 erstellt hat. Es definiert eine bewaffnete Auseinandersetzung mit mindestens tausend getöteten Kombattanten pro Jahr als Krieg. Daran werde ich mich nicht strikt halten, und tatsächlich wurden auch von Politologen in jüngerer Zeit Konflikte mit weniger Todesopfern hinzugerechnet. Hier ist eine Warnung angebracht: Wenn von personellen Verlusten die Rede ist, sind damit alle Soldaten gemeint, die im Kampf gefallen, verwundet oder gefangen genommen wurden oder als vermisst gelten. Leider geht aus manchen Quellen nicht eindeutig hervor, auf welche dieser Verluste sich die Angaben beziehen.
Ein erforderliches Minimum an Todesopfern festzulegen, erleichtert die quantitative Analyse, und die Schwelle von tausend getöteten Kombattanten hat den Vorzug, nur größere Kriege einzubeziehen, allerdings sollte dieser Schwellenwert lediglich als grobe Richtlinie dienen. Ein Konflikt zwischen zwei kleinen Staaten, bei dem nur fünfhundert Soldaten im Kampf getötet werden, ist für sie sicher ebenso bedeutend wie fünftausend im Kampf Getötete für zwei große Länder. Zudem bleiben viele Militäreinsätze zwar unter diesem Schwellenwert der Kriegsdefinition, beinhalten aber dennoch die Anwendung oder Androhung tödlicher Gewalt. Daher haben Politologinnen eine Zwischenkategorie zwischen Krieg und Frieden eingeführt, »bewaffnete zwischenstaatliche Konflikte« (Militarized Interstate Disputes, MIDs), definiert als Konflikte, bei denen die Androhung, die Demonstration oder der Einsatz militärischer Gewalt durch einen Staat ausdrücklich gegen Regierung, offizielle Repräsentanten, offizielle Streitkräfte, Eigentum oder Territorium eines anderen Staates gerichtet sind. Sie reichen in ihrer Intensität von bloßen Drohungen bis hin zu Kämpfen mit weniger als tausend getöteten Kombattanten. Gary Goertz und seine Kollegen merken an, dass das Fehlen von Krieg nicht unbedingt auf Frieden hindeutet. Im Kalten Krieg kam es zwar nicht zu Kämpfen zwischen amerikanischen und sowjetischen Streitkräften, aber das würde man noch nicht als »Frieden« bezeichnen wollen. Daher führen sie fünf Kategorien eskalierender Konflikte an, die noch nicht die Kriegsdefinition erfüllen.10 Sie sind für die Frage relevant, ob Kriege in der jüngeren Geschichte abgenommen haben, denn ein solcher Rückgang könnte auch darin bestehen, dass innerhalb dieser Kategorien eine Verlagerung hin zu weniger Gewalt statt zu völligem Frieden erfolgt.
Statistische Analysen zu Kriegshäufigkeit und personellen Verlusten sind nur für die moderne Zeit möglich – obwohl grobe Zahlen auch darüber hinaus verfügbar sind. Aber Statistiken haben Grenzen. Sie zählen alle Kriege gleich, ungeachtet ihrer Größe (sofern sie mehr als tausend getötete Kombattanten aufweisen), aber die beiden Weltkriege stellen alles andere im 20. Jahrhundert in den Schatten. Sie zu erklären, ist wahrscheinlich wesentlich wichtiger, als zahlreiche kleinere Konflikte zu verstehen. Aber sie als Einzelfälle zu behandeln, lässt außer Acht, dass Kriege eine Aufeinanderfolge bilden und jeder den nächsten beeinflusst. Das Ausmaß eines Konflikts kann man zwar anhand der Zahl der Toten und Verwundeten ermessen, allerdings variiert die Qualität der Schätzungen erheblich. In den CoW-Kriegsdaten sind keine zivilen Verluste enthalten, die häufig unmöglich zu kalkulieren sind. Zudem spielt die Quantifizierung die Rolle von Geschichte und Geografie herunter. Vermutlich bestehen Unterschiede zwischen Kriegen, die in verschiedenen Epochen und unter unterschiedlichen Umweltbedingungen stattfanden. Der offenkundigste Unterschied über die Zeit hinweg ist die exponentiell gewachsene tödliche Wirkung der Waffen, die erhebliche Anpassungen erfordert. Der amerikanische Komiker Will Rogers merkte an: »Man kann nicht sagen, die Zivilisation mache keine Fortschritte, denn in jedem Krieg töten sie dich auf neue Art.« Jeder Ort und jede Zeit haben Eigenarten, die eine Verallgemeinerung erschweren.
Historische Berichte neigen dazu, eher vom Krieg als vom Frieden zu erzählen. Krieg ist aufregend, Frieden langweilig. Kann man vom Frieden »erzählen«? Er verändert sich nicht. Große Monumente wie Burgen, Siegessäulen und Triumphbögen, Kriegerstatuen und Schlachtengemälde bleiben erhalten und gelten häufig als bedeutende Kunstwerke, während friedliche Bauersleute und arbeitende Menschen kaum Spuren hinterlassen. Da die Kriegsgewinner die Berichte schreiben, übergehen sie die Erfahrungen der Verlierer und besingen die Herrlichkeit des Krieges, nicht seine Schande. Heutzutage werden die Schilderungen der Sieger jedoch infrage gestellt. Für einen Doktortitel in Geschichte wird nun Revisionismus verlangt, und viele Statuen von Kriegern und Sklavenhaltern werden niedergerissen. Diese Kritik kommt jedoch verspätet. Es gibt Zeiten und Regionen, für die keine Schriftzeugnisse, geschweige denn Kriegsstatistiken verfügbar sind, beispielsweise für einen Großteil Afrikas in vorkolonialer Zeit. Imperialmächte führten Buch über ihre eigenen Todesopfer, zählten aber die der Ureinwohner nicht. Besonders schwierig sind Schätzungen zur Zahl der Zivilisten, die durch Kriegsfolgen wie Unterernährung und Krankheiten gestorben sind. Wir können sie zwar schätzen, allerdings für verschiedene Perioden und Regionen mit unterschiedlicher Genauigkeit.
Aber nun komme ich zu einer weithin akzeptierten Verallgemeinerung: Krieg ist etwas Universelles, weil er der menschlichen Natur entspricht.
1 Herodot, Historien, 1, 87.4, S. 47.
2 Mann, Die ohnmächtige Supermacht.
3 Nietzsche, Der Antichrist, Punkt 2.
4 Ratchnevsky, Činggis-khan: Sein Leben und Wirken, S. 136.
5 Aron, Frieden und Krieg, S. 112–116, Zitat S. 114.
6 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 12 f. [Hervorh. im Original]].
7 Sun Zi, Sun Zi über die Kriegskunst, S. 19.
8 Clausewitz, Vom Kriege, S. 3 (Hervorheb. im Original).
9 Ebd., S. 30.
10 Goertz u.a., The Puzzle of Peace, S. 27.
ZWEI
Ist Krieg etwas Universelles?
Wie verbreitet sind Kriege? Sind wir dazu verdammt, Generation für Generation die Platon zugeschriebene Feststellung zu wiederholen: »Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen«? Vielleicht ist der Krieg in unserer menschlichen Natur oder in der menschlichen Gesellschaft angelegt. Alle komplexen Gesellschaften hatten spezielle Gruppen bewaffneter Personen, und nahezu alle stellten Armeen auf. Aber haben auch alle Krieg geführt? Es gibt im Wesentlichen zwei Gruppen von Forschungsergebnissen zu den Fragen: Gab es Krieg zwischen Gesellschaften sehr früher Menschen, und gab es über Raum und Zeit hinweg Variationen in der Kriegshäufigkeit. Beide deuten stark darauf hin, dass Krieg nicht genetisch in der menschlichen Natur angelegt ist.
Die frühesten menschlichen Gesellschaften
Ein Großteil der Debatten betrifft die frühesten Gesellschaften, zu denen viele seit der Zeit des Philosophen Jean-Jacques Rousseau vermuteten, dass sie keinen Krieg führten. Andere schlossen sich der Feststellung Ibn Khalduns aus dem 14. Jahrhundert an: »Du musst wissen, dass Kriege und die verschiedenen Arten des Kämpfens in der Schöpfung, seit Gott sie erschaffen hat, nicht aufgehört haben. […] [Der Krieg] liegt in der Natur der Menschen.«1 Diese Debatte setzt sich bis heute fort.
Unsere ersten Zeugen sind Archäologinnen. Sie haben keinerlei Überreste gefunden, die auf organisierten Krieg hindeuteten, bis sie im Sudan am Nil eine Stätte aus der Zeit um 10 000 v. u. Z. entdeckten. Dort lagen 24 von 59 gut erhaltenen Skeletten ganz in der Nähe von Fragmenten, die Waffen hätten sein können – vielleicht ein Hinweis auf einen Gruppenkampf, was jedoch nicht abschließend geklärt ist. Eindeutiger war der Fund von 27 Skeletten in Nataruk, Kenia, die sich auf 8000 v. u. Z. datieren ließen. Zwölf davon waren gut erhalten, zehn wiesen Verletzungsspuren auf, die auf einen Speer, einen Pfeil oder eine Keule zurückzuführen waren und zum Tod geführt haben dürften. Die Leichen waren nicht förmlich beerdigt worden, was vermuten lässt, dass es sich nicht um eine Fehde innerhalb einer Gemeinschaft handelte, sondern um einen kleinen Krieg zwischen rivalisierenden Gruppen.2 Nataruk lag damals am Turkana-See in einer ressourcenreichen Gegend, daher könnte es bei diesem Kampf zwischen den Gruppen um Ansprüche auf bewässertes Land oder Fischgründe gegangen sein. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise, wer die Opfer waren und ob sie dort siedelten.
In Australien zeugen Höhlengemälde von etwa 8000 v. u. Z. von Zweikämpfen, und andere Wandgemälde, die sich auf 4000 v. u. Z. datieren lassen, zeigen Gruppenkämpfe. In Mitteleuropa gibt es aus der Zeit zwischen 5600 und 4900 v. u. Z. ungeordnete Massengräber von Personen, die vermutlich entweder im Kampf oder durch Hinrichtung starben.3 In Spanien deuten Felsenzeichnungen ebenfalls auf eine Zunahme organisierter Gewalt zwischen dem 6. und 3. Jahrtausend v. u. Z. hin, verbunden mit dem Aufkommen von Ackerbau, komplexeren Gesellschaften und Heerführern, die Kriegertruppen anführten und an ihren Grabbeigaben zu erkennen sind.4 Archäologen haben Verletzungen an Skeletten aus der Bronzezeit um 3000 v. u. Z. in Europa mit ausgegrabenen Waffen aus jener Zeit in Beziehung gebracht und erschlossen, dass sie im Kampf getötet wurden. Für eine etwas spätere Periode auf dem Balkan gibt es Schätzungen, dass Waffen und Brustharnische etwa 5 bis 10 Prozent der gesamten Bronzeüberreste ausmachen.5 In Zentralasien existieren jedoch keinerlei eindeutige Belege, dass es vor 3000 v. u. Z. Kriege gab. In Amerika stammen die ersten Indizien von 2200 v. u. Z. In Japan weisen bis 800 v. u. Z. lediglich etwa 4 Prozent der gefundenen Skelette Spuren eines gewaltsamen Todes auf, und es gibt keine bekannten Fälle von gewaltsamem Tod ganzer Gruppen. Wie Hisashi Nakao und seine Kollegen feststellen, lässt eine derart große Variationsbreite zwischen menschlichen Gemeinschaften vermuten, dass Krieg nicht in unserer Natur angelegt ist.6
Wir können nicht sicher sein, dass dies tatsächlich die ersten Kriege waren, denn eine solche Behauptung würde auf dem Fehlen älterer Funde basieren. Vielleicht werden in Zukunft solche älteren Belege entdeckt. Derzeit erscheint es wahrscheinlich, dass eine minimal organisierte Kriegführung irgendwann nach 8000 v. u. Z. begann, in manchen Regionen der Welt wesentlich später, und dass sie vermutlich mit der ortsfesten Landwirtschaft zusammenhing.7 Bereits William Eckhardt war in seiner Prüfung der einschlägigen Literatur zu dem Schluss gekommen: »Krieg war eine Funktion der Entwicklung, nicht des Instinkts.«8
Anthropologen debattieren seit Langem über solche Fragen. Lawrence Keeley behauptete, frühe Jäger-Sammler-Gesellschaften seien extrem kriegerisch gewesen.9 Aber Brian Ferguson ging die angeführten frühen Beispiele eins nach dem anderen durch und erklärte, Keeley habe sie gezielt ausgesucht.10 Dagegen kam er zu dem Schluss, dass nur wenige frühe Gesellschaften regelmäßig Krieg führten. Azar Gat verteidigte Keeley, indem er Daten zu zwei Gruppen zusammenstellte: zu australischen Indigenen und zu Völkern des Pazifischen Nordwestens in Kanada und den Vereinigten Staaten. Seiner Ansicht nach bieten sie »Labore«, in denen von westlichen Wissenschaftlern beobachtete indigene Völker noch »unkontaminiert« sind von der Gewalt des westlichen Imperialismus.11 Kontamination macht es schwierig, von der Erfahrung heutiger Jäger und Sammler allgemeine Rückschlüsse auf prähistorische Jäger-Sammler-Gesellschaften zu ziehen. Bis vor Kurzem noch kriegerische Gruppen wie die heutigen Yanomami in Brasilien haben ihre Grausamkeit großenteils anscheinend erst als Reaktion auf westlichen Kolonialismus entwickelt.12 Gat behauptet allerdings, dass die beiden von ihm untersuchten unkontaminierten Gruppen insofern gewalttätig waren – und zwar vermutlich mehr als moderne Gesellschaften –, als ein höherer Anteil der Männer infolge von Gewalteinwirkung starb.
Gat fokussiert sich auf Jäger-Sammler-Gesellschaften in Australien und verwendet Anthropologenschätzungen zu Tötungsraten in verschiedenen Regionen.13 Die Zahlen der im Kampf Getöteten werden für Zeiträume angegeben, die von zehn Jahren bis hin zu drei Generationen reichen, aber die Schätzungen der männlichen Gesamtbevölkerung beziehen sich anscheinend auf jeweils einen bestimmten Zeitpunkt und rechnen die jungen Männer nicht mit ein, die alljährlich hinzukommen, weil sie erwachsen werden. Bezieht man sie in die Berechnung ein, so ergibt sich eine Rate von 5 bis 10 Prozent der Männer, die eines gewaltsamen Todes starben. Diese Zahlen sind immer noch recht hoch, aber durchaus mit denen moderner Kriege vergleichbar. Graben Archäologen aber in einer Gruppe von vierzig Personen mit zwölf Männern in kampffähigem Alter drei Skelette aus, deren Verletzungen auf einen gewaltsamen Tod hindeuten, läge die Sterberate bei 25 Prozent – höher als in modernen Armeen, was vielleicht an einer Verzerrung durch kleine Fallzahlen liegen mag.
Kriegertrupps der Jäger und Sammler bestanden in der Regel aus weniger als dreißig Männern, zu Kriegen kam es nur gelegentlich und sie dauerten nur kurz. Sie mussten kurz sein, weil praktisch alle gesunden erwachsenen Männer der Gemeinschaft sich daran beteiligten und ihre Familien weder Fleisch noch Fisch bekamen, solange sie sich auf einem Feldzug befanden. Vor einem Angriff gingen die Männer daher auf die Jagd, um ihre Familien für die Zeit ihrer zwangsläufig kurzen Abwesenheit mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Wie Gat erklärt, konnte in einem Krieg, an dem sich alle erwachsenen Männer beteiligten, der Großteil der erwachsenen männlichen Bevölkerung getötet werden, falls ein Waffengang schlecht lief. Die höchsten Sterberaten waren fast nie in Standardgefechten zu finden, die häufig bereits nach den ersten Verlusten beendet wurden. Vielmehr gab es die meisten Todesopfer bei Überraschungsangriffen aus dem Hinterhalt. Das Überraschungsmoment konnte zu einer verheerenden Niederlage und zu einem Massaker führen, gefolgt von der Eingliederung der meisten Frauen und Kinder der Besiegten in die siegreiche Gruppe. Was den getöteten Bevölkerungsanteil angeht, wurden diese Episoden in modernen Zeiten lediglich von Genoziden übertroffen, in denen auch Frauen und Kinder ermordet wurden. Solche Ereignisse waren jedoch recht selten und keineswegs typisch für Kämpfe unter indigenen Australiern.
Richard G. Kimber kommt zu dem Schluss: »Indigene unterscheiden sich insofern offenbar nicht von anderen Völkern der Erde, als es trotz einer generell harmonischen Lage gelegentlich zu Konflikten kam.«14 Zudem betont er die weitaus häufigeren Massaker, die europäische Siedler in Australien an indigenen Menschen begingen. Lloyd Warner vermutete, dass der Tod junger Männer es ermöglichte, an polygynen Ehen festzuhalten.15 Frieden hätte zu erheblichen Konflikten zwischen sexuell ausgehungerten jungen Männern und den Clanoberhäuptern geführt, die in der Regel mehr als eine Frau hatten. Bei den australischen Indigenen war Polygynie üblich, bei den meisten Jäger-Sammler-Gesellschaften jedoch nicht.16 Carol Ember und Melvin Ember halten australische Indigene ebenso wie Gat für recht kriegerisch. Das gilt auch für die Fischergemeinschaften in Nordwestkanada, was sie auf deren feste Siedlungen an natürlichen Häfen zurückführen, die für einen gesunden Mehrertrag sorgten.17 Ein extremeres Beispiel für eine kriegerische Fischergemeinschaft waren die Calusa in Südflorida, die große Sklavenraubzüge unternahmen und sich ein stehendes Heer von dreihundert Mann halten konnten.18
Douglas Fry und Patrik Söderberg geben einen umfassenderen globalen Überblick über einundzwanzig einfache Jäger-Sammler-Gesellschaften.19 In zwanzig von ihnen starben in einen Zeitraum von einem bis drei Jahren im Mittel lediglich drei Personen durch Gewalt. An 64 Prozent dieser Fälle waren jeweils ein Tötender und ein Opfer beteiligt – es handelte sich also um Mord oder einen Kampf. Lediglich in zwölf Fällen wurde in diesen zwanzig Gemeinschaften eine Person aus einer anderen Gruppe getötet. Krieg zwischen Gruppen war also selten und Mord verbreiteter. Unter diesen zwanzig Gruppen war keine australische vertreten. Die einundzwanzigste Gruppe bildete eine Ausnahme: Sie trug nicht weniger als 76 Prozent (38 von 50) zur Gesamtzahl der Konflikte zwischen Gruppen bei, darunter sieben Serien zusammenhängender Tötungen, während es unter den anderen zwanzig Gruppen insgesamt lediglich zwei solcher Serien gab. Bei der abweichenden Gruppe handelte es sich um die Tiwi Nordaustraliens. Die indigenen Australier waren also recht aggressiv, während Jäger und Sammler anderer Regionen selten oder nie Krieg führten. Der Grund mag sein, dass sie Clangesellschaften bildeten, die größere, streng von anderen Clans abgegrenzte soziale Einheiten schufen. Gat lehnte Rousseaus Vermutung ab, dass indigene Völker inhärent friedlich waren, konnte aber auch nicht nachweisen, dass sie sonderlich kriegerisch waren. Krieg war selten.
Bei Völkern im Inneren Neuguineas, die keinerlei Kontakt zu Weißen hatten, verliefen manche frühen Kriege laut den Schilderungen von Anthropologen nur selten tödlich. Die Männer zweier Gruppen trafen sich, manchmal nach vorheriger Vereinbarung, auf einer Lichtung und stellten sich in Reichweite von Pfeilschüssen oder Speerwürfen einander gegenüber in Reihen auf. Sie schrien, bauten sich herausfordernd auf und warfen dann ihre Speere oder schossen ihre Pfeile ab. Sobald einer oder mehrere getroffen wurde, beendeten sie den Kampf, zerstreuten sich und trugen ein etwaiges Opfer zurück ins Dorf. Keine der beiden Seiten war zu der notwendigen Koordination imstande, um die andere Gruppe zu bezwingen oder deren Territorium zu erobern. In ihrer Wirtschaft waren Sklaven wertlos, und zusätzliche Gebiete hatten lediglich marginalen Wert. Diese Gemeinschaften hatten weder die Motivation noch die Fähigkeit, Krieg zu führen. Rituelle Kämpfe waren eine relativ sichere Möglichkeit, seinem Unmut Luft zu machen, seine Ehre wiederherzustellen und seine Tapferkeit zu beweisen.20 Aggressives Verhalten mochte zwar in Gewalt ausarten, die jedoch rituell gehandhabt wurde, bevor sie in etwas münden konnte, was wir als Krieg bezeichnen würden.
Solche Rituale waren möglicherweise erfolgreicher als alles, was Diplomaten im Laufe der Geschichte und die heutigen internationalen Institutionen, die von den Vereinten Nationen und anderen Stellen eingerichtet wurden, zur Konfliktmediation erreicht haben. Über Jahrtausende hinweg wurde Krieg, teils unbeabsichtigt, vermieden, indem man an einer Mischwirtschaft aus Gartenbau, Jagen und Sammeln festhielt, aus der nur selten Krieg hervorging, und zum Teil bewusst die Entwicklung von Gesellschaftsschichten und Staaten verhinderte und beim Status nur eine »Rangungleichheit«, wie Anthropologen es nennen, ohne erbliche Ungleichheit materieller Besitztümer oder politischer Macht zuließ.21 Wenn wir ohne Gesellschaftsschichten und Staaten auskämen, gäbe es vermutlich keinen Krieg mehr – eine zugegebenermaßen utopische Aussicht.
Die wahrscheinlichste Schlussfolgerung aus alledem ist, dass es in vorstaatlichen Gemeinschaften zwar zwischenmenschliche Gewalt, aber nur selten Krieg gab.22 Christoper Coker vertritt die gegenteilige Ansicht, fasst allerdings beide Gewaltformen zusammen.23 Organisierte Kriegführung entstand möglicherweise erstmals in festen Fischer- und Ackerbausiedlungen, die beträchtliche Überschüsse erwirtschafteten, und nahm zu, als sich Gesellschaftsschichten und Staaten entwickelten. Nach Keith Otterbeins Auffassung normalisierte der ortsfeste Ackerbau die organisierte Kriegführung, allerdings unterstützt von bewaffneten Gruppen, die solche Siedlungen von früheren Großwildjägern übernommen hatten.24 Der Krieg eskalierte, wenn Völker sich in fruchtbaren Gegenden wie Feuchtgebieten und Flusstälern angesiedelt hatten und vor Angreifern nicht mehr ohne größere Opfer weglaufen konnten. Ihr Land war es wert, verteidigt zu werden, und Außenstehende hielten es für lohnend, sie anzugreifen.
Frühe Staaten waren umgeben von umherziehenden »Barbaren«, die jagten und sammelten, Nahrung suchten, Brandrodungskultur und Naturweidewirtschaft betrieben. Wie James Scott anmerkt, lebte der größte Teil der Weltbevölkerung sehr lange in solchen Gemeinschaften und nur eine kleine Minderheit in Staaten: Er stellt fest, dass die ersten kriegerischen sumerischen Staaten »erst um etwa 3100 v. u. Z. auftraten, das heißt mehr als vier Jahrtausende nach den Anfängen des Getreideanbaus und der Sesshaftwerdung«, weil gemischte, dezentrale Wirtschaften vorherrschten.25 Als Erklärung für die Entstehung von Staaten und Kriegen betont er den Anbau von Getreide, das zur gleichen Zeit reift und gut sichtbar und schlecht zu verbergen ist. Daher kann es besteuert, beschlagnahmt und gelagert werden. Bewaffnete Räuber konnten dies mit Gewalt tun und sich zu einer müßigen herrschenden Klasse entwickeln, die vom Überschuss anderer lebten, unterstützt von bewaffnetem Gefolge, Stadtmauern, Verwaltungsakten und Kriegen, um Sklaven zu bekommen – all das diente dazu, das von ihnen beherrschte Volk zu knechten. So begannen nahezu alle Zivilisationen der Welt. Andere Anthropologinnen stimmen mit dieser Auffassung nicht überein, sondern sehen Getreidespeicher als Beleg für das kollektive Teilen von Ressourcen. Nach Ansicht von David Graeber und David Wengrow wechselten in frühen Stadtstaaten relativ egalitäre und gewissermaßen »demokratische« politische Institutionen – wie Stadträte, Bürgerwehren und politische Versammlungen, denen auch viele Frauen angehörten – mit Institutionen ab, die mehr Elemente von Klassenungleichheit, Aristokratie, Monarchie und Patriarchat enthielten.26 In welchen es mehr Kriege gab, lässt sich nicht feststellen, obwohl Bedrohungen durch andere Völker egalitäre Gruppen häufig zwangen, sich unter den Schutz bewaffneter Männer zu begeben. Wenn es diesen Männern gelang, an der Macht festzuhalten, oder wenn die fremden Herren von Grenzgebieten, in denen es bereits Könige und Aristokratien gab, triumphierten, entstanden dynastische Reiche der Geschichte, und das Ausmaß der Kriege nahm zu.
Über 95 Prozent der 150 000-jährigen Menschheitsgeschichte waren also vergangen, bevor kriegerische Staaten entstanden. Das heißt, dass Krieg nicht genetisch in uns angelegt ist. Biologie ist kein Schicksal; nicht unsere Gene verdammen uns zum Krieg, sondern Gesellschaften. Die Erklärung von Sevilla zur Gewalt von 1986, unterzeichnet von renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Fachbereichen Biologie, Psychologie, Ethologie, Genetik und anderen Humanwissenschaften, stellt fest, dass Krieg nicht genetisch angelegt ist, dass wir keine von unseren tierischen Vorfahren ererbte Tendenz haben, Krieg zu führen, und es keine natürliche Veranlagung zu aggressivem Verhalten gibt. Es gibt auch keine genetische Disposition mancher ethnischen Gruppen zu mehr oder weniger kriegerischem Verhalten. Genetikerinnen haben gezeigt, dass Menschen trotz äußerer Unterschiede zwischen Menschengruppen bei Nasenform, Hautfarbe und so fort in ihren DNS-Sequenzen erstaunlich gleich sind. Gegenwärtig sind 85 Prozent der genetischen Variationen bei Menschen innerhalb »rassisch« definierter Gruppen zu finden und lediglich 15 Prozent zwischen ihnen. Malešević liefert eine detaillierte Kritik an Erklärungen, die Gewalt auf essentialistisch-genetische und biologische Faktoren oder auf universelle, stabile und biologisch einheitliche menschliche Emotionen zurückführen, die für Gewalt relevant sind.27
Können wir von unseren nächsten Verwandten Antworten herleiten? Gorillas sind nicht aggressiv. In einem Wald in Ruanda saß ich kaum einen Meter von einer Gorillagruppe entfernt, ohne auch nur im Geringsten eine Gefahr zu verspüren. Sie ignorierten meine Anwesenheit, obwohl ein riesiges Silberrückenmännchen im Vorbeigehen meinen Arm streifte. Menschen haben jedoch mehr Gene mit Bonobos (Zwergschimpansen) und Schimpansen gemeinsam. Bonobos sind wesentlich weniger aggressiv als Schimpansen, aber Menschen sind unterschiedlicher als beide Affenarten. Wenn die Beziehungen in Menschengruppen sich verschlechtern, können sie wesentlich gewalttätiger werden, und zwar in größerem Ausmaß, als es bei Beziehungen unter Schimpansen der Fall ist. Wenn menschliche Beziehungen gut sind, sind sie sehr gut und profitieren erheblich mehr von nachbarschaftlichem Umgang als Bonobos. Menschen tun mehr, als nur die Gesellschaft der anderen zu suchen und sich zu paaren, wie es bei den friedlichen Bonobos der Fall ist. Sie treiben Handel, vollziehen aufwändige Zeremonien und schaffen Formen der Zusammenarbeit, die zu ihrer einzigartigen gesellschaftlichen Entwicklung geführt haben. »Was die Beziehungen zwischen Gruppen angeht, übertreffen wir unsere nächsten Verwandten sowohl am positiven wie auch am negativen Ende der Skala.«28 Coker merkt an, dass nicht weniger als siebzig Spezies Gewalt gegen Mitglieder der eigenen Art anwenden, aber nur der Mensch führt organisiert Krieg.29 Allerdings entwickelt auch nur der Mensch komplexe, flexible, kooperative Arbeitsteilung. Extreme Variabilität bei Gewalt und Kooperation ist offenbar ein charakteristisches Merkmal unserer Spezies.
Individuen unterscheiden sich in ihrer Neigung zu Gewalt. Wir alle kennen Menschen, die aggressiv sind, und andere, die sanftmütig und geduldig sind. Wie wir sehen werden, lieben einige wenige Soldaten Gewalt aufgrund von Sadismus oder Heldentum, die meisten tun dies jedoch nicht. In vielen Bereichen des Sozialverhaltens spielen Persönlichkeitsunterschiede kaum eine Rolle. Die Ausbreitung des Kapitalismus hängt nicht von einigen wenigen Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeit ab, sondern von einer Vielzahl von Unternehmern und Arbeitskräften, deren persönliche Unterschiede sich tendenziell gegenseitig aufheben. Aber Entscheidungen über Krieg und Frieden werden von sehr kleinen Personengruppen getroffen, manchmal auch nur von einem einzigen Monarchen, Diktator, Premierminister oder Präsidenten. Wegen der mächtigen gesellschaftlichen Rolle, die sie spielen, hat ihre Persönlichkeit einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang von Krieg und Frieden. Bei Attila, dem Hunnenkönig, bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er Krieg führte, während der englische König Eduard, der Bekenner, Frieden vorzog, und die Geschichte des weißen Amerika von einem verrückten König, Georg III., zu einem anderen, Donald Trump, führt. Solche Eigenheiten setzen der allgemeinen Theorie Grenzen.
Doch wie die menschliche Neigung zu Gewalt auch immer aussehen mag, hat Kooperation in der gesellschaftlichen Entwicklung eine größere Rolle gespielt. Diejenigen, die kämpfen, sterben; diejenigen, die kooperieren, überleben und gedeihen – eine friedliche Version des Überlebens der am besten Angepassten. Wie die meisten Verhaltensmerkmale beinhaltet auch dieses Gegensätze – wir mögen eine Neigung zu Gewalt haben, aber wir haben auch eine Neigung zur Kooperation (wie zu Liebe und Hass, introvertiertem und extrovertiertem Verhalten usw.). Gat bezeichnet Kooperation, Konkurrenz und Gewaltkonflikte als die drei grundlegenden Formen sozialer Interaktion und erklärt, dass Menschen sich zwischen ihnen entscheiden.30 Er vertritt die paradoxe Ansicht, dass Krieg sowohl angeboren als auch optional ist, und meint damit, dass er dicht unter der Verhaltensoberfläche liegt und relativ leicht ausgelöst werden kann. Ganz ähnlich teilt Steven Pinker die menschliche Natur in innere »Engel« und »Dämonen«.31 Bei Entscheidungen über Krieg und Frieden ziehe ich die Metapher einer Balance vor. Menschen stehen in der Mitte. Neigt ihr Verhalten sich in die eine Richtung, bekommen wir Krieg; neigt es in die andere, bekommen wir Frieden. Die Frage lautet: Was lässt sie in die eine oder andere Richtung tendieren?
Randall Collins neigt in seinem brillanten Buch Dynamik der Gewalt ein bisschen zum Frieden.32