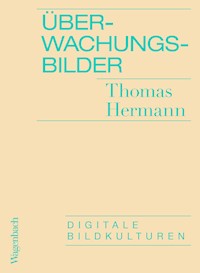
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Überwachungsbilder gehören zu den prägendsten Bildern der digitalen Kultur – dabei sind sie oft unscharf und unter schlechten Bedingungen entstanden. Sie werden von Drohnen, Web- und Dashcams oder Satelliten generiert und halten scheinbar objektiv fest, was im öffentlichen Raum oder an sonst uneinsehbaren Orten geschieht. Mit Überwachungsbildern wird Macht ausgeübt, aber auch kontrolliert. Sie dienen der Wissenschaft ebenso wie der Selbstoptimierung oder sogar der Unterhaltung. Innerhalb der Kunst werden ihre Möglichkeiten und Gefahren kritisch reflektiert. Thomas Hermann gibt einen systematischen Überblick über die verschiedenen Typen und Einsatzgebiete von Überwachungskameras – und fragt: Überwachen wir uns mittlerweile alle gegenseitig?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E-Book-Ausgabe 2022
© 2022 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung: Studio Jung, Berlin.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803143587
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3723 4
www.wagenbach.de
DIGITALE BILDKULTUREN
Durch die Digitalisierung haben Bilder einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Dass sie sich einfacher und variabler denn je herstellen und so schnell wie nie verbreiten und teilen lassen, führt nicht nur zur vielbeschworenen »Bilderflut«, sondern verleiht Bildern auch zusätzliche Funktionen. Erstmals können sich Menschen mit Bildern genauso selbstverständlich austauschen wie mit gesprochener oder geschriebener Sprache. Der schon vor Jahren proklamierte »Iconic Turn« ist Realität geworden.
Die Reihe DIGITALE BILDKULTUREN widmet sich den wichtigsten neuen Formen und Verwendungsweisen von Bildern und ordnet sie kulturgeschichtlich ein. Selfies, Meme, Fake-Bilder oder Bildproteste haben Vorläufer in der analogen Welt. Doch konnten sie nur aus der Logik und Infrastruktur der digitalen Medien heraus entstehen. Nun geht es darum, Kriterien für den Umgang mit diesen Bildphänomenen zu finden und ästhetische, kulturelle sowie soziopolitische Zusammenhänge herzustellen.
Die Bände der Reihe werden ergänzt durch die Website www.digitale-bildkulturen.de. Dort wird weiterführendes und jeweils aktualisiertes Material zu den einzelnen Bildphänomenen gesammelt und ein Glossar zu den Schlüsselbegriffen der DIGITALEN BILDKULTUREN bereitgestellt.
Herausgegeben von
Annekathrin Kohout und Wolfgang Ullrich
Nam June Paik, TV-Buddha (1974), Stedelijk Museum Amsterdam
1 | Eye in the Sky: Vom Auge Gottes zur Sehmaschine
Überwachungsbilder sind sichtbare Indizien unsichtbarer Mächte. Sie entstehen automatisch, ohne fotografische Geste eines Menschen. Überwachungsbildern haftet etwas Paradoxes an: Weil der Mensch die Bildherstellung an die Technik abgibt, werden Einblicke in Ereignisse möglich, die normalerweise verborgen bleiben. Kontrolle und Zufall bestimmen diese Bilder gleichermaßen. Zwar lassen sich Aufnahmeort, Bildausschnitt und Perspektive definieren, was sich vor der Kamera abspielen wird, ist jedoch nicht planbar.
Parallel zu den von Menschen aufgenommenen, veränderten und verbreiteten digitalen Fotografien und Videos entstehen so pausenlos automatisch erzeugte Bilder, die hier unter dem Begriff »Überwachungsbilder« zusammengefasst werden. Gemeint sind damit Bilder, die von öffentlich zugänglichen Webcams, geschlossenen Überwachungssystemen (Closed-Circuit Television, CCTV), Satellitenkameras, Fotofallen, an Windschutzscheiben montierten Dashcams oder anderen sogenannten Smartcams generiert werden. Zum allergrößten Teil werden diese als bloße Daten für einige Zeit gespeichert, bevor sie gelöscht oder überschrieben werden. Die meisten werden kaum einmal von einem menschlichen Auge gesehen.
Wir leben in der Cam Era, einem Zeitalter der endlosen Aufzeichnung durch Überwachungskameras.1 Die allgegenwärtige visuelle Überwachung ist eine Folge der überragenden Bedeutung, die dem Auge als Sinnesorgan für das Sammeln von Wissen und Ausüben von Macht und Kontrolle attestiert wird.
Das Auge als Symbol für eine unsichtbare überwachende Macht hat eine lange Geschichte und spielt schon in der Bibel eine wichtige Rolle. Dort steht es für die Allwissenheit, Allmacht und Weitsicht Gottes. »Die Augen des HERRN sind überall, sie wachen über Böse und Gute«, heißt es im Alten Testament (Sprüche 15:3). Die göttliche Vorsehung wird in der christlichen Ikonografie mit einem Auge dargestellt, das von einem Dreieck für die Trinität und einem Strahlenkranz umgeben ist. Gottes Auge als omnipräsente Überwachungskamera ist das Einzige, was wir von ihm zu sehen bekommen. So hört Moses wohl Gottes Stimme, als er die Zehn Gebote auf dem Berg Sinai empfängt, sieht ihn aber nicht und darf sich aufgrund des ersten Gebots kein Bildnis von ihm machen. Gott bleibt unsichtbar, sieht aber alles, was die Gläubigen an das Einhalten der Gebote ermahnen soll. Angst, bei Fehlverhalten entdeckt und gestraft zu werden, ist eine Seite der Medaille, Schutz und Sicherheit für die »Guten« die andere.
Die Verbindung zwischen göttlicher Weitsicht und heutiger elektronischer Kameraüberwachung wird gelegentlich in den Sozialen Medien thematisiert, etwa im Instagram-Beitrag einer jungen Inderin, die ihre Anhänger:innen daran erinnert, »dass Gottes CCTV immer aktiv ist«. (# 1)
# 1 Erinnerung an göttliche Überwachung im Internetzeitalter
Auge, Dreieck und Strahlenkranz wurden säkularisiert und in die politische Ikonografie übernommen. Ab 1782 erschien das Auge der Vorsehung auf dem Großen Siegel der Vereinigten Staaten. Als Verweis auf christliche und aufklärerische Werte ist es allgegenwärtig und ziert unter anderem die Rückseite der Ein-Dollar-Note.
Die französischen Jakobiner integrierten gegen Ende des 18. Jahrhunderts ebenfalls das Auge in ihr Revolutionsemblem. Die oberhalb des Auges angebrachte Inschrift »Ich richte meinen Blick auf uns alle« lässt sich retrospektiv auch als Ausdruck der repressiven Überwachungspraxis des Terrorregimes um Robespierre und Marat verstehen.2
Mit der zunehmenden Verbreitung der Fotografie bekam das menschliche Auge im 19. Jahrhundert dann Konkurrenz durch technische Formen des Sehens. Auge und Kamera wurden schon früh miteinander verglichen. Der avantgardistische Fotokünstler László Moholy-Nagy etwa pries in den dreißiger Jahren die Fotografie als »objektive Sehform« und attestierte dem Kamera-Auge ein »gesteigertes bzw. ein mehr-sehen«.3 Für den Schriftsteller Iwan Goll war das Objektiv gar ein »Überauge […] tausendfach schärfer als das Menschenauge«.4 Es dürfte daher kaum überraschen, dass staatliche Institutionen wie Polizei oder Geheimdienste die Fotografie früh in ihre Observationspraxis übernahmen.5
Wie sich ein Leben unter permanenter technisch unterstützter visueller Kontrolle anfühlt, vermittelt George Orwells Dystopie 1984 aus dem Jahr 1949. Der Leitsatz »Big Brother is watching you« ist zu einem der bekanntesten Zitate der englischen Literatur geworden. Im Roman verfolgen die Augen des Großen Bruders den Protagonisten Winston Smith auf Schritt und Tritt über ein Bildschirmmedium, den »Televisor«. Das Motiv der Augen und Kameras dient denn auch sehr häufig zur Illustration der Titelseiten von 1984. (# 2 a–c)
# 2 a–c Göttliche und technische Augen als Motive auf Umschlägen von George Orwells Roman 1984 in deutscher (a–b) und norwegischer (c) Übersetzung
Orwells visionärer Roman über einen totalitären Überwachungsstaat hat an Aktualität nichts eingebüßt, auch wenn heutige staatliche oder marktwirtschaftliche Überwachungspraktiken weit weniger oppressiv daherkommen und als Begründung für die Kontrolle gute Absichten ins Feld führen. So werden in großangelegten Schulversuchen in China nicht nur die Leistungen der Schüler:innen digital gemessen und analysiert, um alle Kinder optimal zu fördern. Im »intelligenten Klassenzimmer« wird auch deren Verhalten und Konzentration anhand von Videoaufnahmen ausgewertet.6
Mit wohlklingenden Versprechen wie dem freien Zugang zu Informationen, dem Teilen wertvoller Momente und dem Pflegen von Freundschaften über alle Grenzen hinweg haben Tech-Giganten seit der Einführung von Facebook im Jahr 2004 überall auf der Welt Plattformen errichtet, auf denen sich Milliarden von Nutzer:innen tummeln. Die Macht des Sehens verlagert sich damit vom staatlichen Big Brother auf die Internetkonzerne in Ost und West. Als große Wunscherfüllungsmaschinen locken sie immer mehr Nutzer:innen in ihre Metaversen, wo diese bereitwillig, wissend oder unwissend, persönliche Daten preisgeben. Dave Eggers hat diese Form von digitalem Überwachungskapitalismus in seinem Roman Der Circle (2013) in ein eindrückliches Narrativ übersetzt. Sicherheit, Gesundheit und Glück verheißt der Circle, ein Tech-Riese à la Google oder Meta, seinen Nutzer:innen und zwingt sie damit immer konsequenter zur Teilhabe am digitalen Datentausch, der die Basis für den Profit des Unternehmens bildet. Der Roman beschreibt, wie die junge Mitarbeiterin Mae Holland zur freiwillig-unfreiwilligen Gefangenen ihrer Firma wird. Von dem Moment an, in dem sie ihr Handeln mittels einer um den Hals getragenen Kamera vollständig transparent macht, unterwirft sie sich nicht nur dem Circle, sondern auch Millionen von Anhänger:innen, die ihr online auf Schritt und Tritt folgen. Diese werden in der englischsprachigen Ausgabe als »watcher« bezeichnet, was in der deutschsprachigen Ausgabe nicht ganz adäquat mit »Viewer« übersetzt





























