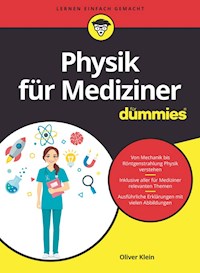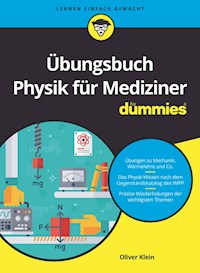
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Seien wir doch ehrlich: Es gibt Fächer, da lernt man stur auswendig. Andere hingegen muss man wirklich verstehen und da braucht es Übung. Physik zählt zu den letzteren. Das mag lästig sein, aber Hilfe naht: Die Übungen in diesem Buch helfen Ihnen beim Verständnis von Mechanik, Thermodynamik, Elektrizitätslehre, Schwingungen und Wellen, Optik und Atomphysik. Knappe Auffrischungsinformationen und zahlreiche Beispiele ermöglichen es Ihnen, passives Wissen wieder zu aktivieren, und so ist dieses Buch für Sie ein hilfreicher Trainer vor Ihrer Physikprüfung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Übungsbuch Physik für Mediziner für Dummies
Schummelseite
MATHE & STATISTIK
Skalarprodukt
Kreuzprodukt
Standardabweichung Normalverteilung
Standardabweichung Poissonverteilung
Standardfehler des Mittelwerts
KINEMATIK
Gleichförmige Bewegung
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung
Frequenz
Kreisfrequenz
Zentrifugalbeschleunigung
DYNAMIK
2. Newtonsches Axiom
Dichte
Gravitationsgesetz
Gewichtskraft
Drehmoment
Druck
Hookesches Gesetz
Dehnung
ENERGIE & IMPULS
Arbeit
Leistung
Kinetische Energie
Potentielle Energie
Impuls
Drehimpuls
FLÜSSIGKEITEN & GASE
Oberflächenspannung
Hydrostatischer Druck
Archimedisches Prinzip
Kontinuitätsgesetz
Bernoulli-Gesetz
Hagen-Poiseuille
Stokes-Reibung
Reynoldszahl
Boyle-Mariotte
Barometerformel
WÄRMELEHRE
Thermische Expansion
Ideales Gasgesetz
Wärmemenge
Wärmeleitung
Stefan-Boltzmann-Gesetz
Mittlere kin. Energie atomares ideal. Gas
Osmotischer Druck
Diffusion
Entropie
ELEKTRIZITÄTSLEHRE I
Coulomb-Kraft
Elektr. Feldstärke
Elektr. Dipolmoment
Elektr. Spannung
Elektr. Kapazität
Plattenkondensator
Elektrischer Strom
Magnetfeldstärke Spule
Magn. Flussdichte
Lorentzkraft
Ohmsches Gesetz
Spez. Widerstand
Leitfähigkeit
ELEKTRIZITÄTSLEHRE II
Reihenschaltung
Parallelschaltung
RC-Glied
Netzspannung (EU)
Elektrische Leistung
Induktionsgesetz
Transformator
Übungsbuch Physik für Mediziner für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2022
© 2022 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten, inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © kotoffei – stock.adobe.comKorrektur: Shangning Postel-Heutz
Print ISBN: 978-3-527-71917-4ePub ISBN: 978-3-527-83690-1
Über den Autor
Dr. Oliver Klein ist akademischer Oberrat an der Goethe Universität Frankfurt am Main. Er hat Physik an den Universitäten Marburg und Frankfurt studiert und 2004 am Institut für Biophysik der Goethe Universität promoviert. Dort leitet er seit 2008 das Praktikum »Physik für Mediziner« und ist seit 2011 als Unterrichtsbeauftragter Physik des Fachbereichs Medizin verantwortlich für die Physiklehre für Studierende der Human- und Zahnmedizin.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Einleitung
Keine Panik
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Teil I: Mechanik
Kapitel 1: Physik als messende Wissenschaft
Internationales Einheitensystem (SI)
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 2: Durch Raum und Zeit
Fläche und Volumen
Winkel
Periodendauer und Frequenz
Vektoren
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 3: Messfehler und Fehlerfortpflanzung
Mittelwert, Standardabweichung und Standardfehler
Modalwert, Median und Perzentile
Fehlerfortpflanzung
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 4: Bewegend: Kinematik
Langweiligste Bewegung: Gleichförmig
Minimal aufregender: Gleichmäßig beschleunigte Bewegung
Jetzt geht's rund: Rotation
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 5: Kraftvoll: Dynamik
Newtonsche Axiome
Gravitation
Zentrifugalkraft
Drehmoment
Druck
Hookesches Gesetz, Normalspannungen
Arbeit und Leistung
Energie
Impuls und Drehimpuls
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 6: Flüssigkeiten und Gase
Atommasse
Stoffmenge
Oberflächenspannung
Hydraulik
Hydrostatischer Druck
Archimedisches Prinzip
Laminare Strömungen
Kontinuitätsgesetz
Gesetz von Hagen-Poiseuille
Ein Blick auf die Aerostatik
Übungsaufgaben
Lösungen
Teil II: Wärme
Kapitel 7: So schaut's aus: Phänomenologische Wärmelehre
Temperatur
Thermische Expansion
Ideales Gasgesetz
Gasgemische
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 8: Jetzt wird's heiß: Wärme
Wärmekapazität
Wärmetransport
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 9: Molekularkinetische Wärmelehre
Wärme als Bewegungsenergie
Osmose
Phasenübergänge
Phasendiagramm
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 10: Hauptsätze der Wärmelehre
Nullter Hauptsatz der Wärmelehre
Erster Hauptsatz der Wärmelehre
Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre
Dritter Hauptsatz der Wärmelehre
Übungsaufgaben
Lösungen
Teil III: Elektrizitätslehre
Kapitel 11: Geladen: Elektrostatik
Coulomb-Kraft
Elektrisches Feld
Elektrische Spannung
Kondensator
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 12: Vom Nord- zum Südpol: Magnetostatik
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 13: Unter Strom: Elektrodynamik
Elektrische Stromstärke
Lorentzkraft
Ohmsches Gesetz
Elektrische Leistung
RC-Glieder
Wechselspannung
Elektromagnetische Induktion
Blindwiderstände
Ladungstransport in Flüssigkeiten
Übungsaufgaben
Lösungen
Teil IV: Schwingungen und Wellen
Kapitel 14: Schwingungen
Schwingungen
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 15: Wellen
Reflexion, Brechung und Interferenz
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 16: Schall
Übungsaufgaben
Lösungen
Teil V: Optik
Kapitel 17: Wellenoptik
Lichtstrom, Lichtstärke und Beleuchtungsstärke
Photonenenergie
Beugungsgitter
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 18: Geometrische Optik
Reflexion und Brechung
Linsen
Abbildungen
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 19: Optische Systeme
Voller Durchblick: Augenmodell
Kleines ganz groß: Mikroskop
Keine Angst vor Extinktion: Spektralphotometer
LASER
Übungsaufgaben
Lösungen
Teil VI: Atomphysik
Kapitel 20: Atome und Moleküle
Bohrsches Atommodell
Pauli-Prinzip
Moleküle
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 21: Röntgen
Lasst uns in die Röhre schauen!
Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit Materie
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 22: Radioaktivität
Zerfallsgesetz
Zerfallsarten
Ionisierende Strahlung
Strahlendosis
Übungsaufgaben
Lösungen
Kapitel 23: Magnetresonanztomographie
Spinnen die Kerne?
Übungsaufgaben
Lösungen
Teil VII: Top-Ten-Teil
Kapitel 24: Fast zehn Tipps, um sich perfekt auf die Klausur vorzubereiten!
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Basisgrößen und -einheiten des SI
Tabelle 1.2: Vorsilben (Präfixe)
Kapitel 23
Tabelle 23.1: Kernspins bei verschiedenen Protonen- und Neutronenzahlen im Kern
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Einige geometrische Flächen
Abbildung 2.2: Einige geometrische Volumina
Abbildung 2.3: Trigonometrische Funktionen
Abbildung 2.4: Rechnen mit Vektoren
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Normalverteilung
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegung
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Geschwindigkeitsprofil bei idealer und realer Flüssigkeit
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Phasendiagramm: links Wasser (mit Dichteanomalie), rechts Kohlendi...
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Knoten- und Maschenregel
Abbildung 13.2: links: Reihenschaltung, rechts: Parallelschaltung ...
Abbildung 13.3: Sinusförmige Netzspannung
Kapitel 17
Abbildung 17.1: links: elektromagnetisches Spektrum, rechts: additive Farbmischun...
Kapitel 18
Abbildung 18.1: Abbildung an Sammellinse
Abbildung 18.2:
: Lupe – virtuelles Bild
Kapitel 19
Abbildung 19.1: Vereinfachtes Augenmodell
Abbildung 19.2: Strahlengang im Mikroskop
Kapitel 21
Abbildung 21.1: Aufbau einer Röntgenröhre
Abbildung 21.2: Spektrum mit Röntgenbremsstrahlung und charakteristischer Röntgen...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
7
8
9
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
255
256
257
258
259
261
262
263
Einleitung
Physik gehört sicher nicht zu den beliebtesten Fächern der Vorklinik. Die meisten Studierenden haben Physik in der Oberstufe abgewählt und die Erinnerungen an die Physik der Mittelstufe sind häufig eher negativ. Viele blicken daher gleich zu Beginn ihres Studiums mit Sorge auf die bevorstehenden schriftlichen Physikprüfungen. Wie soll das nur gutgehen?
Keine Panik
»Physik für Mediziner«-Aufgaben im Physikum und häufig auch die Physikaufgaben in den universitären Klausuren sind im Antwort-Wahl-Verfahren (multiple-choice) gestellte Fragen, bei denen man sich in kurzer Zeit für eine der zur Wahl stehenden Antwortmöglichkeiten entscheiden muss. In vielen Fällen sind dabei keine Hilfsmittel (Taschenrechner, Formelsammlung) erlaubt. Dieses Prüfungsformat kann (und sollte man) auf jeden Fall vorab ausgiebig trainieren. Im Kapitel 24, am Ende des Buchs, finden Sie noch einige allgemeine Tipps zur Vorbereitung auf diese Art von Klausuren.
Für die verschiedenen Teilgebiete der Physik werden in einzelnen Buchkapiteln zunächst die Inhalte kurz zusammengefasst. Am Ende jedes Kapitels finden Sie dann Übungsaufgaben und anschließend die Lösungen mit Lösungsweg. Ein Übungsbuch kann ein Lehrbuch jedoch nicht vollständig ersetzen. Sollte Ihnen die Lösung einer Aufgabe auch nach dem Studieren des Lösungswegs nicht klar sein, geben Sie sich nicht mit einem lauwarmen »wird schon stimmen« ab, sondern lesen Sie das Thema in einem Lehrbuch noch einmal nach.
Eine besondere Physikbegabung ist zum Bestehen einer »Physik für Mediziner«-Klausur nicht erforderlich (schadet natürlich auch nichts). Mit Fleiß und Training kann man das locker schaffen. Also ran an die Aufgaben! Zunächst aber noch ein paar …
Törichte Annahmen über den Leser
Ich nehme einfach mal an, dass Sie wahrscheinlich ein medizinisches Fach studieren und das Übungsbuch zum Trainieren für eine Klausur oder für das Physikum verwenden wollen. Aber auch anderen Studierenden mit Multiple-Choice-Physikprüfungen (wie Pharmazie) können die Übungsaufgaben in diesem Buch nutzen, um ihr Physikwissen zu trainieren und zu überprüfen.
Das Buch kann bei dem gegebenen Umfang der Lösungswege nicht auch noch einfache mathematische Rechenregeln vollständig erklären. Der Mathestoff eines Oberstufen-Grundkurses reicht zur Lösung der Aufgaben aber völlig aus. Bei Problemen kann ansonsten ein Blick in ein »… für Dummies«-Übungsbuch aus dem Bereich Mathe sicher nicht schaden.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Grundsätzlich orientiert sich die Struktur dieses Übungsbuchs am »Gegenstandkatalog Physik für Mediziner« des IMPP: Mechanik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, Optik und Atomphysik.
Die Kapitelreihenfolge entspricht dabei meinem Lehrbuch »Physik für Mediziner für Dummies«, so dass Sie bei weitergehendem Interesse das Thema einer Aufgabe schnell in diesem Lehrbuch finden können. Im Physikum selbst bleiben für die Beantwortung einer Frage im Schnitt nur 90 Sekunden Zeit. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie jede Aufgabe in 90 Sekunden lösen können müssen. Viele einfache Wissensaufgaben (zum Beispiel: »Wie lautet die Einheit der Leistung?«) lassen sich deutlich schneller bearbeiten. Die dadurch gewonnene Zeit kann man in aufwendigere Rechenaufgaben stecken. Grundsätzlich sollten auch die schwereren Übungsaufgaben in diesem Buch ohne Hilfsmittel in unter vier Minuten lösbar sein. Für ein paar wenige kompliziertere Übungsaufgaben darf man auch mal mehr Zeit brauchen. Diese sind mit einem * gekennzeichnet.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie in allen »… für Dummies«-Büchern, gibt es auch in diesem Buch einige Symbole, die Sie auf bestimmte Sachverhalte hinweisen sollen:
Mit diesem Symbol werden zusätzliche Lösungstipps markiert, die auch für andere Aufgaben hilfreich sein können.
Gibt es bei der Lösung einer Aufgabe mögliche Fallen oder die Gefahr von Missverständnissen, wird darauf mit diesem Symbol hingewiesen.
Wie es weitergeht …
… hängt davon ab, wo man gerade steht.
Zur allgemeinen Klausurvorbereitung können Sie das Buch parallel zur Vorlesung oder mit einem Lehrbuch durcharbeiten und dabei immer die Themengebiete trainieren, die gerade behandelt werden.
Falls Sie vor der Klausur bei einem Thema ein unsicheres Gefühl verspüren, können Sie mit den Übungsaufgaben nochmals gezielt einzelne Themenbereiche trainieren.
Kurz vor der Klausur ist es sinnvoll, sich selbst mit zufällig herausgepickten Aufgaben eine eigene Klausur zu erstellen und damit auch seine Bearbeitungsgeschwindigkeit zu kontrollieren.
Teil I
Mechanik
IN DIESEM TEIL …
… gibt es zunächst Übungsaufgaben zu grundlegenden Dingen:
Was sind die SI-Basisgrößen und Basiseinheiten?Wie rechnet man mit den SI-Präfixen?Wie kann man die Physikklausur ohne Lernen bestehen? (Nur Spaß, gar nicht!)Wie bestimmt man statistische Größen?Wie berechnet man die Fortpflanzung von Fehlern?Danach geht es dann klassisch mit Aufgaben aus der Mechanik los (Kinematik, Dynamik …).
Kapitel 1
Physik als messende Wissenschaft
IN DIESEM KAPITEL
Physikalische Größen und Einheiten
SI-Basisgrößen und Basiseinheiten
Präfixe und Zehnerpotenzen
Für das Lösen vieler Aufgaben ist die Kenntnis der Einheiten und Präfixe wichtig. Wenn Sie nicht wissen, was »Femto« bedeutet, können Sie noch so viele Formeln kennen, die Lösung werden Sie trotzdem nicht korrekt ausrechnen können. Deshalb fangen wir am besten erst einmal bei den Einheiten und Vorsilben an:
Internationales Einheitensystem (SI)
Bei Messungen werden physikalische Größen mit einer vorab festgelegten Einheit verglichen. Wie oft die Einheit in die Größe passt nennt man Maßzahl:
Eine physikalische Größe besteht also immer aus einer Maßzahl und einer Einheit.
Im Système international d'unités (SI) hat man sich auf sieben Basisgrößen geeinigt, aus denen dann alle anderen Größen mittels Multiplikation und Division abgeleitet werden können. Für jede dieser Basisgrößen wurde eine Basiseinheit verbindlich festgesetzt (Tab. 1.1).
Präfixe
In den Naturwissenschaften sowie in der Medizin können sehr große und sehr kleine Größen vorkommen, die deutlich von den Basiseinheiten abweichen. So beträgt beispielsweise der Duchmesser eines Erythrozythen nur .
Zur Vereinfachung der Schreibweise gibt es für viele Zehnerpotenzen einfache Abkürzungen (Vorsilben, Tab. 1.2).
Basisgröße
Symbol
Basiseinheit
Abk.
Länge
Meter
m
Zeit
Sekunde
s
Masse
Kilogramm
kg
Elektrische Stromstärke
Ampere
A
Temperatur
Kelvin
K
Lichtstärke
Candela
cd
Stoffmenge
Mol
mol
Tabelle 1.1: Basisgrößen und -einheiten des SI
Potenz
Vorsilbe
Symbol Potenz
Vorsilbe
Symbol
Peta
P
Dezi
d
Tera
T
Zenti
c
Giga
G
Milli
m
Mega
M
Mikro
Kilo
k
Nano
n
Hekto
h
Piko
p
Deka
da
Femto
f
Tabelle 1.2: Vorsilben (Präfixe)
Übungsaufgaben
1.1 Welche der folgenden Einheiten ist eine Basiseinheit des internationalen Einheitensystems (SI)?
Joule
Gramm
Volt
Kilometer
Mol
1.2 Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des internationalen Einheitensystems (SI)?
Meter
Kilogramm
Grad Celsius
Ampere
Candela
1.3 Welche der folgenden Größen ist keine Basisgröße des internationalen Einheitensystems (SI)?
Volumen
Länge
Masse
Elektrische Stromstärke
Stoffmenge
1.4 Welche der folgenden Längenangaben ist äquivalent zu ?
1.5 Für die Wellenlänge von grünem Licht gilt: . Das entspricht
1.6 Die Masse eines Erythrozyten (rotes Blutkörperchen) beträgt ungefähr . Geben Sie diese Masse in der entsprechenden SI-Basiseinheit an.
1.7 Die Periodendauer der beim MRT eingesetzten elektromagnetischen Strahlung betrage . Das entspricht
Kapitel 2
Durch Raum und Zeit
IN DIESEM KAPITEL
Länge, Fläche, Volumen und Winkel
Zeit und Frequenz
Skalare und vektorielle Größen
In vielen Aufgaben ist es notwendig, einfache physikalische Größen wie Flächeninhalt, Volumen, Winkel oder Frequenz berechnen zu können. Im Folgenden daher zunächst eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Formeln, die Sie zum Lösen der Übungsaufgaben benötigen.
Fläche und Volumen
Die einfachste aus der Länge abgeleitete Größe ist die Fläche: . In Abbildung 2.1 sind Formeln für einige häufig vorkommende Flächen aufgelistet.
Abbildung 2.1: Einige geometrische Flächen
Abbildung 2.2: Einige geometrische Volumina
Eine weitere aus der Länge abgeleitete Größe ist das Volumen: . Bei den Vorsilben gilt: ! Eine Besonderheit beim Volumen ist, dass man statt auch Liter sagen kann. Gerade in der Medizin ist es sehr üblich, Volumina in dL, mL (=) oder L (=) anzugeben. Abbildung 2.2 zeigt Formeln für häufig vorkommende Volumina.
Winkel
Winkel werden häufig im Gradmaß angegeben (Vollkreis ). Daneben gibt es auch noch die Angabe im Bogenmaß (Vollkreis ). Bei Winkeln im Bogenmaß schreibt man zur Unterscheidung manchmal die Einheit rad hinter die Zahl.
Bogenmaß und Gradmaß kann man mit Dreisatz leicht ineinander umrechnen:
Winkel im Bogenmaß = Winkel im Gradmaß
Winkel im Gradmaß = Winkel im Bogenmaß
Winkel lassen sich auch mit den trigonometrischen Funktionen bestimmen (siehe Abb. 2.3).
Abbildung 2.3: Trigonometrische Funktionen
Periodendauer und Frequenz
Bei periodisch wiederkehrenden Ereignissen nennt man die Anzahl an Perioden pro Zeit Frequenz . Je größer die Periodendauer ist, umso weniger Perioden werden pro Zeit durchlaufen. Periodendauer und Frequenz sind also antiproportional.
Die Einheit der Frequenz ist demnach . Das kürzt man meistens mit Hertz (Hz) ab:
Vektoren
Physikalische Größen werden durch Maßzahl und Einheit beschrieben und für viele Größen ist das auch vollkommen ausreichend (z. B. Zeit, Energie, Temperatur, Druck, Ladung). Solche Größen nennt man skalare Größen. Bei einigen Größen benötigt man, um die Größe vollständig zu beschreiben, zusätzlich noch eine Richtungsangabe (z. B. Strecke, Geschwindigkeit, Kraft). Größen, die zusätzlich noch eine Richtung benötigen, nennt man vektorielle Größen. Vektorielle Größen kann man auch addieren, subtrahieren und multiplizieren (siehe Abb. 2.4). Allerdings muss man hier immer die Richtung der Vektoren mitberücksichtigen. Vektorielle Größen werden mit einem Pfeil über dem Buchstaben dargestellt (). Lässt man den Pfeil weg, meint man nur den Betrag (skalaren Anteil) der Größe ().
Abbildung 2.4: Rechnen mit Vektoren
Übungsaufgaben
Fläche und Volumen
2.1 Als Modell für einen Röhrenknochen dient ein Hohlzylinder mit dem Innenradius und dem Außenradius . Wie groß ist in diesem Modell die Querschnittsfläche für das Knochengewebe?
2.2 Verdoppelt sich der Durchmesser eines kugelförmigen Bronchialkarzinoms, so wird sich das Volumen
verdoppeln.
vervierfachen.
verachtfachen.
versechsfachen.
halbieren.
2.3 Die Erythrozytenzahl (Erythrozytenkonzentration) in einer Vollblutprobe beträgt . Wie groß ist der Anteil des gesamten Erythrozytenvolumens am Blutvolumen, wenn das mittlere Erythrozytenvolumen (MCV) beträgt.
40%
45%
50%
55%
60%
2.4 Wie hängt der Quotient aus Kugelvolumen und Kugeloberfläche vom Kugelradius ab?
Winkel und Frequenz
2.5 Beim normalsichtigen Erwachsenen beträgt der minimale Winkel, unter dem zwei Punkte gerade noch getrennt wahrgenommen werden können, . Welchen Mindestabstand müssen demnach zwei Punkte auf einem entfernten Blatt (quer zur Blickrichtung) ungefähr haben, damit sie ohne Hilfsmittel getrennt wahrgenommen werden können?
2.6 Welchen Wert hat der Winkel im Bogenmaß ungefähr?
2.7 Wie groß ist die Frequenz , der in der nachstehenden Grafik dargestellten Wechselspannung? (Horizontale Ablenkung: pro Kästchen)
2.8 Die Frequenzen zweier Schwingungen mit der Schwingungsdauer und unterscheiden sich um
2.9 Bei einem Großwindrad mit drei Flügeln überstreicht ein Flügel in einer Sekunde einen Winkel von . Ungefähr wie groß ist die Frequenz des Stroboskopeffekts, der dadurch entsteht, dass die Flügel das Sonnenlicht kurzzeitig abschirmen?
Vektoren
2.10 Welche der nachfolgenden Größen ist eine vektorielle Größe?
Druck
Impuls
Temperatur
Leistung
Zeit
2.11 Zwei senkrecht aufeinanderstehende Kräfte mit den Beträgen und