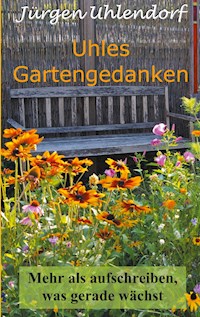
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Uhles Gartengedanken - das sind Geschichten über den Garten und das Leben mit der Natur. Immer mit praktischem Nutzen und gerne mit dem philosophischen Blick auf das Wesen von Unkraut und Ernte. Seit ich einen eigenen Garten habe, notiere ich Aussaaten, Pflanzungen und Ernten in meinen persönlichen Notizbüchern. Dabei stelle ich immer wieder fest, wie weit die Beschreibungen etablierter Gartenratgeber vom tatsächlichen Alltag im eigenen Garten entfernt sind. Die Freude am Ausprobieren und die Hinweise auf viele überraschende Erlebnisse, die in den "Sackgassen des Gärtnerlebens" stattfinden, fehlen allzu oft in den Beschreibungen. Es wird zwar der Anfang beschrieben, aber es bleibt offen, wie die angepriesene Bepflanzung im nächsten Frühjahr aussieht oder was aus den Duftkräutertrittsteinen wird, wenn Vogelmiere, Giersch und Quecke darüber hinweggefegt sind. Für mich gehören diese Erlebnisse genauso zum Gartenalltag wie die Frage "Gibt es wirklich den einen verlässlichen Weg zum Lieblingsgarten?". Aus meinen Notizen sind mittlerweile über 400 Blog-Artikel entstanden. Diese bildendie Basis für dieses Buch. Über die Jahre wiederkehrende Themen habe ich zu längeren Kapiteln zusammengefasst. Andere Kapitel sind vollständig neu erstellt und geben die Erfahrung meiner Gartenjahre wieder. Mein Ziel ist es, persönliche Erfahrungen und informatives Wissen zu einem unterhaltsamen Ganzen zu verbinden. Dabei soll die Freude am Gartenleben im Vordergrund stehen. Gärtnern ist zuallererst Balsam für die Seele. Auch wenn es zusätzlich einen Ertrag in Form von frischem Salat und eigener Marmelade liefert. Für wen ist es? Für jeden Gartenliebhaber, der sich vorstellen kann, neue gedankliche Wege zu gehen und ein nettes Gespräch nach einem langen Tag genießt. Uhles Gartengedanken unterhalten den Leser und macht Mut, - selbst mit dem Gärtnern zu beginnen, - den eigenen Erfahrungen mehr zu vertrauen als allerlei theoretischen Ratgebern und - über die Einzelfragen zu konkreten Gartenthemen hinaus das größere Ganze zu bedenken. Uhles Gartengedanken verstehen sich als freundlich plaudernde Unterhaltung über den Garten. Statt Vorgaben, wie ein "richtiger" Garten zu sein hat oder jahreszeitliche To-do-Listen gibt es Garten - Leben - Jetzt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jürgen Uhlendorf, geboren 1965, lebt in der Nähe von Kassel. Er studierte Chemie in Karlsruhe und Clausthal-Zellerfeld und arbeitet als Qualitäts- und Prozessmanager.
In den letzten fünf Jahren wandte er sich in intensiv dem Thema Garten zu. Sein Gartenblog liefert vielfältige Texte vom Selbstversuch mit Gierschgemüse über den alljährlichen Gartenalltag bis hin zur Verarbeitung verschiedener Heilkräuter.
Weitere Informationen über den Autor finden Sie unter www.juergenuhlendorf.blog.
Das Buch
Die sogenannte Pflege des Rasens sorgt mit viel Aufwand an Zeit und Kraft dafür, dass sich die natürlich vorhandenen Pflanzen nicht ausbreiten. Während ich mich im Gemüsebeet anstrenge, dass der Salat gut wächst, sorge ich auf dem Rasen mit noch mehr Mühe dafür, dass etwas nicht wächst!
Vom Rasen zur Wiese – Ein blühender Sinneswandel
Garten ist nicht einfach ein Stück Land, das ich in Reihen aufteile und dem ich die Saatguttüten zuordne. Der Garten ist mehr als die Ansammlung von Pflanzen! Garten ist eine Lebensweise.
Leben im Naturgarten
Inhalt
Gartengeplauder
oder
Dieses Buch ist gut für
Der Garten ist meine Geschichte
Das erste Schneeglöckchen kämpft sich durch die Kälte
Januargarten
oder
Der Winter in den Gartenzeitschriften
Februargarten: Geduld & Planung
Keltischer Frühlingsanfang
Märzwinter
Gartentagebuch: Der erste Gartentag!
Aussaatplan
Winterverluste
Der wilde Heilpflanzengarten
Hochbeet: Gartentraum und Wimmelbeet
Vorgarten
Die große Entgierschung
Vom Gärtnern: Gedanken über Gartenwerkzeuge
Die Queckenjagd
Das erste Jahr als Kartoffelbauer
Wildflowers ahead! – Wie alles anfing
Der Pflanzenmarkt
Mauersegler und Holunderblüte: Die Sommerboten
Vorhang auf für den Salbeigarten
Sommer im Garten
Sommerernte
Dies wird mein Jahr der Tomate!
Tomatenmarketing
Ernte im Tomatengarten
Sommer mit Eibe
Sonne – Leben – Leichtigkeit: Sommer ist Farbe!
Eine Art Bauerngarten
Vom Rasen zur Wiese – Ein blühender Sinneswandel
Der Traum vom einfachen Leben
Leben im Naturgarten
Blaue Blume an der Landstraße: Die Wegwarte
Alles außer Anleitungen zum Jäten – Was es zum Giersch zu wissen gibt
Die Gartenlandschaft des Lake Districts
Marmeladerie – Plötzlich Selbstversorger
Der schiefe Baum – Baumfällen für Anfänger
Herbstgartenimpressionen
Herbstarbeiten
Den eigenen Spitzwegerichhonig herstellen
Der „fehlende“ Winter
Die Wintertomate
Leben ist JETZT!
Eibe: Finstergiftig und ewig alt
Mittwinter und die Raunächte: Die Zeit dazwischen
Gartengeplauder oderDieses Buch ist gut für …
Es ist Nachmittag. Die Arbeit im eigenen Garten ist getan. Sie haben Ihr neues Gemüsebeet gejätet und sitzen erschöpft aber glücklich mit einem Tee auf der Gartenbank.
Für mich sind das die Momente, in denen ich genug davon habe, zu lesen wie der Kompost aufgesetzt werden muss und welche Tomatensorte wann reif ist. Dann genieße ich es, einem Text zu lauschen, der zwar „irgendwie“ mit Natur und Garten zu tun hat, aber ansonsten nett dahinplaudert. Für solche Momente ist dieses Buch gedacht.
Mir geht es nicht darum, zu erklären, warum die neueste Modefarbe der Tulpensaison völlig unmöglich ist oder Ihnen einzureden, dass es nur eine einzige wirklich richtige Methode gibt, Gurken anzubauen – nämlich meine! Sehen Sie* dieses Buch als einen Plausch am Gartenzaun:
„Na, wie geht es den Tomaten? Immer noch Harzfeuer, wie jedes Jahr?“
„Ach, weißt du*, dieses Jahr traue ich mich mal an andere Sorten. Die Rote Zora soll ja sogar im Freiland wachsen. Das probiere ich aus!“
Seit mehr als fünf Jahren schreibe ich den Gartenblog, aus dem dieses Buch entstanden ist. Dabei werde ich oft gefragt, was das ist, das ich da schreibe: Garten-Tipps? Kolumnen? Kräuterweisheiten? Etwas Unterhaltsames? Ein Sachbuch?
Ich schaue mir die Bücher an, die für mich Vorbilder sind: Reginald Arkell (Pinegars Garten), Michael Pollan (Meine zweite Natur: Vom Glück, ein Gärtner zu sein), Susanne Wiborg (Bin im Garten), Ilga Eger (Ein Jahr im Garten), Max Scharnigg (Feldversuch). Keines davon bezeichnet sich als Roman, Sachbuch oder Erzählung. Es wird dem Leser überlassen, zu entscheiden, was er da liest. Nun gut, wenn es noch keine Bezeichnung für freundlich-unterhaltende und zugleich sachlich-informative Gartengeschichten gibt, dann erfinde ich sie selbst: Dieses Buch enthält literarische Gartensachgeschichten. Oder um es weniger förmlich auszudrücken: Gartengeplauder.
Uhles Gartengedanken ist gut für …
Die Freude am Gärtnern, auch wenn es nicht so wird wie geplant.
Die eine oder andere Idee, auf die man selbst noch nicht gekommen ist.
Den Blick vom eigenen Garten zum großen Ganzen.
Das Glas Rotwein nach einem anstrengenden Gartentag.
* Welche Anrede passt zu einem Gartenbuch? Ich selbst mag es nicht, wenn ich in Texten von mir völlig fremden Menschen mit „Du“ angeredet werde. Andererseits ist das Miteinander an Gartenzäunen und Pflanzenbörsen so freundschaftlich und zugewandt, dass mir das distanzierte „Sie“ dafür ungeeignet erscheint.
Der Garten ist meine Geschichte
Ein Geschichtenerzähler muss seine Figuren gut kennen, bevor er sie in seine Geschichte lässt. Er ruft die schillerndsten und finstersten Figuren zusammen. Von der gütigen Großmutter bis zum heimlichen Bösewicht. Aber sobald er das Wort ENDE schreibt, ist die Geschichte vorbei und der Erzähler ist seine Figuren wieder los. Als Gärtner lebe ich mit meinen Figuren. Umso sorgfältiger muss ich, als Erzähler meines Gartens, meine Figuren auswählen.
Welche Geschichte ist es, die der Garten erzählt? Ist er eine achtköpfige Patchworkfamilie, in der es täglich voller Leben drunter und drüber geht? Mittendrin eine himmelhohe Kastanie. Ein ganzes Menschenleben steht sie schon hier. Rundherum viele leuchtende Blüten von Löwenzahn, Schafgarbe, Wiesenschaumkraut und Habichtskraut, die Farbe in jeden erdenklichen Winkel des Gartens bringen.
Oder ist der Garten ein altes Ehepaar, das sich selbst und das Leben verstauben lässt? Jeden Morgen die immergleiche Scheibe gesundes Vollkornbrot. Nach dem Frühstück wird der Teller sofort abgespült. Keiner der 137 Lebensbäume, die jedes Licht und jede Lebendigkeit aus dem Garten fernhalten, tanzt aus der Reihe. Der Zaun zur Straße verdeckt die kahlen Stellen an den Füßen der finsteren Abwehrpflanzen.
Wie wird sie werden, meine Geschichte dieses Gartens? Weiß ich sie überhaupt selbst schon? Der Garten weiß sie genausowenig wie ich. Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungsreise. Erleben die ersten Sommer voll jugendlichen Wirbelns. Die ersten Winter mit philosophischer Einkehr. Jedes Jahr neu. Nach einigen ersten Jahren bin ich erstaunt, welch Ensemble an Figuren und Bewohnern sich hier versammelt hat.
Da sind die Tomatenprinzessinnen. Sie werden als erste genannt. Immer. Selbst jetzt im Winter, obwohl sie gar nicht da sind. Wie schaffen sie das bloß? Sie haben selbstverständlich ihren eigenen Bereich. Sie sind nicht irgendwer. Sie sind die Pflanzen, für die gesorgt wird. Und trotzdem nörgeln sie herum. Der Sommerflieder stehe zu nah und nehme ihnen die Nachmittagssonne. Der Gärtner ließe die Regenschauer zu sehr an sie heran.
Außerdem alle weiteren Saisongäste. Der Spinat lässt sich schon wenige Tage nach dem letzten Frost aussäen. Danach die anderen Salate, Gemüse und Sommerblumen. Manche kehren von alleine zurück wie die Ringelblumen. Andere wollen förmlich eingeladen werden und füllen die Reihen der Anzuchtschalen.
Die Immerdapflanzen geraten meist etwas in Vergessenheit. Obwohl gerade sie es sind, die den Rahmen bilden und der Geschichte ihre Struktur geben. Die finsteralte Eibe neben der Gartenbank. Die lange Reihe Hainbuchen. Ein fünfzehn Meter breites Stopp-Schild: Hier ist Schluss mit diesem Garten. Wer hier weiterwächst, kommt in ein neues Reich. Giersch und Lerchensporn kümmern solche Warnungen wenig. Das sind die Krawalltouristen in meinem Ensemble. Keine, die ich mir ausgesucht hätte. Sie waren einfach vor mir da. Und mit Autorität und Regeln ist beiden nicht beizukommen.
Ich ahne schon, das wird ein spannendes Jahr:
Wie werden die verschiedenen Wucherer Storchschnabel, Waldmeister und Pfefferminz den Halbschatten an der Felsenbirne unter sich aufteilen?
Gelingt es, mir die Amseln davon abzuhalten, sämtliche Aroniabüsche abzuernten?
Lässt sich mit der hinterlistigen Quecke eine Art Friedensvertrag für das Staudenbeet aushandeln?
Das erste Schneeglöckchen kämpft sich durch die Kälte
Für mich ist das der Anfang des Gartenjahres. Natürlich ist es noch kalendarischer Winter und ich habe keine Ahnung, ob das Schneeglöckchen sich selbst noch zum Winter oder schon zum Frühling zählt. Für mich ist es schon jetzt der Neuanfang.
Sätze wie „Mein Gartenfrühling beginnt mit Imbolc!“ klingen nach jahrhundertealtem Wissen. Meine unerfahrene Gärtnerseele schreckte lange zusammen und wurde ganz kleinlaut, wenn mein Gegenüber mit solch geballtem Wissen aufwartete. Inzwischen weiß ich, dass solch ein Satz völliger Unsinn ist. Es funktioniert einfach nicht. Ich notiere nun schon seit fünf Jahren, welche Arbeiten ich wann erledige und hoffe jedes Jahr, dass ich aus den Notizen im nächsten Frühling Jahr etwas lernen kann. Und trotzdem fängt jeder Frühling auf seine eigene Weise an.
Der Frühling, das ist weder Imbolc noch eine statistische Durchschnittstemperatur. Die Luft riecht plötzlich anders. Ein erstes laues Lüftchen. Von irgendwoher zwitschern Vögel und ich kann in den ersten Sonnenstrahlen für kurze Zeit wieder auf der Gartenbank sitzen. Sobald die Sonne hinter den Nachbarhäusern verschwindet, wird es schnell kalt und der erste Frühlingshauch ist wieder vorbei. Aber er war da! Auf dem Weg zurück ins Haus fällt mir dann vielleicht eine Schlüsselblume oder eine Scilla auf, die gestern noch nicht da war. So fängt für mich der Frühling an. Auch wenn der Winter immer mal wieder eine Nachhut schickt, seine Tage sind gezählt und ich fange an, mich ernsthaft mit dem Frühling zu beschäftigen.
Januargarten oder Der Winter in den Gartenzeitschriften
Man darf den Winter in den Gartenzeitschriften nicht mit dem Winter im Garten verwechseln. Das gilt zwar für das ganze Jahr, aber im Winter wird es am deutlichsten. In den Gartenzeitschriften dominieren zu dieser Zeit immer wieder zwei Themen:
Wunderschön mit Raureif überzogene Stauden
Diese Fotos sind wirklich schön. Mir gelingen sie nur äußerst selten. Meist liegt es daran, dass die alten Blütenstände zwar noch da sind, aber mit oder ohne Raureif einfach nur verwelkt und hässlich aussehen. Es mag aber durchaus Gärtner geben, denen die Fotos gelingen und dann sind sie wirklich beeindruckend.
Ich bin dazu übergegangen, die Stauden bereits im Spätherbst/Frühwinter zurückzuschneiden. Das ist eine gute Arbeit für den November- oder Dezembergarten, je nachdem, wann eine günstige Gelegenheit dafür ist. Im Februar/März, wenn das neue Gartenjahr beginnt, ist mit jedem Sonnentag so viel zu tun, dass ich froh darum bin, wenn diese Arbeit bereits erledigt ist. Da ist es praktischer im neuen Gartenjahr das Beet leer zu haben und neu zu beginnen. Das Alte soll im alten Jahr zurückbleiben.
Welche Winterarbeiten jetzt zu erledigen sind
Die Autoren schwärmen vom Blättern in Gartenkatalogen, der Pflege der Gartengeräte oder dem Herstellen von selbst geschnitzten Kleiderhaken aus Astgabeln. Ich sehe das mittlerweile ganz anders. Ich habe den Eindruck, dass den Gartenheftautoren einfach nichts einfällt, aber der Herausgeber darauf besteht, dass es auch im Januar ein neues Heft gibt. Das Gärtnern ist ein Leben mit und in der Natur. Bereits im späten Herbst ist deutlich zu spüren, wie die Natur „ausatmet“ und zur Ruhe kommt. Dem sollte sich der Gärtner anschließen. Der Winter ist nicht die Zeit, um der Natur wie Hase und Igel ein Schnippchen zu schlagen und vor dem Frühjahr schon da zu sein. Das ist doch genau das, was die Baumärkte mit vollen Pflanzenregalen zur Unzeit vormachen. Welchen Grund sollte es geben, sich daran zu orientieren? Der Winter ist auch für den Gärtner die Zeit der Ruhe und des Insichgehens nach getaner Arbeit. Ein guter Platz ist ein Sessel am Kaminfeuer.
Februargarten: Geduld & Planung
Anfang Februar höre ich die ersten Kraniche. Kann das sein oder war das eine akustische Täuschung? Abgesehen von Schneeglöckchen und Winterlingen sind die Beete noch braun und wüst. Im Dezember hatten sich die ersten Blüten der Schlüsselblume hervorgewagt, aber inzwischen wurden sie von den wenigen Tagen strengen Frostes vertrieben. Nachdem es lange so aussah, als fiele der Winter komplett aus, schleichen sich jetzt im Februar doch der Frost und gelegentliche Schneeflocken heran. Mittlerweile fällt es mir echt schwer, mich durch all die verschiedenen Eindrücke hindurchzufinden:
Für die Kelten ist ab 2. Februar Frühling
Phänologisch ist die Zeit der Schneeglöckchen der Erst-Frühling
Kalendarisch ist noch Winter
Ja was denn nun? Gibt es eigentlich neben den keltischen, phänologischen und kalendarischen Jahreszeiten auch „gärtnerische“ Jahreszeiten? Dann würde ich die aktuelle Jahreszeit als „Verwirrung“ beschreiben.
Ich habe den Eindruck, dass im Februar vor allem eine besondere Tugend des Gärtners gefragt ist: Geduld. Das Frühjahr ist noch weit, auch wenn es bei jedem Sonnenstrahl in den Fingern juckt, ob vielleicht nicht doch schon das Frühbeet bepflanzt werden kann. Zur Überbrückung dieser Wartezeit kommt nun der einzige Tipp zum Tragen, den ich mit den Gartenzeitschriften gemeinsam empfehle: Saatgutbestellung!
Welches Saatgut ist nötig? Wie viel davon? Welche Sorte genau? Anhand der Erfahrungen des vergangenen Jahres (jetzt macht sich ein Gartennotizbuch bezahlt) lässt sich gut herausfinden, was wirklich gebraucht wird. Wenn ich jetzt einen halbwegs realistischen Pflanzplan erstelle, kann ich in einem Anlauf alle benötigten Pflanzen und Sorten notieren und stehe nicht bei jedem Einkauf mit großen fragenden Augen an den riesigen, bunten und verführerischen Saatgutregalen und überlege „Habe ich schon Postelein?“.
Natürlich darf man träumen und sich vornehmen, zehn Tomatensorten anzubauen, obwohl man längst weiß, dass nur Platz für fünf bis sieben ist. Natürlich darf man von Haferwurz fasziniert sein, auch wenn man keine Ahnung hat, wie sie wächst und ob man die Ergebnisse dann wirklich essen mag. Dennoch wird man auf diese Weise deutlich weniger und gleichzeitig passender kaufen.
Noch ist im Garten nichts zu tun. Für heute also noch einmal Teetrinken und Abwarten. Bald genug wird es losgehen mit der Gartenarbeit.
Keltischer Frühlingsanfang
Ich habe mich so an unsere kalendarischen Jahreszeiten gewöhnt, dass ich überrascht davon bin, dass es auch anders geht. Für die Kelten begann der Frühling bereits am 2. Februar. „Am 2. Februar? Wie kommt man denn auf so ein schräges Datum“, dachte ich zuerst. Aber es ist ganz einfach und logisch. Der 2. Februar ist genau die Mitte zwischen der Wintersonnenwende (21. Dezember) und der Tag-Nacht-Gleiche am 21. März. Was feierten „die Kelten“ – wer auch immer das so ganz genau war – bloß in dieser Eiseskälte?
Astronomisch gesehen macht dieser Tag jedoch Sinn: Wenn die Wintersonnenwende, der Tag der tiefsten Dunkelheit, „Mittwinter“ genannt wird, dann ist „Winter“ die Zeit vor und nach dieser Mitte des Winters. Der keltische Winter beginnt am 1. November und endet am 2. Februar. Alle anderen Jahreszeiten verschieben sich dann entsprechend. Der keltische Frühling beginnt daher am 2. Februar und geht bis zum 1. Mai.
In der christlichen Tradition findet sich der 2. Februar als Maria Lichtmess wieder. Der 2. Februar ist genau 40 Tage nach Weihnachten und der letzte Tag der Weihnachtszeit. Erst an diesem Tag werden in den katholischen Kirchen traditionell die Krippenfiguren eingepackt. Früher begann für die Bauern mit Maria Lichtmess das Arbeitsjahr. Knechte und Mägde bekamen ihren Lohn und hatten einen oder zwei Tage frei. Es ist für mich immer wieder lehrreich zu sehen, wie in der Natur und der bäuerlichen Tradition die Dinge miteinander verwoben sind. Diese Zusammenhänge sind dem modernen Büromenschen völlig fremd geworden. Ich mag mich gerne wieder mehr auf die Kreisläufe der Natur um mich herum einlassen, anstatt meinen Jahreskreis ausschließlich von Büroterminen zerteilen zu lassen.
In den letzten Jahren fielen einige Winter aus, aber in diesem Jahr wird wieder klar, was mit Winter gemeint ist: Erbarmungslose Kälte für Menschen ohne Zentralheizung und Daunenjacke. Wie überstanden frühere Generationen diese Zeit aus Dunkelheit und zweistelligen Minustemperaturen, in der sie ohne frische Lebensmittel auskommen mussten? Und welche Bedeutung hatte dieser „Frühlingsanfang“ für die Menschen?
Die Tage werden wieder länger. Das Licht kehrt zurück! In einer Zeit ohne elektrischen Strom war es eine unglaubliche Erleichterung, dass endlich die Dunkelheit wieder wich. Das aktuelle Wetter ist gar nicht das Thema von Imbolc, wie das keltische Frühlingsfest auch genannt wird. Daher hat der keltische Frühlingsanfang für mich aus gärtnerischer Sicht auch keine Bedeutung.
Zu einer Zeit, als der Winter noch eine existenzielle Bedrohung war, freuten sich die Menschen schon über ein nur ein nur symbolisches Näherkommen des Frühlings. Wir dagegen schauen mürrisch auf die Wetter-App und beschweren uns, dass immer noch Schnee liegt. Ja, es liegt Schnee und es ist kalt, aber falls es im nächsten Februar 15 °C warm sein wird, werden die Menschen genauso mürrisch verkünden, dass der Klimawandel uns alle ruiniert.
Märzwinter
Zum dritten Mal verspricht die Wettervorhersage, dass es am nächsten Wochenende über zehn Grad warm wird. Doch kaum beginnt die neue Woche, relativiert sich diese Aussicht von Tag zu Tag ein wenig. Als das Wochenende tatsächlich da ist, nehme ich doch wieder die Winterjacke von Haken, als ich morgens mit dem Hund zum Brötchenholen gehe. Heute war es bis zum Nachmittag tatsächlich richtig sonnig, aber kaum ist die Zeit für den Besuch im Straßencafé gekommen, ziehen Wolken auf und ein kalter Wind pfeifft mir um die Nase. Der März entwickelte sich zum echten Wintermonat.
Nachdem ich Jahr für Jahr notiere, welche Blumen wann blühen und welche Gartenarbeiten ich wann erledige, stelle ich immer mehr fest, dass diese Verwirrung aus mildem Winter, spätem Frost und gelegentlichen Sonnentagen genau das ist, was den Frühling ausmacht. Als Gärtner brauche ich die eigene Erfahrung, um mich durch die vielseitigen Eindrücke hindurchzufinden und für den eigenen Garten zu entscheiden, welches der richtige Zeitpunkt und für die einzelne Arbeit ist.
In meinem Garten haben Schlüsselblumen und Kugelprimeln, die im Februar schon in Aufbruch-Stimmung waren, sicherheitshalber noch einmal in den Wintermodus gewechselt. Sie hocken mit fast geöffneten Blüten tief am Boden, als wollten sie sagen „wir sind noch gar nicht da“. Die Notizen aus den anderen Jahren zeichnen dagegen ein völlig anderes Bild.
War das „früher“ auch so ein Durcheinander mit dem Wetter im Frühjahr? Ich bin mittlerweile geneigt, hinter jeder Wolke gleich den Klimawandel zu vermuten und hinter einigen steckt er wohl auch. Doch, wenn früher immer das gleiche Wetter gewesen wäre, jeder Februar frostig, jeder März in Duftveilchen gehüllt, dann hätte sich niemand die Mühe gemacht, die Zusammenhänge zwischen Pflanzenwachstum und Wetterlagen als Bauernregeln festzuhalten.
Bei aller Verwirrung durch das Wetter und plötzlichem Frost ist der Frühling auch immer Aufbruch und Neubeginn. Irgendwann reicht es mir dann mit der Kälte und ich lasse mich nicht mehr von neuerlichen Schneeschauern schrecken. Ja, in manchen Jahren werden noch einmal einige Pflanzen erfrieren, aber auf jeden Fall gibt es bald die ersten frischen Wildkräuter. Mit der neuen Aussaat rückt dann wieder das Werden in den Blick, der einige Monate von Vergehen und Kälte verfinstert war.
Gartentagebuch: Der erste Gartentag!
Ganz egal, ob es der 17. März oder der 5. April ist, irgendwann ist der erste richtige Gartentag des neuen Frühlings! Heute Morgen war die nahegelegene Autobahn A7 Kassel – Würzburg wegen Schneetreibens gesperrt. Quasi ein Aprilscherz des Wettergottes. Gerade einmal zehn Stunden später locken mich der strahlende Sonnenschein und 14 °C in den Garten. Ich will nur kurz schauen, ob ich die Buchensetzlinge, die vorgestern per Post kamen, einpflanzen kann. Doch kaum bin ich im Garten, sehe ich bei jedem Schritt eine neue Aufgabe, die zu tun ist. Jetzt fängt es also wieder an: Ich muss mir gar keinen Plan mehr machen, sondern gehe einfach nach draußen und erledige die Dinge, die mir über den Weg laufen. Heute schneide ich den lieb und knorrig gewordenen Salbei zurück. Ich steche die Hälfte des zu groß gewordenen Pfefferminz-Busches aus und entferne die Seitentriebe, die trotz massiver Wurzelsperre durch das Beet wuchern.
Die Buchensetzlinge müssen noch einen weiteren Tag warten. Stattdessen schneide ich den Lavatera-Strauch zurück. Im letzten Jahr hatten mich Angaben wie „nicht völlig winterhart“ verwirrt. Ich war froh, dass der Busch wieder kräftig austrieb. Darüber versäumte ich, ihn genauer im Auge zu behalten, und er entwickelte sich im Laufe des Sommers zu einem wirren Ungetüm. Inzwischen habe ich nachgeforscht. Schon der Name ist eine Kunst für sich. Bei Lavaterra handelt es sich je nach Quelle um eine Buschmalve, Strauchmalve, Bechermalve oder Strauchpappel. Ich habe eine Lavatera Barnsley, die nur in sehr kalten Wintern einen Schutz braucht und im Frühjahr einen radikalen Rückschnitt à la Sommerflieder verträgt.
Ich genieße die kurze Zeit der Wärme und des Sonnenscheins. Sobald die Sonne hinter den Dächern verschwindet, wird es merklich kühler. Noch sind die sonnigen Nachmittage im Garten die Ausnahme, aber der Bann ist gebrochen!
Ideenliste
An den ersten Tagen mit Gartenwetter fange ich wieder eine meiner Ideenlisten an. Ich nenne sie bewusst nicht To-do-Liste, weil ich mit To-do den Stress verbinde, die Aufgaben pünktlich zu erledigen. Die Ideenliste ist für mich eher ein Ort zum Sammeln von Ideen. Da kommt alles drauf, was mir so begegnet, wenn ich durch den Garten laufe. Vieles davon lässt sich gar nicht gleich erledigen oder ich weiß noch nicht, wann das Wetter dafür gut genug ist. Also kommt die Aufgabe vorerst auf die Ideenliste. Die liegt immer auf dem Schreibtisch parat und wenn eine halbe Stunde oder gar ein ganzer Vormittag Zeit sind, suche ich mir das Liebste von der Liste aus. Manches Mal gibt es auch dringende Aufgaben, ja, das stimmt, und wenn ich im Sommer Tomaten ernten will, dann muss ich sie im Frühjahr aussäen. Nicht jede der Arbeiten kann ich beliebig verschieben. Aber, wenn ich ehrlich bin, wird klar, dass ich selbst derjenige bin, der die Liste schreibt. Die Liste ist keine Zwangsvorgabe von außen. Kein Chef sagt mir, was ich davon zu tun habe und was nicht. Wenn ich es also nicht schaffe, rechtzeitig Dahlien zu setzen, ja, und? Dann haben eben die Astern mehr Platz.
Wenn ich vergangene Ideenlisten ansehe, zum Beispiel die für die Weihnachtsferien, bin ich immer wieder überrascht, wie vieles davon erledigt ist, ohne dass ich konkrete Termine plane. Heute notiere ich auf die aktuelle Frühlingsideenliste:
Sommerflieder schneiden
Weg um das Hochbeet bauen
Deckel für die Holzvorratskiste zimmern
Rhabarber versetzen
Aussaatplan
Endlich ist es soweit: Die ersten Saatgutkörnchen dürfen ins Sämlingshaus! All diese Winterwarterei beginnt ein Ende zu haben. Wenn im Dezember der Garten zur Ruhe kommt, denke ich, dass so eine Pause gut ist. Aber nun ist langsam genug mit Pause. Jetzt braucht es wieder Licht und Sonne, Rausgehen und Gemüsebeetgraben!
Im Gegensatz zu den letzten Jahren sortiere ich in diesem Jahr nicht nur meine Saatgutkiste und bestelle fehlende Sorten nach, sondern ich erstelle gleich einen Aussaatplan für das ganze Jahr. Dabei überrascht mich, dass die sogenannten Zweijährigen unter den Blumen gar nicht im Spätsommer ausgesät werden, sondern gleich am Anfang der Saison. Der einzige Unterschied zu ihren einjährigen Kumpanen ist, dass sie in diesem Jahr nicht blühen. Im Spätsommer werde ich trotz des Jahresplans noch einmal komplett neu planen. Genau so, als sei gerade Januar, kommen alle Saatgutpäckchen auf den Tisch. Dann schaue ich, welches Saatgut zu den freien Beeten und dem Wetter passt.
Heute also die erste Runde Aussaat. Es ist bestimmt der völlig falsche Mond und wie die Sterne stehen, kann ich bei der Bewölkung heute sowieso nicht sehen. Doch im Ernst, ich kann mich um meinen Garten hauptsächlich am Wochenende oder am Abend kümmern. Dabei versuche ich es so gut zu machen, wie es geht. Manches Mal dauert es drei, vier Wochen, bis ein passender Aussaattag auf einem Wochenende liegt. In diesen Situationen mache ich für mich die Erfahrung, dass es besser funktioniert zu säen, wenn ich Zeit dafür habe oder – später, wenn im Freiland gesät wird – lieber einen Tag mit gutem Wetter abzupassen, anstatt den richtigen Mond zu haben, dafür aber strömenden Regen.
Bisher gelingt es mir gut, mich an meinen Aussaatplan zu halten. Nun ja, er ist gerade erst zwei Wochen alt. Aber ich merke, dass es wirklich eine Hilfe ist, den Plan gleich für das ganze Jahr zu schreiben. Ich muss nicht jedes Mal neu überlegen, was gerade dran ist und was nicht. Ich hatte z. B. Mangold als „ganz arg früh“ in Erinnerung und wollte schon die Körner abzählen, aber meine Liste sagt ganz klar „Mangold: Noch warten / Spinat: Jetzt starten“. Für mich ist es eine Hilfe, alles einmal zu durchdenken und danach nur noch auf den Zettel schauen zu müssen.
Winterverluste
Lange hatte ich die Töpfe mit frostempfindlichen Pflanzen im Garten gelassen. Bis weit in den Dezember hinein war es mild. Als es dann im Februar kalt wurde, räumte ich sie in die helle und frostfreie Garage. Seit einigen Tagen hole ich sie Stück für Stück zurück in den Garten. Leider hat vieles den Winter nicht überlebt. Auch eine ganze Stiege vorgezogener Zweijähriger: Königskerze, Muskateller-Salbei, Wegwarte. Die kann ich zwar neu aussäen, aber sie blühen dieses Jahr dann nicht mehr. Das ist echt der Haken an den ZWEI-jährigen. Der Name sagt es schon.
Die Pflanzen, die ich aus lauter Vorsicht vor Kälte schützen wollte, sind mir stattdessen vertrocknet. Ich hatte mehrfach nachgesehen, wie es den Töpfen geht, aber wohl nicht häufig genug. Wie wäre es den Pflanzen im Garten ergangen? Hätten sie den Winter womöglich ohne meine Hilfe besser überstanden? Vor Jahren machte ich beim Umbau eines Beetes genau die entgegengesetzte Erfahrung: Pflanzen, die „eigentlich“ frostfest sind, sind mir erfroren, weil sie in Töpfen im Garten standen und nicht in der Erde verbuddelt waren.
Die Lösung dieses Dilemmas bringt nur die langjährige Erfahrung des Gärtners. Da lässt sich noch so viel in schlauen Büchern nachschlagen, trotzdem wird immer wieder die eine Pflanze vertrocknen, während die andere erfriert. Erst nach Jahren hat man genug Erfahrung und weiß, dass die Wegwarte ohne Pflege besser zurechtkommt, als mit Winterschutz, während die Kugelprimel ohne Zögern erfriert, wenn sie nicht fest in der Erde vergraben ist. Selbst nach vielen Jahreskreisen ist es eher eine Art von Gefühl als ein konkretes Wissen. Was kann ich einer Pflanze zutrauen und was nicht.
Der wilde Heilpflanzengarten
Als ich meinen Garten kennenlernte, gab es dort ein Beet mit Küchenkräutern. Dies ist einige Jahre her und bei den verschiedenen Umgestaltungen, die ich im Garten vornahm, war auch immer wieder die Idee dabei, aus dem Küchenkräuterbeet einen Heilkräutergarten zu machen. Ich dachte, Heilkräuter gehören in einen eigenen Gartenbereich, und wollte dafür das Beet der Küchenkräuter verwenden. Ein doppeltes Missverständnis.
(1) Nicht alle Heilpflanzen sind Kräuter. Was beim Thymian noch eine spitzfindige Diskussion sein mag, wird spätestens bei Holunder und Weißdorn deutlich. Beide haben mit Kräutern wenig zu tun.
(2) Nicht alle Heilpflanzen haben dieselben Ansprüche und lassen sich mal eben so in ein gemeinsames Beet setzen. In meiner Vorstellung spielte da sicher die vage Idee eines Klostergartens eine Rolle. Doch selbst wenn es den Mönchen gelang, alle in einem Kloster verwendeten Heilpflanzen selbst anzubauen, so war das sicher nicht ein einzelnes Beet, sondern eine ganze Gartenanlage.
Küchenkräuter: Als ob die botanischen Begriffe nicht schon verwirrend genug sind, gibt es zusätzlich das Stichwort Küchenkräuter. Wann ist denn ein Kraut für die Küche und wann ist es heilsam? Wenn ich Wildgulasch mit Thymian würze, ist der Thymian dann ein Küchenkraut oder eine Heilpflanze, die ich zum Kochen verwende? (Ganz abgesehen davon, dass Thymian immer noch kein KRAUT ist …)
Wildkräuter: Heil- und Küchenkräuter sind für den Gärtner willkommene Gäste. Schwieriger wird es bei wilden Kräutern, die niemand gezielt pflanzt. Man könnte auch Unkräuter dazu sagen. Gleichzeitig benutze ich den Spitzwegerich als wirksames Mittel gegen Insektenstiche. Laufe ich nun jedes Mal durch Wald und Flur, um drei Blätter Spitzwegerich zu fin





























