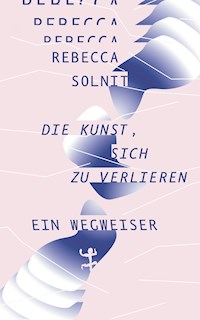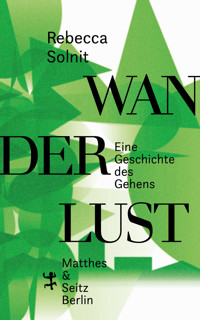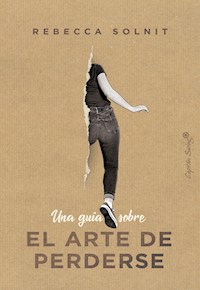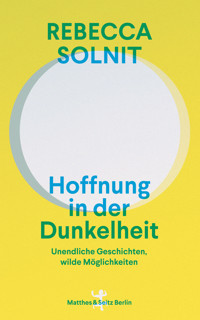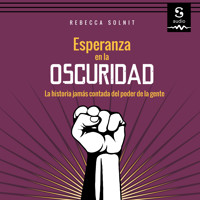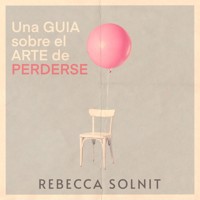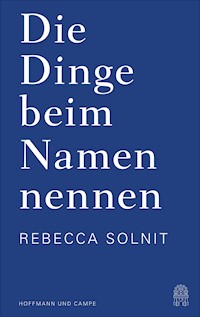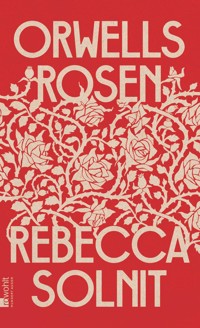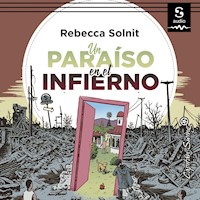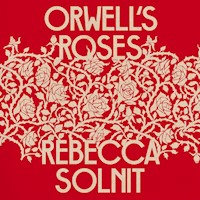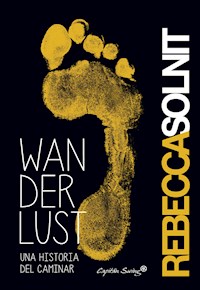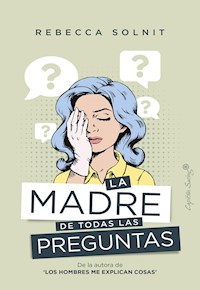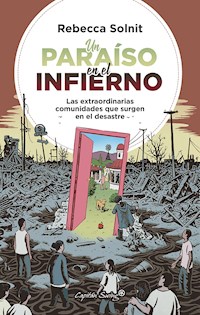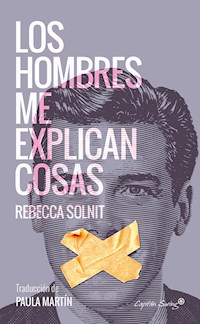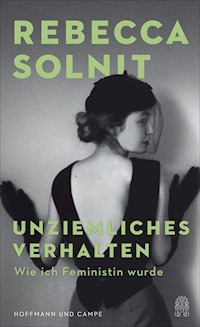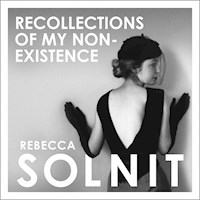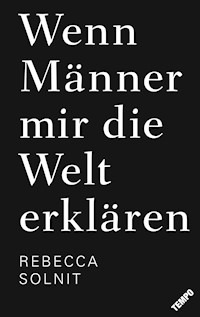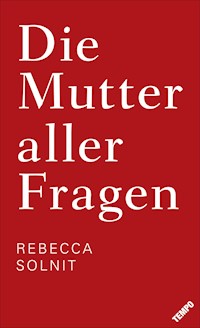19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie können wir eine bessere Zukunft schaffen? Wie wollen wir leben? Wie verlieren wir bei allem Realismus nicht die Hoffnung? Eine dreihundert Jahre alte Geige, die uns viel über Wälder und Klima erzählen kann, ein Lob des Tanten-Seins, das die kinderlose Frau als Stütze der Gesellschaft preist, und scharfe Kritik an Milliardären, die unsere Demokratie gefährden: Rebecca Solnit erforscht in ihrem neuen Buch, wie wir durch unser Handeln Gegenwart und Zukunft gestalten können. Anhand der drängenden Fragen unserer Zeit – Klimawandel, Bedrohung der Demokratie, Frauenrechte – blickt sie zunächst zurück und erklärt, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen, um dann nach vorne zu blicken. «Rebecca Solnits Prosa ist so schön wie Poesie, ihre Gedanken sind klug, forschend und voller Neugier und Staunen. Unmöglich, sich nicht auf ihre unkonventionellen philosophischen Streifzüge mitreißen zu lassen.» The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rebecca Solnit
Umwege
Essays für schwieriges Terrain
Über dieses Buch
Wie können wir eine bessere Zukunft schaffen? Wie wollen wir leben? Wie verlieren wir bei allem Realismus nicht die Hoffnung?
Eine dreihundert Jahre alte Geige, die uns viel über Wälder und Klima erzählen kann, ein Lob des Tanten-Seins, das die kinderlose Frau als Stütze der Gesellschaft preist, und scharfe Kritik an Milliardären, die unsere Demokratie gefährden: Rebecca Solnit erforscht in ihrem neuen Buch, wie wir durch unser Handeln Gegenwart und Zukunft gestalten können. Anhand der drängenden Fragen unserer Zeit – Klimawandel, Bedrohung der Demokratie, Frauenrechte – blickt sie zunächst zurück und erklärt, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen, um dann nach vorne zu blicken.
«Rebecca Solnits Prosa ist so schön wie Poesie, ihre Gedanken sind klug, forschend und voller Neugier und Staunen. Unmöglich, sich nicht auf ihre unkonventionellen philosophischen Streifzüge mitreißen zu lassen.» The Guardian
Vita
Rebecca Solnit, Jahrgang 1961, ist eine der bedeutendsten Essayistinnen und Aktivistinnen der USA. Sie ist Mitherausgeberin des Magazins Harper's und schreibt regelmäßig Essays für den Guardian. Für ihre Werke erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den renommierten Book Critics Circle Award. Ihr Essay Wenn Männer mir die Welt erklären, auf dem der Begriff «mansplaining» beruht, ging um die Welt. Auf Deutsch erschien von ihr zuletzt Orwells Rosen. Solnit gehört dem Vorstand der Klimagruppe Oil Change International an und hat kürzlich das Klimaprojekt Not Too Late ins Leben gerufen.
Michaela Grabinger lebt in München. Zu den von ihr übersetzten Romanen und Sachbüchern zählen Werke von Anne Tyler, Meg Wolitzer, Elif Shafak, Michael Crichton, David Graeber, Alain de Botton und Ece Temelkuran.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «No Straight Road Takes You There. Essays For Uneven Terrain» bei Haymarket Books, Chicago.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg «No Straigt Road Takes You There. Essays For Uneven Terrain» Copyright © 2025 by Rebecca Solnit
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Palma Imbicatus, Kollektion: Botanicus C.VII, Serie Nr. 878221 von Marianne Hendriks
ISBN 978-3-644-02376-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhalt
Lob des Indirekten, Unvorhersehbaren, nicht Messbaren, Langsamen und Unterschwelligen 7
I. VISIONEN
Ein Burgfrieden mit den Bäumen 19
Der Himmel voller Wälder 29
Über den Verzicht auf Gewissheit in einer Erzählung ohne Ende 38
Schildkröte auf der Eintagsfliegen-Party 51
Lob des Abschweifens 59
Aufrührerische Tanten 68
II. REVISIONEN
Verzweiflung ist Luxus 97
Warum wir Nazis nicht entgegenkommen sollten 112
Gegen den Zentrismus und seine Voreingenommenheiten 124
Im Schatten von Silicon Valley 133
Männlichkeit als radikaler Egoismus 152
Abtreibung ist eine Frage der Finanzen 160
Für eine Demokratie der Stimmen 168
Der Storykiller und sein Urteil 175
Der Feminismus steht erst am Anfang 183
III. NOCH MEHR VISIONEN
Tiefe Zeit kontra kurze Frist 195
Die Klimaerzählung ändern 203
Klima der Fülle 225
Der große Wandel 234
Hoffnung fern am Horizont 239
5. November 2024, 23 Uhr 246
Danksagung 248
Angaben zu den Erstveröffentlichungen 251
Literaturverzeichnis 252
Lob des Indirekten, Unvorhersehbaren, nicht Messbaren, Langsamen und Unterschwelligen
Wie man die Welt sieht, hängt von dem ab, was man in ihr tun kann. Unser Handeln ist von Vorstellung en geprägt – den Gerüsten, die uns die Welt verständlich machen. Jedenfalls denke ich das seit Langem und habe deshalb in meinen Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte nicht nur einfach meine Ansichten dargelegt, sondern auch versucht, ein Rüstzeug anzubieten für alle, die über Geschichte, Macht, gesellschaftlichen Wandel und das Mögliche nachdenken. Genau das ist mein Anliegen mit diesen Essays, und während ich sie zusammenstellte, wurde mir klar, wie sehr meine Überzeugung – oder mein Arsenal – auch eine große Feier des Umwegs ist.
Wobei ich gegen das Simple, Unmittelbare, Offensichtliche, das Geradlinige und Vorhersagbare überhaupt nichts habe. Aber ich denke, dass vieles, womit wir konfrontiert sind und das wir erreichen wollen, die Hinwendung zu seinem Gegenteil, zumindest aber die Anerkennung seines Gegenteils erfordert. Deshalb bin ich die langen Wege nachgegangen, die in Veränderung münden, den häufig vergessenen Ereignissen und Ideen, die zu einem Umbruch, einem Durchbruch oder einer Revolution geführt haben, sowie den oft übersehenen, erst später zutage tretenden mittelbaren Folgen davon. Ich finde es großartig, wenn Bewegungen, die ihr erklärtes Ziel nicht erreichen, immerhin etwas bewirken oder anstoßen können, das manchmal genauso wichtig oder sogar wichtiger als das ursprüngliche Vorhaben ist. Und mir ist aufgefallen, dass Bewegungen auf dem langen Weg zum Sieg oft den Vorwurf zu hören bekommen, sie seien gescheitert, der Sieg dann aber doch eintritt.
Was das Siegen betrifft, so kann ich den «Erfolg ohne Sieg», wie Jules Lobel vom Center for Constitutional Rights das Phänomen nennt, nur begrüßen: Klagen, die zwar vor Gericht gescheitert sind, aber als Teil größerer Menschenrechtskampagnen die jeweilige Sache voranbringen. Ich habe die Langsamkeit, die Geduld, die Beharrlichkeit und die langfristige Sicht schätzen gelernt, weil sie wichtige Werkzeuge sind, mit denen man die Welt verändern oder sogar verstehen kann. Und ich bin zu einer Erzählerin geworden, die Beispiele für die Wirkung dieser Werkzeuge aufspürt, weil wir die Erzählung ändern und Erzählungen niederreißen müssen, denen wir in die Falle gegangen sind, um dann solche zu suchen, die zu unserer jeweiligen Realität passen, wenn wir unsere eigenen Kräfte und Möglichkeiten entdecken wollen.
Außerdem finde ich Kompliziertes schön. Finde es schön, den mühsamen Wegen zu folgen, die man zurücklegen muss, bis etwas Wirkung zeigt. Das verschachtelte Gefüge von Zusammenhang und Ursache zu betrachten. Die Kraft beharrlicher Geduld und langfristiger Sicht zu erleben. Zu begreifen, dass Veränderung oft in der Peripherie und mit Bewegungen und klugen Köpfen beginnt, die zuvor als unbedeutend abgetan worden sind, auch wenn der Wandel im Fortschreiten häufig zur Mitte hinrückt und seine Reise im Scheinwerferlicht beendet, das die Zentren der Macht bestrahlt. Finde es schön zu wissen, wie sehr Kultur – die meinem Verständnis nach tief im Untergrund unserer kollektiven Weltanschauungen wirkt – die Oberfläche formt, auf der sich Politik abspielt. Finde es schön und freue mich, dass eine Handlung auch dann enorm wichtig sein kann, wenn wir im Moment des Handelns noch gar nicht wissen, in welcher Hinsicht und weshalb (und dass der Wert solchen Tuns vielleicht erst Jahrzehnte oder ganze Menschenalter später ermessen werden kann, weil manche Bücher, Handlungen oder Ideen Geschenke an eine Nachwelt sind, die sich die Schenkenden gar nicht vorstellen konnten). Finde es schön, die kleinen Ereignisse – Begegnungen, Zufälle, Epiphanien – wertzuschätzen, die oft tiefgreifende Folgen haben. Die Wörter kurzsichtig und unausweichlich sind gängige Begriffe; ich hätte gern das Wort langsichtig für die Fähigkeit zu sehen, wie im Lauf der Zeit Muster entstehen, und, sagen wir, das Wort ausweichbar als Gegenteil von unausweichlich.
Apropos Ausweichbarkeit: Ich schätze die Unvorhersehbarkeit als die Kehrseite der Möglichkeit – wenn man schon weiß, was passieren wird, ist nichts weiter beziehungsweise nichts anderes möglich, was oft zu Rückzug und Passivität führt. Doch in den meisten Fällen weiß man es eben nicht; die Ausrufung von Unausweichlichkeit ist meistens eine falsche Prophezeiung. Hoffnung ist in diesem Sinn schlicht die Erkenntnis, dass die Ungewissheit eventuell Raum dafür lässt, sich zu den besten Möglichkeiten hin- und von den schlechtesten wegzubewegen, dass die Zukunft, anders, als ihr oft angedichtet wird, eben kein bereits existierender Ort ist, zu dem wir uns hinschleppen, sondern einer, den wir mit unseren Handlungen – oder oder unserem Nichtstun – in der Gegenwart erst erschaffen. Genauer gesagt besteht Hoffnung aus dieser Erkenntnis sowie der Bereitschaft, auf die besseren Möglichkeiten innerhalb des Spielraums des Ungewissen, des noch nicht Geschaffenen hinzuarbeiten. Mit den Worten Audre Lordes: «Nicht an der Gestaltung der Zukunft teilzuhaben bedeutet, sie aufzugeben. Lasst euch nicht zu Passivität verleiten, weder von einem falschen Gefühl der Sicherheit (‹ich bin nicht betroffen›) noch von Resignation (‹wir können ja eh nichts machen›). Jede von uns muss für sich herausfinden, was zu tun ist.»
Das Unbehagen an der Ungewissheit manifestiert sich als Fatalismus, Pessimismus, Untergangserwartung, Verzweiflung – manchmal aber auch als Optimismus –, wenn es so tut, als wüssten wir genau, was geschehen wird. Es reduziert die Unermesslichkeit des Unbekannten auf das Bekannte, auf die falsche Gewissheit, die vorgibt zu wissen, um ignorieren zu können, dass sie nichts weiß. Das Wahrscheinliche trifft zwar oft ein, das Unwahrscheinliche aber immerhin noch so häufig, dass wir es nicht ausblenden dürfen. Was im Rückblick offensichtlich, vorhersehbar, unausweichlich erscheint, galt zuvor oft als unwahrscheinlich oder unmöglich. Die genaue Erinnerung daran hilft, auch beim nächsten Mal etwas angeblich Unmögliches anzupacken. Falsches (oder gar nicht erst stattfindendes) Erinnern dagegen bringt uns im Umgang mit der Zukunft nicht weiter.
Die Erinnerung ist vor allem dann eine Kraft, wenn sie die großen Muster, den sich langsam vollziehenden Wandel erkennt, während gezieltes Vergessen und Amnesie von Schwäche zeugen. Gespräche zwischen den Generationen, historische Kenntnisse und die gewohnheitsmäßige Suche nach Kontext tragen zu dieser Kraft bei. Howard Zinn, der große Historiker des Möglichen, sagte in diesem Zusammenhang Folgendes: «Wir neigen zu der Annahme, dass es so, wie es ist, bleiben wird. Wir vergessen, wie oft es schon vorkam, dass uns der plötzlich einsetzende Zerfall von Institutionen, ein verblüffendes Umdenken, unerwartet ausbrechende Aufstände gegen Tyranneien, der rapide Zusammenbruch vermeintlich unbezwingbarer Machtstrukturen überrascht haben. An der Geschichte der letzten hundert Jahre springt vor allem ihre absolute Unvorhersehbarkeit ins Auge.» Ich suche andere Sichtweisen, würdige die Wege, die von Ideen eingeschlagen werden, und hebe hervor, dass Hoffnung fast immer auf dem Erinnern gründet, weil man die Zukunft nicht sehen, aber Muster und Möglichkeiten verstehen kann, wenn man die Vergangenheit kennt.
Ich habe Veränderungen in der Gesellschaft, in Politik und Wissenschaft erlebt, die in meiner Jugend nicht nur als unwahrscheinlich gegolten hätten, sondern geradezu unvorstellbar gewesen wären, und weiß von vielen solcher Veränderungen, weil ich eine gewissenhafte Geschichtsschülerin bin. In der Welt, in der wir leben, geht es so turbulent zu, wie es sich kaum ein Science-Fiction-Roman erdenken konnte (zwar weniger Raketenrucksäcke, dafür mehr geschlechtliche Vielfalt, weniger Raumfahrt, dafür mehr Raum für andere Möglichkeiten des Menschseins, für andere Fragen danach, wer und was wichtig ist). Ich teile mittlerweile Howard Zinns Sichtweise, wonach die Zukunft zwar ungewiss ist, die Vergangenheit aber erkennen lässt, dass ganz normale Leute weltverändernde Kampagnen gestartet haben, von denen viele unvorhersehbar gewesen waren. Die zunächst unscheinbar wirkenden Bewegungen, die 1989 die autoritären Regime in Osteuropa stürzten, überraschten sogar die Beteiligten selbst. Niemand sah im vergangenen Jahrtausend voraus, dass indigene Völker auf dem amerikanischen Kontinent Einfluss und Sichtbarkeit zurückgewinnen, ihre Rechte und die Geltung ihrer Weltbilder weitgehend anerkannt würden. Dass wir von Bewegungen früherer Jahrzehnte profitieren und sich diese Bewegungen entsprechend ihren zunehmenden Einsichten verändert haben, zeigt, dass der Prozess andauert und wir ohnehin immer mitten in der Sache stecken.
Das Unbehagen an zeitweiliger Ungewissheit, das sich als falsche Gewissheit in Bezug auf die Zukunft äußert, hat, wie mir inzwischen klar ist, sein Pendant im Unbehagen an Ambiguität, Komplexität, Widersprüchlichkeit und Undurchsichtigkeit, das als Drang zutage tritt, die Realität in luftdichte Kategorien zu stopfen. Kategorien lassen sich nicht vermeiden – die Sprache selbst besteht daraus –, doch man sollte zugestehen, dass sie durchlässig und begrenzt sind. Manchmal verdeutlicht man das Wesen einer Sache, indem man ihr ein Etikett anheftet oder sie mit etwas anderem vergleicht. Allerdings kann es dadurch auch undeutlicher werden, weil die Unterschiede ebenfalls wichtig sind und durch die Etikettierung oder den Vergleich verloren gehen oder weil der Wesenskern in sich uneinheitlich oder nicht klar zu erkennen ist.
Wo Kategorien im Spiel sind, wird oft nicht weitergedacht. Wir tendieren dahin, so zu tun, als wäre ein einmal kategorisierter Sachverhalt keinen Gedanken mehr wert. Ist er in den meisten Fällen aber eben doch. Auf kaum eine Wendung greife ich öfter zurück als auf die folgende von Chip Ward, der in Utah über ökologische Themen schreibt: Sein Ausdruck «Tyrannei des Quantifizierbaren» enthält die Erkenntnis, dass der Einfluss und Wert eines Menschen, eines Kunstwerks, einer Handlung, einer Bewegung, eines Orts oder Systems oft nicht in Kategorien passt, sich nur schwer und vielleicht überhaupt nicht messen lässt und dennoch bedeutsam ist.
Wir müssen ständig mit komplexen Gegebenheiten umgehen, mit Widersprüchen, Ambiguitäten, mit schlechten Menschen, die Gutes tun, und guten, die Schreckliches tun, und mehr noch damit, einfach nicht zu wissen. Wir kennen einen Menschen kaum je durch und durch, wissen nur selten, woher er kommt, wie es ihm gerade geht und was er von sich erkennen lässt, wie sehr er sich verändert hat und seine Meinung von vor ein paar Jahren inzwischen gar nicht mehr seine Meinung ist, und ob er möglicherweise falsch dargestellt wurde. (Wir sind uns ja oft selbst ein Rätsel.) Ich räume einer nicht hundertprozentig gewissen Sache gern einen Vertrauensvorschuss ein, wende die Unschuldsvermutung – im Zweifel für den Angeklagten – darauf an. Die sozialen Medien haben schon aus viel zu vielen Leuten Möchtegernexperten und falsche Propheten gemacht, weil sie zu summarischen Urteilen und zu Meinungsäußerungen ermuntern, die nicht auf Fakten und Expertise basieren. Ohne Meinung fühlen sich die Menschen in diesem Umfeld offenbar nackt und kostümieren sich mit allem, was verfügbar ist, insbesondere mit dem, was vermeintlich alle anderen tragen. Zu wissen, dass man etwas nicht weiß, ist eine wichtige Art von Wissen und sogar von Weisheit, die nie durch Wissensillusion ersetzt werden sollte – was aber häufig geschieht.
In diesem Buch, diesen Essays, in denen ich mich sowohl pro (vor allem im Abschnitt «Visionen») als auch kontra (im Abschnitt «Revisionen») äußere, zeige ich die Umwege auf, die der Zufall einschlägt, die Nebenstraßen und abgelegenen Pfade, auf denen Bewegungen entstehen und Ideen vorrücken, wenn es geradeaus nicht weitergeht – aber, um aus Antonio Machados berühmtem Gedicht zu zitieren: «Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht im Gehen.» Die meisten Ziele sind nur auf verschlungenen Wegen erreichbar. Die Route führt über Berge, durch Wälder und aus dem uns Bekannten hinaus. Doch sie verläuft nicht nur durch Gefahren, sondern auch durch unfassbar Schönes und ungeahnten Wandel hindurch. Auch wenn sie auf keiner Karte verzeichnet oder sehr steil ist, auch wenn es Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauert, sie zu bewältigen, werden wir unser Ziel erreichen, indem wir erzählen, Allianzen schließen oder unerwartete Verbündete bekommen. Dieses Buch kündet vom Schwierigen und Ungewissen, aber auch von dem, was möglich ist. Es ist ein Aufruf zum Weitermachen.
Anmerkung: Die folgenden Essays wurden in den letzten Jahren meist als Reaktion auf bestimmte Umstände verfasst – die Anfangszeit der Pandemie, die strafrechtliche Verurteilung eines Vergewaltigers, die Folgen der Wahl von 2020. Ich habe Texte ausgewählt, die meiner Meinung nach über den jeweils aktuellen Zeitpunkt hinaus aufschlussreich sind, und weise wo nötig auf die Besonderheiten der jeweiligen Situation hin.
I.Visionen
Ein Burgfrieden mit den Bäumen
David Harrington, Gründer und künstlerischer Leiter des Kronos Quartet aus San Francisco, spielt seit fünfzig Jahren auf einer 1721 gebauten Geige «ziemlich sportliche Musik», wie er es nennt. Ich habe ihn auf diesem Instrument ganz Unterschiedliches spielen hören, von der aufpeitschenden Melodie des Stücks Orange Blossom Special über die minimalistischen Kompositionen von Terry Riley bis hin zu einem Werk von Bach dann und wann. Die Geige wurde in Mailand von Carlo Giuseppe Testore hergestellt. Sie hat drei Jahrhunderte überlebt, unzähligen Zuhörern musikalischen Genuss geschenkt und ist auf mehr als sechzig Kronos-Alben zu hören.
Als ich das Alter des Instruments erfuhr, war ich erstaunt, dass ein so fragiles Stück Handwerkskunst Jahrhunderte überdauern kann, dass etwas so Zierliches, Leichtes so viel vollbringt, dass ein Instrument aus dem 18. Jahrhundert noch im 21. Jahrhundert so viel zu sagen hat. Die Geige erschien mir wie eine Botin aus der Vergangenheit, wie ein Sinnbild des Möglichen, wie Relikt und Verheißung zugleich.
Sie stammt aus der Zeit bevor. Bevor James Watt die Dampfmaschine erfand und sie zu einem gefräßigen, weltweit verbreiteten Apparat wurde, der zunächst Kohle und Holz, später Öl verschlang und Mühlen, Webstühle, Pumpen, schließlich auch Lokomotiven und Dampfschiffmotoren antrieb. Bevor wir die Erde auspressten wie wild, um die Dampfmaschinen und dann die Verbrennungsmotoren zu füttern. Bevor wir den Kohlenstoff, den die Pflanzen früherer Zeitalter so schön tief in der Erde gespeichert hatten, in riesigen Mengen ausgruben. Bevor sich die Einwirkungen des Menschen innerhalb kürzester Zeit in eine destruktive Kraft verwandelten, die den Säuregehalt der Meere und die Zusammensetzung der Atmosphäre zu verändern vermochte.
Ein Instrument, das solche Zeitspannen überdauert, zeigt mir, dass es großartige kulturelle Errungenschaften auch auf der Basis materieller Genügsamkeit geben kann, dass die Welt vor der Förderung und Verfeuerung fossiler Brennstoffe durchaus Eleganz hervorgebracht hat und auch die Welt, wie wir sie in Reaktion auf den Klimawandel gestalten müssen, nicht zwangsläufig entbehrungsreich sein wird, sondern von Fülle geprägt sein kann.
Allerdings sind fossile Brennstoffe giftig – nicht nur im buchstäblichen, auch im politischen Sinn. Jetzt auf sie zu verzichten, da die Erneuerbaren als Energiequellen besser – im Sinne von sauberer, günstiger, leichter zugänglich – geworden sind, heißt etwas aufgeben, das die Welt kontaminiert und unser Vertrauen in die Zukunft geschwächt hat. Fülle ist für uns meist etwas Materielles, doch vielleicht überschattet unser berghoch angehäuftes Raubgut so manches weniger greifbare Ding, das ebenso zählt – Phänomene wie historische Kontinuität, Vertrauen in die Zukunft und kultureller Reichtum, der mehr ist als eine Ware.
Man sieht Harringtons Geige an, dass mit ihr gearbeitet wird: Sie ist ein bisschen ramponiert, der Lack abgenutzt, das Holz von vielen winzigen Rissen und einem deutlich sichtbaren Sprung durchzogen. Die Materialien, aus denen sie besteht, bilden eine Art globale Zusammenkunft. Die ursprünglichen sind ausnahmslos organisch, stammen nicht aus dem Bergbau, auch wenn für die Herstellung des Instruments Werkzeuge aus Metall benötigt wurden. Der obere Teil einer Geige, die Decke, besteht in der Regel aus Fichtenholz, der Boden und die Zargen – die Seitenteile – sowie der Hals sind meist aus Ahorn gefertigt. Griffbrett und Saitenhalter wurden traditionellerweise aus südasiatischem oder afrikanischem Ebenholz hergestellt. Inzwischen verwendet man dafür meist anderes Holz, da Ebenhölzer vom Aussterben bedroht sind (nur in China werden sie nach wie vor in erheblichen Mengen eingesetzt).
Der Leim, der die Geige zusammenhält, dürfte aus ausgekochten Tierhäuten bestehen. Der Lack enthält entweder Schellack, gewonnen aus einem Sekret der südasiatischen Lackschildlaus, oder nur Kiefernharz und ein Pflanzenöl, üblicherweise Leinöl. Die Saiten machte man früher aus Schafsdarm (nicht aus Catgut oder «Katzendarm», so verbreitet der Begriff auch ist), heutzutage dagegen eher aus Metall und synthetischen Materialien. Kolophonium, das aus Baumharz hergestellt und auf das Rosshaar des Bogens aufgetragen wird, sorgt dafür, dass der Bogen auf den Saiten Töne hervorbringt – ohne Geigenharz wäre das Instrument stumm, sagt Harrington. Als ich in meiner Kindheit – alles andere als aussichtsreich – Geige spielte, war der kleine durchsichtige bernsteinfarbene Klumpen Harz für mich so ziemlich das Interessanteste am ganzen Instrument.
Man bespannt Geigenbögen bis heute meist mit Pferdehaaren. Weil die Stuten auf ihren Schweif urinieren, werden idealerweise die weißen Haare aus dem Schweif eines Hengstes beziehungsweise Wallachs aus Sibirien, Kanada, Argentinien oder der Mongolei verwendet. Vor einigen Jahren, berichtet Harrington, habe ihm ein Bogenmacher gesagt, dass es wegen der Klimakrise inzwischen schwieriger geworden sei, kräftiges Rosshaar zu bekommen, das sich in kalten Klimazonen bildet. Geigenbögen stellte man jahrhundertelang vorzugsweise aus dem Pernambukholz der atlantischen Küstenwälder Brasiliens her, und zwar hauptsächlich aus dem Kernholz, den eng aneinanderliegenden Ringen aus orangebraunem Holz in der Mitte des Stamms. Auch diese Bäume sind gefährdet und werden inzwischen meist nicht mehr verwendet. Bogenmacher*innen und Geigenbauer*innen haben sich mittlerweile mit Leuten aus dem Naturschutz zusammengetan und die International Pernambuco Conservation Initiative gegründet. Ziel des Vereins sind die Bewahrung und Regeneration dieser Baumart und der Wälder, in denen sie vorkommt.
Ein Geigenbogen vereint also die Arktis und die Tropen in sich, und wenn noch Elfenbein, Meeresschnecke oder Perlmutt darin verbaut sind, beinhaltet er auch Materialien aus dem Meer. Eine Geige aus Ebenholz und Elfenbein mit einem Bogen aus Pernambukholz ist ein Relikt aus der Zeit des Kolonialismus, in der sich Europa an Materialien aus anderen Kontinenten bereicherte, und zugleich ein Artefakt aus vollständig erneuerbaren Rohstoffen.
Vor allem aber besteht eine Geige aus Bäumen. Auch auf die Fichten und Ahorne, aus deren Holz man Geigen baut, wirkt sich der Klimawandel aus. Auf dem Deckel von Davids Violine sind die Jahresringe der Fichte in ziemlich gleichmäßiger Abfolge zu sehen; doch wechselhaftes Wetter hat unregelmäßige Ringe zur Konsequenz, und in den Dolomiten, wo die Fichten wachsen, aus denen man italienische Geigen baut, verändert sich das Klima. In diesem Gebirge gibt es einen berühmten Wald, der «Wald der Geigen» genannt wird, weil schon so viele Geigen aus dem Holz seiner Bäume entstanden. Mit fortschreitendem Klimawandel könnte er seine Funktion als ideale Quelle von Instrumentenholz allerdings verlieren. Außerdem dürften gleichmäßige Maserungen aufgrund des weltweit zunehmend erratischen Wetters seltener werden.
Man muss auch das Holz, das Stradivari, der legendäre Geigenbauer des 17. und 18. Jahrhunderts, und seine Kollegen verwendet haben, im Zusammenhang mit dem Klima sehen, sagt die Geigenbauerin und -lehrerin Nancy Benning:
Über Jahrzehnte anhaltende niedrigere Temperaturen in Italien, Deutschland und der Schweiz haben das Wachstum der Fichten verlangsamt. Insbesondere dem für Geigen aus Cremona verwendeten Holz werden eine außergewöhnliche tonale Ausdruckskraft und Klangprojektion zugeschrieben, die auf die Dichte (d.h. die Gedrängtheit der Jahresringe) der in der Kälte gewachsenen Fichten zurückgehen. Die seltenen, hochgeschätzten Instrumente aus dieser Geigenbautradition unterscheiden sich von anderen durch ihre Schwingungskraft und die ausgeprägte Fähigkeit ihres Holzes, Schall zu erzeugen.
Einem Bericht in Nature Climate Change zufolge wachsen Rotfichten in Mitteleuropa inzwischen um ein Drittel bis drei Viertel schneller als früher. Vielleicht wird man eines Tages aus Bäumen, deren Stimmen sich mit dem Klima verändert haben, Anthropozän-Instrumente mit ganz eigenem Klang herstellen. Mein Freund Hans Jóhannsson, Geigenbauer in Reykjavík, kommt zwar aus der großen Tradition, blickt aber eher interessiert als ängstlich in die Zukunft. «Ich fürchte keine Veränderungen und glaube nicht, dass der Zauber verfliegen wird», sagte er mir vor ein paar Jahren. Er macht seinen Hautleim selbst und lackiert und baut die Instrumente kaum anders als einst Stradivari und Testore mithilfe von Handwerkzeug. Seine Instrumente werden in Orchestern und Streichquartetten überall auf der Welt gespielt. Er hat aber auch experimentelle Musikinstrumente gebaut und neue Materialien ausprobiert.
Obwohl Computer hilfreich sein können, vertraut man im Geigenbau noch immer auf Ohr und Hand. «Die Massenproduktion von Violinen ist unter anderem deshalb so schwierig, weil das Holz nie die gleichen Eigenschaften hat – nicht einmal Stücke von Fichte und Ahorn aus ein und demselben Baum», sagt Hans. «Wenn man die Holzstücke hält und mit der Faust darauf schlägt, vibrieren die einen laut und bringen einen lang anhaltenden, satten Ton hervor, während sich die anderen dumpf anhören und ihr Ton rasch verklingt.» Durchaus möglich, dass die von ihm gebauten Celli und Violinen so lange gespielt werden, wie Harringtons Testore – vielleicht musiziert im Jahr 2322 jemand auf einer Jóhannsson-Geige.
Wie alle Pflanzen, alle Wälder haben auch die Bäume, aus denen die Testore entstand, der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen und es in ihrem Holz und in der Erde gebunden. Die fossilen Energieträger, die wir heute verbrennen, sind ein Endprodukt des Kohlenstoffs, der vor Jahrmillionen von Pflanzen gespeichert wurde. Die Geige ist eine winzig kleine Kohlenstoffsenke, eine Lagerstätte für Kohlenstoff, der nicht in die Luft zurückgekehrt ist, sondern im Holz verbleibt und erklingt.
Mir erscheint das fanatische Verfeuern fossiler Brennstoffe oft wie ein Krieg, den wir gegen die Bäume führen, indem wir den Kohlenstoff zurückbefördern, den sie der Atmosphäre entzogen haben und bis heute entziehen – die Wälder der Erde speichern etwa ein Viertel des von Menschen jährlich in die Atmosphäre abgegebenen Kohlenstoffs. Auch die Instrumente der drei anderen Mitglieder des Kronos Quartet[1] stammen aus ferner Zeit. John Sherbas Geige wurde 1884 in New York gebaut, als der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre noch 293 ppm betrug, nur 16 ppm mehr als 1721. Sie entstand, ein Jahr bevor Carl Benz das erste mit Leichtbenzin angetriebene Automobil baute. Das Cello von Sunny Yang wurde 1903 in Italien hergestellt, als sich der Messwert auf 296,8 ppm belief. In jenem Jahr wurde das erste Ford-Modell A verkauft, und die Brüder Wright flogen zum ersten Mal mit einem motorisierten Luftfahrzeug, das schwerer als Luft war. Hank Dutts Bratsche stammt von 1913 – drei Jahre nachdem die Schwelle von 300 ppm überschritten war und das Jahr, in dem mit Fords Modell T ein Automobil erstmals voll und ganz in Massenproduktion hergestellt wurde.
Alle diese Instrumente kommen aus einer Welt, in der Kunststofferzeugnisse auf Erdölbasis erst allmählich Verbreitung fanden, in der die großen tropischen Wälder weitgehend intakt waren und sich der Jahreszyklus noch nicht verschoben hatte, zugleich aber aus einer Welt, in der Afrika größtenteils von europäischen Mächten beherrscht war und viele Menschenrechte noch kaum gedacht, geschweige denn irgendwo auf der Erde verwirklicht waren. Die Vergangenheit erzählt viele Geschichten und doch immer nur eine: dass sich alles verändert, sei es zum Besseren oder zum Schlechteren.
Vor Kurzem besuchte ich das jährliche Konzert des Symphonieorchesters San Francisco mit dem Oakland Interfaith Gospel Choir. Die Musiker*innen saßen in einem Halbkreis, an dessen einem Ende die Geigen und Bratschen, am anderen die Celli und Kontrabässe platziert waren, und nach der langen Beschäftigung mit David Harringtons Violine sah ich förmlich einen Wald aus Holzinstrumenten vor mir. Die Mitglieder des Gospelchors standen oberhalb des Orchesters, und als ich einmal Dutzende Bögen im Halbdunkel gleichzeitig über die Saiten streichen und fünfzig Münder im Gesang geöffnet sah, hatte ich plötzlich das Gefühl, als hätten die Bäume und unsere Spezies einen Burgfrieden miteinander geschlossen.
Vielleicht ist das die Verheißung, die ich in Davids Geige zu erkennen glaubte, als ich erfuhr, wie lang sie schon gespielt wird. Er brachte sie auf meine Bitte hin zu mir nach Hause und hob sie aus dem Kasten. Ich hatte so viel Respekt vor ihr, dass ich ein sauberes Tuch darunter ausbreiten wollte, doch David legte sie ohne großes Tamtam auf den Tisch, und ich durfte sie in die Hand nehmen. Sie kam mir wie ein Vögelchen vor: federleicht, unglaublich stark und sehr, sehr zart. Und dann erlebte ich einen weiteren Auftritt des Kronos Quartet und sah und hörte sie in Davids Händen Musik hervorbringen wie seit dreihundert Jahren – so kraftvoll, als könnte sie bis in alle Ewigkeit weiterklingen.
Der Himmel voller Wälder
Ein Foto von zwei Menschen am Strand, alle und niemand. Sie schauen aufs Meer in einer Zeit, in der man sich automatisch fragt, welches Problem sie im Blick haben könnten. Denn Probleme lauern in diesen Tagen heftiger Klimastörungen überall. Betrachten die beiden einen unheildrohenden Himmel bei ungewöhnlichem Wetter, einen ansteigenden Meeresspiegel, den Niedergang der Fischereiwirtschaft, oder halten sie Ausschau nach einem Schiff, das gleich am Horizont erscheinen wird? Suchen sie an der Küste Schutz vor Feuer im Landesinneren wie die Leute ganz in meiner Nähe während der Brände 2017 in Sonoma County, Kalifornien, oder suchen sie vor einer Hitzewelle Zuflucht am Meer, das in den vergangenen Jahrzehnten so viel überschüssige Wärme absorbiert hat und in heißen Gebieten trotzdem immer noch kühlend wirkt? Sehen sie sich die Natur an – die Gesamtheit der Erdsysteme, zu denen auch der Mensch immer gehört hat –, um sich zu beruhigen oder aus Sorge, Unbehagen und Angst? Bestärkt sie der Anblick, oder vergrößert er ihre Ungewissheit? Was sehen sie?
Was ist Zuflucht, wo droht Gefahr? Diese Fragen kann heute jede und jeder an jedem Ort der Erde stellen, überall.
Ich denke an einen Sonntagmorgen im Sommer, den ich vor nicht allzu langer Zeit erlebt habe.
Der Himmel war voller Wälder.
Voller ferner Wälder. Das Feuer brachte den Kohlenstoff, den sie der Luft entzogen hatten, zurück. Die Luft war voller Asche und anderer Partikel, der Rauch der Flächenbrände bildete einen erschreckend vertrauten Filter, die Sonne war rot, der Mond orange, der Himmel grau, das Atmen gefährlich, das Licht falsch – goldgelb, aber so fahl, als käme es nicht von unserer guten alten Sonne, sondern von einem anderen Stern. Ich war tausendfünfhundert Kilometer von zu Hause entfernt, doch mein Zuhause war mir in Gestalt der in den Bergen Kaliforniens brennenden Geisterwälder gefolgt. Ich hatte auf Umwegen zurückfahren und unterwegs Freunde besuchen wollen, musste aber die andere, rauchfreie Route einschlagen, weil ich mich nicht überwinden konnte, tiefer in den beißenden Qualm hineinzufahren. Ich hatte in den Brandjahren 2017, 2018, 2019 und 2020 schon zu viele Wochen in diesem Rauch verbracht.
Viele Jahre zuvor hatte mir der Zen-Priester Enkyo Pat O’Hara aus Lower Manhattan von den Tagen nach 9/11 erzählt, als der Schutt des einstigen World Trade Center noch glühte. «Es war, als würde man Menschen einatmen. Es roch nach Schießpulver oder wie nach einer Explosion. Es roch nach allen möglichen vollständig zersetzten Dingen, auch nach Menschen. Nach Menschen, elektrischen Geräten, Stein, Glas, einfach nach allem.»
Jetzt atmeten wir Wälder ein.
Es war das fünfte Jahr der großen Brände in Kalifornien, der Brände, die mehrere Zehntausend Quadratkilometer Wald, Städte und Dörfer, Vögel und Säugetiere, Menschen, Wild- und Haustiere und Häuser von Leuten vernichtet hatten, die ich kannte. Brände, die alle Rekorde gebrochen, ihr eigenes Wetter hervorgebracht und Rauchwolken produziert hatten, die man noch über der Prärie von Kansas und den Großen Seen fotografieren konnte, Rauch, der bis nach New York City gelangt war und besagte, dass alles zusammenhängt, alles ein Albtraum, alles ein Traum ist.