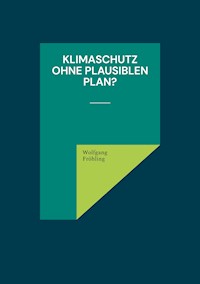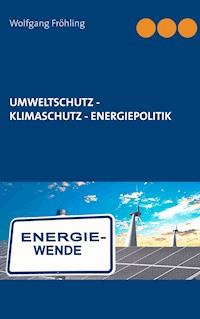
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wer sich über die großen Zukunftsthemen Umweltschutz - insbesondere Naturschutz - sowie über Naturschutz- und Energiepolitik (Stichwort Energiewende) informieren will, ist bei diesem Buch an der richtigen Adresse. Bei den drei genannten Themen kommen jeweils die globalen, europäischen und nationalen Bezüge zur Sprache. Der Autor - Dozent für Umweltrecht und Umweltpolitik - informiert hierzu aktuell, praxisnah, verständlich, auch kritisch und auf das Wesentliche konzentriert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Vorwort
Allgemeiner Teil
Grundsatz der Nachhaltigkeit
Rahmenbedingungen für den Umweltschutz
Bevölkerungsentwicklung
Umweltschutz und Finanzen
Rechtsquellen des Umweltrechtes
Umweltvölkerrecht
Umwelteuroparecht
Umweltverfassungsrecht
Umweltprivatrecht
Umweltstrafrecht
Umweltverwaltungsrecht
Besonderer Teil
Natur- und Artenschutz
Einführung
Internationale Abkommen
Europäische Ebene
Naturschutz auf nationaler/ kommunaler Ebene
Lebensraum Acker und Grünland
Lebensraum Wald
Lebensraum Gewässer
Erfolge beim Artenschutz
Rechtliche Grundlagen
Ausweisung von Schutzgebieten
Eingriffe in Natur und Landschaft
Energieversorgung und Klimaschutz
Derzeitige Energieversorgung
Anforderungen an eine nachhaltige Energieversorgung
Versorgungssicherheit
eachtung des Klimaschutzes
Bezahlbare Energieversorgung
Ausbau der erneuerbaren Energien
Einzelne erneuerbare Energieträger
Wasserkraft
Fotovoltaik
Windenergie
Biomasse
Solarthermie, Geothermie, Umweltwärme
Ausbau der Stromnetze
Speicherung von Strom
Energiesparen/ Energieeffizienz
Verkehr
Klimaschutz
Naturwissenschaftliche Grundlagen
Klimaschutz auf internationaler Ebene
Klimaschutz auf europäischer Ebene
Klimaschutz auf nationaler Ebene
Über den Autor
Vorwort
Das vorliegende Buch vermittelt dem Leser anhand vieler Schaubilder und einer Fülle von Fakten ein fundiertes Grundwissen zum Umweltschutz. Es beginnt mit dem Allgemeinen Teil: dem Grundsatz der Nachhaltigkeit, dem Völkerrecht und dem immer wichtiger werdenden Europarecht. Auf nationaler Ebene werden das Umweltstrafrecht und weitere wichtige Rechtsquellen erläutert. Alle Informationen sind auch für den Laien gut verständlich.
Es folgt der Besondere Teil - hier zunächst der Naturschutz als Kernanliegen des Umweltschutzes. Der Autor legt den Fokus auf den bedenklichen Rückgang der Arten. Mit zahlreichen Schaubildern und Grafiken geht das Buch der Frage nach, welche Möglichkeiten bestehen, die Vielfalt der Arten zu erhalten.
Der Besondere Teil geht dann ausführlich auf den Schutz des Klimas ein. Es geht beim Klimaschutz, soweit CO2 betroffen ist, um die Umstellung der globalen Energieversorgung von den heute dominierenden fossilen Energien auf erneuerbare Energiequellen. Die Darstellung der erneuerbaren Energien nimmt daher breiten Raum ein. Das Welt-Klimaabkommen von Paris bildet seit 2016 den Rahmen für den globalen Klimaschutz. Das Abkommen wird ausführlich erläutert. Auf europäischer Ebene hält die EU auch nach 2020 am Emissionshandel als maßgebendem Instrument fest. Der Autor kritisiert diesen u.a. viel zu komplizierten Ansatz. Für Deutschland gilt das ambitionierte Ziel einer 55-prozentigen Treibhausgas-Minderung bis 2030 (gegenüber 1990). Das Buch untersucht, welche Möglichkeiten in den Sektoren Energiewirtschaft, Verkehr und Haushalte bestehen, das ehrgeizige Klimaziel zu erreichen. Deutschland trägt mit nur 1,75 Prozent zur Erderwärmung bei (Quelle: BMUB). Von daher besteht sein maßgebender Beitrag zum globalen Klimaschutz nicht in der formalen Erfüllung von Minderungszielen, sondern in der Entwicklung klimafreundlicher Technologien - z.B. der dringend notwendigen Speichertechnologie für Wind- und Solarstrom. Das vorliegende Buch vertieft auch diesen Aspekt.
Dr. Wolfgang Fröhling
Koblenz, im Januar 2018
I. Allgemeiner Teil
1. Grundsatz der Nachhaltigkeit
Ziel des Umweltschutzes, des Umweltrechtes und jeglicher Umweltverwaltung ist es, den Grundsatz der Nachhaltigkeit zur Geltung zu bringen.
Der Gedanke einer nachhaltigen Entwicklung hat seinen Ausgangspunkt in der Forstwirtschaft. Im 18. Jahrhundert litt der deutsche Wald unter einer starken Übernutzung. Die Steinkohle als Energieträger war noch nicht entdeckt. Holz war der einzige Energieträger. Hans Carl von Carlowitz, Oberberghauptmann des Erzgebirges, legte 1713 erstmals ein geschlossenes Werk über die Forstwirtschaft vor, in dem er festlegte, dass pro Jahr nur soviel Holz geschlagen werden durfte, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Damit war die Grundlage für den Gedanken der Nachhaltigkeit gelegt.
Selbstverständlich ist das Problem der Übernutzung der Ressourcen nicht auf den Wald beschränkt. Dementsprechend bedeutet nachhaltige Entwicklung aus heutiger Sicht, alle natürlichen Ressourcen in einer Weise zu nutzen, dass sie auch den künftigen Generationen in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Dieser Gedanke kommt auch in Art. 20 a GG zum Ausdruck: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung.“
In der heutigen Diskussion wird gefordert, die Nachhaltigkeit nicht auf den Schutz der Ressourcen zu beschränken. Denn in der politischen Realität lassen sich Umweltbelange nur mit Erfolg durchsetzen, wenn ökonomische und soziale Schieflagen vermieden werden. Der Zusammenhang von Umweltschutz und sozialer Frage kommt auch in Art. 4 Abs. 1 S. 2 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) zum Ausdruck. Dort heißt es:
„ Sie (die EU) wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin.“
In ähnlicher Weise äußerte sich auch das Institut der deutschen Wirtschaft (Köln), indem es ein Drei-Säulen-Modell vorlegte. Danach ist nachhaltige Entwicklung ein fortwährender Prozess, der drei Dimensionen integrativ berücksichtigt:
Ökologie: Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und sparsamer Umgang mit den Ressourcen der Erde;
Ökonomie: Erhaltung und Zunahme des Wohlstandes durch wirtschaftliches Wachstum;
Soziales: Schaffung gesellschaftlicher und sozialer Werte und Systeme (nachhaltige Sozialsysteme).
Erbguth (Umweltrecht, § 3) unterscheidet i.S. der obigen Ausführungen zwischen dem eindimensionalen Grundsatz der Nachhaltigkeit, der sich auf den Schutz der Ressourcen beschränkt, und dem mehrdimensionalen Grundsatz der Nachhaltigkeit. Letzterer beinhaltet die gleichzeitige und berechtigte (Mit-)Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Belange bei staatlichen und gesellschaftlichen Entscheidungen.
Es ist sinnvoll, dem Grundsatz der Nachhaltigkeit eine soziale Dimension zuzusprechen. Denn wie der frühere Umweltminister Töpfer formulierte, ist existenzbedrohende Armut das gefährlichste Umweltgift.
Als Wirtschaftsordnung, die einer nachhaltigen Entwicklung dienen soll, hat sich in Deutschland die soziale Marktwirtschaft bewährt. Die Marktwirtschaft basiert auf dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Der Wettbewerb vieler Anbieter kommt dem Verbraucher zugute. Den Gegensatz zur Marktwirtschaft bildet die Planwirtschaft. Bei dieser Wirtschaftsform versucht der Staat, das gesamte Wirtschaftsleben zu lenken. Die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten sind auch deshalb gescheitert, weil sich die Planwirtschaft als unterlegenes Konzept herausstellte. Es fehlte an der nötigen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Fehlplanungen waren an der Tagesordnung.
Allerdings hat die Marktwirtschaft den Nachteil, dass die sozial Schwachen an den Rand gedrängt werden. Aus diesem Grund haben sich nach dem 2. Weltkrieg Wirtschaftsminister Erhard, sein Staatssekretär Müller-Armack u.a. mit Erfolg für eine soziale Komponente in der Marktwirtschaft eingesetzt: soziale Sicherungssysteme (bereits unter Bismarck eingeführt), freie Gewerkschaften, betriebliche Mitbestimmung und vieles andere mehr dienen heute dem Sozialstaat.
Auch der Umweltschutz kommt in dem System von Angebot und Nachfrage nicht wirklich zur Geltung. Produzenten und Abnehmer von Waren und Dienstleistungen haben kein direktes Eigeninteresse an ökologischen Standards. Aus diesem Grund ist es auch hier Aufgabe des Staates, Umweltstandards verbindlich festzulegen. Sinnvoll und notwendig ist somit eine soziale ökologische Marktwirtschaft.
Die neuere Entwicklung wird von dem Phänomen der Globalisierung beherrscht. Sie erfasst alle Bereiche: globale Absatzmärkte, globalen Arbeitsmarkt, eine global operierende Finanzindustrie, globalen Informationsaustausch usw. Zutreffend hat die deutsche Bischofskonferenz bereits 2006 in der Schrift „Welthandel im Dienste der Armen“ von einem „mörderischen Konkurrenzkampf“ als Folge der Globalisierung gewarnt. Aus Sicht des Umweltschutzes besteht die Gefahr, dass sich Firmen Wettbewerbsvorteile durch niedrige oder fehlende Umweltstandards verschaffen.
Die Auswirkungen der Globalisierung sind für die einzelnen Staaten sehr unterschiedlich: Deutschland etwa ist ein ausgesprochener Globalisierungs-Gewinner. Durch den weltweiten Verkauf hochwertiger Produkte verdient Deutschland viel Geld und kann sich hohe Umweltstandards – z.B. eine kostspielige Energiewende – leisten. Auch China als weltweit größte Handelsnation ist durch die Globalisierung zu Wohlstand gelangt und hätte die Möglichkeit, höhere Umweltstandards durchzusetzen. Bei der Luftqualität geschieht dies offensichtlich bisher nicht. Allerdings nehmen viele Staaten an dem Wohlstand, den die Globalisierung bringen soll, nicht teil. Dies gilt vor Allem dann, wenn die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet wird und deshalb kein staatlich gelenkter Umweltschutz stattfindet.
Generell führt die mit der Globalisierung verbundene Entgrenzung vieler Politikbereiche zu einem Bedeutungsverlust der Nationalstaaten. Sinnvoll wäre es, dem durch eine globale soziale ökologische Marktwirtschaft zu begegnen. Hierzu fehlen jedoch die notwendigen politischen und organisatorischen Ansätze.
Um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, ist eine kaum überschaubare Vielzahl von Maßnahmen notwendig. Die wichtigsten Themen sind jedoch:
der
Klimawandel
(Näheres hierzu unter II 2)
der Erhalt der
Artenvielfalt
(s. II 1)
der schonende Umgang mit landwirtschaftlich nutzbaren
Böden
; nach einer Studie der Universität Bonn (2016) verschlechtern sich die Böden auf etwa 30 Prozent der globalen Landfläche deutlich. Hauptgrund hierfür ist eine nicht nachhaltige Landnutzung – z.B. werden wertvolle Böden schutzlos der Bodenerosion durch Starkregen ausgesetzt.
Und nicht zuletzt der sachgerechte Umgang mit den
Süßwasserreserven
.
Nach Schätzung der OECD werden im Jahr 2025 rund 1,8 Milliarden Menschen in Regionen mit empfindlicher Wasserknappheit leben. Der Staat Israel liefert jedoch den Beweis dafür, dass das Problem des Süßwassermangels lösbar ist.
Wassermanagement in Israel
Israel litt seit Jahrzehnten unter akutem Wassermangel, konnte das Problem inzwischen aber weitgehend lösen.
Die Maßnahmen im Einzelnen:
Geeignete Verwaltungsstruktur:
Für die gesamte Wasserwirtschaft des Landes wurde ein Masterplan erstellt. Sämtliche die Wasserwirtschaft betreffenden Kompetenzen wurden in einer zentralen Institution – Water Authority – gebündelt.
Erhöhtes Wasserangebot:
Die Meerwasserentsalzungsanlagen wurden massiv ausgebaut. Heute stammen mehr als 70 Prozent des Trinkwassers in Israel aus dem Mittelmeer. Die Meerwasserentsalzung ist allerdings nur dann nachhaltig, wenn sie unter Einsatz erneuerbarer Energien (insbesondere Solarthermie) erfolgt.
Wiederverwendung von Abwasser:
Mehr als drei Viertel aller Abwässer werden gesäubert und als sog. Grauwasser in der Landwirtschaft zur Bewässerung von Plantagen und Feldern verwendet.
In der Landwirtschaft wird die „Tröpfchenbewässerung“ angewandt: Schlauchsysteme mit kleinen Löchern überziehen Felder und Plantagen. Die Pflanzen werden daraus zielgenau mit der richtigen Menge Wasser versorgt.
Vermeidung von Lecks:
Mithilfe modernster Technik wird sichergestellt, dass die Wasserleitungen keine Lecks aufweisen.
Tarifgestaltung:
Der Wasserpreis ist kostendeckend und für alle Bürger unabhängig vom Wohnort gleich. Allerdings müssen Haushalte, die ein bestimmtes Kontingent überschreiten, einen höheren Wasserpreis zahlen.
Quelle: Die WELT vom 22.8.2015
Das Beispiel Israel zeigt, dass nahezu jedes Umweltproblem von der technischen Seite her lösbar ist. Natürlich haben nicht alle Staaten die finanziellen und fachlichen Ressourcen wie Israel. So weisen kirchliche Institutionen (vgl. Misereor, Rundbrief von Juni 2017) darauf hin, dass auch einfache Lösungen sinnvoll sein können, z.B. sichern leicht zu bauende Regenrückhaltebecken in Entwicklungsländern über Monate den Zugang zu Wasser und schützen so vor Dürreperioden.
2. Rahmenbedingungen für den Umweltschutz
Für die Frage, ob sich die Umweltschutzziele durchsetzen lassen oder nicht, sind zahlreiche Rahmenbedingungen maßgebend. Als besonders wichtige Rahmenbedingungen werden nachstehend die Bevölkerungsentwicklung und die staatlichen Finanzen dargestellt.
a) Bevölkerungsentwicklung
Die bevölkerungswissenschaftliche Abteilung der Vereinten Nationen gibt regelmäßig Berichte heraus, die die maßgebenden Fakten und Prognosen der Bevölkerungsentwicklung enthalten.
Die Grafik zeigt den dramatischen Anstieg der Weltbevölkerung seit 1950. Darüber hinaus lässt die Prognose für 2100 erkennen, dass eine aus Umweltsicht besorgniserregende weitere Zunahme der Weltbevölkerung zu erwarten ist (Details s. folgende Seite). Im Übrigen sind bevölkerungswissenschaftliche Prognosen zuverlässiger als andere Vorhersagen, weil sich die Geburtenraten erfahrungsgemäß nur langsam – und daher besser prognostizierbar – verändern.
Der Anstieg der Weltbevölkerung auf einen Höhepunkt von etwa 11 Milliarden Menschen stellt eine historisch noch nie dagewesene Herausforderung für den Umweltschutz dar. Technisch lassen sich die Probleme allerdings lösen: durch erneuerbare Energien, was den Klimaschutz und die Energieversorgung anlangt; durch Recycling, was knappe Rohstoffe betrifft, und durch einen schonenden Umgang mit Böden und Süßwasserressourcen in Ländern mit Wasserknappheit. Es ist jedoch eine offene Frage, ob es der Staatengemeinschaft gelingen wird, diese Möglichkeiten auch zu nutzen.
Der UN-Bericht weist auf die niedrige Geburtenrate in Deutschland hin (s. hierzu die nachfolgende Grafik). Bei der Geburtenrate (Kinderzahl pro Frau) ist in Deutschland allerdings eine leichte Trendwende zu beobachten. Sie stieg 2015 auf 1,5 Kinder pro Frau an. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt bei Freuen 83 Jahre und bei Männern 78 Jahre (Statistisches Bundesamt, 2016).
Niedrige Geburtenraten und steigende Lebenserwartung belasten in Deutschland in erster Linie die sozialen Sicherungssysteme. Aus Sicht des Umweltschutzes ist diese Entwicklung nicht einfach zu beurteilen: Es ist möglich, dass es einer immer älter werdenden Gesellschaft an der nötigen Dynamik fehlen wird.
b) Umweltschutz und Finanzen
Deutschland ist – wie auch andere westliche Industriestaaten – hoch verschuldet.
In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts begann die öffentliche Hand damit, ihre Ausgaben verstärkt durch Schulden zu finanzieren. Wie vorstehende Grafik zeigt, stieg in den folgenden Jahrzehnten der Schuldenberg von Bund, Ländern und Gemeinden kontinuierlich an und überschritt die 2-Billionen-Grenze.
Um dem Anstieg der Schulden ein Ende zu bereiten, wurde 2009 eine Schuldenbremse beschlossen und in das Grundgesetz aufgenommen. Es heißt nun in Art. 115 Abs. 2 GG: „Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Der Bund ist nun kraft Verfassung zu materiellem Haushaltsausgleich ohne Staatskredite verpflichtet. Tatsächlich ist die Staatsverschuldung, wie obige Grafik zweigt, in den letzten Jahren nicht mehr angestiegen. Auch die Bundesländer haben in ihre Landesverfassungen Schuldenbremsen aufgenommen. Für die hoch verschuldeten Städte und Gemeinden gilt aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften ein Zwang zum ausgeglichenen Haushalt.
Die Auswirkungen der Staatsschuldenkrise auf den Umweltschutz sind gravierend: Zwar muss weiterhin der Vollzug der Umweltgesetze gewährleistet werden. Aber für freiwillige Umweltschutzausgaben fehlt in der Regel der finanzielle Spielraum.
Der deutsche Sparkurs ist auf europäischer Ebene umstritten. So sorgt die Europäische Zentralbank (EZB) durch den massiven Ankauf von Staatsanleihen für sehr niedrige Zinsen. Bund, Länder und Gemeinden profitieren natürlich von den künstlich niedrig gehaltenen Zinsen.
Es ist unwahrscheinlich, dass die rund 2 Billionen Euro Schulden jemals zurückgezahlt werden. Niemand weiß auch, wie es mit den Zinsen und der Staatsverschuldung im Allgemeinen in Zukunft weitergehen wird.
3. Rechtsquellen des Umweltrechtes
Das Umweltrecht basiert auf folgenden Rechtsquellen:
Völkerrecht
Europarecht
Verfassungsrecht
Umweltprivatrecht
Umweltstrafrecht/Ordnungswidrigkeiten
Umweltverwaltungsrecht (öffentliches Recht auf dem Gebiet des Umweltschutzes)
a) Umweltvölkerrecht
Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten untereinander, zu den internationalen Organisationen sowie zwischen diesen. Das Umweltvölkerrecht umfasst die Regelungen, die dem Schutz der Umwelt dienen. Einzelpersonen werden durch völkerrechtliche Regelungen grundsätzlich weder berechtigt noch verpflichtet.
Gemäß Art. 38 Abs. 1 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs (IGH-Statut) sind Rechtsquellen des Völkerrechts insbesondere völkerrechtliche Verträge und das Völkergewohnheitsrecht.
Völkergewohnheitsrecht: Gemäß Art. 25 GG sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Völkergewohnheitsrecht) Bestandteil des Bundesrechts. Völkergewohnheitsrecht hat sich allerdings in der relativ jungen Geschichte des Umweltrechts nur in geringem Umfang bilden können. Es ist somit ohne größere Bedeutung.
Völkerrechtliche Verträge: Sie sind die mit Abstand bedeutsamste Rechtsquelle des Umweltvölkerrechts. Die Verträge können bilateraler Natur sein – z.B. die Zusammenarbeit zweier Staaten in Umweltfragen regeln. Sie können regionaler Natur sein – z.B. das Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (Helsinki-Konvention). Sie können aber auch globaler Natur sein wie etwa die Klimarahmenkonvention.
Es gibt eine Vielzahl völkerrechtlicher Verträge zum Umweltschutz. Nur einige besonders wichtige Verträge seien nachfolgend genannt:
Klimaschutz:
Rahmenvereinbarung der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (Klimarahmenkonvention 1992)
Welt-Klimaabkommen (Paris 2015)
Schutz der Ozonschicht:
Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht (1985)
Montrealer Protokoll (1987)
Gewässerschutz:
Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen (1972)
Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL, 1973)
Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR-Übereinkommen, 1992)
Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes (Helsinki-Konvention, 1992)
zahlreiche Übereinkommen zum Schutz einzelner Flüsse – z.B. des Rheins, der Elbe, der Donau
Natur- und Artenschutz:
Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (Washingtoner Artenschutzabkommen, 1973)
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention, 1992)
Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wattvögel von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention, 1971)
Immissionsschutz:
Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen (1979)
Bodenschutz und Abfallbeseitigung:
Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation (UNCCD, Wüstenkonvention,1994)
Baseler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (Baseler Übereinkommen, 1989)
Globale Verträge mit dem Ziel des Rohstoffrecycling existieren nicht. Hier fehlt es offenbar an einer Institution, die derartige Abkommen in die Wege leiten könnte.
Schutz vor gefährlichen Chemikalien: