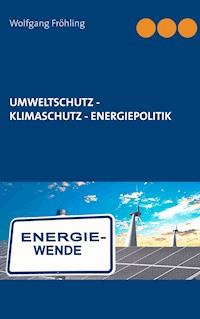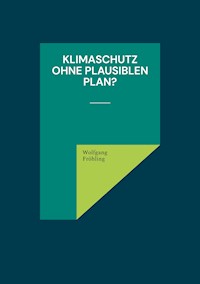
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor stellt in einem spannenden und informativen Abriss die derzeitige Klimaschutz- und Energiepolitik dar. Dabei werden die positiven Ansätze wie auch die Irrwege hintergründig beleuchtet. Sein Fazit lautet: Bei der Klimaschutz- und Energiepolitik gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Ansätze: auf der einen Seite das offensive Konzept, bei dem mit internationaler Zusammenarbeit die großen Möglichkeiten der Solar- und Windenergie und des grünen Wasserstoffs genutzt werden; auf der anderen Seite eine Energie-Mangelwirtschaft. Bei ihr werden die unerschöpfliche und preiswerte Solar- und Windenergie nur unzureichend genutzt. Der dadurch entstehende Engpass wird mit Einschränkungen von Freiheitsrechten verwaltet. Ich bin mir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende nur den offensiven, vor allem auf Solarenergie gestützten Klimaschutz akzeptieren werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Waltraud
Inhaltsübersicht
Nachhaltige Entwicklung
Klimaprognosen
Anstieg der Temperatur
Wetterextreme
Anstieg des Meeresspiegels
Unwägbarkeiten
Das Pariser Klimaschutzabkommen
Das Klimapaket der EU „Fit for 55“
Die Ausgangslage
Der Emissionshandel
CO
2
-Grenzzölle
Emissionshandel für Verkehr und Gebäude
E-Mobilität
40 Prozent erneuerbare Energien
Solarenergie
PV-Dachanlagen
PV-Freiflächenanlagen
Solarstrom außerhalb der EU
Windenergie
Windenergie an Land
Windenergie auf See
Wasserstoff
Die nationale Wasserstoff-Strategie
Geplante Anwendungsgebiete
Grüner Wasserstoff aus Chile
Klimaschutzkonzepte
Die Ausgangslage
CO
2
-Bepreisung
Beispiel Kohleausstieg
Beispiel energieintensive Industrie
Beispiel Mobilität
Nationale Klimaschutzgesetze
Das Konzept des Bundesverfassungsgerichts
Ein 50.000 km
2
umfassendes Solarprogramm
Über den Autor
I. Nachhaltige Entwicklung
Die Erkenntnis, dass auf unserem Planeten eine nachhaltige Entwicklung stattfinden muss, ist in aller Munde. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit? Vereinfacht formuliert bedeutet Nachhaltigkeit eine dauerhaft durchhaltbare Lebensweise. Eine andere Formulierung besagt, die natürlichen Ressourcen in einer Weise zu nutzen, dass sie auch künftigen Generationen in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Dieser Gedanke kommt auch in Art. 20 a des Grundgesetzes zum Ausdruck: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung…“
Die Nachhaltigkeit berührt viele Aspekte. Von herausragender Bedeutung sind der Klimaschutz, die Ressourcenschonung und die Artenvielfalt. Der Klimaschutz ist Gegenstand dieses Buches. Auf die beiden anderen Aspekte möchte ich kurz eingehen.
Ressourcenschonung: Die starke Zunahme der Weltbevölkerung und die Industrialisierung haben dazu geführt, dass sich bei vielen Rohstoffen ein Engpass abzeichnet. Beispiele sind Phosphor, Metalle wie z.B. Kupfer und viele andere Stoffe. Die Antwort auf dieses immer größer werdende Problem ist eine Kreislaufwirtschaft, d.h. die primären Rohstoffe werden durch Recycling als sekundäre Rohstoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt.
In wieweit Recycling gelingt oder gelingen kann, lässt sich nur für jeden einzelnen Stoff gesondert beurteilen. Z.B. übertrifft in Deutschland die Produktion von Aluminium aus gebrauchten Produkten (Recycling) bereits die Produktion von Primär-Aluminium. Entscheidend ist jeweils die Preisdifferenz zwischen primären und sekundären Rohstoffen. Viel diskutiert wird das Recycling von Plastik. Plastikmüll darf zwar nicht in die Umwelt gelangen; aber für Recycling besteht hier deshalb kein großer Bedarf, weil der Grundstoff Rohöl im Übermaß vorhanden ist.
Wie schwierig die Kreislaufwirtschaft im Einzelfall sein kann, zeigt sich am Beispiel des Smartphones. In Deutschland werden jährlich ca. 24 Millionen Smartphones verkauft (2019). Bei der Produktion eines solchen Gerätes werden bis zu 30 verschiedene Metalle verarbeitet. Dazu gehören Stoffe wie Kobalt, Gallium, Indium, Wolfram und seltene Erden – alles Stoffe, die immer knapper werden. Eine Rückgewinnung der seltenen Metalle ist kaum möglich. Die Herausforderung besteht darin, die verschiedenen Trenn- und Rückgewinnungsverfahren, die sich aus den unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften und Konzentrationen der Inhaltsstoffe ergeben, ökonomisch und ökologisch effizient zu koordinieren (Zitat Reuter, Direktor des Helmholtz-Instituts Freiberg). Reuter vergleicht das Metall-Recycling damit, eine Tasse Kaffee wieder in ihre einzelnen Bestandteile Wasser, Kaffeepulver, Zucker und Mich zu zerlegen.
Für eine Kreislaufwirtschaft müssten recyclingfähige Produkte geschaffen werden. Diese Herausforderung ist globaler Natur. Es wäre daher wünschenswert, eine spezielle Abteilung der UNO für die Kreislaufwirtschaft zu schaffen.
Zur Artenvielfalt: Sie nimmt seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, kontinuierlich ab. Stichworte wie Zerstörung der Regenwälder, industrielle Landwirtschaft, Überfischung der Meere oder Insektensterben sind durch zahllose Berichte in den Medien einer breiten Öffentlichkeit geläufig.
Um hier zu einer Trendwende zu kommen, müssten vor allem ökologisch hochrangige Naturräume geschaffen werden. Diesem Anspruch wird das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit seiner Eingriffsregelung, die große praktische Bedeutung hat, nicht gerecht: Wer in die Natur eingreift (Straßenbau, Bebauungspläne, Fabrikanlagen usw.), muss gemäß §§ 13 ff BNatSchG diesen Eingriff kompensieren, d.h. er muss an anderer Stelle die beeinträchtigten Funktionen (Wasserhaushalt, Boden, Luft, Klima, Tiere, Pflanzen) ausgleichen. Dieses Konzept weist Mängel auf: Der Artenverlust im zerstörten Biotop kann vielfach gar nicht kompensiert werden. So ist etwa bei der Abholzung eines Buchenwaldes der dort heimatlos gewordene Waldlaubsänger endgültig verschwunden.
Vor allem aber ist die Eingriffsregelung nur darauf gerichtet, den Status quo zu erhalten. Die bloße Erhaltung des Ist-Zustandes reicht für einen modernen, effizienten Naturschutz nicht aus. Man sollte vielmehr von den Investoren als den Verursachern des Eingriffs eine Naturschutzabgabe in Geld verlangen – bemessen nach der Schwere des Eingriffs. Mit dieser Abgabe ließen sich Hotspots der Artenvielfalt schaffen. Ein Beispiel hierfür sind die Rieselfelder nördlich von Münster (Westfalen): Auf einer Fläche von 4,3 km2 befindet sich dort ein Europa-Reservat für Wat- und Wasservögel. Ausgedehnte Schilf- und Wasserflächen ermöglichen eine phantastische Artenvielfalt.
II. Klimaprognosen
Wenn es um die Prognose des künftigen Klimageschehens geht, ist der Welt-Klimarat (IPCC) das maßgebende Gremium. Im August 2021 hat der IPCC seinen 6. umfassenden Bericht seit seiner Gründung im Jahr 1988 vorgelegt. 234 namhafte Wissenschaftler/-innen aus 66 Ländern haben in dem neuen Report die aktuellen Erkenntnisse zum Stand der Klimaforschung zusammengetragen. Die wichtigsten Themen des Berichts – Temperaturanstieg, Wetterextreme, Anstieg des Meeresspiegels – werden im Folgenden kurz behandelt.
Anstieg der Temperatur
Maßgebende Ursache für die Erwärmung der Erdatmosphäre ist der Treibhauseffekt (Schönwiese, Klima). Er besteht darin, dass die von der erwärmten Erdoberfläche ausgehenden Wärmestrahlen durch Treibhausgase reflektiert werden. Hierdurch erwärmt sich die untere Erdatmosphäre. Treibhausgase sind H2O (Wasserdampf/ Wolken), CO2 (Kohlendioxid), CH4 (Methan), N2O (Lachgas), FCKW u.a.
Man sollte bei der Klimadebatte auch Methan (CH4) im Blick haben. Methan ist am anthropogenen (künstlichen) Treibhauseffekt mit rund 20 Prozent beteiligt. Quellen für Methan-Emissionen sind insbesondere
Viehhaltung (Wiederkäuer)
Mülldeponien (organische Abfälle)
Abbau/ Förderung fossiler Energien (Kohlebergbau, Ölförderung usw.)
Auftauen der Permafrostböden als Folge der Erderwärmung.
Der IPCC-Bericht 2021 beziffert den globalen Temperaturanstieg seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit 1,07 ° Celsius. Jedes der vergangenen vier Jahrzehnte war wärmer als das vorherige. Der IPCC betont, dass die bisherige Erwärmung durch den Menschen verursacht wurde. Natürliche Einflüsse, die zu der gemessenen Erwärmung beigetragen haben könnten, seien nicht bekannt.
Der Welt-Klimarat kann nicht wissen, welche Menge an Treibhausgasen die Menschheit bis zum Ende des Jahrhunderts verursachen wird. Deshalb haben die Wissenschaftler fünf unterschiedliche Szenarien berechnet – angefangen von einem sehr pessimistischen bis hin zu einem sehr optimistischen Szenarium. Vieles deutet darauf hin, dass wir ein mittleres Szenarium zu erwarten haben. Für diesen Fall rechnet der Welt-Klimarat mit 2 ° Erwärmung bis Mitte des Jahrhunderts und 2,7 ° bis 2100 (im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts). Die zwei benachbarten Varianten kommen auf eine Erwärmung von 1,8 ° bzw. 3,6 ° bis 2100.
Das Pariser Klimaschutz-Abkommen verfolgt das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 ° Celsius zu begrenzen. Dann dürften nur noch 500 Milliarden Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Wenn man den derzeitigen Ausstoß zugrunde legt, wäre diese Menge schon in 13 Jahren erreicht! Bei realistischer Betrachtung deutet nichts darauf hin, dass die Emissionen so stark gesenkt werden, dass das Ziel von 1,5 ° eingehalten wird.
Wetterextreme
Hitzewellen in Kanada, Kalifornien und im Mittelmeerraum, Überschwemmungen in Mitteleuropa und ausgedehnte Waldbrände an vielen Orten der Erde haben im Jahr 2021 einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht, dass der Klimawandel bereits im Gange ist und Folgen hat. Allerdings sind die extremen Ereignisse häufig nicht nur auf den Klimawandel zurückzuführen. So wurden z.B. die Überschwemmungen in Deutschland maßgebend durch unnötige Begradigungen/ Kanalisierungen von Bächen und Flüssen mit verursacht.
Der IPCC-Bericht geht – entsprechend der fortschreitenden Erwärmung – von einer Zunahme der Wetterextreme aus: Vor allem für Hitzewellen weist der IPCC einen deutlichen Anstieg für alle Erdteile nach. Die Hitzewellen sind zudem immer öfter mit Dürren und Waldbränden verbunden.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts regnet es mehr; denn wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. So erklären sich auch die häufiger werdenden Starkniederschläge in vielen Regionen. Trotz der vermehrten Niederschläge beobachtet der IPCC in manchen Gegenden der Erde häufigere Dürreperioden. Bei Tropenstürmen stellt der Klimabericht bislang keinen langfristigen Trend fest. Allerdings bringen die Stürme mehr Regen. Der Welt-Klimarat weist allerdings darauf hin, dass bei Prognosen von Wetterextremen für einzelne Regionen große Unsicherheiten bestehen.
Anstieg des Meeresspiegels
Seit 1901 ist der Meeresspiegel im globalen Durchschnitt um rund 20 cm gestiegen. Der bisherige Anstieg ist also moderat. Er hat sich allerdings im Laufe der Zeit beschleunigt und beträgt derzeit 3,7 mm jährlich. Dass es als Folge des Klimawandels zu einem Anstieg des Meeresspiegels kommt, hat vor allem zwei Ursachen: zum einen die wärmebedingte Ausdehnung des Wassers, zum anderen der Zufluss von Schmelzwasser (z. B. das schmelzende Grönland-Eis).
Der IPCC hat in der nachstehenden Grafik dargestellt, mit welchen Szenarien wir beim Anstieg des Meeresspiegels bis zum Jahr 2100 rechnen müssen (jeweils abhängig vom Ausmaß der Treibhausgas-Emissionen).